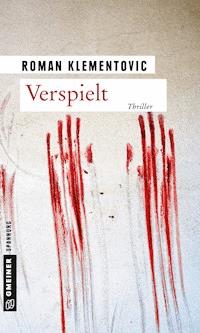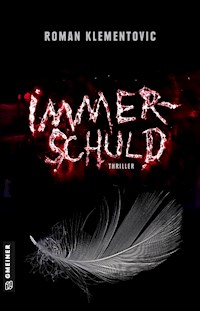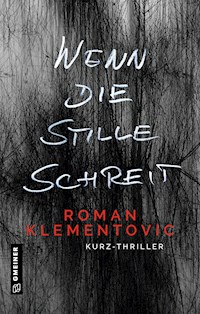Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Gmeiner-VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriller von Roman Klementovic
- Sprache: Deutsch
In einer eisigen Winternacht verschwinden zwei Jugendliche spurlos. Die örtliche Polizei tappt im Dunkeln, findet keinerlei Anhaltspunkte und mit der Zeit gerät der Fall in Vergessenheit. Doch dann, auf den Tag genau drei Jahre später, werden wieder zwei junge Menschen vermisst. Die Medien wittern eine Tragödie und in dem kleinen Dorf wächst die Nervosität. Als eine misshandelte Leiche gefunden wird, bricht Panik aus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roman Klementovic
Immerstill
Thriller
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2016
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © lumpozumpo / photocase.de
und © Denise-Sophie / photocase.de
ISBN 978-3-8392-5030-3
Widmung
Für Anna
Wenn alles in einem schreit LAUF!, sollte man dann nicht darauf hören?
Montag, 9. Februar
1
Das Heizungsgebläse lief auf Hochtouren, damit die Scheiben nicht weiter beschlugen, der blassgelbe Duftbaum, auf dem »Tropical« stand und der nur noch nach Karton roch, baumelte wild vom Rückspiegel herunter, und Roxettes »It must have been love« dröhnte aus den Boxen des Autoradios. Normalerweise liebte ich solche Rock-Schnulzen, aber jetzt war ich gar nicht in der Stimmung dafür. Ein Blick auf den Tacho – 39 km/h – und das auf der Bundesstraße. Aber mehr ließen die stockdunkle Nacht, der nasse Asphalt und die dichten Nebelschwaden nicht zu.
Verfluchter Winter!
Ich hing knapp hinter der Windschutzscheibe und klammerte mich verkrampft am Lenkrad fest, während sich der schmale Lichtkegel der Scheinwerfer durch die Dunkelheit schnitt. Das endlose Schwarz links und rechts davon war mir unheimlich. Meine Hände waren schweißnass, meine Augen brannten und immer wieder schossen mir dieselben Fragen durch den Kopf: Wo konnte sie nur stecken? War ihr etwas passiert? Und wieso ausgerechnet jetzt, genau drei Jahre danach? War es Zufall oder hatte ihr Verschwinden mit den Geschehnissen von damals zu tun? Ich machte mir große Sorgen. Glaubte nicht daran, dass ich übertrieben reagierte.
Kurzes Hoffen, als mein Handy auf dem Beifahrersitz läutete. Doch es war nicht sie, die mich endlich zurückrief. Auf dem Display erschien schon wieder nur Toms Name. Ich drehte Roxette lauter und zwang mich, nicht ranzugehen.
It must have been love but it’s over now
It’s where the water flows, it’s where the wind blows
…
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis der schrille Standardklingelton verstummte. Erst jetzt merkte ich, dass ich die ganze Zeit über die Luft angehalten und scheinbar jeden Muskel meines Körpers angespannt hatte. Ich atmete tief durch, versuchte locker zu werden, doch es wollte mir nicht gelingen.
Ich fühlte mich verloren. Einsam. Und aus irgendeinem Grund auch schuldig.
Seit geraumer Zeit war ich keinem anderen Fahrzeug mehr begegnet. Ich sehnte mich nach irgendeinem Lebenszeichen, hätte mich schon über ein fahles Licht in weiter Ferne gefreut. Aber nichts.
Langsam nahm ein Verkehrsschild in der Dunkelheit vor mir Formen an. Ich kniff meine Augen zu schmalen Schlitzen und versuchte etwas zu erkennen. Dann endlich: »Grundendorf 9 km«.
Bald hatte ich es also geschafft. Dabei wusste ich gar nicht so recht, ob ich mich wirklich darüber freuen sollte. Beim Gedanken daran, meinen Vater gleich wiederzusehen, verkrampfte sich mein Magen. Es war nicht so, dass ich ihn nicht gernhatte. Es war nur – ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie passten wir ganz einfach nicht zueinander, hatten uns nichts mehr zu sagen. Und seit dem Tod meiner Mutter war alles noch komplizierter geworden. Mein Vater meldete sich mittlerweile nur noch zu Weihnachten und an meinem Geburtstag, und wenn er bei einem meiner seltenen Anrufe einmal ranging, redete er kaum etwas, und man musste ihm jeden einzelnen Wortfetzen aus der Nase ziehen. Tagein, tagaus verkroch er sich in seiner Werkstatt und arbeitete dort von frühmorgens bis spät in die Nacht hinein. Die Arbeit war zu seinem einzigen Lebensinhalt geworden. Ansonsten wusste ich kaum mehr etwas über ihn.
In der Dunkelheit vor mir tauchte endlich die scharfe Abzweigung nach Grundendorf auf. Ich drosselte die Geschwindigkeit weiter, verließ die Bundesstraße und folgte einer schmalen, schlecht asphaltierten Landstraße mit unzähligen Schlaglöchern und tiefen Regenpfützen. Auf einmal schien es mir, als ob der Nebel dichter und die Nacht noch schwärzer geworden war. Die alten Kirsch- und Nussbäume zu beiden Seiten der Straße sahen wie bizarre Wesen aus, die mich an der Weiterfahrt hindern wollten.
So nahe war ich meinem Heimatdorf schon lange nicht mehr gewesen. Ein eiskalter Schauer lief mir über den Rücken, die Erinnerung an die Ereignisse von damals übermannte mich. Drei Jahre und zwei Tage war es nun schon her, dass Linda und Markus verschwunden waren. Drei Jahre und zwei Tage der Ungewissheit, was mit ihnen geschehen war. Hatten sie das alljährliche Grundendorfer Faschingsfest am Abend ihres Verschwindens jemals erreicht? Niemand hatte es mit Sicherheit sagen können, da fast alle Gäste verkleidet gewesen waren. Waren sie gemeinsam durchgebrannt? Kaum vorstellbar, da Markus als Einzelgänger galt und die hübsche und frühreife Linda wohl kaum etwas mit ihm angefangen hätte. Waren sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen, entführt oder gar ermordet worden? Auch dafür gab es nicht die geringsten Anhaltspunkte. Ihr spurloses Verschwinden war bis heute ein Rätsel.
Ich hatte schon lange nicht mehr an die beiden gedacht, sie waren zu einer vagen Erinnerung verblasst, die irgendwie unwirklich erschien – bis zum heutigen späten Nachmittag jedenfalls. Seitdem spukten die Ereignisse von damals in meinem Kopf herum, und ich war auf dem Weg in meine alte Heimat Grundendorf. Der Grund? Wenige Stunden zuvor hatte ich einen Anruf von meinem Vater bekommen.
Ich war gerade in einem Meeting mit zwei präpotenten und nervtötenden Vertretern gewesen, die glaubten, mich mit ihrer breitbeinigen Sitzhaltung, ihrem schmierigen Grinsen und ihren anzüglichen Witzen beeindrucken zu können, als mein stumm geschaltetes Handy vor mir auf dem Tisch zu vibrieren begann.
»Papa«, zeigte das Display an, und augenblicklich regte sich ein ungutes Gefühl in mir. Instinktiv wusste ich, dass etwas passiert war. Ich griff zum Telefon, hetzte aus der Galerie hinaus in die eisige Kälte und ließ die beiden notgeilen Affen alleine zurück.
»Hallo, Papa.«
»Lisa?« Seine Stimme war brüchig.
»Ja?«
»Störe ich dich?«
»Nein, nein – es geht schon.«
»Gut … wie … wie geht’s dir?«
»Ganz okay.«
»Mh.«
»Und dir, Papa?«
»Ich ruf an, weil … weil …«
»Was ist los?«
Ein tiefes Seufzen. »Maria … sie ist …«
Das ungute Gefühl in mir war schlagartig zu Angst geworden, als mein Vater den Namen meiner Schwester ausgesprochen hatte. Sie hatte sich in jeder Faser meines Körpers festgesetzt. Mein Herz schlug schneller.
Meine Stimme zitterte: »Was ist mit Maria?«
»Sie ist verschwunden. Seit dem Faschingsfest am Samstag.«
2
Still, es war totenstill. Und kalt. Ich saß mit meinem Vater in der kleinen Küche meines Elternhauses und rieb mir die Hände, weil es mich fröstelte.
Seit meinem Auszug vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren hatte sich auf den ersten Blick kaum etwas verändert. Doch bei genauerer Betrachtung fiel mir auf, wie heruntergekommen mittlerweile alles war. Die Orchidee auf dem Fensterbrett war verendet, die Wanduhr über der Mikrowelle war stehen geblieben und zeigte sechs nach neun an. Zwei der vier flammenförmigen Glühbirnen der Deckenleuchte waren kaputt, die anderen beiden waren verstaubt und gaben nur mehr ein fahles Licht ab. An der Decke und in den Ecken hingen Spinnweben, auf den hellgrauen Wandfliesen hinter dem Herd klebten eingetrocknete Sugospritzer, und im Küchenrollenhalter steckte eine nackte Kartonrolle. Der Messerblock aus Kiefernholz, den ich meinem Vater zu seinem letzten Geburtstag geschenkt hatte, wirkte unbenützt und als ob er nicht hierhergehörte. Nur das gerahmte Familienfoto hing immer noch neben dem schweren Holzkreuz über dem Esstisch. Es war im September 2011 an Tante Hannelores Geburtstag entstanden. Meine Eltern strahlten darauf, meine Schwester auch. Obwohl ich mich erinnere, diesen Tag sehr genossen zu haben, war mein Gesichtsausdruck ernst. Als ob ich damals bereits geahnt hatte, dass schon wenige Wochen später das Unglück über uns hereinbrechen würde. Dass meine Mutter bald nicht mehr bei uns sein würde.
Ich versuchte die schmerzhaften Erinnerungen abzuschütteln und wandte mich meinem Vater zu, der mir zusammengesunken und mit hängendem Kopf gegenübersaß. Der Mensch vor mir hatte so gar nichts mehr mit meinem Vater auf dem Familienfoto zu tun. Er wirkte verwahrlost und viel zu alt für seine 47 Jahre – und daran hatte nicht nur der zottelige Vollbart Schuld, den er sich vor einigen Monaten hatte wachsen lassen und der sein breites Kinn verdeckte. Nein, vor allem auch die tiefen Falten in seinem Gesicht, die sich seit Mutters Tod so rasant vermehrten, ließen ihn älter aussehen – sie wirkten wie Hunderte feine Risse in einer Fensterscheibe, die sich im eisig kalten Wintersturm immer weiter ausbreiteten. Mein Vater starrte regungslos auf die dunkelgrauen, verstaubten Bodenfliesen. Der alte Holzstuhl knarrte ab und zu unter seinem Gewicht. Der Kräutertee, den ich ihm vorhin gemacht hatte, stand unberührt vor ihm auf dem Tisch. Er schien ihn gar nicht wahrzunehmen. Ich nippte an meinem. Er war bereits kalt geworden und schmeckte nach nichts. Der Heizkörper gab ein Glucksen von sich. Der Wasserhahn begann zu tropfen.
»Warum hast du mich nicht schon früher angerufen?«, fragte ich schließlich nach einer langen Zeit des Schweigens.
Er sagte nichts, begann stattdessen an seinen langen grau melierten Barthaaren zu zupfen. Ich konnte ihm ansehen, dass er in seinen Gedanken nicht hier bei mir, sondern bei Maria war.
»Papa?«
Schwerfälliges Durchatmen. »Musst du denn morgen nicht zur Arbeit?«
»Ich habe mir ein paar Tage freigeschaufelt.«
»Das geht so einfach?«
»Papa, es ist meine Galerie. Mach dir darum keine Sorgen.« Es wäre der falsche Zeitpunkt gewesen, meinem Vater von den finanziellen Problemen und den ausbleibenden Kunden zu erzählen. Davon, dass es ziemlich sicher niemanden kratzte, wenn die Galerie ein paar Tage geschlossen blieb.
»Ah.«
»Warum hast du denn nicht schon früher etwas gesagt?«
Mein Vater seufzte, schien völlig kraftlos. »Ich weiß auch nicht, ich …«
Ich starrte ihn an, wartete auf eine Fortsetzung. Sie kam nicht.
»Hat Maria vielleicht irgendetwas gesagt oder ist sie komisch gewesen, bevor sie verschwunden ist?«
»Nein«, sagte er und kaute an seiner Unterlippe. Als ich schon gar nicht mehr damit rechnete, fuhr er fort: »Sie hat nur gesagt, dass sie sich dann fertig machen und auf das Faschingsfest gehen wollte. Ich bin in die Werkstatt gegangen und erst nach ein paar Stunden zurück ins Haus gekommen. Da ist sie schon weg gewesen.«
»Und seitdem hast du nichts mehr von ihr gehört?«
Er nickte kaum merklich.
»Und ihr Handy war immer ausgeschaltet?«
Wieder wortloses Nicken.
Ich rieb mir mit beiden Händen das Gesicht, atmete tief durch, versuchte trotz meiner innerlichen Anspannung einen klaren Kopf zu behalten und logisch zu denken. »Hast du die Leute im Ort gefragt, ob sie wer gesehen hat?«
»Ja.«
»Wann?«
»Heute.«
»Wieso erst heute?«
»Ich dachte … ich …« Der Satz verlief im Nichts.
»Wen hast du denn gefragt?«
»Ein paar Leute halt.«
»Was heißt ›ein paar‹?«
»Na, einige halt.«
Ein tiefer Atemzug. »Und keiner weiß etwas?«
Er schüttelte den Kopf.
»Und was ist mit Marias Freundinnen? Hast du mit denen schon gesprochen?«
»Schon, aber …« Er begann wieder an seinem Bart zu zupfen.
Es war offensichtlich, dass mein Vater das Problem nicht wahrhaben wollte. Aber ebenso klar war, dass uns stummes Hoffen nicht weiterbringen würde.
»Papa, wir müssen …«
»Du hättest nicht extra kommen müssen, Lisa. Es wird schon nichts passiert sein«, unterbrach er mich und versuchte sich in einem Lächeln, was ihm gründlich misslang.
»Papa!«
Er sah mich an wie ein kleiner, trauriger Junge, der nicht wusste, warum er hier bei mir sitzen und sich rechtfertigen musste.
»Hast du schon die Polizei informiert?«
Sein Blick wanderte zum Familienfoto an der Wand. Er blieb stumm.
»Hast du oder hast du nicht?«
»Noch nicht.«
»Und warum nicht? Worauf willst du warten?«
»Vielleicht kommt sie ja noch.«
»Papa, Maria ist seit Samstagabend verschwunden. Jetzt haben wir Montag, bald Mitternacht.«
Der Mund meines Vaters öffnete sich, aber es drangen keine Worte daraus.
»Wir müssen die Polizei informieren«, drängte ich ihn, obwohl mir selbst unwohl dabei war. Das Wiedersehen mit Patrick würde bestimmt nicht leicht werden. Ich versuchte mir erst gar nicht auszumalen, wie er wohl reagieren würde, wenn ich auf einmal vor ihm stand.
Es dauerte eine Weile, dann sah mich mein Vater an.
»Gleich morgen früh, in Ordnung?«
Zögerliches Nicken.
Dienstag, 10. Februar
3
Kurz vor 1 Uhr nachts.
Mein Vater hatte sich schlafen gelegt. Besser gesagt, war er irgendwann nach einer endlosen Zeit des Schweigens aufgestanden, hatte etwas gemurmelt, von dem ich annahm, dass es »Gute Nacht« bedeuten sollte und hatte sich in sein Schlafzimmer zurückgezogen. Ich bezweifelte allerdings, dass er in dieser Nacht auch nur eine Minute Schlaf finden würde.
Ich war alleine in der kalten Küche zurückgeblieben, hatte ein wenig abgewartet und mich dann auf Zehenspitzen die Stufen hinauf in den ersten Stock und durch den finsteren Flur in Marias Zimmer geschlichen. Bei jedem verräterischen Knarren der Stufen und des alten Holzbodens hielt ich inne und verzog mein Gesicht unwillkürlich zu einer Grimasse. Ich wollte nicht, dass mein Vater mich dabei hörte, wollte ihn nicht beunruhigen. Doch in mir hatte sich längst eine beißende Unruhe festgesetzt, und pausenlos quälte mich die gleiche Frage: War Maria in Gefahr?
Behutsam schloss ich ihre Zimmertür hinter mir und machte rasch das Licht an. Ich hasste Dunkelheit. Keine Ahnung, warum, aber sie machte mir Angst. Selbst jetzt noch, mit meinen 24 Jahren. Selbst hier in meinem Elternhaus, in dem ich mehr als 21 Jahre und somit den Großteil meines Lebens gewohnt hatte. Vielleicht war irgendein Erlebnis in meiner Kindheit daran schuld, vielleicht eine letzte Erinnerung an ein früheres Leben, vielleicht ein dummer Film, den ich längst verdrängt hatte.
Während die Energiesparlampe nur langsam ihre volle Leuchtkraft entfaltete, sah ich mich im Zimmer meiner Schwester um. Trotz der Leere konnte ich ihre Anwesenheit regelrecht spüren. Maria war mittlerweile zu einer jungen Frau herangewachsen, das konnte ich deutlich erkennen. Die grelle rote Wandfarbe war einem schlichten Weiß gewichen, unter dem Dachfenster stand eine prächtig gedeihende schulterhohe Palme. Die Poster von gut aussehenden Schauspielern und Boybands mit nackten Oberkörpern waren von den Wänden verschwunden – mit 20 war man selbst auf dem Land zu alt dafür. Sie waren durch Ikea-Bilder, die Metropolen wie New York, London und Paris zeigten, ersetzt worden. Waren sie etwa Ausdruck einer Sehnsucht meiner Schwester? Hatte sie aus ihrem Leben ausbrechen wollen? Weg aus Grundendorf, diesem kleinen, trostlosen Kaff? Oder waren die Bilder nur Zeuge eines konformen, postpubertären Geschmacks? So vieles hatte sich verändert, aber von ihrem einäugigen Stoffhund Rufus hatte Maria sich nicht trennen können – er lag unbeirrt auf dem Kopfpolster und starrte an die Decke, als wäre nichts passiert.
Ein Blick in ihren Kleiderkasten. Er war vollgestopft, fast jeder Bügel belegt. Auch die Unterwäscheladen quollen über. Ich musste die Sockenknäuele flachdrücken, um die Lade schließen zu können, ein BH-Träger schaute heraus, ich stopfte ihn hinein. Das unterstrich meine Vermutung, dass Maria nicht einfach ausgerissen war – dann hätte sie doch zumindest Kleidung für ein paar Tage mitgenommen.
Auf der schmalen Kommode an der Fußseite des ungemachten Betts standen ein kleines Keramikschälchen mit unzähligen Ketten, Ohrringen und sonstigem Modeschmuck, daneben zwei pastellfarbene Parfümfläschchen und ein paar gerahmte Fotos. Ein Klassenfoto in einem weißen Holzrahmen erregte meine Aufmerksamkeit. Ich nahm es in die Hand und betrachtete es näher. Es war vor knapp vier Jahren aufgenommen worden, weniger als ein Jahr vor Lindas Verschwinden. Maria war damals 17 gewesen und trug ihre braune Mähne noch so lang, dass sie ihr fast bis zum Hintern reichte – als ich sie zum letzten Mal gesehen hatte, waren sie nur noch schulterlang gewesen. Sie strahlte in die Kamera – ein schiefes Lächeln, frech und unbekümmert, wie es ihre Art war. Wenn sie diesen Blick aufgesetzt hatte, konnte man sich nie sicher sein, was sie gerade dachte oder im Schilde führte. Ich glaube, das wusste Maria genau – und sie genoss es. Links daneben ihre damalige beste Freundin Linda. Auch sie lächelte – ein liebliches, verspieltes und selbstbewusstes Lächeln, eines von der Sorte »mir geht es gut und die Welt ist schön«. Was für ein wunderschönes Mädchen sie doch gewesen war. Und so viel reifer, als es ihre 17 Jahre hätten vermuten lassen. Bestimmt hatte sie einer ganzen Reihe von Burschen im Dorf den Kopf verdreht.
Bilder blitzten vor meinem geistigen Auge auf, Erinnerungen an die unzähligen Abende, an denen Linda bei Maria übernachtet hatte. Bei uns im Haus. Hier in diesem Zimmer. In dem Bett, neben dem ich gerade stand. Ich setzte mich an die Kante, streifte mit den Fingerspitzen über den Flanellbezug von Marias Polster, nahm ihren Stoffhund und drückte ihn ganz fest an mich. Als ich die Augen schloss, war es fast so, als konnte ich ihre Anwesenheit spüren, ihrer beider Stimmen hören, ihr Lachen.
Ich legte Rufus zurück auf den Polster und warf einen letzten Blick auf das Klassenfoto. In der hintersten Reihe rechts außen stand Markus. Obwohl er von so vielen Menschen umgeben war, wirkte er irgendwie einsam, sein Gesichtsausdruck war nichtssagend, fast schon leer. Mir wurde klar, dass ich ihn überhaupt nicht gekannt hatte, er mir bis zu seinem Verschwinden kaum aufgefallen war und ich fast nichts über ihn wusste – bis auf das, was die Leute im Dorf hinter vorgehaltenen Händen über ihn redeten: dass er etwas langsam im Kopf war, ein wenig zurückgeblieben halt.
Maria. Linda. Markus. Drei Menschen aus demselben Dorf. Aus derselben Klasse. Alle drei spurlos verschwunden.
Was ging hier vor?
Schuldgefühle überfielen mich, und ich konnte regelrecht spüren, wie es mir den Magen zusammenzog. Weshalb hatte ich mich nicht öfters bei meiner kleinen Schwester gemeldet, hatte sie gefragt, wie es ihr ging oder sie zu mir nach Wien eingeladen? Hatte es ausschließlich an mir gelegen, dass unsere Beziehung so oberflächlich geworden war? Gott, ich würde es nicht ertragen können, wenn ihr etwas zugestoßen war.
Ich wischte mir die Augen trocken und stellte das Foto zurück auf die Kommode. Rückte es sorgfältig zurecht, strich noch einmal darüber und betete, dass es Maria gut ging.
4
Später lag ich im schmalen Bett meines alten Zimmers, das seit meinem Auszug unverändert geblieben war, und starrte an die spärlich von meiner Nachttischlampe erhellte und mit Spinnweben übersäte Decke. Die Wände waren kahl und weiß gestrichen, alle Bilder hatte ich beim Auszug mitgenommen. Keine Pflanzen, keine Farben. Der Raum strahlte das aus, was er war – leblos und verlassen. Das Fenster war etwas undicht, die Spinnweben und die Vorhänge in ständiger Bewegung.
Es gelang mir nicht, meine Sorgen auszublenden und einzuschlafen. Pausenlos dachte ich an meine Schwester und versuchte mich zu erinnern, wann ich sie zum letzten Mal gesehen oder mit ihr telefoniert und worüber wir gesprochen hatten. War es an Weihnachten gewesen? Doch sosehr ich mich auch anstrengte, ich konnte mich nicht erinnern. Rastlos wälzte ich mich von einer Seite zur anderen, immer und immer wieder. Der Holzrahmen knarrte, die Federn der alten, durchgelegenen Matratze quietschten und bohrten sich in meinen Rücken. Das Bettzeug roch muffig, obwohl ich es zuvor erst frisch überzogen hatte.
Ich tastete nach meinem Handy, das auf dem Nachtkästchen lag. Es zeigte 2.23 Uhr. Außerdem drei verpasste Anrufe und fünf SMS. Leider alle von Tom. Ich zwang mich dazu, sie zu ignorieren, wählte zum gefühlten 100. Mal in den letzten Stunden Marias Nummer und konnte die Anspannung kaum ertragen. Aber wieder erklang sofort die Standardansage ihrer Mobilbox: »Sie befinden sich in der Mobilbox der Nummer …« Ich wollte etwas sagen, fand aber meine Stimme nicht und legte noch vor dem Piepton auf. Dann schrieb ich ihr eine SMS: »Bitte melde dich bei mir oder Papa!!! Wir machen uns Sorgen!!! Lisa«
Ich legte das Telefon zurück auf das Nachtkästchen und wandte ihm den Rücken zu. Tu’s nicht!, befahl ich mir immer wieder. Tu’s nicht! Eine Minute später wurde ich doch schwach und las Toms SMS:
19:51: Es tut mir leid. Bitte ruf mich an, wenn du angekommen bist. Kuss Tom
20:21: Lisa, es tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Kuss Tom
22:38: Warum rufst du nicht zurück? Tom
23:17: Hoffe, du bist stolz auf dich. Glaubst du etwa, das beeindruckt mich, wenn du mich ignorierst?
23:45: Es tut mir leid. Kuss
Ich seufzte. Griff nach meinem Magen und unterdrückte die Tränen.
Mit zittrigen Fingern tippte ich zur Antwort: »Mir tut es auch leid.« Ich grübelte, löschte den Text, schrieb: »Ich rufe dich morgen früh an.« Ich starrte auf die Zeilen, löschte auch diesen Text und schrieb: ›Bin gut angekommen.‹ Dann drückte ich auf Senden. Keine Minute später war mein schlechtes Gewissen so groß, dass ich Tom noch eine weitere SMS schickte: »Mir tut es auch leid.«
5
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mir so kalt, dass es mich regelrecht schüttelte. Trotzdem war mein Flanellpyjamaoberteil durchgeschwitzt und klebte an meiner Haut. Mein Kreuz tat weh, mein Nacken fühlte sich steif an. Ich hatte in der letzten Nacht höchstens zwei bis drei Stunden geschlafen – und selbst dieser Schlaf war hauchdünn gewesen. Ich hatte mich kaum erholt und absurde Albträume gehabt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!