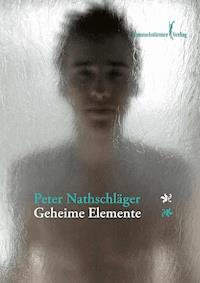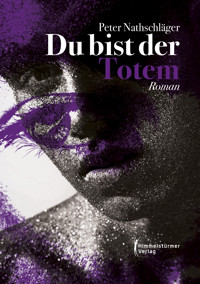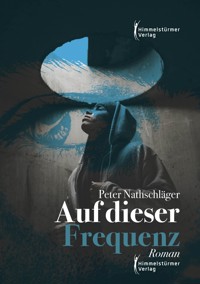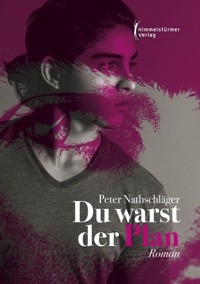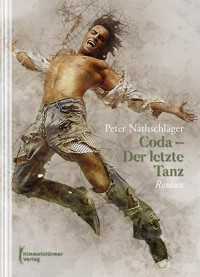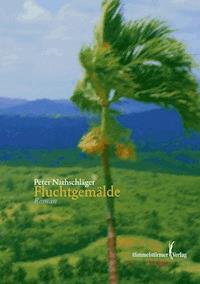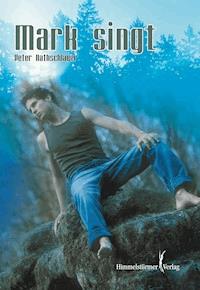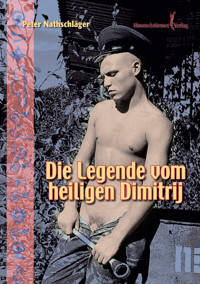Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
David Schneider wurde als Siebenjähriger von Frank Dohunan, dem Jäger und Beutemacher entführt. Er durfte sich nicht mehr David nennen sich an nichts mehr erinnern. Dohunan zwang ihn zur Prostitution und belog ihn über seine Vergangenheit. Erst neun Jahre später schaffte David die Flucht; Es wird nicht nur eine Reise quer durch die USA, sondern auch eine entlang der dunklen Flüsse menschlicher Grausamkeit - durch eine von Menschenhand erschaffene Hölle. Diese erlebt er in einem Internat für elternlose Jungen, die durch ihre Aufseher ein grauenhaftes Martyrium erleiden. Die Flucht, seine Suche nach seinem Zuhause, führt ihn nicht nur hart an den Rand dessen, was ein Mensch ertragen kann, sondern auch in die Arme von Mark Fletcher, einem gleichaltrigen Jungen, der vom Gefährte zum Freund und zum Geliebter wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2005
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Nathschläger
Dunkle Flüsse
Roman
Himmelstürmer Verlag
eBookMedia.biz
978-3-86361-045-6 PDF
978-3-86361-046-3 PRC
978-3-86361-040-1 ePub
Copyright © by Himmelstürmer Verlag
Photo by Benno Thoma: www.bennothoma.nl
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer, AGD, Hamburg - www.olafwelling.de
Originalausgabe, September 2005
Hergestellt mit IGP:FLIP von Infogrid Pacific Pte. Ltd.
Peter Nathschläger
Geboren am 3.3.1965 in Wien
Nach der Schule Tischlerlehre, Abschluss 1983
Von 1983-1998 bei verschiedenen Wiener Bühnen als Tischler tätig
1998 Wechsel zur IT, zurzeit tätig im IT Projekt Management
1999 erschien der erste Gedichtband, der erste Roman folgte im Herbst 2004
Peter Nathschläger lebt seit 1995 gemeinsam mit seinem Freund Ryszard in einer "vom Leben gebeutelten", aber glücklichen Beziehung
Flucht
1
So sehr er sich auch bemühte, er konnte die Augen nicht offen halten. Es tat weh, das Tageslicht brannte, die Augen tränten und die Lider schienen verklebt. Alles um ihn herum war lichtdurchflutete Kälte, kristallener Frost.
Sag was, sag was, sag was ... Du musst reden. Lenk dich ab, erzähl mir was, dann tut’s nich’ mehr so weh ...
Wie war das im Sommer, als das Mädchen Freddy küsste? Denk nach und sprich’s aus. Lass’ dir nicht so die Scheißwürmer aus der Nase ziehen ...
Kann nicht denken, ist so scheißkalt.
Komm, es fällt dir wieder ein, wenn du dir nur etwas Mühe gibst; s’ is ein bisschen wie zaubern. Na?
Ich war neidisch, ok? Einfach neidisch! Das war so ein schöner Anblick, wie die Tussi aufs Spielfeld lief und wie Freddy grinste und verschämt in die Menge winkte und er war so hübsch dabei und sie auch und es tat mir weh.
Ach Scheiße, mir tun die Füße so weh.
Wieso hat es dir denn wehgetan? Komm jetzt, sag’s.
Es war so normal, verstehst? Es war normal. Und in meinem abgefickten Drecksleben war nie was normal. So was nicht!
Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Und jetzt einen Fuß vor den nächsten. Und geh’ weiter...
Erzähl’ weiter...
2
Der Junge blieb stehen und blies sich warme Luft in die Hände, die hellrot glühten. Er konnte die Finger kaum bewegen, geschweige denn zur Faust ballen. Der Wind hatte aufgefrischt und den Pulverschnee am Straßenrand zu Schneewehen aufgetürmt. Vor etwa einer halben Stunde hatte er den Wald verlassen; eine hässliche Ansammlung grau-schwarzer, blattloser Bäume, die doch ein wenig Schutz geboten hatten. Hätte er nur noch ein wenig gewartet, sagen wir mal noch 5 oder 6 Stunden ... aber in der Scheune war es nicht sicher; nirgendwo war es sicher. Onkel Frank war ein Sucher und Jäger; ein Beutemacher.
Auf seiner Flucht war er bisher von zwei Althippies mitgenommen worden, die ihm gute Tipps und ein paar Joints gegeben hatten, dann von einer alten Frau und zwei Lastwagenfahrern. In den Autos war es immer mollig warm gewesen, da hatte er nicht so über’s Wetter nachgedacht. Er musste nach Nordwesten, da war er sicher. Er wusste nicht, warum er sich sicher war, es war nur so ein Gefühl. Aber es konnte nur besser werden, wenn er West Virginia hinter sich gebracht hatte. Zuerst Ohio, dann Indiana. Irgendwo in einer Stadt untertauchen und sich in einer Unterführung aufwärmen. Alles besser als dieser schwarze Streifen Straße, endlos lang und wie ein besoffener, verwackelter Schnitt zwischen den Feldern und bewaldeten Hügeln.
Einen Kilometer hinter ihm war der Waldrand; ein Wald durch den ein Fluss führt, der elendsbreit war. Und dreckig und strudelnd. Eine gurgelnde Straße durch den Wald, breiter als ein Highway. Die letzte Ortschaft vor dem Waldstück war Nitro, West Virginia. Ein unerfreulicher Fleck auf Gottes verkommener Landkarte. Zumindest wirkte die Kleinstadt so auf ihn; im Winter war wohl jede Kleinstadt, an der man vorbeiging, unerfreulich und schal wie kalter Rauch. Er hatte versucht, sich unter einer Brücke, die den Fluss überspannte, ein schattiges Plätzchen zu suchen, haha, Windschatten und so. Als er die bewaldete Böschung runterschlitterte und sich an der Steinmauer entlang tastete, wäre er fast ausgerutscht und mit den Füßen voran in den Fluss geschlittert. Über sich hatte er das wusch-wusch der Autos gehört, die über die Trennfugen fuhren. Danke schön. Der Wind fing sich da unten besonders scharf, so als ob er dem Jungen den letzten Funken Hoffnung rauben wollte.
3
Der sechzehnjährige Bursche wurde Patrick genannt und ihn fror. Ihm war kalt wie noch nie. Ihm war vor allem kalt, weil sich nirgendwo eine Chance auf eine Rast bot. Nirgends, wo er sich aufwärmen konnte. Er hielt sich abseits der großen Transitrouten, durchwanderte unfreundliche kleine Orte, die bestenfalls auf regionalen Landkarten verzeichnet waren, und schlief in Hühnerställen und Scheunen, immer in Deckung, immer vorsichtig, immer geduckt. Die Ortschaften wirkten wie Dekoration, die nach der Vorstellung einfach auf der Bühne vergessen worden war und vor sich hin gammelte. Aufgelassene Fabriken und Werke, vernagelte Auslagen, niemand auf den Straßen. Es war der fünfundzwanzigste Dezember. Seit 2 Tagen war er unterwegs, auf der Flucht, ein Ausreißer, Patrick, der Straßenjunge. Und Patrick kam es so vor, dass er geboren war, um genau diese Rolle auszufüllen.
Die Füße fühlten sich an, als ob in seinen Sneakers der Schweiß gefroren wäre und nun an den Fersen scheuerte. Hey, aber du spürst sie noch, ist ein gutes Zeichen, oder? Sag was: Patrick-Patty-Boy!
Patrick schleppte sich weiter, die Beine steif von Müdigkeit und Kälte. Er blieb einmal stehen, drehte sich im Kreis und zuckte mit der Schulter. Kein Auto, kein Lastwagen. Ja, wie denn auch? Bei dem Wetter war selbst Auto fahren für’n Arsch, das ist mal amtlich. Er war knapp dran loszuheulen und sich an den Straßenrand zu setzen, ein schlaksiger Junge mit schwarzen Haaren, grünen Augen und einem Gesicht, das etwas bekifft wirkte. Aber es war wohl die Müdigkeit. Er hatte eine überweite Jeans an, die ihm immer etwas über den Arsch runterrutschte und der Bund der Boxershorts scheuerte auf der weißen Haut; er hatte einen schwarzen H&M Anorak an, eine Strickmütze auf und die Kapuze übergezogen. Auf dem Rücken trug er einen vergammelten, dunkelblauen Eastpak Rucksack, indem er ein bisschen Wäsche hatte, einen Notvorrat an Zigaretten und das Wichtigste. Das Geld. Siebentausend Dollar. Aus Franks Kaffeedose.
Du weißt, was passiert, wenn Frank dich kriegt? Ja?
Ja, er wird mit mir in den Schuppen gehen.
Zuerst die Autofahrt, Vorwürfe, Ohrfeigen, Griffe zwischen die Beine, die wehtun, und dann...
... der Schuppen. Alles klar, ich gehe ja weiter.
Nach etwa 500 Metern mündete die Landstraße, der er, seitdem er aus dem Wald gekommen war gefolgt war, in eine größere Landstraße. Vielleicht sogar eine Bundesstraße, die in den Straßenkarten eingetragen ist. Das ist ja nicht selbstverständlich, so was. Nicht in diesem Eck der USA, indem er sein Heil in der Flucht suchte. Nicht zu dieser Jahreszeit. Nicht in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Da verschwanden nämlich alle eingezeichneten Landstraßen und Bundesstraßen in der Twilightzone zwischen Eis und Schnee. Übrig blieben die sanften Hügel, tiefen Wälder und sturmgewellten Felder.
Kalt.
Aber bei Gott, da war diese Straße und die hatte sogar einen Trennstreifen, war gestreut; das sah echt offiziell aus. Jubel. Ein verwittertes, rostiges Schild wies darauf hin, dass man sich auf dieser Straße der Ortschaft Hurricane näherte. Klingt toll, dachte der Junge und schaffte ein eingefrorenes Grinsen.
So toll ist das aber nun auch wieder nicht. Ja? Denk mal, ’ne offizielle Landstraße, eingetragen und eingezeichnet und sogar mit ’nem Mittelstreifen. Sogar vielleicht nach ’nem kommunalen Politiker benannt, der Mal seinen fetten Arsch hier raus hievte, um ein Band durchzuschneiden, kraft Regierungsbeschluss und dem ganzen Kack. Und was haben diese Straßen an sich? Buh, die Bullen tauchen hier immer wieder mal unangemeldet auf, gabeln kleine Landstreicher auf und bringen sie auf’s Revier. Ein Telefonat, ein paar Hiebe in die Magengrube, ein feuchter Fetzen, der keine Spuren hinterlässt und dann kriegst noch ’nen heißen Kakao bis Onkel Frank kommt und dich heimholt.
Und dann mit dir zum Schuppen geht... Die Rechnung ist ganz einfach und das Ergebnis beschissen wie ein Autobahnklo: Landstraße, Bullen, Frank. Da führt kein Weg daran vorbei. Also verpiß dich von dieser fetten Straße und ... im Straßengraben vielleicht...
Patrick strauchelte plötzlich, übermannt von grenzenloser Müdigkeit und Angst. Er sackte in den Knien durch und schrie überrascht auf, als er vornüber auf die Straße kippte. Er dachte zumindest, dass er schrie. In Wirklichkeit entrang sich ihm ein kraftloses Piepsen wie das eines Vogels, der erfroren vom Ast fiel. Er sah sich an: Die Jeans war versaut, der Anorak war versaut, heilige Scheiße ... Er rappelte sich hoch, kam schwankend zu stehen und sah in den hinterfotzigen grauen Himmel. Er hörte ein Flattern wie von einem aufsteigenden Vogelschwarm.
Ist da jemand?
Dann wurde ihm schwarz vor Augen und er fiel um. Diesmal war es besser. Denn er spürte nicht, wie er aufschlug. Und noch viel besser: Er spürte die Kälte nicht mehr. Das war so gut, dass es Patricks Meinung nach so bleiben könnte.
Für immer.
Patrick blieb regungslos liegen und in den Falten seiner Jeans und des Anoraks sammelte sich der feine Pulverschnee.
4
Thomas Beier war froh, dass er diesen Mietwagen bekommen hatte; einen Chrysler Voyager: monströs und gut zu fahren, bequem und wie er fand, seinem Status entsprechend. Er fuhr von Richmond nach Columbus. Er kam aus New York, hatte den Flieger nach Richmond genommen und verbummelte die 3 Tage, die ihm verblieben, bis er sein Projekt beginnen konnte, mit einer gemütlichen Autofahrt. Thomas war deutscher Repräsentant eines Softwarekonzerns, der in den USA größere Aufträge an Land ziehen wollte. Er war nicht nur mit den Produkten so gut vertraut, dass man ihm den Techniker blindlings abkaufte, er war auch ein gottbegnadeter Verkäufer, sprach fließend englisch und spanisch. Es störte zwar, dass er seine Frau und die Kinder über Weihnachten nicht sehen konnte, aber wenn er diesen Deal unter Dach und Fach hatte, konnte er sich ein halbes Jahr Auszeit nehmen und sich um die Familie kümmern. Die waren jetzt bei seinen Eltern gut aufgehoben.
Thomas fuhr gerne Auto. Zeit nachzudenken, klassische Musik zu hören und die USA so zu sehen, wie die Amis sie sahen, ländlicher, wahrhaftiger. Er hatte einen riesigen Straßenplan auf dem Beifahrersitz, rauchte eine Zigarette und saugte die Eindrücke in sich auf. Schwarze Felder mit blendend weißen Schneeflächen, Raben, die aufstiegen und schrien, das konnte nicht mal Chopin übertönen, und in der Ferne eine Wand aus Wald, kein Verkehr. Gut, um sich zu entspannen. Und das ging auch eine Weile gut, recht gut sogar. Er rollte mehr als er fuhr, kam durch einige Ortschaften, die er wildromantisch fand, von denen er aber in Wirklichkeit wusste, dass es trostlose Nester waren. Wirtschaft hatte sich mal angesiedelt und war zugrunde gegangen. Werke waren eröffnet und wieder geschlossen worden. Um die Werke hatten sich Leute niedergelassen und eine Zeit recht gut gelebt; es gab Hotels, Motels, Kirchen, Einkaufszentren und so weiter; er sah, wie die Leute hier gelebt hatten, als die Ortschaften in Blüte standen. Dann sah er wieder die Wirklichkeit und empfand so ein Gefühl, als würde er durch einen verzauberten, nein, verwilderten Garten gehen.
Aber die Ortschaften waren trostlos; nur wenige Leute auf der Straße, gehässige Blicke, ein paar Jungs, die vor einem 24-Stunden-Lokal herumlümmelten, rauchten, Bier tranken und ausspuckten als er vorbeifuhr ... Nichts, wo man halten und einkehren möchte. Das Auto bot ihm die nötige Sicherheit, um Distanz zum Elend zu waren. Und Thomas sah das trübe Licht über allem. Keine wilde Romantik, keine Chancen, kein Glück und für die, die hier lebten, keine Chance wegzukommen. Gefangen in einer Welt heruntergekommener Wohnwagensiedlungen, einer Welt, die sie nicht mehr gehen lassen wollte.
Jetzt rollte er auf der asphaltierten Bundesstraße dahin, hörte Klaviermusik und genoss den langweiligen Ausblick. Nach den eher ernüchternden Ortschaften war dies regelrecht befriedigend. Rechts sah er eine Landstraße, die in der Hauptstraße mündete. Er sah kurz aus dem Augenwinkel die Straße entlang und stellte fest, dass sie wohl zu dem Wald führte. Wenn ihn sein Orientierungssinn nicht ganz im Stich gelassen hatte, musste in diesem Wald ein breiter Fluss sein, an dem mehrere Ortschaften und verkommene Wohnwagensiedlungen lagen, durch die er gekommen, beziehungsweise an denen er vorbeigefahren war. Dann sah er wieder auf die Straße, dann auf die Uhr: Kurz nach ein Uhr Mittag. Zeit, etwas zu essen. Dann sah er wieder raus und sprang auf die Bremse. Am rechten Fahrbahnstreifen lag ein großer Lumpenhaufen. Der Chrysler bockte, stellte sich quer. Thomas war ein geübter Fahrer, verlor nicht die Nerven und lenkte dagegen, bis der Wagen schlingernd wieder in die Gerade kam. Er spürte sein Herz bis zum Hals schlagen. Das linke Knie schmerzte, als ob er sich angeschlagen hätte. Er bremste sachte, bis der Wagen etwa fünf Meter vor dem Knäuel zu stehen kam. Er hatte es gewusst. Schon als er die Lumpen gesehen hatte. So was verdrängt man nicht. Es war ein Mensch, der da lag. Er hatte schon die Hand am Türöffner, bereit auszusteigen, als ihm die Warnungen von Verwandten und Bekannten, Freunden und Kollegen einfielen. Leute, die auf der Straße herumliegen haben entweder Böses im Sinn, ein Alkohol- oder Drogenproblem oder alles zusammen. Anständige Leute - merk dir das Tommy - liegen nicht am Straßenrand herum. Nicht im Sommer. Und schon gar nicht im Winter. Also fahr weiter und wenn du schon unbedingt helfen musst, dann ruf übers Handy die Polizei oder die Rettung. Halt dich raus, fahr weiter und vergiss es.
Aber das klappte nicht. Denn das Bündel sah nicht gefährlich aus. Eher hilfsbedürftig und jung, sagte eine Stimme in ihm.
Ein Junge in Lebensgefahr.
Thomas stieg aus, schlug den Kragen hoch und stapfte auf die Gestalt am Straßenrand zu.
„Hallo Sie!“, rief er. Er kam näher. Klar. Ein Junge. Könnte der jetzt aufspringen und dir ein Messer an die Kehle halten? Ein kleiner mieser Strauchdieb? Nein, das sah zu echt aus. Thomas beugte sich zu dem Jungen runter und legte zwei Finger auf den Hals. Das hatte er mal im Fernsehen gesehen. Das sah professionell aus. Aber es brachte nichts. Er spürte keinen Puls. Er griff unter der Hüfte des Jungen durch und drehte ihn seitlich, dass er nicht an seinem eigenen Erbrochenen ersticken konnte, falls er nach oder während eines Schocks vielleicht kotzen musste. Aber schon, als er den Jungen herumdrehte wusste Thomas, dass es hier keinen Schock gab, keine Drogen und keinen Alkohol. Und von einem Messer konnte schon gar keine Rede sein.
Durch die offene Fahrertür konnte er jetzt Barber’s Adagio hören und das gab ihm den Rest. Er schob die Kapuze etwas zurück und sah dem Jungen ins Gesicht. Die Augen waren zu. Er war hübsch. Auerordentlich hübsch sogar und Thomas spürte einen Stich. Dort, wo er schon lange glaubte, unempfindsam zu sein. Wann hatte er zuletzt einen Jungen, der älter als fünf Jahre und nicht sein Sohn war, als hübsch bezeichnet? Nun, das ist lange her, nicht? So lange, dass es schon fast nicht mehr wahr ist. Aber eben nur fast. Thomas ging zum Chrysler zurück und machte die Beifahrertür auf. Dann ging er zu dem Jungen zurück und griff ihm um die Hüfte, rollte den Körper auf seinen rechten Unterarm und hob ihn sachte an. Geht doch.
Mit der linken Hand umfasste er das Genick, rutschte mit dem rechten Arm tiefer und hatte den Jungen dann bei den Kniekehlen. Bestens; er riss mal kurz an, bis er ihn in einer Position hatte, in der er ihn tragen konnte und brachte ihn dann zum Auto. Der Junge sagte etwas. Thomas blieb stehen und wartete, ob der Junge es wiederholen würde, und ob es an ihn gerichtet war. Es war nicht mehr als das Geräusch, das der Pulverschnee machte, wenn er über gefrorene Felder geweht wurde.
Dann sagte der Junge noch mal was und Thomas bekam eine Gänsehaut:
„Nicht in den Schuppen ... bitte.“
Thomas wuchtete, so vorsichtig wie es ging, den Jungen auf den Beifahrersitz und klappte sanft die Tür zu. Dann hastete er um den Wagen und sah zu, dass er selbst wieder in’s Warme kam. Das Außenthermometer des Chryslers zeigte minus 11 Grad. Thomas rutschte auf den Fahrersitz und drehte das Gebläse voll auf. Die Musik drehte er leiser und dann schob er die Automatik auf Fahrt und der Chrysler rollte weiter.
Thomas überlegte, ob er das Richtige getan hatte. Ob es gut war. Er musste den Jungen irgendwo unterbringen. Auf der Straße konnte er ihn nicht lassen. Und er hatte so das Gefühl, als ob der Junge ganz sicher keine Freude damit hätte, wenn er ihn auf einem Revier abliefern würde. Er sah immer wieder zu dem Jungen rüber und flüsterte: „Kratz hier bloß nicht ab, Junge. Stirb mir ja nicht, ja?“
Aber was tun? Polizei wäre natürlich das Naheliegendste. Aber irgendwas sträubte sich in ihm. - Der Junge will nicht zur Polizei, sonst wäre er nämlich nicht auf der Straße. Wenn man zu den Bullen will, kann man das leichter haben -. War er nach einer Party zu Fuß aufgebrochen und einfach umgekippt? Nein, auch das schien Thomas nicht wahrscheinlich. Abgehauen? Aus einem Heim? Thomas verdrängte diese Gedanken und beschloss, die Sache einfach auf sich zukommen zu lassen. Erst mal ins Warme mit ihm, ein heißes Bad, die klammen Sachen ausziehen und in ein warmes Bett stecken. Als er kurz, wirklich kurz daran dachte, wie er den Jungen nackt in eine Wanne mit heißem Wasser ließ, wurde ihm sonderbar zumute. So, als hätte ein alter Gedanken endlich heimgefunden.
Thomas fuhr durch Hurricane und war mit einmal sachte bremsen auch schon wieder am Ende der Ortschaft. Laut seiner Karte musste er auf der Bundesstraße bleiben ... und zwar bis ... Huntington. Dann konnte er eigentlich in einem Sitz bis Portsmouth fahren. Dort ein Motelzimmer nehmen und sich um den Jungen kümmern. Und falls er nicht damit klar kam, könnte er noch immer einen Arzt kommen lassen. Nur musste er sich da eine Geschichte einfallen lassen. Er ist mein Sohn und er war da auf ’ner Party und ich war schon ziemlich nervös und wollte ihn holen, fand ihn auf der Landstraße ... Blödsinn. Er war nicht mal Bürger der USA. Also kann man die Story mit dem Sohn vergessen.
Der Sohn eines Kollegen. Ich sollte ihn nach weiß der Geier wohin mitnehmen. Büchste aus, besoff sich und dann das. Sie sehen ja ... die Jugend von heute...
Bis Portsmouth in Ohio waren es grad mal hundert Kilometer. Ein Klacks also. Und bei dem Verkehr konnte er in einer guten Stunde dort sein, ohne sich allzu sehr auf eine Geschwindigkeitsübertretung einzulassen. Mit dem Gedanken, dass vielleicht wirklich ein heißes Bad und eine Mütze Schlaf ausreichen würden, um den Burschen wieder auf die Beine zu kriegen, entspannte sich Thomas, lehnte sich zurück und genoss, wie der Wagen Kilometer fraß.
Fünfzig Minuten später und kein Auto auf der Straße, rollte Thomas auf einem Parkplatz am Stadtrand von Portsmouth aus und betrachtete missmutig das Motel, dass sich zwischen zwei Autofriedhöfen an die Bundesstraße drückte. Desperation pur, sozusagen. Portsmouth lief in ein paar zusammengewürfelten Siedlungen aus; einige Einkaufszentren und davor riesige Parkplätze. Die Neonreklame des Motels flackerte und schaukelte sachte im Winterwind. Er hatte sich etwas Besseres erhofft, etwas mit ein wenig mehr Stil. Aber er hatte keine Chance, herumzufackeln. Der Junge war zwischendurch einmal fast zu sich gekommen und hatte sich bewegt; ein gutes Zeichen. Ein Spuckebläschen hatte sich an seinem Mundwinkel gebildet. Die Hände sahen so jung und doch so rissig aus, trocken und eindeutig unterkühlt. Thomas hätte vor Mitleid heulen können. Aber er riss sich zusammen, hinterfragte nicht seine Motive und ließ auch nicht zu, dass ein kleiner Schelm in ihm diese Fragen stellte. Er stellte den Wagen in den Windschatten an eine Wand, zwischen einen Subaru und einen Steinzeitford.
„Junge? Hey? Geht’s?“
Er schüttelte den Jungen sachte am Arm. Keine Reaktion. Noch mal: „Junge?“ Eine kleiderraschelnde Bewegung. Thomas stieg aus, ging hinten um den Wagen rum und öffnete die Beifahrertür vorsichtig, dass der Junge nicht rauskippte. Draußen war es still bis auf das silbrige Singen des feinen Pulverschnees, der über den Parkplatz geweht wurde. Das Quietschen der Ketten, an denen die Neonwerbung hing. Diesmal trug er den Jungen nicht, sondern nahm einen Arm, schulterte ihn und versuchte so den Eindruck zu erwecken, als sei der Junge einfach zu besoffen, um zu gehen. Zumindest war das der Plan. „Komm Junge, versuch’s ... linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein“, flüsterte Thomas, griff mit der rechten Hand den Hosenbund des Jungen und schaffte so eine Karikatur vom Vater, der seinen besoffenen Sohn führt. Er mühte sich an der Wand entlang und checkte gleichzeitig die Autos ab. Sah da was offiziell aus? Streuwagen, Streifenwagen, ein besonders gepflegter Wagen aus Regierungsbeständen? Nichts. Gott sei dank. Zwei Pick-up, und sonst nur Rostschleudern. Er schleppte den Jungen zur Glastür, mühte sich durch und nahm sofort wahr, wie überheizt der Raum war.
Links war die Rezeption mit Buch und Klingel, einem Aschenbecher und einem kleinen Plastikweihnachtsbaum. Rechts an der furnierten Wand hingen ein paar alte Magazine. Thomas hatte sich nichts anderes erwartet. Er klemmte den Jungen zwischen sich und der Theke ein und haute mit der freien Hand auf die Klingel. Hinter der Theke ging eine Tür auf und eine junge Frau mit zuviel Schminke im Gesicht erschien. „Ja bitte?“
„Ähhh, Tag auch. Mein Junge hier hat wohl ein bisschen zuviel getrunken bei der Feier mit seinen Freunden und ich möchte nicht, dass seine Mutter ihn so sieht ... Haben sie ein Zimmer frei?“
„Für wie lange?“
„Naja.“ Thomas zuckte mit der Schulter. „Sagen wir mal ein paar Stunden, bis zum Abend halt.“
Die Frau sah ihn mit verschlagenen Augen an. Diese Augen sagten: Spar dir deine Story. Ich weiß alles über Typen wie dich und halbwüchsige Jungs wie ihn. Aber sie sagte nichts. Nicht dazu. Sie schob das Buch näher an Thomas ran: „Sie wollen wahrscheinlich bar zahlen, ja?“ Thomas nickte und trug sich in die erste freie Zeile unter den anderen gesichtslosen Namen ein. Sie holte einen Schlüssel von unter der Theke und schob ihn Thomas zu: „Durch den Gang, zur Glastür raus, über den Hof, erstes Zimmer links. Die Handtücher sind abgezählt. Viel Spaß.“
Thomas nahm den Schlüssel und zuckte zusammen. Er wollte etwas erwidern, aber die Frau hatte sich abgewandt und ging in den Raum hinter der Theke zurück, in dem ein Fernseher plärrte. Er nahm den Jungen fester und ging los, über den Gang und raus, erste Tür links.
Das Motel war weitläufiger, als es von außen wirkte. Es bestand aus zwei parallel laufenden Trakten mit ungefähr 16 Zimmern. Pro Zimmer eine helle Spanplattentür und ein großes Fenster neben der Tür. Nichts rührte sich. Wenn auch andere Gäste hier waren, hielten sie sich in den Zimmern auf und schliefen. Es hatte wieder leicht zu schneien begonnen und der Hof war glatt und rein weiß angezuckert. Keine Schritte außer denen von ihm und die Schleifspuren des Jungen. Der frische Schnee milderte ein wenig den unfreundlichen Eindruck dieses Ortes. Er stupste mit dem Fuß die Tür hinter sich zu und wuchtete dann den Jungen so sanft wie möglich auf das gemachte Bett. Thomas zog seinen Anorak aus, warf ihn über einen Lehnsessel und inspizierte das Bad. Es war überraschend sauber und gepflegt und hatte, wie er gehofft hatte, eine Badewanne. Thomas spülte die Wanne aus -man weiß ja nie- und stöpselte dann den Abfluss zu. Danach drehte er das Heißwasser auf und ließ es in die Wanne plätschern. So, Zeit, sich um den Jungen zu kümmern. Er ging zurück in den großen Hauptraum und sah den Jungen so liegen, wie er ihn zurückgelassen hatte. Thomas’ eigener Sohn war elf Jahre alt. Und Thomas wünschte sich, dass sein Sohn niemals in eine solche Lage kommen würde. Was ihn wieder zu der Frage brachte, was einen Jungen einen Tag nach Weihnachten auf die Straße raus trieb und zwar so energisch, dass er Erfrierungen in Kauf nahm. Er überlegte kurz, ob er den Rucksack des Jungen durchwühlen sollte, verwarf aber schnell den Gedanken.
-Du musst ihn jetzt ausziehen. Das weißt du, ja?-
-Aber klar. Kein Problem-
-Echt nich’?-
-Wird schon gehen-
Wo anfangen? Gut. Er rollte den Jungen auf den Bauch, zerrte den Rucksack von seiner Schulter und ließ ihn neben dem Bett auf den Boden fallen. Ging nix zu Bruch, gut, weiter. Als nächstes die Jacke. Thomas keuchte wie ein Sportler nach einer Höchstleistung. Er setzte den Jungen auf und stützte ihn mit der Schulter ab. Er roch nach frischer Luft und ein bisschen nach getrocknetem Schweiß. Die Haare des Jungen kitzelten in seiner Nase und rochen nach ... Schnee. Er ließ den Anorak neben dem Bett auf den Rucksack fallen. Jetzt die Sneakers, klobige Modeschuhe. VANS II stand drauf. Er zog sie dem Jungen aus; die Schuhbänder waren nicht geknüpft, sondern seitlich in die Schuhe gesteckt. Die Socken stanken und waren dreckig. Der braucht aber echt ’ne Dusche, der Junge, kicherte Thomas verzweifelt und hielt den Atem an, während er die Socken von den Füßen rollte. Die Füße waren schön geformt, er hatte lange Zehen. Nichts desto trotz waren die Füße arg in Mitleidenschaft gezogen; Thomas sah keine echten Erfrierungen, aber doch blaue Stellen und Druckstellen, wo die Socken an den Fersen gescheuert hatten. Thomas wurde erneut von Traurigkeit übermannt, jedoch nicht genug erschüttert, um zu weinen. Was für ein Elend. Was für eine beschissene Welt, wo Jungs auf der Straße trampen, bis sie erfrieren. Der Junge hätte sterben können. Wenn er ’ne andere Route gewählt hätte und nicht vorbeigekommen wäre, wäre der Bursche wahrscheinlich schon tot. Das wurde Thomas schlagartig klar. Wäre er nur eine halbe Stunde später an der Stelle vorbeigekommen, der Junge wäre nur noch ein schneeweißer Fleck gewesen. All zu leicht, so etwas zu übersehen. Der Junge hatte nur ganz knapp überlebt, war Thomas sicher.
Was hat dich da rausgetrieben, Junge? Welcher beschissene Wind? Du solltest zu Hause sitzen, mit deinen Geschwistern streiten und die Weihnachtsbäckerei deiner Mutter wegnaschen. Du solltest am Computer sitzen und chatten oder so was. Dich über Weihnachtsgeschenke freuen. Er gurtete die Jeans auf und spürte wieder diesen Stich, nein, eher ein Ziehen. Ein sehnsüchtiges Gefühl -Hör auf, verdammt. Er könnte dein Sohn sein- in der Magengrube. Die Boxershort rutschte gleich mit. Er sah, dass die Schamhaare komplett abrasiert waren. Kein Härchen, nur ansatzweise Stoppel.
Was ist los mit dir, Bursche?
Er zog dem Jungen Jeans und Boxershort in einem Stück runter, drehte den schlaffen Körper herum und das, was er dann sah, entlockte ihm ein entsetztes Stöhnen, fast ein Schluchzen.
Was um Himmels Willen ist dir passiert, Junge?
Der Junge hatte einen unbehaarten, kleinen und kräftigen Hintern. Nichts zu beanstanden, wenn da nicht die fingerdicken Striemen und schlecht verheilten Biss-Spuren gewesen wären. Blutunterlaufene dicke Striemen, die den ganzen Hintern bedeckten. Fassungslos wischte sich Thomas eine Träne weg und fuhr so vorsichtig es ging mit dem Zeigefinger drüber. Der Junge bewegte sich etwas, wimmerte. „Nicht ... bitte nicht den ... Schuppen ... tut mir ... leid ...“
Thomas ließ sich kraftlos auf den Boden fallen und saß eine Minute im Schneidersitz neben dem Bett. Der Junge lag nackt vor ihm auf der Matratze. Dann packte Thomas so was wie wattierte Wut. Ein Gefühl, dass ihm so fremd war wie nur was. Wer konnte das tun? Blödheit unter Jungs, die komische Männlichkeitsrituale zelebrierten? Ein Vater, der seine Kinder mit dem Stock erzieht? Und wenn wir schon beim Thema sind: Auch mit den Zähnen? Was? Dann hob er den Jungen hoch und brachte ihn ins Bad, ließ ihn vorsichtig in die Wanne, nicht ohne vorher mit dem Finger zu testen, ob das Wasser vielleicht zu heiß war. Nein, nein, gerade richtig. Als er den Jungen ins Wasser setzte, sah er merkwürdige blaue Flecken auf dem ebenfalls rasierten Hodensack des Jungen, Kratzspuren auf dem Penis. Dann noch einen ziemlich großen Bluterguss auf der rechten Hüfte und eine dunkelblaue Schwellung unter dem Brustbein. Doch durch all die Trauer und dieses - Nichtverstehen - machte sich ein anderes Gefühl bemerkbar, unangenehm und bohrend. Ein Gefühl, das Thomas bislang nur gegenüber Frauen empfand. Besonders gegenüber seiner eigenen Frau.
Begierde.
Er unterdrückte dieses Gefühl und achtete darauf, dass der Junge sicher saß und nicht vielleicht mit dem Kopf unter Wasser rutschen konnte. Das wäre ja wohl dann der Gipfel des ganzen Schlamassels. Dann stand er auf, ging zu dem Telefon ohne Wählscheibe neben dem Bett und bestellte an der Rezeption eine Salamipizza. Er legte auf, ordnete die Kleider des Jungen und setzte sich auf den Lehnstuhl, starrte auf sein Spiegelbild im dunklen Fernseher und wartete.
Nach etwa einer Viertel Stunde fischte er den Jungen aus dem Wasser und legte ihn aufs Bett, drehte ihn rum und wickelte ihn in die Decke ein. Er brauchte eine Wundsalbe. Er wusste, dass er in der Autoapotheke so was hatte. Gründlich wie er war, hatte er bei der Übergabe des Wagens auch den Erste Hilfe Koffer überprüft. Bis die Pizza kam, die wahrscheinlich auch irgendwo bestellt werden musste, hatte er Zeit, zum Wagen zu gehen und die Salbe zu holen. Sollte er das machen? Der Junge schien jetzt nicht mehr ohnmächtig zu sein, sondern zu schlafen. Er hatte im Bad die Augen aufgemacht und sich umgesehen. Aber nichts gesagt. Thomas sammelte sich und schlüpfte in den dicken Anorak und ging raus, die Salbe holen.
Der Schnee fiel inzwischen viel dichter, in den Ecken, wo sich der Wind fing, wirbelte er Schnee zu Säulen hoch und brach wieder zusammen; Thomas hastete über den Platz, durch den Gang, an der Rezeption vorbei und zum Auto, nahm die Salbe aus dem Koffer und eilte zurück. Die junge Frau hinter der Rezeption rief ihm nach: „Pizza kommt in circa 20 Minuten, alles klar?“
Thomas winkte mit der Hand und eilte, ohne sich umzudrehen, über den Hof, stemmte sich gegen den hartnäckigen Wind und betrat wieder das Zimmer.
Der Junge lag seitlich. Die Decke war über die Schulter runtergerutscht und Thomas gestand sich ein, dass der Anblick durchaus seinen Reiz hatte. Aber die Geschichte, die er vermutete, ließ nicht zu, dass dieses Gefühl überhand gewann. Er zog die Decke ganz runter, schraubte die Salbendose auf und fing an, die Salbe auf den Füßen des Jungen einzumassieren. Dann der heikle Teil. Der Hintern. Er gab sich etwas Salbe auf die Finger und verrieb sie zwischen den Handflächen. Dann cremte er die Pobacken des Jungen ein. Der Junge bewegte sich verschlafen, reckte ihm seinen Arsch entgegen und schnurrte zufrieden.
Wie jetzt?
Thomas dachte, er könnte das Geräusch falsch interpretiert haben. Doch dann wand sich der Junge wie eine Katze unter seinen Berührungen. Er hob den Kopf, grinste über die Schulter und sagte: „Willst du nicht meine unbehaarte Boyfotze schlecken, du geile Drecksau?“
Thomas zuckte zurück. Sein Gesicht signalisierte blankes Entsetzen. Durch den Nebel seiner Überraschung registrierte er, dass der Satz wie automatisch abgespult wirkte. Als hätte man auf einen Knopf gedrückt und eine Puppe zum Sprechen gebracht.
„Kannst mich auch ficken. Stehst eh drauf, ’nen Teenyskater in den Arsch zu ficken, was?“
Der Junge drehte sich ganz rum, griff sich zwischen die Beine und quetschte sich die Eier. Dabei wirkte er noch immer irgendwie wie weggetreten. „Nimm ihn ins Maul, Schwanzlutscher!“
Er spielte Szenarien durch wie ein Computer, der versuchte, eine Lösung zu errechnen.
„Lass den Unsinn, Junge. Du warst schwer unterkühlt und ich hab dich von der Straße aufgelesen und hierher gebracht. Ich hab kein Interesse an deinen, ähhh ... Angeboten. Es würde mir leid tun, wenn ich sehe, dass ich da vielleicht einen Blödsinn gemacht habe.“
Der Junge sah ihn verschlagen an und grinste überlegen: „Ich hab gesehen, wie du mich angesehen hast, als du mich ins Bad gelegt hast. Tu nicht so spießbürgerlich. Du bist eine geile Drecksau. Und ich seh’s ja. Du willst mir die Nudel lutschen. Oder das Arschloch lecken. Also sei ein Mann und mach, was du willst.“
Bevor Thomas sich seinen Anorak schnappte und zur Tür rausstürzte, sah er noch, wie der Junge sein Becken durchdrückte und sich einen Finger in den Hintern steckte und dabei anzüglich lächelte.
Schnee wehte herein und als die Tür zuklappte, gefror das Lächeln in Patricks Gesicht. Er sah verwirrt drein. Er nahm den Finger aus seinem Arsch und plumpste schwerfällig zurück. Das klappte doch sonst immer? Trick 17: Biete dich wie eine Nutte an. Das kommt immer gut, war Onkel Franks Devise.
Thomas stürmte nach draußen, knallte fünfundzwanzig Dollar auf den Tresen und sprang in den Chrysler. Er wollte losfahren. Echt. Aber er blieb wie versteinert sitzen und lotete seinen Gemütszustand aus. Er war wie vor den Kopf geschlagen, frustriert, verängstigt und stand neben sich.
-Boyfotze- Ich meine, woher hat der Junge solche Ausdrücke, fragte er sich. Was ihn ebenso verwirrte, war die Tatsache, dass es einen alten und schwachen Teil in ihm gab, der auf das Angebot eingehen wollte. Er mochte sich das nicht eingestehen. Aber es war so. Vielleicht nur für Sekundenbruchteile war da diese nagende Gier nach etwas Verbotenem. Nicht weil es ihm irgendwer verbot, sondern weil er es sich selbst verbot. Er hatte mal als Vierzehnjähriger nach dem Sport mit zwei Jungs gewichst und das war überraschend befriedigend gewesen. Mit einem der Jungs hatte er geschmust und das war der Überhammer. Thomas erinnerte sich noch immer an diese satte Zufriedenheit, die dem Orgasmus gefolgt war. Später, als aus dem Jungen ein Mann geworden war, Frauen seine Wege kreuzten und schlussendlich eine bei und mit ihm blieb, waren die Erinnerungen daran wie ausgelöscht. Auch die Erinnerungen daran, dass er manchmal beim ficken daran dachte wie es war, mit einem Jungen zu schmusen. Aber das waren eben ... Jungs aus der Schule. Nette Jungs. Und der hier? Der war die männliche Ausgabe einer mit allen Wassern gewaschenen Nutte. Nur, dass er nebenbei noch ein Teenager war. Wie das denn jetzt? Thomas seufzte und beschloss, noch mal reinzugehen. Als er die Tür aufmachte und sie ihm der Wind fast aus der Hand riss, rollte gerade der kleine Lieferwagen des Pizzaservices auf den Parkplatz. Thomas ging mit dem Pizzalieferanten zur Rezeption, zahlte die Pizza und ging über den Hof zurück zum Zimmer, den Duft der frischen Pizza in der Nase und frischen Schnee im Haar.
Als er das Zimmer betrat, saß der Junge schlaff wie eine Stoffpuppe auf der Bettkante und begutachtete seine Zehen. Er blickte auf und sah den Mann an, den der Schneesturm ins Zimmer wehte und grinste.
„Kannst auch meine Zehen lutschen, Homo!“, höhnte er und ließ sich rücklings aufs Bett fallen und streckte ein Bein aus.
Thomas ignorierte das obszöne Angebot und legte die Pizza auf dem kleinen Beistelltisch ab. Dann setzte er sich neben dem Jungen aufs Bett und sagte: „So. Pass mal auf. Ich will nichts von dir. Egal, was du glaubst, oder denkst, oder was man dich gelehrt hat. Du wirst jetzt diese Pizza da verdrücken und ich werde deine Drecksklamotten waschen. Dann hau ich ab. Vielleicht gibt es Männer, die auf ... so was abfahren. Ich gehöre nicht dazu. Hast du das kapiert, Junge?“
Thomas sah dem Burschen fest in die Augen und sah dort Tränen glitzern. Noch ein Trick?
„Wie heißt du?“, fragte er jetzt sanfter.
„Patrick.“
„Okay Patrick, haben wir uns verstanden? Ich gehe dann und du kannst bis 18:00 hier bleiben. Schlaf dich aus und denk nach, ob’s nicht gescheiter ist, nach Hause zu gehen.“
Patrick schniefte Rotz hoch und Thomas sah, dass der Junge gleich zu weinen anfangen würde.
„Aber das will ich, ich ja ... Ich will nach ... nach Hause ... aber wo bin ich denn her? U u u und was soll ich denn sonst machen? Ich kann nur so, wie er’s mir gezeigt hat ...“
Patrick weinte und wischte sich mit einem Polsterzipfel die Tränen ab. Dann beruhigte er sich wieder etwas und flüsterte: „Ich geh nie wieder in den Schuppen, nie wieder ...“
„Iß jetzt die Pizza, bevor sie kalt wird.“
Patrick rutschte nach vor und zog sich den Abstelltisch näher. Dann riss er sich ein Stück aus der Pizza und mampfte vor sich hin. Thomas blieb noch eine halbe Minute sitzen und sah ihm zu. Dann stand er auf und ging ins Bad, um mit Seife und Heißwasser die Socken und die Unterwäsche und das T-Shirt des Jungen sauber zu kriegen.
-Ich kann nur so, wie er es mir beigebracht hat-
Darüber sollte man mal nachdenken.
Und Thomas dachte an nichts anderes, als er Patricks Sachen wusch. Aber er kam zu keinem Ergebnis. Wer hatte dem Jungen was beigebracht? Und warum? Und ganz leise die Frage, die er sich nicht laut zu denken wagte: Und wie hat er ihm das beigebracht? Er breitete die Socken, die Shorts und das T-Shirt über der heißen Heizung auf.
Ein Strichjunge, der seinem Zuhälter durchgebrannt ist? Gibt es so was?
Thomas wusste es nicht und wollte es auch nicht wissen. Er war sich sicher, dass sein Weltbild nicht unerheblich leiden würde, wenn er die ganze Geschichte des Jungen hörte. Und das wollte er nicht. Auf gar keinen Fall. Er blieb noch eine Weile unentschlossen im Bad stehen und sah den angelaufenen Spiegel an. Dann riss er sich los und ging zurück in den Wohnschlafraum.
Patrick lag im Bett, halb zugedeckt und schlief, die Pizzaschachtel mit nichts mehr drin als ein paar Krümel, lag auf dem Boden neben dem Bett. Patrick schnarchte ganz leise.
Thomas zog sich den Anorak an und bevor er rausging, um seine Reise fortzusetzen, ging er zu dem Jungen, zog ihm die Decke bis zum Hals und küsste ihn auf die Stirn: „Komm gut heim, Kleiner.“ Schnell wandte er sich ab, weil er Schuldgefühle spürte. Alte Gefühle, die ihm zusetzten. Dann öffnete er die Tür und entschwand aus Patricks Leben.
5