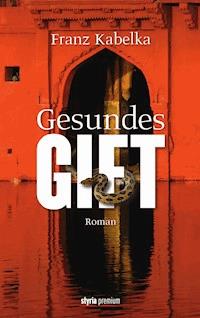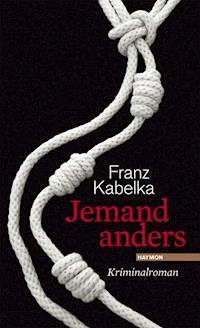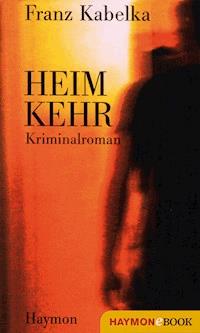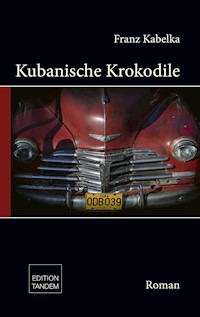Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tone-Hagen-Trilogie
- Sprache: Deutsch
AUF SPURENSUCHE IN EINER PSYCHIATRISCHEN ANSTALT CHEFINSPEKTOR TONE HAGEN IST ZURÜCK: Nicht in der Bregenzer Kriminalabteilung allerdings, sondern als Patient in einer psychosomatischen Klinik in Süddeutschland - ausgebrannt von jahrelangem Polizeidienst und privaten Tiefschlägen, soll er sich dort eine Auszeit nehmen. Doch dann wird Hagens kriminalistischer Instinkt von den dunklen Geheimnissen geweckt, die die Klinik zu bergen scheint: Unter den Patienten toben Kämpfe, ebenso in der Ärzteschaft. Im Auge des Hurrikans: Marie Therese Herbst, eine Borderline-Patientin, die Hagen immer näher rückt. Aber bald steigen Zweifel in Hagen auf: Kann er den Erzählungen der verführerischen Frau trauen - und seinem eigenen detektivischen Gefühl? Sind die gefährlichsten Verbrechen die realen oder jene, die sich nur im Kopf abspielen? Die Antwort auf diese Fragen bringt Hagen in Lebensgefahr … Im letzten Band seiner Tone Hagen-Trilogie führt Franz Kabelka den Vorarlberger Chefinspektor aus der Sphäre des "gewöhnlichen Verbrechens" hinein in eine Welt, in der Wahn und Wirklichkeit nahe beieinanderliegen - und konfrontiert ihn dort mit seinem letzten und wohl ungewöhnlichsten Fall. LESERSTIMMEN: "Ein faszinierender Krimi der das Innenleben einer psychiatrischen Anstalt offenbart, ein Fundort für Geschichten zwischen Wahnsinn und Wirklichkeit im Alltag von Patienten und Ärzten, ein richtig spannendes Meisterwerk!" "Welcher Schauplatz bietet mehr Geschichten als eine psychiatische Anstalt? Für den Anti-Komissar gibt's genügend Indizien seinen Kuraufenthalt nicht allzu ernst zu nehmen und in seine gewohnte Rolle zu schlüpfen, ein wirklich gelungener Szenewechsel."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANZ KABELKA
DÜNNE HAUT
Franz Kabelka
DÜNNE HAUT
Kriminalroman
Die Zitate aus Samuel Becketts „Glückliche Tage“ (im Text nicht ausgewiesen) wurden vom Autor ins Deutsche übersetzt.
© 2008HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7504-6
Umschlaggestaltung: Haymon Verlag/Stefan RasbergerUmschlagfoto: istockphoto.comSatz: Haymon Verlag/Thomas Auer
Diesen Kriminalroman erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
für Sy
Wer das Herz des Feindes verzehrt, ehrt ihn.Das Herz des Feiglings lässt der Krieger unberührt.Afrikanische Redensart
You must fly with the wild geese. You must go.To stand still is to sink in the bog.William Butler Yeats
1 REDEN WIR HALT
Sein Versuch, den flaumigen Wall aus Kissen und Federbett zu überwinden, um den Schalter der Nachtkästchenlampe ertasten zu können, scheitert schon im Ansatz. Was ist es, das ihn ins Weiche zurückdrückt, getränkt mit einem angenehmen Geruch, Moschus vermutlich, der wohlig aus dem Träumeland herüberwabert, aus tiefster Bettwärme? Etwas in seinem Schädel ist noch krampfhaft darum bemüht, die idyllische kleine Insel festzuhalten, auf der der Kaiman sich in der Sonne aalt, ein Eiland voll exotischer Pflanzen und Tiere, mit fallenden Kokosnüssen als einziger Gefahrenquelle für das gewaltige Reptil. Bis der Mensch kommt. Der Jäger, der sich von hinten anpirscht, immer von hinten, um das Tier am Schwanz zu packen und nicht mehr loszulassen, bis es sich im Zoo wiederfindet, lebendig und tot zugleich. Kaiman oder Jäger? Aber spiegelt nicht ohnehin eine jede Traumgestalt nur dich und deinen Seelenzustand wider? Wer hat das gesagt? Egal – aufwachen, Hagen, heraus aus deiner Taucherglocke! Er wartet auf dich, der seichte Steppensee der Realität, durch den es wie ein Reiher zu staksen gilt auf der Suche nach den Würmern, die das Überleben garantieren …
Etwas nestelt an ihm herum. Dieses unangenehme Gefühl hatte er zuletzt vor zwei Jahren, als er nach seiner Schulteroperation aus der Narkose erwachte. Es irritiert ihn, dass sich seine rechte Hand nicht bewegen lässt. Dass sie nicht wie gewöhnlich unter dem Polster ruht, um im Schlaf Kinn und Wange zu stützen, sondern hochgezurrt ist in eine unnatürliche Stellung. Ersatzweise versucht er, seine Linke einzusetzen. Die Reaktion ist ein harter Griff und eine Schlinge ums Handgelenk. Eine leicht duftende Schlinge. Dünn und doch reißfest, wie ein Damenstrumpf.
Auf ihm die Silhouette einer weiblichen Gestalt. Ihr Gewicht drückt ihm den Brustkorb zusammen. Jetzt ist auch sein zweiter Arm am Bettgestell fixiert. Und als die Augen sich langsam an die Schattenwelt zu gewöhnen beginnen, geht mit einem Schlag das Licht an.
Ein Licht, das jeden Zweifel über seinen Zustand beseitigt. Ob er schon wach ist oder noch träumt.
Sie hockt auf ihm wie ein Ringer auf dem Besiegten, mit einem orangen Ding in ihrer Hand.
Schwer zu sagen, wie sie an sein Stanley rangekommen ist. Vielleicht hat sie es bei ihrem Besuch in der offenen Schublade gesehen und einfach mitgehen lassen. Den Cutter mit der versenkbaren Klinge, den er immer dabeihat, wenn er verreist. Ein Leatherman wäre zweifellos standesgemäßer.
Die Situation hat etwas furchtbar Triviales an sich. Die kurze Klinge blitzt und funkelt nicht gefährlich im Mondlicht, wie die klassische Waffe in einem Thriller es zu tun pflegt, sobald es ans Eingemachte geht. Die mausgrauen Jalousien geben dem Mond ja gar keine Chance, die Szene dramatisch zu beleuchten, und ein gerade mal fünfzehn Zentimeter langer Kartonschneider ist auch nicht die klassische Waffe. Kurios, denkt Hagen, wie einfachste Dinge es manchmal schaffen, dem Leben wenn schon keinen Sinn, so doch eine gewisse Struktur zu geben, Anknüpfungspunkte: In seinem letzten großen Fall hat ein Kartonklebeband eine wichtige Rolle gespielt, um Mund und Hals eines alten Obdachlosen gewickelt. Selbstmord oder Mord, so lautete damals die Frage. Im Prinzip riecht es hier, mit seinem Stanley in ihrer Rechten, nach derselben traurigen Alternative.
Mit dem feinen Unterschied, dass die Variante Mord diesmal ihn, den Chefinspektor a. D., höchstpersönlich betreffen würde.
Außer Dienst. Es ist ihm nicht leicht gefallen in den vergangenen Wochen, dieses a. D. hinter seinem Amtstitel zu akzeptieren. Dass man es angesichts seiner jetzigen Zwangslage auch als Ade, als endgültige Verabschiedung lesen könnte, daran hat er bisher nicht gedacht.
Sie ist von seinem gefesselten Körper heruntergerutscht und steht vor ihm, wie er es von ihr kennt: sexy, lässig. Nur ihr Blick passt nicht dazu. Der passt besser zum Schneidewerkzeug in ihrer Hand.
„So“, sagt sie und betrachtet ihr Werk.
Ihre Stimme könnte nüchterner nicht klingen. Wie in einer James-Bond-Szene, wo der Agent X den Agenten Y geschäftsmännisch neutral auffordert, der eigenen Liquidation mannhaft ins Auge zu sehen. Was Y üblicherweise auch tut. Spione haben das offenbar verinnerlicht, zumindest im Film. Wenn das Spiel aus ist, gibt es nichts zu jammern, wird nicht um Gnade gewinselt. Gegebenenfalls vollführt man noch eine Pirouette, trifft mit dem gestreckten Bein punktgenau den Revolver, die Waffe wechselt im Flug den Besitzer, und nun ist X der Gelackmeierte, schaut seinerseits in die kleine runde Öffnung. Keine Zeit für Schockzustände. Wenn die Kugel einem das Hirn beim Hinterkopf hinaustreibt, ist wenig Gefühl im Spiel. Auch nicht beim Kinopublikum. Das Gesetz der Spionage ist ein Naturgesetz, und jeder Beteiligte kennt und akzeptiert es: Wer schneller abdrückt, hat recht. Überleben als einziges Kriterium. Aber das fällt dem Guten im Film natürlich wesentlich leichter als in der profanen Wirklichkeit. Zumal der Agent im Film nicht ans Bett gefesselt ist, wortwörtlich.
„Setz dich auf“, sagt sie.
„Witzig“, sagt er, „wie denn?“
Die Strümpfe schnüren ihm das Blut ab. Er merkt, dass es um seinen Kreislauf nicht zum Besten bestellt ist. Ein leichter Schwindel hat ihn erfasst, und er kämpft dagegen an. Nein, das wäre nicht angebracht, so knapp vor dem Abgang noch zu kollabieren.
Die Andeutung eines Lächelns auf ihrem Gesicht vermag ihn nicht zu beruhigen. Es drückt ziemlich unmissverständlich aus, dass er sich wegen seines zu niedrigen Blutdrucks keine Sorgen mehr machen muss, wie auch wegen sonst nichts mehr. Sie haben viel geredet miteinander in den letzten Tagen. Da lernt man, die Kommentare im Gesicht des anderen zu lesen.
„Na schön. Dann tu halt, was du tun musst.“
Wieder dieses Lächeln.
„Nein, mein Freund. So schnell sind wir nicht fertig miteinander. Ein wenig wirst du dich schon noch gedulden müssen.“
Sein Blick fällt auf die Hausschuhe neben dem Bett. Die beiden Filzpantoffel stehen wieder einmal verkehrt nebeneinander, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Allenfalls wird sich später ein ermittelnder Kollege darüber den Kopf zerbrechen. Ob die ungewöhnliche Stellung der Pantoffeln womöglich etwas über den Tathergang aussage, oder ob es sich gar um eine letzte verschlüsselte Botschaft des Opfers handle.
Schwachsinn!, denkt er. Wie schwer es mir fällt, meine Situation als dramatisch anzunehmen, obwohl sie es zweifellos ist. Ist das vielleicht dieselbe Art von Sehnsucht wie bei meinem Bruder, ein dunkler Drang nach drüben? Erwarte ich mir so etwas wie die Erlösung von der Banalität alles Irdischen? Aber wird es denn danach wirklich weniger banal? Die Worte des Vaters auf der Intensivstation kommen ihm in den Sinn, an ihn gerichtet in einem der seltenen intimen Augenblicke, die er mit seinem Erzeuger teilte:
„I säg dr eppas, des hon i sus no niamand gset: I glob nix vo dem Käs, Tone, gär nix vo dem, was do no ko söll. A koan Gott und o a koan Tüfel.“
Das hatte der Alte ihm noch mitgeben wollen, dass er an nichts von all dem glaube, was nach dem Tod kommen solle, weder an Gott noch an den Teufel, und seine tief liegenden Augen hatten darum gebeten, diese Worte für sich zu behalten. Ein Wunsch, den Hagen natürlich erfüllte. Allerdings, wenn er ehrlich ist, arg beschäftigt hat er sich mit Vaters Einsichten zwischenzeitlich auch nicht. Dass sie ihm gerade jetzt wieder einfallen müssen …
„Also schön. Dann reden wir halt. Wenn es dir hilft.“
Es ist nicht das erste Mal, dass er diesen Spruch verwendet. Vor allem gegenüber Lisa hat er damit geglänzt. Zumeist, wenn sie ihn darum bat, endlich ihr komisches Verhältnis zu klären. Er ist nie ein großer Redner gewesen. Außer bei Verhören, aber das ist ein anderer Kanal. Ein öffentlich-rechtlicher gewissermaßen, kein peinlich privater. Mehr noch als das Reden ist das Reden-Lassen ein Teil seiner Arbeit. Es gibt nur wenige Verbrecher, die im Verlauf von tagelangen Verhören nicht zu dem Punkt gelangen, wo sie sich mitteilen wollen. Müssen! Und wenn es nur ein Polizist ist, der ihnen zuhört. Hauptsache, irgendeiner beschäftigt sich mit ihrem vertrackten Innenleben.
„Wenn es dir hilft!“, äfft sie ihn nach. „Hat schon viel gelernt von den Ärzten hier, unser Amateurpsychiater! Aber wer sagt dir, dass ich mit dir reden will?“
„Was willst du dann?“
Sie sieht durch ihn hindurch, als ob er nicht im Raum wäre. Er hat noch keinen Menschen kennengelernt, der das besser beherrscht hätte als sie. Es ist nicht jener Blick ins Leere, der einem mitunter beim Nachdenken hilft; nein, es ist die kalte Verneinung des Gegenübers. Ein Leugnen seiner Existenz. Oder zumindest seiner Existenzberechtigung.
„Abwarten“, sagt sie und nimmt auf seiner Matratze Platz. Als wäre sie eine Besucherin am Krankenbett.
Von draußen hört er den Ruf eines Uhus. Nichts Außergewöhnliches, die Klinik liegt ja nah genug am Waldrand. Auch die Natur sagt mir, ich sollte mich fürchten, denkt er. Wieso kann ich mich nicht einfach fürchten?
Das Stanley in ihrer Rechten zittert nicht im Mindesten, als sie die Klinge noch ein Stück weiter ausfährt.
2 DIE SACHE
Es herbstelt, ohne Zweifel. Von den Bergen winkt bereits der erste Schnee, der Dornbirner Marktplatz aber strotzt noch vor satten, fast südländischen Farben: das Rote Haus röter noch als gewöhnlich, dahinter die Gelb- und Ockertöne der Kastanienbäume, rechts das bunte Giebelmosaik von St. Martin und der grüne Spitzhelm des Ostturms, der sich in den tiefblauen Himmel bohrt. Alles in allem ein scharfer Kontrast zu Hagens Gemütsverfassung und Grund genug, um erstmals seit Monaten Zeitausgleich in Anspruch zu nehmen. Ein kurzer Anruf im Landeskriminalamt, und Punkt vierzehn Uhr ist der Arbeitstag für den Chefinspektor ad acta gelegt.
„Tuas gnüßa“, hat ihm Claudia, die Sekretärin des Majors, gewünscht, „ab morn ischt eh Reaga agset.“ Er klopft sich auf die Schulter: Endlich, endlich hat er sich einmal überwunden und seiner Lust nachgegeben – seiner Unlust, genau genommen. Sollen doch Gfader und Winder den restlichen Zeugen der Messerstecherei in Hatlerdorf hinterherhecheln! PKK-Anhänger gegen Graue Wölfe, das alte Lied.
Auf dem Weg zum Parkplatz lässt ihn ein Geruch schwach werden: Maroni! Er gönnt sich ein Viertelkilo, dabei hat er doch eben erst ein dreigängiges Menü vertilgt. Aber wie willst du dich wehren gegen den Duft der Maroni, der herüberströmt aus jener verflossenen Zeit, als geröstete Kastanien, verpackt in einer schlichten Tüte aus Zeitungspapier, den Gipfel kindlicher Glückseligkeit darstellten?
Die Tüte ist noch nicht zerknüllt, da ist es mit der nostalgischen Wonne schon wieder vorbei. Ein Schalensplitter, der sich beim Schälen unter seinem Fingernagel verspießt hat, nervt Hagen ebenso wie die Tatsache, nicht recht zu wissen, wozu er sich eigentlich freigenommen hat. Er pickt ein Strafmandat von der Windschutzscheibe, das zweite in dieser Woche, und zerknüllt es. Rast auf der A14 heim nach Levis, wirft sich auf die Couch, studiert die Fernsehzeitung. Vergeblich: Unter zig Programmen keine einzige Sendung, die einen reizen würde, auf den Knopf zu drücken. Außerdem muss er nach einem Blick in die Speisekammer erkennen, mit vergorenem Hopfen und Malz nicht mehr ausreichend gerüstet zu sein, um idiotische TV-Shows um fünf bis sechs Prozent erträglicher zu gestalten. Also wieder auf, Hagen, keine Müdigkeit vorschützen! Er holt das Fahrrad aus der Garage und packt die Kiste mit den leeren Bierflaschen hinten drauf.
Dem üblichen Stau auf der Reichstraße weicht er über die verkehrsberuhigte Mutterstraße am Fuß des Ardetzenbergs aus. In der Wiese blöken ein paar Schafe. Eigentlich wohne ich in einer rechten Idylle, denkt Hagen. Mitten in der Stadt und doch am Land. Es sind große, weiße Schafe, weitaus größere als jene, die er letzten Sommer in Irland gesehen hat, und bedeutend träger. Die unseren könnten sich auf den steilen Pfaden der Twelve Pins kaum halten, nein, sicher nicht, geschweige denn, dass sie über die Moorgräben drüberkämen. Dafür geben sie wahrscheinlich mehr Wolle, sind leichter zu halten, angepasster an die Menschen hierzuländle. Scheiße! Wollte er diese Gedanken nicht streichen, ein für alle Mal – wie alles, was mit der grünen Insel zusammenhängt? Aber wenn doch jedes blöde Schaf es schafft, ihn wieder hineinzureißen; hinein in diesen Graben, diesen Morast, hüfttief gefüllt mit Wasser und Schlamm. Ein Moorbad, von dem absolut keine Heilwirkung ausgeht …
Aus einer Quergasse sieht er einen blassblauen BMW auftauchen, etwas schnell unterwegs vielleicht, aber er, der Radler, hat ja Vorrang, was soll’s. Die leeren Flaschen hinter ihm veranstalten einen Höllenlärm, man muss sich fast schämen, als Polizist so unterwegs zu sein, sichtbar und hörbar, das nächste Mal wird auch er wie jedermann den Wagen benützen. Der blaue BMW biegt jetzt in seine Straße ein. Verdammt, wieso bremst der nicht? Trotz der getönten Scheiben ist zu erkennen, wie der Fahrer, ein junger Spund, ins Handy spricht, lacht, dazu eine Bee-Gees-Nummer für die ganze Welt, und der Kerl lacht noch immer, während er ihn schneidet, wahrscheinlich schildert er der Tussi am anderen Ende der Leitung gerade, wie er einen Opa auf dem Fahrrad eben ein wenig ausgebremst hat, ausgebremst ohne zu bremsen, haha, und wie die leeren Bierflaschen dabei einen Tanz aufführen in ihrer Kiste und greller noch klingen als die Stimmen von Maurice und Barry Gibb.
Keine zwanzig Meter weiter bremst der BMW dann doch, um seitlich einzuparken. Der Fahrer grinst noch immer, als Hagen fast auf gleicher Höhe ist mit ihm, quatscht noch immer in sein dämliches Handy: alles klar, Angie-Baby, alles klar. Und Angies Lover, Sohn eines betuchten Feldkircher Rechtsanwalts, wird die nächsten paar Sekunden hilflos mit ansehen müssen, wie die Hand des ausgebremsten Opas hinter sich in die Biersteige langt und eine Flasche herauszieht, eine leere Bierflasche Marke Mohrenbräu, die, das gibt es ja gar nicht, in hohem Bogen auf seinem Autodach landet, dort eine beträchtliche Beule hinterlässt, wieder abspringt und schließlich – wundersamerweise ohne zu zersplittern – auf der Straße landet. Muss sich anhören, wie nun der Radfahrer seinerseits lacht, ein irres Lachen, wie der junge Mann später zu Protokoll geben wird, nie hätte er sich gedacht, dass ausgerechnet ein Polizist zu so etwas imstande sein könnte! Die Delle im Autodach sei ja zu verschmerzen, aber der Schock! Man stelle sich vor, wenn er in diesem Stress nicht seine Nerven im Zaum gehalten hätte! Aber eine Genugtuung, das wird er später einmal Angie oder ihrer Nachfolgerin erzählen, eine echte Genugtuung sei es ihm schon gewesen, dass der oberste Chef des Landeskriminalamts ihn persönlich gebeten habe, über dieses Vorkommnis Stillschweigen zu bewahren. Was er auch versprochen habe, als ihm versichert wurde, das Schweigen und ein außergerichtlicher Vergleich sollten sein Schaden nicht sein.
*
„In Anbetracht der Tatsache, dass so etwas das erste Mal vorgekommen ist“, sagt Major Ender jetzt schon zum dritten Mal. „Und angesichts Ihrer unglückseligen familiären Umstände im Vorfeld …“
Hartmann, der Polizeipsychologe, übt sich im Dauernicken. Auch er ist peinlich berührt. Über einen Gruppenleiter, der schon doppelt so lange im Polizeidienst tätig ist wie er, ein psychologisches Gutachten erstellen zu müssen, ist weder alltäglich noch lustig. Wenigstens sind in den zwei langen Gesprächen mit Hagen genügend außergewöhnliche Stressmomente ans Tageslicht gekommen, die es angebracht erscheinen lassen, die Sache nicht aufzubauschen. Der Chefinspektor zeigt sich zudem einsichtig und verzichtet gegenüber seinem Vorgesetzten auf jede Rechtfertigung. Ausgerastet sei er eben, unentschuldbar, er wolle das gar nicht kleinreden. Und wenn man deshalb sein Ausscheiden aus dem Dienst verlange, werde er sich nicht dagegen sperren.
„Aber ich bitte Sie!“ Der Major klingt für einmal fast ehrlich. „Wegen einer solchen Lappalie werden wir nicht einen verdienten Mann wie Sie … Das hätte gerade noch gefehlt. In Wien steht derzeit die halbe Führungsebene der Kripo vor Gericht, täglich werden neue Schandtaten der Polizei in den Medien breitgetreten. Angebliche, versteht sich, zu neunundneunzig Prozent pure Erfindung! Aber etwas bleibt ja immer an einem hängen, der verdächtigt wird, wer wüsste das besser als unsereins. Jedenfalls können wir da kein zusätzliches Theater brauchen. Wir stehen selbstverständlich voll hinter Ihnen, Herr Kollege. Aber ein bisschen werden Sie uns schon entgegenkommen müssen.“
Schweigen im Raum. Düsteres Harren der Bedingungen. Aus dem Munde eines Vorgesetzten, der ihm nie besonders grün war. Wenn ihn Malin nicht protegiert hätte, aus Sympathie zu seinem verstorbenen Vater, Hagen hätte nicht einmal den Gruppenleiterposten bekommen damals, vor mittlerweile sechs Jahren. Aber vielleicht wäre das auch gescheiter gewesen so.
„Kennen Sie eine gute Klinik, in die Sie sich für eine Weile … zurückziehen können?“
„Eine Klinik? Zurückziehen? Wozu denn das?“
Ender versucht sich nun in einem väterlichen Ton, was angesichts der knapp fünf Jahre, die der Major älter ist als Hagen, ein wenig eigen anmutet.
„Ja, mein lieber Hagen, im Leben eines jeden Polizisten, der wie Sie tagaus, tagein mit den Schattenseiten des menschlichen Daseins befasst ist, gibt es einmal einen Zeitpunkt, wo die persönlichen Ressourcen erschöpft sind. Nein, schütteln Sie nicht den Kopf: Sie stehen seit Jahr und Tag an der Front, und jeder Soldat braucht einmal Fronturlaub, so viel ist sicher. Gönnen Sie sich ein paar Seelenmassagen, Sie werden sehen, wie gut Ihnen das tut. Und danach …“ – Ender legt eine Kunstpause ein – „danach werden Sie in Ihrem Dienst auch wieder mehr Befriedigung finden.“
Und nicht mehr so leicht ausflippen, denkt Hagen, das hast du netterweise weggelassen. Er versucht es mit einem Gegenvorschlag. „Ich könnte mich ja auch bei einem hiesigen Therapeuten ein-, zweimal die Woche auf die Couch legen, wenn es das ist, was Sie wollen. Nach der Arbeit, natürlich. Wir sind doch schon zu dritt am Anschlag, wie sollen Gfader und Winder alleine den Karren am Laufen halten!“
Ender winkt ab. „Sie brauchen Abstand von der Arbeit, nicht noch mehr Stress, Hagen! Und machen Sie sich keine unnötigen Sorgen wegen Ihrer Gruppe. Jetzt geht es erst einmal um Ihre Gesundheit. Demnächst bekommen wir ohnehin Verstärkung durch einen deutschen Kollegen, das Gegengeschäft quasi zu Winders Hospitation in Berlin vor zwei Jahren. Also, ich denke, wir verstehen uns, nicht wahr? Gut. Ja, und noch etwas: Sollten Sie, was ich durchaus verstehen könnte, eine Kur im benachbarten Ausland vorziehen, wo einen nicht jeder kennt, kann Ihnen Dr. Hartmann sicherlich mit Adressen behilflich sein. In diesem Sinne“ – er steht auf und gibt Hagen damit zu verstehen, dass das Gespräch beendet ist – „freue ich mich, wenn Sie uns erholt und voll überschäumender Energie bald wieder verstärken werden!“
Keine Kündigung, nur entlassen – in eine Kur. Als arbeitsunfähiges Psycherl abgestempelt, das dringend eine Rehabilitation braucht. Es hätte schlimmer ausgehen können, sagt sich Hagen. Er weiß zwar nicht, wofür das Ganze gut sein soll, aber bitteschön. Auf diese Weise kann man dem Chef schon mal entgegenkommen.
3 DER TORFSTECHER
Liam heiße ich, nix sonst, einfach Liam, das muss genügen.
Und du? Anton, aha. Nach dem heiligen Antonius, Helfer der Suchenden. Ein wichtiger Heiliger!
Und sie? Lisa. Sehr angenehm. Deine Frau, nehme ich an? Nein? Na ja, es geht mich ja nix an.
Anthony und Lisa … Schöne christliche Vornamen! Aus Österreich kommt ihr? Der Hitler ist auch aus Österreich gekommen, nicht wahr? Hat es den Briten ordentlich gezeigt, damals, alle Achtung! Wenn es am Ende auch nicht ganz gereicht hat.
Und was macht ihr bei uns in Connemara? Wandern, ach so. Mittlerweile kommt ja die ganze Welt zu uns. Sogar Japaner und Chinesen … eine echte Heuschreckenplage! Aber ich hab eh nix gegen sie. Wer wird sich beschweren über sein Zubrot. Am verrücktesten sind die Schlitzaugen: Die springen aus dem Bus, noch bevor er richtig steht, und stellen sich links und rechts von mir auf im Feld. Dann wird fotografiert, was das Zeug hält. Und ein Gegrinse ist das! Wenn sie fertig sind damit, hüpfen sie gleich wieder in ihren Bus und ab die Post. Ich winke ihnen brav nach, bis sie verschwunden sind. Weil das gehört zu meinem Job, hat der Bursche von Failte Ireland gesagt.
Also, das Feld gehört mir ja gar nicht, ich würde es auch nicht wollen. Eine saure Wiese, um die sich keiner reißt. Wie? Pyramiden aus Torf? Pyramiden, haha, das ist gut! Nach dem Ausstechen muss das Zeug halt zum Trocknen geschlichtet werden, damit es ordentlich brennt. Das hat sich nicht geändert in den letzten tausend Jahren …
Aber ich beschwere mich nicht. Das Torfstechen und das Brikettschlichten ist eine aussterbende Kunst. Immer weniger geben sich dafür her, und schon gar keine Jungen.
Jetzt fällt er mir wieder ein, sein Name: Malley, so heißt er, der Bursche vom Tourismusverband, Pete Malley. Ein studierter Kopf, das hab ich gleich gemerkt. Hat mich extra in meinem Cottage besucht, um mir den Deal vorzuschlagen. Wann wird das gewesen sein? Vor elf oder zwölf Wochen vielleicht, knapp vor Beginn der Hauptsaison. Du bist ein harter Brocken, Liam, sagt er, das sieht man, du lässt dich nicht so leicht von Wind und Wetter vertreiben, oder? Ne, sag ich und schenke mir ein zweites Glas aus der Flasche ein, die er auf den Tisch gestellt hat, vier Jahreszeiten pro Tag, das macht mir nix und überhaupt. Weil das ist wichtig, sagt er: Du musst ständig draußen sein. Von mir aus kann es Kartoffeln hageln, sag ich, ich rühre mich nicht von der Stelle. Das ist auch die erste Bedingung, sagt er. Die zweite ist, dass du dir nichts daraus machen darfst, wenn sie dich fotografieren. Wer wird mich schon ablichten wollen, lache ich, einen alten Torfstecher wie mich! Wirst schon sehen, sagt er, wirst schon sehen. Am besten fangen wir gleich damit an. Ich musste in mein ältestes Gewand steigen, und er hat mich beim Stechen fotografiert. Für den neuen Katalog, hat er erklärt. Er war gar nicht mehr zu bremsen, einen ganzen Film hat er verschossen – nur für mich! Der alte Liam im Hochglanzkatalog von Failte Ireland, stellt euch das mal vor! Ich hätte natürlich lieber meinen Feiertagsanzug angezogen, aber das kam nicht in Frage. Weil es doch darum geht, dass alles echt aussieht, hat Pete gemeint. Je zerschlissener das Gewand, umso besser. Und Regen und Nebel würden die Leute auf den Fotos lieber haben als Sonnenschein, wegen der urigen Stimmung. Ich hab mir das nicht vorstellen können. Glaub mir, Liam, sagt er, was die richtige Stimmung angeht, bin ich Experte. Vier Jahre Marketingstudium in Dublin und in London. Keine Ahnung, was sie da zusammenstudieren, denke ich, aber okay, er wird es wohl wissen. Nach der Knipserei sind wir zum Geschäftlichen gekommen. Er hat mir siebzig Euro die Woche geboten, einfach so, ich hab nicht einmal handeln müssen. Siebzig Euro, das sind fast fünfzig alte irische Pfund! Eine ordentliche Menge Geld für einen Rentner wie mich. Abgemacht, sage ich, die Hand darauf. Abgemacht, sagt er. Er hat mir sogar noch die halb volle Flasche Paddy dagelassen – ein feiner Bursche!
Den ganzen Tag Torf stechen und Torf schlichten … Es klingt anstrengender, als es ist. Ich hab genug Zeit, zwischendurch meine Pfeife zu rauchen und für einen Schluck aus der Buddel, die unter den Briketts eh keiner sieht. Aber wann immer ein Auto oder ein Radfahrer auftaucht am Horizont, fang ich sofort wieder an mit dem Stechen. Oder mit dem Schlichten, je nachdem. Im Urlaub sehen die Menschen am liebsten anderen bei der Arbeit zu, hat Pete gesagt, und ich schätze, er hat recht damit. Auch wenn nie einer das Zeug abholt zum Verheizen, es geht ja nur ums Zurichten, und dass alles möglichst original ausschaut. Und weil eh nie etwas wegkommt, hab ich mir jetzt einen neuen Plan überlegt: Am Abend stoß ich die Haufen einfach wieder um! So erspare ich mir, jeden Tag neue Briketts ausstechen zu müssen. Nicht schlecht, was? Das dürft ihr dem Pete Malley aber nicht verraten!
Nicht ganz ehrlich? Ach, wissen Sie, das ist so eine Sache mit der Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit, sag ich immer, ist wie ein Katzenjunges. Furchtbar lieb, aber blind. Ohne viel Lebenserfahrung und ohne viel Lebensberechtigung. Wahrscheinlicher, dass es schon am ersten Tag ersäuft, als dass es sie aufkriegt, seine verklebten Augen.
Ich werde es wohl wissen, weil da bin ich der Experte. Seit ewigen Zeiten bringen sie mir ihre Katzenjungen, damit ich sie entsorge für sie. Wie ich das erledige, ist ihnen egal, solange sie nicht zuschauen müssen dabei. Liam, du machst das für mich – nicht wahr, Liam? Ich hab keine Hand für so was, und meine Frau, du kennst sie ja, die würde am liebsten gleich den ganzen Wurf behalten … Weil ich also eine Hand für so was habe, darf ich sie ertränken, im nächstbesten Moorgraben. Dort liegen schon ich weiß nicht wie viele. Irgendwann einmal wird sich ein Archäologe den Kopf darüber zerbrechen, was so viele Katzenskelette auf einem Haufen bedeuten. Ob das eine Opferstätte der Kelten war oder sonst was Antikes.
Aber die Leute brauchen mich nicht nur, wenn unerwünschter Nachwuchs gekommen ist. Es gibt auch die, die ihre alte Katze nicht mehr aushalten, weil sie plötzlich nicht mehr stubenrein ist. Zehn Jahre lang ist alles bestens gelaufen, und auf einmal versaut sie den Teppich oder scheißt einem vor die Tür. Ich sag den Leuten immer: Wenn es nicht Darmkrebs ist oder so, wird es wohl daran liegen, dass etwas umgestellt wurde in der Wohnung. Vielleicht findet sie sich einfach nicht mehr zurecht bei Ihnen zuhause? Aber die Leute wollen sich darüber gar keine Gedanken machen. Die glauben, eine Katze ist dazu da, sich ihnen anzupassen und nicht umgekehrt. Dann bin ich halt wieder der, der sie entsorgen muss.
Bevor ich es in den Graben werfe, tröste ich das Tierchen noch ein bisschen. Ja ja, pussy cat, sage ich, unberechenbar ist es halt geworden, das Leben, furchtbar kompliziert. Was glaubst, wie es uns Menschen erst damit geht! Und da ist keiner, der es so schnell und schmerzlos zu Ende bringt mit uns wie ich jetzt mit dir.
Ich kann es ja nicht beweisen, Anthony, aber ich glaube, nach so einem Trost stirbt es sich gleich um einiges leichter.
4 KLINIK SONNBLICK
Da haben wir aber Glück gehabt, Herr Hagen!
Glück, genau, Glück … Was ist schon ein blauer Fleck auf dem Hintern angesichts der Unendlichkeit – also angesichts der unendlich vielen Möglichkeiten, sich wehzutun. Auch wenn der Fleck sich ständig auszuweiten scheint und in seinem Zentrum mittlerweile richtig gelb geworden ist, eine Schwefelader mitten durch den Allerwertesten. Es hätte auch leicht das Knie daran glauben können, oder gar die Hüfte, in der ohnehin seit gut zwei Jahren eine veritable Arthrose hockt, die ihm die Lust raubt an jeder heftigen Bewegung. Den Mambotanzkurs hat er deshalb nach nur sechs Abenden aufgeben müssen: Schau, Lisa, diese Ausfallschritte sind einfach nichts für meine ramponierte Hüfte. Wenn es krümelt und kracht, als hättest du Sand, was sage ich, als hättest du mittlere Felsbrocken im Getriebe, da kommst du dir gleich noch einmal so blöd vor bei diesen Verrenkungen.
Dabei ist der Mambo noch gar nichts im Vergleich zum argentinischen Tango …
Mit Schaudern denkt er zurück an ihre gemeinsame letzte Silvesternacht in diesem St. Gallener Keller. Verführt, verhext, verloren! Gefangen im Lasso von Lisa, das sie wie ein waschechter Gaucho wirft, vorwärtsgepeitscht von den rasenden Akkorden der extra aus Patagonien eingeflogenen Musiker, vier wahre Konditionswunder, die im Gegensatz zu ihm keine Pause benötigen. Gitarrengeschrumme, Akkordeongequetsche; Lisa, die ihn umschwänzelt; schmachtende Blicke allüberall. Da Auerhahn, dort Henne. Permanentes Balzen in wiegender Zeitlupe, mitunter beschleunigt zu einem synchronen zackigen Herumreißen der Köpfe, auf das jähe Erstarrung folgt: eine Skulptur schweißgesülzter Eitelkeit, ein – wäre er nicht gezwungen, selbst dabei mitzumachen – faszinierender, von Pathos triefender Augen- und Ohrenschmaus. Und Schweizer Preise für den üppig fließenden Malbec, der hilft, die sonstige Verklemmtheit fasnachtmäßig zu entsorgen. Ein Ausnahmezustand, der die Regel bestätigt.
Tut es uns noch sehr weh, Herr Hagen?
Nein, tut es nicht. Aber danke der Nachfrage. Ein lächerlicher Ausrutscher halt, nicht vergleichbar jenem bei der winterlichen Radtour im Bregenzerwald, der ihn vor zwei Jahren ins Krankenhaus gebracht hat, und dennoch: Ein Treppenwitz seiner eigenen Geschichte, weil passiert in total nüchternem Zustand. Aber was sonst soll man auch hier drinnen sein als nüchtern. Wie oft hat er es eigentlich geschafft, im steilsten Gelände sturzbesoffen einen Sturz zu vermeiden? Das Austarieren – eine alte Spezialität von ihm. Vielleicht, dass es etwas mit seinem Sternzeichen zu tun hat, einer Waage ist die Balancierfähigkeit ja angeblich eingeschrieben. Erst hier, auf der ganz und gar unspektakulären Treppe zwischen Therapiebereich und Wohnräumen muss er es fertigkriegen, auszurutschen auf dem abgeschliffenen Lärchenholz und sich, schon im Fallen, ausgerechnet an einem Kaktus festzuhalten …
Was, zum Teufel, haben langstachelige nordamerikanische Kakteen eigentlich im Stiegenhaus einer psychosomatischen Klinik zu suchen?
Armer Herr Hagen! Wie konnte das nur passieren?
Ja, wie eigentlich? Ist das alles vielleicht Teil eines größeren Absturzes? Du musst die Dinge ganzheitlicher betrachten, Tone, hat Lisa immer gesagt. Okay, ihr Kriminaler seid super, wenn es darum geht, etwas zu analysieren und auseinanderzuklauben, keine Frage; aber die Welt lässt sich nicht auf die Summe ihrer Teile reduzieren. Und er darauf: Was hast du gegen das Zerlegen? Im Mikrokosmos ist doch der Makrokosmos enthalten – deine Worte! Und sie lächelt nur, lächelt und macht diese komische Gebärde wie die hinduistische Götterfigur mit den vielen Armen, bevor sie ihm wieder entgleitet, in der nassen Schwärze versinkt, und er greift ins Leere, zu kurz seine langen Handballerarme, viel zu kurz …
Zeit für den Kaffee, Herr Hagen!
Wunderbar, danke. Wohltuend, diese Regelmäßigkeit! Um Punkt sieben Uhr fünfundvierzig gibt es Frühstück, ob es regnet oder schneit oder ob, wie heute, die Sonne scheint. Von zwölf bis dreizehn Uhr dann Mittagessen, von siebzehn Uhr fünfundvierzig bis achtzehn Uhr dreißig das Abendbrot. Der Zeitplan ist angesichts der vielen Therapien und Vorträge, die dazwischen zu absolvieren sind, recht engmaschig, aber ihm taugt das. Er schätzt klare Vorgaben und ist froh, wenn sich der Tagesablauf wie von selbst ergibt. Schwer zu verstehen, wieso sich manche Patienten hier über alles und jedes echauffieren müssen: über den Zeitplan, über die Kost, über das polnische und karibische Pflegepersonal. Sich echauffieren – eine prächtige Vokabel, findet Hagen, mit nostalgischem Beigeschmack. Schon wie sich das ie schier endlos dehnen lässt, drückt es mehr von der selbstgefälligen Erregung aus als jedes andere Wort.
Am meisten weiß sich der Laub zu echauffieren. Wolfgang Laub, ein Oberstudienrat aus Stuttgart. Ich lege Wert darauf, dass man meinen Vornamen nicht zu einem Wolfi verstümmelt! Schon beim ersten Treffen der Neuankömmlinge, beim Kennenlernabend, wo sich das Ärzte- und Therapeutenteam der Station vorstellte und man einander beschnupperte, ist der Mann unangenehm aufgefallen. Seine endlose Fragerei – zwecks besserer Orientierung, so Laubs ständige Floskel, noch eine schnelle Frage zwecks besserer Orientierung! – hat bewirkt, dass man am Ende des Kennenlernabends nur eines bis ins letzte Detail wusste: was alles in der Klinik verboten ist. Denn ausschließlich für Regeln, geschriebene wie ungeschriebene, zeigte der Herr Oberstudienrat Interesse. Mit einem wie ihm in der Gruppe hat sogar der seelisch Stabilste schnell einen Schaden weg. Natürlich leidet Laub, wie die meisten hier, an Burnout, im Sonnblick ist man ja auf Ausgebrannte spezialisiert. Was auch die überproportional große Anzahl von Lehrern und Sozialarbeitern unter den Patienten erklärt. Früher, als die österreichische Krankenkasse noch anstandslos alles bezahlte, kamen sie angeblich zuhauf von der anderen Seite der Grenze; jetzt halten Selbstbehalt und Mehraufwand doch die meisten davon ab. Derzeit scheint Hagen der einzige Vorarlberger im Haus zu sein, worüber er heilfroh ist. Und der einzige Kriminalpolizist. Darauf hat ihn der geschniegelte Chefarzt auch gleich angesprochen, zum Glück unter vier Augen: Er freue sich, einmal einen waschechten Kommissar in seinem Haus begrüßen zu dürfen. Da werde man sich in den nächsten sechs Wochen ja ganz besonders sicher fühlen …
Depp!, dachte Hagen und lächelte wie eine polierte Zweieuromünze. Das hat er schon gefressen, wenn sich ein Mann die Wimpern einfärbt!
Und dennoch muss er Major Ender im Nachhinein noch dankbar dafür sein, dass der ihn dazu gedrängt hat, ins Dütsche zu gehen. Man stelle sich vor: In der Gruppentherapie hockt dir einer gegenüber, den du einmal eingebuchtet hast! Wär’ was für die Analen, wie der liebe Kollege Winder zu witzeln pflegt, Analen mit einem „n“ …
Die Klinik Sonnblick