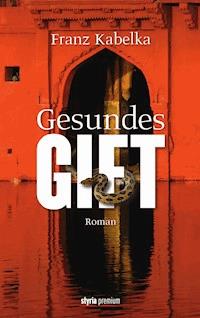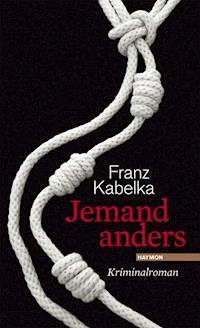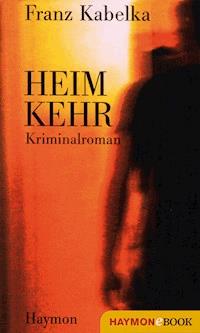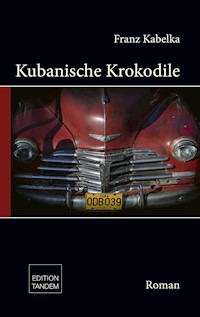Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tone-Hagen-Trilogie
- Sprache: Deutsch
AUF SPURENSUCHE IM OBDACHLOSENMILIEU Sein zweiter Fall führt Chefinspektor "Tone" Hagen tief ins subkulturelle Milieu seiner Heimat: Ausgerechnet am Weihnachtsabend wird in der Ruine der Heidenburg eine Leiche gefunden, die als Paul Pröll identifiziert wird - ehemaliger Slalomstar und nunmehr Bewohner der "Herberge", wie das Obdachlosenheim nahe Bludenz genannt wird. Aber wer ist für Paulis Tod verantwortlich? Sind Eifersucht, Neid, Hass die Motive? Oder war es Selbstmord? Und steht das zeitgleiche Verschwinden des Gymnasiasten Clemens Schöch damit in einem Zusammenhang? Ist Clemens tatsächlich nur aus der Biederkeit seines Elternhauses geflohen? Und als wären das noch nicht genug der Fragen, steht "Tone" Hagen auch in seinem Privatleben vor Turbulenzen: Drei Jahre nach seiner Rückkehr hat er in seiner eigentlichen Heimat noch nicht recht Fuß gefasst, und seine generelle melancholische Grundstimmung droht sich zur ausgewachsenen Midlife-Crisis zu entwickeln. Franz Kabelka erzählt auch in seinem zweiten Kriminalroman mit trockenem Humor und psychologischer Raffinesse und führt den Leser an die unterschiedlichsten Schauplätze, vom Obdachlosenmilieu bis hin zur Welt des saturierten Großbürgertums. LESERSTIMME: "Dass ausgerechnet ein gescheiterter Tiroler Ex-Schirennläufer in einem Obdachlosenheim in Vorarlberg landet und dort auch noch ermordet aufgefunden wird spricht für die skurilen Geschichten des Autors, die dennoch von Realität zeugen und den Blick auf die Provinz schärfen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Kabelka
LETZTE HERBERGE
Kriminalroman
© 2006HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7505-3
Umschlag: Stefan Rasbergerunter Verwendung eines Fotos von www.photocase.deSatz: Karin Berner/Haymon Verlag
Diesen Kriminalroman erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Komisch: ich glaube an den Teufel,aber nicht an den lieben Gott.
Ödön von Horváth, Jugend ohne Gott
gewidmet den Bewohnern der echten Herbergeund jenen, die nicht das Glück haben,eine solche zu finden
1. DIE HEIDENBURG
„So hat das Christkind doch noch Mitleid gehabt!“, sagte Anna.
Just am Morgen des letzten Adventsonntags, als in der endlosen Nebelsuppe des Vorarlberger Rheintals schon keiner mehr daran glaubte, hat es zu schneien begonnen. Zuerst zwar nur in fetten, viel zu wässrigen Flocken, was die meisten prophezeien ließ, dass wieder trostloser Matsch angesagt sei, Matsch draußen, Matsch drinnen in den Köpfen. Doch dann waren die Reste der Warmfront zusammengebrochen, und der Schnee schickte sich an zu fallen wie in den guten alten Heimatfilmen: perfekte Kristalle, still und heimelig.
Richtig weihnachtlich eben.
In ihren teuren Skioveralls, die Blondschöpfe versteckt unter Fleecezipfelmützen und Hände und Füße in dicken Fäustlingen und noch dickeren Moonboots – so weiß Dr. Rosskopf seine Sprösslinge trocken und geborgen. Auch zu dieser späten Stunde. Meine Jungs, denkt er stolz, die wahren, die einzigen Augensterne! Schade, dass ihre Großmutter sie so nicht sehen kann. Wie der Atem zu Schwaden gefriert um die vermummten Köpfe. Wie ihre Beinchen ausholen, als gälte es noch in dieser Nacht das Basislager des K2 zu erreichen. Aber die lange Fahrt von Fulda hat Mutter heuer nicht mehr in Kauf nehmen wollen, und er als Arzt hätte es auch gar nicht zugelassen. Nicht nach dieser Apoplexia Minoris, dem Schlägle, das sie Anfang Oktober gestreift hatte, wie es hierzulande beschönigend heißt. Zu groß die Belastung einer fast siebenstündigen Zugfahrt, mit zweimaligem Umsteigen. Das war selbst für die fitte ältere Dame, als welche man sie bis letzten Sommer noch mit Fug und Recht bezeichnen konnte, kein Honiglecken gewesen. Heuer kam das nicht mehr in Frage. Und Anna hat auch nichts dagegen gehabt, sich einmal nicht unterm Christbaum die Ratschläge der Schwiegermutter anhören zu müssen.
Ach Anna! Bereitet lieber das Weihnachtsessen vor und passt auf die Nachzüglerin im Laufstall auf, als hier in frostiger Winternacht herumzustapfen. Ist schließlich euer Ritual, Männer, hat sie lächelnd gemeint, während sie ihre Söhne zärtlich in die Wangen kniff.
Peter, der Neunjährige, führt stolz die kleine Gruppe an. Seit Tagen hatte er sich das gewünscht.
„Gell, Papa, wenn’s Schnee hat, darf ich spuren?“
„Klar, Peter.“
Lukas hat sich nach anfänglichem Schmollen damit abgefunden: Der Ältere hat nun einmal gewisse Vorrechte. Schlau, wer das rechtzeitig begreift. Schließlich will man sich in ein, zwei Jahren selbst darauf berufen können, gegenüber der kleinen Schwester. Und dann ist da ja auch noch der runde Bolla, den seine Zunge genüsslich hin und her rollt. Das Rahmzuckerl, das ihm das Schicksal des Zweitgeborenen versüßt.
„Haltet euch mehr rechts! Ein falscher Schritt und – ihr wisst schon …“
Sofort reagieren die beiden. Sie sind es gewohnt zu gehorchen. Rosskopf lächelt zufrieden. Das darf er sich an die eigene Brust heften, ausschließlich. Disziplin. Kontrolle. Darauf versteht er sich wie selten einer. Keine Kunst gegenüber Frau und Kindern, klar; aber auch auf der Abteilung hat er sich in der internen Hackordnung längst über manch älterem Kollegen etabliert. Wenn du weißt, dass du Autorität ausstrahlst, kannst du sie auch gezielt einsetzen, im eigenen wie im höheren Interesse. Daran vermag auch das Handicap, mit einem äußerst jugendlichen Aussehen ausgestattet zu sein, nichts zu ändern. Babyface – das war mehr als ein Spitzname: eine Demütigung! Aber er hat früh erkannt, dass es die geistig Minderbemittelten sind, die solche Hänseleien im Halfter führen müssen, inner- und außerhalb der Schule. Als die Haare auf dem Kinn zu sprießen begannen, stellte sich die Frage, ob er sich einen Bart zulegen sollte, schon nicht mehr. Nur um damit älter zu wirken, erfahrener? Nein. Durch seinen Bartverzicht demonstrierte er, dass man sich nicht hinter einer Maske zu verstecken braucht, um als ebenbürtig akzeptiert zu werden. Locker hat er diese Stufe übersprungen. Ebenbürtigkeit ist eine Quantité négligeable für einen, der sich als überlegen empfindet und es den anderen zeigen will. Und wie er es ihnen gezeigt hat! Keiner würde heute mehr Babyface zu ihm, dem anerkannten Kardiologen, sagen – keiner! Obwohl die Diskrepanz zwischen seiner faltenlosen Stirn und seinem Alter von knapp vierzig heute auffälliger ist denn je. Aber wissenschaftliche Würdigungen und die tägliche Routine im OP haben sein Gesicht sakrosankt gemacht, so wie der weiße Visitenmantel den Rest des Körpers. Das Tuscheln hinter seinem Rücken, es hat heute eine ganz andere Bedeutung: Ein fescher Kerl, unser Dr. Rosskopf! Wie der sich trotz des harten Chirurgenjobs sein jugendliches Aussehen bewahren konnte … Alle Achtung!
„Schau, Papa!“
Peter deutet auf den Stamm einer riesigen Buche. Auf den Tag genau vor acht Jahren hat Armin Rosskopf mit dem Taschenmesser ein A und ein P in die Rinde geritzt, zwei Jahre später ist ein L dazugekommen. Die Initialen ihrer Vornamen sind im Verlauf der Jahre verwittert, aber immer noch gut zu lesen.
„Nächstes Jahr werden wir die Susi vielleicht schon mitnehmen können, Jungs.“
„Dann ritze ich ein S für sie ein“, sagt Peter.
„Nein, ich!“, quengelt Lukas.
Eine energische Geste beendet den aufkommenden Streit im Ansatz. „Wir müssen weiter, also vorwärts, Peter! Oder bist du schon müde? Soll vielleicht dein Bruder spuren?“
„Pah!“
Der Pfad wirkt in der einbrechenden Dunkelheit viel steiler als im Tageslicht. Vom Westen her leuchten die Lichter von Göfis herauf, und ganz hinten, am oberen Ortsrand, funkelt ein kleines Dreieck: die elektrischen Kerzen auf der großen Blautanne vor ihrem Haus. Kitschig, vielleicht, denkt Rosskopf; aber was hätte er als Junge darum gegeben, daheim in Fulda einen solchen Zauberbaum auf eigenem Grund und Boden bestaunen zu können.
„Dürfen wir jetzt die Taschenlampen anmachen?“
„Wartet noch ein bisschen damit. Wenn sich die Augen erst einmal an das künstliche Licht gewöhnt haben, kommt man sich ohne Lampe wie blind vor. Und außerdem …“ – Dr. Rosskopf klingt jetzt wie der Weihnachtsmann höchstpersönlich – „außerdem ist es so doch viel geheimnisvoller, nicht?“
Die Buben nicken eher brav als überzeugt. Ein lautes Knacken im Unterholz lässt sie zusammenfahren.
„Keine Angst. Das ist wahrscheinlich … ja, da, seht nur, Rehe!“
Drei, vier große Schatten huschen keine zehn Meter an ihnen vorüber. Das letzte Tier hält kurz inne, glotzt, schnuppert in ihre Richtung, dann springt es den anderen hinterdrein.
„Wow!“, ruft Lukas begeistert, „hast du gesehen Papa – ein Hirsch!“
„Ein Rehbock“, korrigiert ihn Rosskopf, „Hirsche sind viel größer, das weißt du doch aus dem Wildpark.“
„Aber das letzte war ja viel größer als die anderen“, beharrt der Kleine, „und es hatte ein Geweih!“
„Dummkopf, Rehböcke haben doch auch ein Geweih!“, belehrt ihn Peter und erntet dafür einen anerkennenden Blick des Vaters.
Lukas bleibt stur. „Und es war doch ein Hirsch!“
„War es nicht.“
„War es doch!“
Wenn Rosskopf etwas hasst, sind es Zankereien wie diese. Sie erzeugen in ihm ein Gefühl der Ohnmacht, die Ohnmacht des Wissenden gegenüber der unbelehrbaren Ignoranz. Aber sie sind doch noch Kinder, hört er Anna sagen, Anna, die alles Entschuldigende, Anna, die alles Verzeihende. Selbst seinen Seitensprung mit Lore hat sie ihm verziehen in ihrer unendlichen Großmut, mit der sie sich ihm entzieht, mit der sie ihn, den Erfolgsverwöhnten und zweifellos Intelligenteren, zu bestrafen weiß. Ja, er wünschte, sie wäre weniger großmütig, weniger rücksichtsvoll, weniger verwaschen. Auch wenn diese ihre Haltung, zugegeben, dazu beiträgt, Konflikte zu vermeiden – er würde dennoch die Klarheit, die Geradlinigkeit, wie seine Mutter sie besitzt, vorziehen. Die die Dinge immer beim Namen nennt. Ihr messerscharfer, analytischer Verstand. Auf Biegen und Brechen. Nicht auf Dehnen und Beugen …
Peter bittet den Vater, austreten zu dürfen, und verschwindet hinter einem Baum. Minuten vergehen.
„Hast du eine Blasenentzündung, oder was?“, ruft Rosskopf ungeduldig.
„Bin schon fertig, Papa!“
Lukas glaubt etwas Bläuliches in der Rechten des Bruders zu sehen, doch der versenkt gleich beide Hände in den Jackentaschen. Sie gehen schweigend weiter. Der Mond breitet einen dünnen Silberteppich über den Weg, der sich ein letztes Mal gabelt. Sie wissen: Das Ziel ihrer Wanderung ist beinahe erreicht. Ein kurzer steiler Anstieg noch, und sie stehen vor den Resten der winzigen Ruine, die ihrem Namen kaum gerecht wird: die Heidenburg.
Eine Burg flößt für gewöhnlich Respekt ein. Nicht so dieses Relikt aus der Römerzeit. Die moosbesetzten, annähernd quadratisch angeordneten Steinmauern bringen es auf keine sechs Meter Seitenlänge und erreichen nur im nordöstlichen Winkel knapp Mannshöhe. Gäbe es nicht die kleine blecherne Hinweistafel, angebracht vom regionalen Tourismusverband, kein Mensch käme auf die Idee, es handle sich hier um einen geschichtsträchtigen Ort, dem schon manch wissenschaftlicher Artikel gewidmet wurde. Historische Aufsätze, die Rosskopf selbstverständlich studiert hat. Der Fund einer römischen Reiterstatuette auf der Heidenburg, Alemannia Studens 11 etwa. Ein Dr. Rosskopf pflegt sich auf seine Touren vorzubereiten, und seien sie noch so klein. Erst recht, wenn sich diese Wanderung an jedem Heiligen Abend wiederholt, wenn sie fixer Bestandteil des weihnachtlichen Rituals geworden ist.
„Geschafft“, sagt Lukas mit einem nachdrücklichen Seufzen, das untermauern soll, welch heroische Leistung er vollbracht hat.
„Ja, Jungs, toll seid ihr gelaufen, alle Achtung! Dafür wird uns der Braten doppelt so gut schmecken.“
„Doppelt so gut wie wem?“
„Na, wie all den Stubenhockern dort drüben,“ – Rosskopf deutet hinüber zum Lichtergefunkel des Dorfes – „die nur darauf lauern, sich endlich auf die Berge von Geschenken stürzen zu können. Aber wir, wir gehen lieber auf die richtigen Berge, was, Jungs?“
Eifrig nicken die beiden, auch wenn sie der väterlichen Vorgabe, dass pro Person maximal drei Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen dürfen, nicht wirklich etwas abzugewinnen wissen. Wem soll man auch damit imponieren? Der erntet höchstens ein mitleidiges Lächeln, der nachzubeten versucht, was das Oberhaupt der Familie als Parole ausgegeben hat: dass Weihnachten nicht das Fest des Überflusses und der Völlerei, sondern das der Besinnung und Bescheidenheit sei. Dass das Jesuskind schließlich auch mit Stroh und Stallgeruch Vorlieb nehmen musste, angebetet von zerlumpten Hirten. Und wenn die Rede auf die Gaben der Weisen aus dem Morgenland kommt, versteht Rosskopf es, Weihrauch und Myrrhe hervorzukehren, denn das mit dem Gold sei höchstwahrscheinlich nur ein Übersetzungsfehler. Den Altgriechischkenntnissen und der Bibelkundigkeit ihres protestantischen Mannes hat auch die Mutter, die so viel mildere, so viel großzügigere (sentimental, hoffnungslos sentimental nennt er sie) nichts entgegenzusetzen. Immerhin: Mit einer Nachtwanderung zur Heidenburg können andere Kinder nicht aufwarten. Die gibt es nur in ihrer Familie. Das entschädigt schon für manch enge Auslegung der Heiligen Schrift.
Sie trinken vom heißen Kamillentee aus der Thermosflasche, die der Vater ihnen reicht. Sich hinzusetzen verbieten Kälte und Schnee, aber da sie endlich die Erlaubnis erhalten haben, ihre Taschenlampen einzuschalten, erkunden Peter und Lukas sowieso lieber das Gelände. Wer hier wohl einmal gewohnt hat? Die Römer, wie Papa meint? Aber wieso heißt es dann Heidenburg und nicht Römerburg? Und was sind überhaupt Heiden?
„Heiden, das sind Menschen, die nicht an Gott glauben, die den wahren Gott nicht kennen.“
„Gibt es auch einen … einen unwahren Gott?“
„Ja, Peter, es gibt viele falsche Götter, viel zu viele. Alkohol, Drogen, Geld … Götzen nennt man die, und viele Menschen richten sich mehr nach ihnen als nach dem lieben Gott.“
Lukas stochert mit seinem Wanderstock im hintersten Winkel der Ruine herum. Er ist stolz auf dieses Stück Haselholz, in das der Vater Girlanden und kleine Blumenmuster geschnitzt hat. Keiner außer ihm besitzt so einen rundum verzierten Stecken, auch Peter nicht. Am Ende einer jeden Wanderung fügt der Vater mit dem Taschenmesser ein Muster hinzu. Lukas darf sich immer aussuchen, was der Vater schnitzen soll. Heute wird er sich den Kopf eines Tieres wünschen. Papa kann alles schnitzen, was man ihm ansagt. Sogar einen Wolf. Ja, heute wird er sich den Kopf eines Wolfes wünschen. Direkt am Griffende. Den kann er sich dann immer anschauen, wenn sie unterwegs sind. Und wenn er einmal müde ist vom Wandern, wird der Wolf ihm neue Kraft geben.
„Also, Jungs? Dann wollen wir mal. Heim zu Mama und Susi.“
„Warte noch, Papa.“ Lukas ist fündig geworden. Die Stockspitze ist auf etwas gestoßen, das zu weich ist für Stein und zu hart für Moos. Lukas richtet den Strahl der Stablampe auf den großen Klumpen zu seinen Füßen. Die schwarzen Löcher im Schnee erinnern ihn an ein Märchen, an welches nur? Sind es die dunklen Tränen einer Prinzessin, die ihrem Prinzen nachweint? Oder die Spuren eines alten grauen Wolfes, der sie gerade aus seinem Versteck heraus beobachtet?
„Tritt zurück“, hört er die Stimme hinter sich rufen, und lauter: „Weg da, Lukas!“
Wieso?, will Lukas protestieren, das ist meine Entdeckung, meine Beute! Doch er wagt keinen Mucks. Zu eindringlich klangen die Worte des Vaters, der sich nun über den Klumpen beugt und mit bloßen Händen den Schnee wegschiebt. Sein breiter Rücken verdeckt Lukas die Sicht. Der Junge beugt den Kopf weit zur Seite. Außer ein paar Fetzen und Bändern lässt sich nichts erkennen. Peter oben auf den Resten der Mauer hat da sicher einen besseren Blick. Wie ungerecht! Er hat schließlich den Fund gemacht, nicht der große Bruder, der wie versteinert herunterstiert, die Hände tief in den Jackentaschen. Als Lukas ihn anleuchtet, scheint er zu erwachen. Fast wäre er heruntergestürzt auf den Vater und den Fetzenhaufen unter ihm, aber er kann sich wieder fangen und geht schlotternd in die Hocke. Der Mond steht hoch über ihnen, und gruselige Schatten ziehen über Peters bleiches Gesicht.
„Was ist, Papa, was ist denn los?“
Endlich richtet der Vater sich wieder auf, wendet Lukas das Gesicht zu. Seine Augen glitzern im scharfen Strahl der Taschenlampe, ernster noch als üblich.
Und kein Schimmer von Weihnachten. Nicht der geringste …
„Das hier ist nichts für euch.“
Mit sanfter, aber bestimmter Hand wird Lukas hinausgeschoben aus dem steinigen Geviert. In dem Moment, als Rosskopf sich kurz nach Peter umdreht, sieht auch der Jüngere, was den Bruder hat erstarren lassen.
„Kommt, Jungs, wir müssen zurück. Beeilung!“
Keuchend hetzen sie bergab.
Wenn nur Papa nicht so schnell liefe!
Wenn nur die Batterie hält!
Das Licht nicht erlischt …
2. DER FREDI
Else
Mittwoch, 3. März ‘04
Was mein erster Eindruck war vom Fredi? Schrullig, würde ich sagen. Ein Kauz, ein Käuzchen. Wie aus einem fernen Zauberwald. Ungewohnt, das schon, aber nicht unangenehm. Ist sicher für beide Seiten kein Honiglecken, so ein Lehrerwechsel mitten im Schuljahr. Andererseits: Wer von der Klier eine Klasse erbt, hat automatisch einen Startvorteil.
Die Klier hat offenbar das einzige Mal, wo ihr Alter versehentlich über sie drübergekrochen ist, nicht aufgepasst. Das war schon am Anfang des Schuljahres deutlich zu sehen. Lächerlich, wie sie versucht hat, es mit ihren weiten, grauenhaft beigen Blusen zu kaschieren. Gleich nach den Weihnachtsferien hat sie sich dann in den Karenzurlaub vertschüsst. „Es tut mir ja so leid, euch mitten in der siebten Klasse im Stich lassen zu müssen!“ Mensch, waren wir froh, die fade Tante endlich los zu sein! Samt ihren bescheuerten Fremdwörtern! „Das erste Buch, das ich mir für mein Deutschstudium gekauft habe, war ein Fremdwörterlexikon …“ Darauf ist sie auch noch stolz gewesen! Und es ist ihr super gelungen, ihr Trauma an uns weiterzugeben. Die Liste mit den aktuellen Fremdwörtern und Synonymen mussten wir bereitliegen haben, sobald sie die Klasse betrat, um sie ja jederzeit ergänzen zu können. Zwecks besserer Strukturierung, größerer Eloquenz … Konnotation und Denotation, Diversifikation und Distribution … Sie checkte nicht, dass die deutsche Sprache für die meisten von uns schon Fremdsprache genug ist. Das sollte sich bei Fredi schnell ändern. Wie so ziemlich alles.
Unsere Klasse ist sich darin einig wie selten sonst: Der Fredi ist der lebende Beweis dafür, dass es einer trotz Hirn und Herz zum Lehrer bringen kann. Unser Fredi. Ein Ehrentitel! Tausendmal wertvoller als das Herr Professor vor dem Familiennamen! Anfangs haben wir uns ja gefragt, wie einer überhaupt Märker heißen kann, der sich nicht einmal bis zur nächsten Stunde merkt, was er in der vorigen vorgetragen hat. „Was haben wir da gleich durchgenommen? Helft mir bitte auf die Sprünge!“ Wir Naivlinge haben tatsächlich geglaubt, er sei schon ein bisschen senil oder einfach schlecht vorbereitet. Bis klar wurde, dass das pure Taktik ist: So kriegt er am schnellsten heraus, was wir überhaupt mitgekriegt haben. Und seine absurden Kommentare! Die reinsten Rätsel. Aber er will uns damit nur bluffen, reizen. Vielleicht sogar dazu bringen, dass wir ihm widersprechen. Um selber herauszufinden, was wichtig ist und was nicht. Was sagte er neulich, als wir den späten Minnesang durchnahmen? „Es gibt keine Kardinalsünden, die nicht zugleich Kardinaltugenden sein können. Und umgekehrt.“ Der Adrian, dessen rechte Hand immer an einem unsichtbaren Faden an der Decke angebunden ist, fragt ihn natürlich gleich, ob wir das notieren sollen. „Du schon“, kriegt er als Antwort, „ein Adrian muss alles aufschreiben, für den ist alles Lehrstoff.“
Aber was ist eigentlich der Stoff für den Fredi? Was ist der Stoff, aus dem seine Träume sind? Ist es der Stoff, den er sich nächtens gibt? Alkohol rührt er ja nicht an, behauptet jedenfalls Clemens, der ihn schon öfter im Dörflinger gesehen hat, immer vor einem Glas Schwarztee mit Milch. Aber ich möchte wetten, dass er heimlich Shit raucht – mindestens! Er hat richtig verträumte Augen, überhaupt keine Lehreraugen.
„Ich bin ledig und, soviel ich weiß, kinderlos.“ So hat er sich uns in der ersten Stunde vorgestellt. Und, wie er seither immer betont: „in keinem Verein eingeschrieben.“ Snezana meint, in seinem Kopf müsse es zugehen wie in einem Bienenstock mit mehreren Königinnen. Snezana hat immer die geilsten Metaphern parat. Auf seine Prüfungsfragen kann sich wirklich keiner vorbereiten, nicht einmal der Adrian. „Was hältst du von der Entwicklung des Begriffs der êre in der mittelalterlichen Literatur?“ Was willst du auf so was groß lernen? Im Prinzip kannst du durchgeackert haben, so viel du willst, kannst jedes verdammte höfische Epos lesen, oder zumindest jede Internetseite, die einem sonst bei der Prüfungs- und Referatsvorbereitung hilft – letztlich will der Fredi genau das nicht hören, was für seine Kollegen mehr als reicht. „Gut gebüffelt, Ochse!“, lautet noch sein wohlmeinendster Kommentar in solchen Fällen. Was ungefähr auf das Gleiche rausläuft wie sein „Selber denken macht fett. Geistig, meine ich. Leider tendieren die meisten, was das anlangt, eher zur Magersucht.“ Trotz solcher Sprüche kann man bei ihm problemlos ein Gut holen, schlechtestenfalls ein Befriedigend, was er auch schon mal geistesabwesend als Befriedigung einträgt. Aber ein Sehr gut, das hat bis heute noch keiner geschafft. Nicht gerade ein breites Notenspektrum.
Er hat übrigens nichts dagegen, von uns Fredi genannt zu werden. Vielleicht brüstet er sich damit sogar vor seinen Kollegen, das würde zu ihm passen. Autoritätsprobleme, das hat ein jeder von uns mittlerweile eingesehen, kriegt er deswegen keine. Seine Autorität ist wie von einer anderen Welt. Anredeunabhängig. Notenunabhängig.
Ich mag ihn jedenfalls. Auf meine Art lass ich es ihn auch merken. Merk’s, Märker, dass ich an deinen Lippen hänge. Ohne die Miene zu verziehen, ohne die Spur eines Lächelns, versteht sich. Das wäre definitiv zu penetrant, um die Klier zu zitieren. Nein: Allein, dass eine an seinen Lippen hängt, ist schon mehr, als ein vierzigjähriger Mittelschullehrer sich von einer Sechzehnjährigen erwarten darf. Definitiv mehr!
Aber am Dienstag hat er mich fast in Rage gebracht. Da ist er mit diesem alten Schinken hereingekommen, den ich schon letztes Jahr für mich gelesen habe. „Ein bisschen ein Kontrastprogramm“, hat er gesagt. Ein Kontrast zu den noch viel älteren Schinken aus der Zeit der Ritter und edlen Fräulein, mit denen er uns bisher beglückte, hat er wohl gemeint. „Wenn auch die Frage der Ehre in diesem Werk wieder eine wesentliche Rolle spielt.“ Da musste ich grinsen. Ganz leicht nur, aber er hat es sofort gecheckt. „Und wieso lächelt sie jetzt so maliziös?“, hat er in die Klasse hineingeflüstert. Nicht etwa, dass er die Frage an mich persönlich gerichtet hätte. Eine jede von uns hätte gemeint sein können – Sigrid, Diana, Snezana … Eine so gut oder so schlecht wie die andere, eine von neun weiblichen Nullen halt, durch ein und dasselbe dümmliche Gegrinse für ihn qualifiziert als – unqualifiziert. Aber welcher Lehrer rechnet schon mit einer ehrlichen Antwort auf die Frage, warum man in seinem Unterricht grinst? Keiner, wenn er nicht völlig bescheuert ist. Normalerweise machst du auf so eine Frage hin einfach weiter und sagst nichts. Mich hat es aber geärgert, dass er von mir in der dritten Person redet, und darum hab ich ganz gegen meine Gewohnheit laut herausgerufen: „Weil ich Jugend ohne Gott schon kenne. Und weil’s total uncool ist.“
Er schaut mich noch immer nicht an. Sein Blick schwebt wieder einmal im Niemandsland, dort oben zwischen Schülerscheiteln und Neonröhren, wo Lehrerblicke gerne hängen bleiben, was ich normalerweise sogar als angenehm empfinde, jedenfalls als bedeutend weniger nervig als die Blicke von Lolle Bilgeri, unserem Mathelehrer. Wie der dir auf den Nabel schaut, möchtest du meinen, er sei halb verhungert.
„So, ist es das? Und könntest du das vielleicht etwas näher erklären?“ Erst jetzt sieht er mir in die Augen.
Ich muss wohl mit der Schulter gezuckt haben, denn er hat nun seinerseits mit der seinen gezuckt. Mehrmals. Das ist noch so ein Tick von ihm: dass er einen imitiert. Ohne Worte, rein körpersprachlich. Wenn er zum Beispiel merkt, dass die Aufmerksamkeit eines Schülers abdriftet, spiegelt er das dem Betreffenden, genau so, wie ich es in den letzten Ferien vor dem Centre Pompidou erlebt habe: Ein stummer, weiß geschminkter Mime kopiert zum Gaudium des Publikums einen ahnungslosen Passanten so lange, bis das Opfer endlich kapiert, wer da die längste Zeit den Anlass geboten hat für die allgemeine Volksbelustigung. Die meisten der Imitierten lachen dann mit, andere reagieren sauer darauf oder werden rot. Ich gehöre eindeutig zu der zweiten Sorte.
„Ich finde das überhaupt nicht lustig!“, hab ich gesagt. Leider kam es verdammt unglücklich rüber, weil meine Stimme mitten im Satz gekippt ist, in so ein Gegickse, das mir selbst am meisten auf den Keks geht. Die Klasse hat sofort das Tuscheln eingestellt. Man kennt mich und weiß, dass ich lange brauche, um überzulaufen. Aber wenn, dann dafür gehörig.
„War auch nicht als Belustigung gedacht“, hat der Fredi gesagt. Für einige Sekunden hat er unschlüssig gewirkt, etwas, das man von ihm sonst nicht kennt. Wenn einer den Faden nicht verliert, selbst wenn er vom Hundertsten zum Tausendsten kommt – man verzeihe mir den kleinen Exkurs, heißt das bei ihm –, ist das der Fredi Märker. Aber gleich darauf war er wieder der Alte. „Ein Schulterzucken verdient als Antwort eben nur ein Schulterzucken.“ Was willst du darauf noch sagen?
„Verstaubt“, hab ich nachgelegt. „Dieser Horváth ist so was von verstaubt! Da können wir grad so gut noch eine zehnte Rittergeschichte durchnehmen.“
„Gar nicht übel!“, hat er gelacht. „Betrachten wir Jugend ohne Gott demnach als letztes höfisches Epos. Und du, Else, hast die Ehre, uns darüber ein aufschlussreiches Referat zu halten. Thema: Die Verstaubtheit des Ehrbegriffs bei Ödön von Horváth. Okay?“
Okay. Klar. Nach außen hin hab ich mich zwar weiterhin böse gegeben, aber eigentlich war ich nicht unzufrieden. Zum einen hatte ich ihm gezeigt, wo meine Grenzen sind. Zum anderen würde ich so ein billiges Referatthema kein zweites Mal aufreißen können. Ein schmales Büchlein, das ich eh schon kenne und zu dem es jede Menge gescheiter Kommentare gibt – eine aufgelegte Sache.
3. EINE INTERESSANTE LEICH
„Eine interessante Leich, zweifelsohne!“
Ein typischer Gfaderkommentar. So etwas wie der ultimative Superlativ aus dem Munde des Montafoners. Üblicherweise spricht er von einer toten Leich, oder von toter als tot. Das verheißt eine vom Standard immerhin abweichende Ermittlungstätigkeit. Aber eine wirklich interessante Leich, eine für einen Kriminaler echte Herausforderung, die fällt nicht oft an in der Abteilung.
Genau genommen liegt die letzte schon drei Jahre zurück. Hagens Einstandsgeschenk gewissermaßen. Sein erster Fall im Ländle, von dem er sich bis heute nicht richtig erholt hat. Weswegen er den Job hinschmeißen wollte, kaum dass er ihn begonnen hatte. Aber was hast du mit bald fünfzig Jahren für eine Perspektive? Leib Leben Gesundheit, oder – niente. Mit ein bisschen Protektion hat man es gerade noch zum Abteilungsleiter in der Bregenzer KA gebracht. Kurz, bevor die Politiker über Umstrukturierungen bei Gendarmerie und Polizei nachzudenken begannen. Was à la longue nichts anderes bedeuten wird, als früher das hübsche Wort Freisetzung und noch früher – weniger hübsch, aber ehrlicher – Entlassung ausgedrückt hat, Abbau unrentabler Arbeitsplätze. Und diesen sicheren Posten willst du hinschmeißen? Wegen einer klitzekleinen Depression, die eh in der Familie liegt, seit drei Jahren kombiniert mit einer posttraumatischen Störung, die an der Familie liegt? Und von wegen Umschulung, beruflicher Neuorientierung … Dass ich nicht lache! Bestenfalls ein Leben als Sandler steht in diesem Alter zur Debatte. So, wie es die interessante Leich, mit der Hagen es jetzt zu tun hat, geführt haben dürfte.
Denn dass es sich bei dem Toten vermutlich um einen langfristig Obdachlosen handelt, scheint laut vorläufiger gerichtsmedizinischer Erkenntnis nahezu gesichert. Der miserable Zustand der Zähne, die körperliche Verwahrlosung ganz allgemein, nicht zuletzt aufgrund eines offensichtlich andauernden Alkoholmissbrauchs, und Fingernägel, so lang wie bei einem Flamencospieler. Allerdings nicht annähernd so gepflegt.
„Wie alt war der Mann, hat der Gerichtsmediziner gesagt?“
„Um die sechzig. Könnten aber auch fünf bis zehn Jahre weniger sein. Solche verbrauchten Typen wirken oft beträchtlich älter, als sie tatsächlich sind.“
Verbraucht. Typen. In die unterste Schublade mit ihnen. Ins Massengrab, wo schon der Mozart auf sie wartet, oder der Woyzeck. Auch so ein interessanter Fall. Verbraucht, missbraucht, zu nichts mehr zu gebrauchen.
Und wer braucht dich noch, Hagen?
Die Mutter im Altersheim? Damit sie noch einer besuchen kommt, vierzehntägig wenigstens, eine halbe Stunde, dem Feierabend zähneknirschend abgezwackt? Oder dass wer die Stiefmütterchen gießt, die sie auf das Grab von Vater und Hartmut gepflanzt hat? Stiefmütterchen, ausgerechnet! Die Blumensorte, die der Alte partout nicht ausstehen hat können. Für ihn der Ausbund an Spießbürgerlichkeit. Wenn du mir das Kraut im Garten einsetzt, zieh ich aus! Er brauchte nicht auszuziehen. Zu seinen Lebzeiten hat sie seine Stiefmütterchenallergie gefressen, wie alle seine Wunderlichkeiten. Aber gleich nach seinem letzten Schnaufer hat er nichts mehr zu bestimmen gehabt. Nicht einmal, welches Kraut er sich nun eine Ewigkeit lang von unten anschauen darf.
Was sie natürlich nie zugeben würde. Sie sagt: Wir nehmen Stiefmütterchen, weil Stiefmütterchen sind pflegeleicht und halten sich lang. Und grad die violetten passen so gut auf ein Grab …
Ach, vergiss es, Hagen! Vergiss Mütter und Stiefmütterchen. Wo er Recht hat, hat er Recht, der Gfader: Interessant ist sie, unsere Leich, hochinteressant sogar. Der brave Mitbürger, der seine Ex mit einer Pumpgun niedermacht … Die Frau, die ihren Alten im Schlaf mit seiner Angelschnur erdrosselt … Alles Schema F, alles x-fach gehabt. Aber knapp zwei Meter Paketklebeband um Kopf und Hals herumgewickelt, und dann dieser Fundort! Das bringt die grauen Zellen auf Trab. Du musst auch die schönen Seiten deines Berufs sehen. Die Herausforderung. Das Kribbeln im Bauch, wenn einmal was Unvorhergesehenes passiert, was Unprovinzielles. Etwas, worum sie dich sogar in der Großstadt beneiden. Auch wenn wir dafür jetzt das ganze Weihnachtswochenende zusammenhocken dürfen. Grad darum! Das Fest der Familie … Du bist ja heilfroh, wenn dich was ablenkt davon. I got it bad and that ain’t good. Das kannst du dir zu Hause noch oft genug anhören, wenn die Erinnerungen dich wieder nicht einschlafen lassen.
„Du hast ja ziemlich lang mit diesem Dr. Rosskopf geredet. Ist ihm was Spezielles aufgefallen am Fundort? Irgendwelche Spuren zum Beispiel, bevor er und seine Buben da oben alles zertrampelt haben?“
„Ach ja, der Herr Doktor“, stöhnt Gfader, „der hat vielleicht den Fachmann hervorgekehrt! Hat darauf beharrt, dass er an der Lage der Leiche nichts verändert hat. Abgesehen davon, dass er sie zuerst mit bloßen Händen vom Schnee befreien musste. Und nachdem auch der Hals komplett verpackt war, du weißt schon, womit, hat er halt versucht, den Puls am Handgelenk zu nehmen. Aber auch die Hand habe er selbstverständlich wieder in die ursprüngliche Position zurückgelegt. Wie gesagt, ein Fachmann, der Herr Kardiologe.“
Sie betrachten gemeinsam die Fotos der Spurensicherung. Auf der roten Thermosflasche keinen Meter neben der Leiche glänzt sternförmig die Reflexion des Blitzlichts.
„Ich bin gespannt, was sie da drin finden. Es war ja noch ein Rest in der Flasche, oder?“
„Ja. Und wenn mich mein Riechkolben nicht vollkommen getäuscht hat, würd ich sagen: ein billiger Obstler. Meilenweit entfernt von allem, was unsereins gewöhnt ist.“
Bei Schnäpsen ist der Montafoner eine Kapazität, zweifellos, eine wahre Koryphäe. Vorigen Herbst konnte Hagen sich selbst davon überzeugen, als Gfader ihn und Winder erstmals zu sich in sein Schrunser Domizil eingeladen hat. Im ausgebauten Keller haben sie ein ganzes Arsenal von Selbstgebranntem verkostet. Natürlich alles schwarz. Da hätte eine gewisse Abteilung bei den Finanzern ihre wahre Freude daran gehabt. Frage nicht, wie man damals heil nach Hause gekommen ist, und ohne einem Kollegen von der Streife in die Arme zu laufen! Das hätte der Major sicher gerne in der Personalakte vermerkt: Chefinspektor Hagen mit über zwei Promille im Blut angehalten …
„Und was folgern wir daraus?“
Gfader zwirbelt an seinem Schnurrbart herum.
„Du meinst, es könnte ihm einer eingeflößt haben? Nachdem der Alte k. o. gegangen ist? Die Kampfspuren an seinem Oberkörper waren ja unübersehbar, dafür hätte es keinen gerichtsmedizinischen Befund gebraucht.“
„Denkunmöglich wäre das zumindest nicht, oder?“
Nein, denkunmöglich ist kaum einmal was bei so einem interessanten Fall. Übrigens auch nicht bei den uninteressanten. Wie oft haben vorschnelle Schlüsse einen schon in die Irre geführt.
„Wir sollten vorläufig noch vorsichtig sein mit Hypothesen. Denk daran, was John Mayall über Jimi Hendrix gesungen hat.“
„Nämlich?“
„Drugs may bring you joy, but the danger is they destroy … Der Blues hieß Accidental Suicide, wenn ich mich richtig erinnere. Tja, momentan können wir Selbstmord auch nicht wirklich ausschließen.“
„Also bitte! Da muss doch einer kräftig nachgeholfen haben. Wer verklebt sich alleine die Atemwege mit zwei Meter Industrieklebeband? Vier Umwicklungen! Das dauert seine Zeit. Da bist du längst erstickt, bevor du damit fertig bist!“
„Kommt wohl darauf an, wie lange du die Luft anhalten kannst. Fesselungsspuren an Armen und Beinen waren auf jeden Fall keine feststellbar. Und wie die Leiche dagelegen ist – hin-gekuschelt quasi, geradezu friedlich. Wir werden ja sehen, ob die gerichtsmedizinischen Untersuchungen noch was Neues ergeben. Aber es würde mich nicht wundern, wenn die genaue Todesursache infolge der Verwesung der Leiche gar nicht mehr feststellbar ist. Wie auch immer“, Hagen erhebt sich und macht ein paar Dehnungsübungen, „wir ermitteln vorderhand in alle Richtungen, wie es so schön heißt.“
„Okay. Und ich bin sicher, dass wir über den Gebissabdruck schnell herausfinden werden, mit wem wir es zu tun haben.“
„Hoffen wir’s. Und vielleicht bringt ja auch das Absuchen des Geländes was ans Tageslicht. Die Burschen sind wohl noch immer dran, oder?“
„Sind sie. Ich hab grad erst mit ihnen telefoniert. Nichts Neues. Keine Schleifspuren, kein Blut in der Umgebung. Und keine Spur von der Klebebandrolle.“
„In dem Fall: Kaffeepause!“
Sie halten sich eh schon viel zu lange an den Spruch, den sie auf dem zerschlissenen T-Shirt der Leiche gelesen haben: Tua eppas! Das braucht man ihnen, die nun schon seit über zwölf Stunden auf den Beinen sind, wirklich nicht als Motto unter die Nase zu reiben. Zuerst droben auf der Heidenburg bei der Spurensicherung, dann unten in der Pathologie bei der Leichenöffnung. Fürwahr: eine stille, eine heilige Nacht!
4. DAS DOPPELPACK
Alles neu macht der Mai. Die Natur erwacht, die Bäume schlagen aus … Ein Schmäh, wie das meiste. Gar nichts neu macht der Mai! Die Bäum schlagen nicht aus, und die roten Bonzen tragen rote Nelken am Revers, wie jedes Jahr. Es gehen eh nur mehr Politiker hin zu die Aufmärsche. Während das arbeitende Volk sich seinen Rausch ausschlaft.
Und was macht das fahrende Volk am Tag der Arbeit? Es hockt sich in den nächsten Intercity und wartet. Auf den erstbesten Schaffner wartet es, dass ein bisserl eine Abwechslung kommt in das Leben.
„’n Abend. Fahrscheinkontrolle.“
Guten Morgen, guten Abend! Fahrscheinkontrolle! Bitte sehr, danke sehr. Wünsche eine schöne Weiterfahrt, die Herrschaften. Na, blöd tät ich mir vorkommen, wenn ich das ein paar hundert Mal sagen müsst am Tag. Schön deppert, wenn ich so einen Job hätt. Wenn ich überhaupt einen Job hätt.
„Kann ich Ihre Fahrkarte sehen?“
Ihre Fahrkarte! Schaun wir mal, wie lang der mit uns per Sie ist, Kurtl. Aber lass mich nur machen, das Reden ist eh deine Sach nicht.
„Einen Augenblick. Bin ja schon am Suchen.“
Wann hast du das letzte Mal eine Fahrkarte vorgezeigt, Kurtl? Also ich vor fünfzehn, zwanzig Jahren vielleicht. Oder auch ein bisserl mehr, spielt eh keine Rolle nicht. Auf so einer Schmalspurbahn war’s, glaub ich, droben im oberen Waldviertel, wo ich die Enzi öfters besucht hab. Aber die gibt’s eh nimmer. Die Bahn nicht und die Enzi erst recht nicht.
„Alsdann? Ich hab nicht ewig Zeit!“
Zeit, mein Gott: Zeit! Was rennt einem Schaffner davon? Wenn einer im Zug zu Haus ist, kann er nie zu spät kommen. Die Fahrgäst, ja. Die könnten einen Anschluss verpassen, einen Geschäftsabschluss oder zumindest ein Techtelmechtel. Aber einem Schaffner kann das wurscht sein. Komplett Powidl. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist. Was kümmert’s den Haifisch, wenn am Himalaja einer abstürzt! Eben. Der Zug, das ist deine Welt, und sonst gar nichts. Siehst, das haben wir Sandler mit den Schaffnern gemeinsam: Können uns gratis die Welt anschauen. Pardon, nicht Schaffner! Zugführer wollen sie ja neuerdings gerufen werden. Als ob’s deswegen mehr anzuschaffen hätten. Aber von mir aus.
„Ich fürcht, es gibt da ein Problem, Herr Zugführer.“
„Ah so! Kann mir gut vorstellen, was für eins. Bei eurem Aufzug!“
Schau, so schnell geht das, Kurtl! Schon sind wir per Du. Na ja, macht eh alles viel einfacher, net wahr?
„So eine fesche Uniform wie die deine kann sich unsereins freilich nicht leisten.“
„Also bitte! Keine Fahrkarte, und dann auch noch goschert! Jetzt schaut’s, dass ihr weiterkommt’s, aber dalli!“
„Wohin, bitte? In die erste Klass?“
„Pass auf, Bursche! Frotzeln muss ich mich von dir nicht lassen, nicht von dir!“
Stimmt, das ist nicht fair. Weil so ein Zugführer hat kein angenehmes Leben nicht. Muss sich eh schon den ganzen lieben Tag lang die Nörgeleien von die zahlenden Fahrgäst anhören: Könnten’S die Klimaanlage nicht etwas höher einstellen, da herinnen hat’s ja eine Affenhitz! Könnten’S die Klimaanlage nicht ausschalten, ’s zieht ja wie in einem Vogelkäfig! Und wieso stehn wir jetzt schon eine Viertelstunde herum, auf offener Strecke? Was, ein technisches Gebrechen? Und dafür will die ÖBB jede Woche zehn Prozent mehr! Aber so ein braver Zugführer kann ja den Raunzern nicht auf die Nase binden, dass sich halt wieder einer vor die Lok geschmissen hat. Zerstückelte Selbstmörder – das käm nicht gut an bei die Reisenden. Nein, frotzeln musst so einen armen Hund nicht. Wo er dich nicht einmal rausschmeißen kann, wenn er dich erwischt ohne Ticket. Weil dafür fahren sogar die österreichischen Züge zu schnell. Und wenn beim nächsten Bahnhof dann wirklich einmal die Polypen auf dich warten: ’s weiß doch eh ein jeder, dass du in spätestens zwei Stunden wieder mit von der Partie bist. Dem Taktfahrplan sei Dank! Drum: Das Theater mit der Polizei und so – steht doch gar nicht dafür, Herr Zugführer, also wirklich …
„Wie heißt’s ihr zwei überhaupt?“
„Ich bin der Pauli. Und das ist der Kurtl.“
„Familiennamen haben wir keine?“
„Sicher. Aber was hast davon, wenn wir dir die nennen? Wer red’t einen Sandler schon mit dem Familiennamen an?“