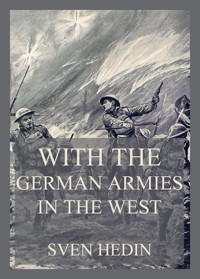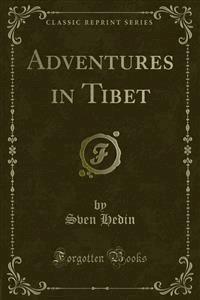Durch Amerika zum Südpol – Band 252 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski E-Book
Sven Hedin
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
Der schwedische Autor, Geograph, Topograph, Entdeckungsreisender, Fotograf, Reiseschriftsteller und der Illustrator der eigenen Werke, Sven Hedin erzählt in diesem Buch umfangreich im Detail über unseren Planeten Erde, den Mond und das Weltall, über die Entwicklung des Menschen, die Verhältnisse in Afrika und vor allem in Amerika. Der ganze amerikanische Kontinent von Pol zu Pol und seine Geschichte von der Entdeckung des Kontinents durch die Vikinger und Christoph Kolumbus bis ins zwanzigste Jahrhundert werden ausführlich behandelt. Mit vielen Bildern und Zusatzinformationen wird dieses Buch neu herausgegeben. – Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sven Hedin
Durch Amerika zum Südpol – Band 252 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski
Band 252 in der gelben Buchreihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Der Autor Sven Hedin
Sven Hedin: Von Pol zu Pol – Durch Amerika zum Südpol
Im Reich der Zwerge
Timbuktu
Die Sahara
Im Bann des Atlas
Christoph Kolumbus
Die Entdeckung Amerikas
Dank der Heimat
Auswanderer
Im Zwischendeck
New York
Ein nordamerikanisches Märchen
Pittsburg
Der Mississippi
Chicago
Kanada und die Großen Seen
Der Niagara
Indianer
Das Felsengebirge
Der Grislibär
Jaguar und Puma
Die Cañons des Colorado-Flusses
Abraham Lincoln
„MERRIMAC“ und „MONITOR“
Der Alexander der neuen Welt
Cortez auf dem Weg nach Mexiko
Der König der Azteken
Menschenopfer in Mexiko
Montezumas Gefangennahme und Tod
„Die traurige Nacht“
Die Zerstörung Mexikos
Kaiser Maximilian von Mexiko
Das Trauerspiel von Queretaro
Die Landenge von Panama
Das Inkareich
Pizarro
Der Kondor
Die Fahrt des Orellana
Durch die Urwälder des Amazonenstromes
Alexander von Humboldt
Über die Llanos von Venezuela
Auf dem Orinoco
Unter den Indianern des Gran Chaco
Der Albatros
Walfänger
Die Robinson-Insel
Der Stille Ozean
Die Inseln der Südsee
Schiffbruch
Über Samoa nach Neuseeland
Zurück nach Kap Hoorn
Der Südpol
Shackleton
Im unendlichen Raum
Der Mann im Mond
Die Erde
Die ersten Menschen
Weltenende
Zu den ewigen Sternen
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.
Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.
2022 Jürgen Ruszkowski
Ruhestands-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Der Autor Sven Hedin
Der Autor Sven Hedin
https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/hedin.html
Sven Anders Hedin wurde am 19. Februar 1865 in Stockholm geboren und starb am 26. November 1952 ebendort. Er war ein schwedischer Geograf, Topograf, Entdeckungsreisender, Fotograf, Reiseschriftsteller und der Illustrator der eigenen Werke.
In vier Expeditionen nach Zentralasien entdeckte er den Transhimalaya (nach ihm Hedin-Gebirge genannt), die Quellen der Flüsse Brahmaputra, Indus und Sutlej, den See Lop Nor sowie Überreste von Städten, Grabanlagen und der Chinesischen Mauer in den Wüsten des Tarimbeckens. Den Abschluss seines Lebenswerkes bildete die postume Veröffentlichung seines Central Asia Atlas.
* * *
Sven Hedin: Von Pol zu Pol – Durch Amerika zum Südpol
Sven Hedin: Von Pol zu Pol – Durch Amerika zum Südpol
https://www.projekt-gutenberg.org/hedin/ppamerik/ppamerik.html
Erstmals 1913 in Leipzig erschienen
* * *
Im Reich der Zwerge
Im Reich der Zwerge
https://www.projekt-gutenberg.org/hedin/ppamerik/chap001.html
Die „alte Welt“ umfasst die drei Erdteile, durch die, von einem flüchtigen Ausblick auf Australien abgesehen, unsre bisherigen gemeinsamen Reisen „Von Pol zu Pol“ geführt haben. Soweit der Scharfsinn unsrer Forscher die Nacht der Jahrtausende zu durchdringen vermag, gehörten Europa, Asien und Afrika, wenn auch in sehr unvollständigen und verschwommenen Umrissen, zum Bild der östlichen Halbkugel, die bis vor vier Jahrhunderten der ausschließliche Schauplatz alles dessen war, was Geschichte hieß. Erst die Entdeckung Amerikas verdoppelte mit einem Schlag das Reich der Erdbewohner, zauberte die westliche Hälfte des Erdballs aus dem Nichts, aus einem wolkenbedeckten Chaos hervor und eröffnete der Wirksamkeit des Kulturmenschen der alten Welt unermessliche Weiten.
Ehe wir aber mit Kolumbus der „neuen Welt“ zusteuern, folgt mir noch einmal in den schwarzen Weltteil, dessen nordwestliche Ausbuchtung gleichsam ein Sprungbrett über das große Wasser hinüber darstellt! Durch die Nähe Europas ist die Entdeckungsgeschichte Afrikas zu reich, sein Kulturzustand zu vielseitig und eigenartig, um nicht wenigstens mit einigen charakteristischen Bildern, deren gleichen auch das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ nicht aufzuweisen hat, von ihm Abschied zu nehmen. –
Von guten und bösen Zwergen erzählen die Märchen aller Völker und Zeiten, und die Kunde von dem Vorhandensein eines Menschenschlags von unnatürlich kleinem Wuchs hat ihre Wurzeln in vorhistorischen Jahrhunderten. Schon der Dichter der Ilias fabelt von den Kranichen, die „fliehend der Winterkälte und Regen unter Krächzen und Schreien den ozeanischen Strömen zueilen, um den Faustmännchen (Pygmäen) Tod und Verderben zu bringen“. Fünf kecke Jünglinge der Nasamoner, weiß der alte Herodot zu berichten, hätten sich eines Tages aufgemacht, von ihrer Heimat Libyen aus immer nach Sonnenaufgang zu wandern, „weiter, als man je zuvor gekommen“.
Herodot
Zuerst zogen sie durch bewohnte Gegenden, dann durch das Land der wilden Tiere, und darauf kamen sie an eine große Sandwüste, zu deren Durchwanderung sie viele Tage brauchten. Endlich sahen sie wieder einmal Bäume, die wuchsen auf dem Feld. „Und sie gingen hin und pflückten von den Früchten, die auf den Bäumen waren, und wie sie pflückten, kamen herbei kleine Männer, noch unter Mittelgröße, und griffen sie und führten sie von dannen; aber sie verstanden einander kein Wort, weder die Nasamoner (war ein Volksstamm im antiken Nordafrika) von ihnen, noch sie von den Nasamonern. Und sie führten sie durch große Sümpfe, und wie sie durch dieselben hindurch waren, kamen sie in eine Stadt, da waren alle Leute ebenso klein wie die Führer und schwarz von Farbe. Und bei der Stadt floss ein großer Strom, und floss vom Abend nach Sonnenaufgang, und waren Krokodile in demselben zu sehen.“
Unter diesem Strom vermutete Herodot nichts anderes als den Nil, den auch Homer unter den „Ozeanischen Strömen“ versteht; denn damals glaubte man noch, der Nil entströme dem Ozean, der Afrika umfließe. Und dass die Kraniche im Winter nach Afrika hinüberflogen, wusste man damals so gut wie heute.
Herodot berichtet durchaus vom Hörensagen. Hundert Jahre später aber scheint die Afrikaforschung der Alten schon einige Fortschritte gemacht zu haben.
Der Weise von Stagyra, Aristoteles, verzeichnet es als eine feststehende Tatsache, dass an den Quellen des Nils, dem Winteraufenthalt der Kraniche, die Pygmäen wohnen, und zwar sei das „keine Fabel, sondern die reine Wahrheit“.
Aristoteles
Wie recht hat die primitive Kenntnis der Vorzeit behalten! Die weite Quellengegend des Nils ist in der Tat die Heimat von Volksstämmen, die den Namen Pygmäen oder Zwergvölker durchaus verdienen. Aber erst der modernen Afrikaforschung war es vorbehalten, die Zeugnisse der griechischen Historiker auf ihren richtigen Kern hin zu prüfen.
Ein wenig anders zwar sehen die afrikanischen Kobolde aus, als das Zwergvölkchen der Sagen und Märchen Europas. Und doch wieder welch nahe Verwandtschaft mit der dichtenden Phantasie weit entlegener Zonen!
Georg Schweinfurth, * 7. Dezember jul. / 29. Dezember 1836 greg. in Riga, Gouvernement Livland, Russisches Kaiserreich – † 19. September 1925 in Berlin, war ein russisch-baltendeutscher Afrikaforscher.
(Siehe Band 151 in dieser gelben Buchreihe!)
Der deutsche Reisende Georg Schweinfurth, der sich um die Erforschung der oberen Nilländer und der nach dem Kongo sich senkenden Wasserscheide grundlegende Verdienste erworben und auch als Erster eines der afrikanischen Zwergvölker, das der Akka, wissenschaftlich beobachtet und geschildert hat, berichtet von seinen nubischen Begleitern, dass ihre Phantasie die Zwerge genau so sah wie nur irgendeine Großmutter an einem deutschen Kamin.
In einem südlich vom Gebiet der Niam-Niam gelegenen Land hätten sie Männchen angetroffen, die nie über drei Fuß Höhe erreichten und bis an die Knie mit einem langen weißen Bart versehen seien, weshalb sie auch nicht anders als „Leute mit spannenlangem Bart“ geheißen hätten.
Pygmäen
Natürlich aber bewachten diese afrikanischen Heinzelmännchen nicht Gold und Edelsteine im Schoss der Berge, sondern sie verkauften das nicht minder kostbare Elfenbein an die Händler und waren große Jäger vor dem Herrn. Mit guten Lanzen bewaffnet schlüpften sie gewandt den Elefanten unter den Leib, wo sie sie mit Leichtigkeit töteten, während die kurzsichtigen Tiere trotz des langen Rüssels ihrer nicht habhaft werden konnten. –
Es war im September 1887 in der Araberstation Ugarrowwa am Ituri, als Stanley zum ersten Mal einen Vertreter des Zwergstammes erblickte, der nördlich von jenem Fluss stark verbreitet war, und zwar eine kleine Dame von etwa siebzehn Jahren, die nur 87 Zentimeter groß war, sich aber körperlich wohl ausgebildet zeigte und ganz ansprechende Züge und prächtige Augen gleich einer jungen Gazelle besaß. Ihre glatte, glänzende Haut glich an Farbe gelb gewordenem Elfenbein, war also viel heller als die der anderen hochgewachsenen Eingeborenen.
Henry Morton Stanley, * 28. Januar 1841 als John Rowlands in Denbigh, Wales – † 10. Mai 1904 in London, war ein britisch-amerikanischer Journalist, Afrikaforscher und Buchautor.
(Siehe Band 152 in dieser gelben Buchreihe!)
Die Miniaturdame bewegte sich mit Anmut, und die Bewunderung, die sie erregte, schmeichelte sichtlich ihrer Eitelkeit. Im Februar 1888 fingen Stanleys Leute sogar die Frau eines Häuptlings, eine Zwergen-Königin, die etwa neunzehn bis zwanzig Jahre zählte und 32 Zentimeter groß war. Wenn sie die Arme gegen das Licht hielt, bemerkte man einen weißlich-braunen Flaum auf ihnen. Die Haut des ersten ausgewachsenen Zwerges, den man im Oktober 1888 nebst seiner Ehegesponsin vor Stanley brachte, fühlte sich beinahe pelzartig an mit Haaren von fast 1,3 Zentimeter Länge. Sein Kopfschmuck bestand aus einer Art Kappe, ähnlich wie sie Priester tragen, und war mit einem Büschel Papageienfedern geschmückt. Im Übrigen war er nur mit einem Streifen Baumwollrinde bekleidet. Seine Hände waren überaus zart und erregten durch ihre monströse Ungewaschenheit Aufsehen. Das Paar war gerade mit Schälen von Bananen beschäftigt gewesen, als man es im Dickicht überraschte.
Als nun die breitschulterigen Sudanesen und die großen Zanzibariten sich um den kleinen Mann scharten, war es ergötzlich zu beobachten, wie die Gedanken sich mit Blitzesschnelle in seinen Zügen malten: die Verwunderung, die ihn erfüllte, die rasch wechselnde Furcht wegen seines Schicksals, die ängstlichen Zweifel und die entstehende Hoffnung, als er in den Zügen der Fremden gute Laune entdeckte, dann die Neugier, zu erfahren, woher diese menschlichen Ungetüme gekommen seien und was sie etwa mit ihm machen, ob und wie sie ihn töten würden, ob sie ihn lebendig braten oder ihn trotz seines Schreiens in Fässer-große Kochtöpfe werfen würden. Ach Gott! hoffentlich nicht. Dann zeigten ein leichtes Kopfschütteln, eine noch bleichere Färbung der Lippen und ein nervöses Zwinkern mit den Augen, in welcher Not er sich befand.
Stanley forderte ihn auf, sich zu ihm zu setzen, die Sudanesen strichen ihm über den Rücken und gaben ihm einige geröstete Bananen, um seinen aufgeblasenen Bürgermeisterbauch zu füllen, worauf der Zwerg dankbar lächelte. Was für ein verschlagener Spitzbube er war! Und wie rasch er begriff! Er sprach mit seinen Gesten so beredt, dass jeder ihn verstand.
„Wie weit ist es bis zum nächsten Dorf, wo wir Lebensmittel erhalten können?“
Er legte seine rechte Hand mit der Fläche über das linke Handgelenk (mehr als zwei Tagemärsche).
„In welcher Richtung?“
Er wies nach Osten.
„Wie weit ist es bis zum Ihuru?“
„Oh!“ Er hob seine rechte Hand bis zum Ellenbogen. Das sollte die doppelte Entfernung bedeuten, vier Tage.
„Sind nach Norden hin Lebensmittel?“
Er schüttelte den Kopf.
„Nach Westen oder Nordwesten?“
Er schüttelte wieder den Kopf und machte eine Bewegung mit der Hand, als wollte er einen Haufen Sand fortwischen.
„Weshalb?“
Er streckte seine beiden Hände aus, als ob er ein Gewehr anlegte, und sagte: „Duuu!“
Sicherlich hatten die Manjema Tippu Tips alles vernichtet.
„Sind jetzt ‚Duuus‘ in der Nachbarschaft?“
Er blickte aus und lächelte so arglos, wie eine Kokette, als ob er sagen wollte: „Das wisst ihr selbst am besten; unartiger Mann, wie kannst du mich so zum Besten haben?“
„Willst du uns den Weg nach dem Dorf zeigen, wo wir Lebensmittel erhalten können?“
Tippu Tip, * 1837 oder 1838 – † 13. Juni 1905 in Stone Town, Sansibar, mit richtigem Namen Hamed bin Juma bin Rajab bin Mohammed bin Said el-Murjebi, war ein ostafrikanischer Sklaven- und Elfenbeinhändler.
Er nickte rasch mit dem Kopf und strich seinen Vollmonds-Bauch, was bedeutete: „Ja, denn dort werde ich eine volle Mahlzeit erhalten, hier“ – nun lächelte er verächtlich und drückte den Daumennagel auf das erste Glied des linken Zeigefingers – „sind die Bananen nur so groß, während sie dort“ – seine Wade mit beiden Händen erfassend – „so groß sind“.
„Oh, das Paradies!“ schrien die Leute, „Bananen so dick wie ein Menschenbein!“ Dem Zwerg war es gelungen, die Zuneigung aller zu erringen, und er fühlte das sehr wohl, wenn auch seine Züge arglose Unschuld ausdrückten und er sich ebenso gut bewusst war, dass die Geschichte von den riesigen Bananen nichts weiter als Schwindel war.
Während dieser Unterhaltung spielte das kupferfarbene Gesicht der nussbraunen kleinen Dame in beredter Weise die Gefühlsregungen des männlichen Zwerges wieder. Ihre Augen strahlten vor Freude, und mit blitzartiger Geschwindigkeit glitt ein listiger Zug über ihr Gesicht. Ihr Mienenspiel zeigte dieselben Zweifel und Hoffnungen, dieselbe erstarrende Furcht und dieselbe Neugier, als sie erriet, welche Stimmung ihr Gefährte erregte. Sie war so rundlich wie eine Gans am Weihnachtstag und glänzte in der Farbe alten Elfenbeins. In dem Männchen steckte, sagt Stanley, die nachgeahmte Würde eines Adams, in der Frau die ganze Weiblichkeit einer Miniatureva. –
Im Übrigen waren diese Zwergen-Stämme keineswegs so harmlos wie die Pygmäen, die vor Tausenden von Jahren die fünf Jünglinge der Nasamoner durch die Sümpfe in ihre Stadt geleiteten; denn diese Nasamoner kamen ungefährdet wieder nach Hause zurück, wie Herodot ausdrücklich versichert, sonst hätten sie ja ihre Erlebnisse niemandem erzählen können. Die Zwergen-Stämme an den Ufern des Aruwimi umschwärmten aber Stanleys Karawane allenthalben wie giftige Insekten, sie lauerten auf jeden günstigen Moment, mit ihren kindlichen, aber durch die vergifteten Spitzen dennoch lebensgefährlichen Pfeilen Schaden anzurichten und durch Diebstahl und Verwüstung allerhand Teufeleien auszuhecken. Dem von Stanley angelegten Fort Bodo wurden sie so lästig, dass sie verschiedene Male energisch gezüchtigt werden mussten. Nomadenartig streiften die einzelnen Zwergen-Familien durch die Wälder und lebten von ihrer Jagd- oder Kriegsbeute. Den übrigen Eingeborenen, denen sie gerade befreundet waren, um von ihnen Bananen und sonstige Früchte gegen Elfenbein einzutauschen, dienten sie als überaus gewandte Kundschafter, die allenthalben rechtzeitig Stanleys Ankunft in den Dörfern meldeten, so dass die Hütten der Eingeborenen verödet standen und alle Lebensmittelvorräte fortgeschafft waren.
Abgesehen von den einzelnen Gefangenen, die sich gelegentlich erwischen ließen, gelang es den Leuten Stanleys nur selten, solch ein Zwergvölkchen unter sich zu beobachten. Eines Tages hatte einer der Träger, wie so oft, seine Last, eine Kiste Patronen, nicht ins Lager gebracht, sondern einfach am Weg unter einen großen Baum niedergelegt. Am Abend wurde er unter Bedeckung zurückgeschickt, um sie zu holen. Als die ausgesandte Schar in der Nähe der Stelle ankam, sah sie einen ganzen Stamm von Zwergen, Männer, Frauen und Kinder, versammelt, und zwei Männlein machten gerade den Versuch, das Gewicht der Kiste zu probieren. Da die kleinen Leute außerordentlich scharfe Augen hatten, hielten sich Stanleys Leute versteckt, um zu sehen, was die Zwerge mit der Kiste machen würden. Jedes Mitglied des Stammes schien einen Vorschlag zu machen, während die kleinen Kinder auf einem Bein umherhüpften und vor unwiderstehlichem Vergnügen über den Fund sich auf die Schenkel klappten und die zierlichen Frauen mit ihren noch zierlicheren Babys auf dem Rücken in der Weise kluger Weiber ihren Rat dazwischen schrien. Da nahm ein beherzter Mann eine leichte Stange und schob sie durch die Handgriffe an den Enden der Kiste, worauf die sämtlichen kleinen Leute vor Freude darüber, dass sie eine so geistreiche Erfindung gemacht hatten, laut schrien und kreischten. Einige Herkulesse des Stammes drängten sich nun heran, wandten ihre äußerste Kraft auf, um die Kiste bis zur Schulterhöhe zu heben, und schwankten dann damit fort ins Dickicht. Da fiel plötzlich seitens der Leute Stanleys ein harmloser Schuss, und im Augenblick war das ganze hübsche Märchenbild zerstoben. Ihrer Wiesel-artigen Geschwindigkeit verdanken die Zwerge auch den Ruf, sich unsichtbar machen zu können. –
Diese Zwergvölker, von denen alle Afrikaforscher der letzten Jahrzehnte zu berichten wissen, sind unter verschiedenen Namen quer durch den ganzen schwarzen Weltteil verbreitet, sie ziehen sich wie eine Kette in der ganzen Breite des Äquatorialgürtels von Küste zu Küste; am dichtesten sind sie im Nordosten des großen zentralafrikanischen Urwalds westlich vom Albert- und Albert Eduard-See. Um Stanleys Fort Bodo herum hießen sie Wambutti; am Hof des Monbuttu-Königs Munsa, wo Schweinfurth längere Zeit reiche Gastfreundschaft genoss, nannte man sie Akka. Nach der Ansicht der meisten Anthropologen gelten die Zwerge und die mit ihnen verwandten etwas größeren Buschmänner in Südafrika als die ursprüngliche Eingeborenenbevölkerung, die durch die Wanderungen und Vorstöße umwohnender Völker und Stämme versprengt wurden.
Buschmann
Denn von Entartung ist an ihren wohl ausgebildeten Körpern nichts zu verspüren.
Emin Pascha hat viele Zwerge gemessen, die alle nicht größer als 124 Zentimeter waren. Die Größe der Wambutti ist nach Stanleys Angaben nur 90-140 Zentimeter. Nach Schweinfurths Schilderung hatten die Akka einen großen runden Kopf, große Ohren, einen flachen Brustkasten und lange dürre Arme mit außerordentlich zierlichen Händen. Schön von Angesicht sind sie keineswegs, die Schnauzen-artig vorspringenden Kiefer und die tiefeingesenkte Nasenbasis geben ihnen eine bedenkliche Ähnlichkeit mit dem Affenmenschen Darwins, nur ihre Augen sind, in auffallendem Gegensatz zu den zusammengekniffenen Augen der Buschmänner, groß und offen.
Emin Pascha, * 28. März 1840 als Isaak Eduard Schnitzer in Oppeln, Oberschlesien – † 23. Oktober 1892 in Kinena im Kongogebiet, war ein Afrikaforscher sowie Gouverneur der Provinz Äquatoria im Türkisch-Ägyptischen Sudan.
(Siehe Band 154 in dieser gelben Buchreihe!)
Charles Darwin, * 12. Februar 1809 in Shrewsbury- † 19. April 1882 in Down House/Grafschaft Kent, war ein britischer Naturforscher. Er gilt wegen seiner Beiträge zur Evolutionstheorie als einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler.
(Siehe Band 171 in dieser gelben Buchreihe!)
Schweinfurth nennt ihren Haarwuchs spärlich entwickelt, von Bart zeigten die Akka keine Spur; die Farbe ihrer Haare glich dem Werg. Unter den Zwergen, die Jephson während seines Aufenthaltes bei Emin Pascha sah, waren aber viele Männchen mit langen Bärten, ein überaus abschreckender Anblick.
Oft beobachtete Schweinfurth, wie auch Stanley, an ihnen einen grotesken Hängebauch, der aber mehr die Folge ihrer unmäßigen Gefräßigkeit war. Der deutsche Forscher führte anderthalb Jahre einen 134 Zentimeter großen Akka als Begleiter mit sich, doch starb der Zwerg infolge seiner Unmäßigkeit trotz sorgfältigster Pflege. Ein anderer Reisender brachte in den siebziger Jahren zwei Akka nach Europa, die unter der Wirkung europäischer Kultur trefflich gediehen und ganz manierlich aussahen. In dem altertümlichen Palast eines Patriziers in Verona hatten sie ein sorgloses Asyl gefunden und fühlten sich dort überaus wohl.
Im Allgemeinen ertragen aber die Zwerge den Aufenthalt im offenen Land nur schlecht, denn sie sind durchaus Waldmenschen, wodurch vielleicht auch die hellere Hautfarbe verursacht ist. Ihre Sinne sind überaus scharf entwickelt, und sie sind für die Jagd mit den vorzüglichsten Fähigkeiten ausgerüstet. Mit ihren Waffen, kleinen Bogen und Pfeilen, deren Spitzen dick mit Gift bestrichen sind, und Speeren, töten sie Elefanten, Büffel und Antilopen; außerdem graben sie Gruben und bedecken sie in geschickter Weise mit leichten Stöcken und Blättern und streuen Erde darauf, um das Wild zu überlisten. Sie stellen schuppenartige Bauwerke her, deren Dach an einer Ranke hängt, und breiten Nüsse oder reife Bananen darunter aus, um Schimpansen, Paviane und andere Affen hinein zu locken; bei der geringsten Bewegung fällt die Falle zu. Auf den Fährten der Zibetkatzen, Iltisse, Ichneumons und kleiner Nagetiere stellen sie Bogenfallen auf, die die Tiere beim eiligen Durchschlüpfen festhalten und erdrosseln. Aus der Haut des geschlachteten Wildes verfertigen sie Schilde und verkaufen diese nebst Pelz und Elfenbein an die größeren Eingeborenen für Bananen, süße Kartoffeln, Tabak, Speere, Messer und Pfeile.
Sobald eine Abteilung Zwerge in der Nähe eines Dorfes erscheint, beeilt sich der Häuptling, sie durch Geschenke von Getreide und Gemüse zu Freunden zu machen. Solange dieser Tauschhandel ehrlich betrieben wird, herrscht zwischen beiden Parteien das beste Einvernehmen; sobald sich aber die überaus empfindlichen Zwerge im geringsten beleidigt fühlen, üben sie rachsüchtige Vergeltung, töten ihre Feinde aus dem Hinterhalt und zerstören die Bananenpflanzungen. Ihre eigenen zeitweiligen Niederlassungen sind meist in größerer Entfernung von den Eingeborenendörfern unter Bäumen und Büschen mitten im Wald, möglichst in der Nähe eines Baches. Die bienenkorbartigen Hütten haben oft nur einen Durchmesser von einem Meter, und die Bewohner schlafen daher nur mit dem Oberkörper innerhalb derselben, während die Beine aus der Tür hervorragen; Knaben und Mädchen begnügen sich damit, sich Schutzdächer aus niedergebogenen Zweigen junger Bäume herzustellen. Als geborene Kundschafter bevorzugen sie für ihre Lager die Kreuzungspunkte der Eingeborenenwege und sind damit freiwillige Posten, die Lichtungen und Ansiedelungen bewachen. Dadurch aber sind sie gleichzeitig auch Belagerer, die die Eingeborenenstämme selbst in Schach halten und ihnen jede Bewegung über ihr Gebiet hinaus so gut wie unmöglich machen! Die Einrichtung ihrer mit breiten Blättern gedeckten Hütten ist denkbar roh und einfach. Hausgerät kennen sie nicht; sie kochen ihre Nahrung, indem sie sie in Blätter einwickeln und auf glühende Kohlen legen; gelegentlich erhalten sie Kochtöpfe aus den Dörfern, in deren Nähe sie als lästige Schmarotzer ihr Lager aufgeschlagen haben. Ihr einziges Haustier ist das Huhn. Erstaunlicherweise wusste man auch das schon vor mehreren tausend Jahren. Eine Mosaik aus Pompeji, die man heute im Nationalmuseum zu Neapel bewundern kann, stellt die Pygmäen dar, umgeben von ihren Häuschen und Hüttchen, alle voll von Hühnern!
Gleich den umwohnenden Eingeborenen huldigen auch die Zwerge bei günstiger Gelegenheit dem Kannibalismus. Hauptsächlich aber leben sie von Wild und den Feldfrüchten ihrer jeweiligen Freunde. Sie selbst pflegen nur ausnahmsweise Pflanzungen anzulegen. –
Hinterlist und Bosheit sind die vorstechenden Charaktereigenschaften aller dieser afrikanischen Zwergvölker, und auch da, wo man ihnen mit Freundschaft entgegentritt, ist man vor ihren Unarten und Teufeleien niemals sicher. Diese Erfahrung machte auch Georg Schweinfurth oft genug mit seinem Akka-Zögling. Emin Pascha hatte eine Zwergen-Frau als Dienerin; sie war sehr fleißig, schien nie müßig zu gehen und zeigte sich dabei stets fröhlich und gutmütig. Die Männer dagegen sind keine Freunde der Arbeit im Dienst anderer, und auch da, wo sie als Sklaven gut gehalten wurden, waren ihr Unabhängigkeitssinn und ihre Widerspenstigkeit niemals auszurotten. –
Eine Sage der alten Griechen erzählt, dass die Pygmäen einstmals den schlafenden Herakles überfielen, um den Tod ihres Riesenbruders Antäus, des mythischen Beherrschers von Libyen, an ihm zu rächen. Sie krabbelten auf seinen Gliedern herum und versetzten sein Haupt in Belagerungszustand, ohne ihm aber Böses antun zu können. Der Halbgott wachte auf, lachte, sammelte die kleinen Helden in sein Löwenfell und brachte sie seinem Arbeitgeber Eurystheus. Gleicht nicht der ungeheure Erdteil Afrika dem erwachenden Riesen, auf dessen Leib die schwarzen Zwerge noch immer umherkrabbeln?
* * *Am Hof eines Kannibalen-Fürsten
Am Hof eines Kannibalen-Fürsten
Wisst ihr euch noch des Schauders zu erinnern, der euch den Rücken hinunterrieselte, als ihr zum ersten Mal vom kleinen Däumling hörtet, wie er mit seinen Geschwistern wegmüde sich in die Hütte des Menschenfressers verirrte, dem ob dieser ihm unversehens bescherten Mahlzeit das Wasser im Mund zusammenlief? In Zentralafrika ist das Märchen noch heute nur allzu schreckliche Wirklichkeit. Was würdet ihr nun sagen, wenn ihr euch plötzlich von einer Horde solcher Unmenschen umgeben sähet, die euch nachdrücklich einladen, es euch in ihren Kochtöpfen bequem zu machen, oder wenn ihr vor den Obersten solch einer Teufelsbande geführt würdet, dem die Reste seiner Kannibalen-Mahlzeit noch an den schwarzen Fingern kleben und dessen Haarbusch unter einer dicken Schicht von – Menschenfett erglänzt?
Doch keine Angst! Natürlich seid ihr vortrefflich bewaffnet und nicht allein. Ihr gehört vielmehr einer mächtigen Karawane Chartumer Kaufleute an, die an den Quellflüssen des Nils allenthalben ihre befestigten Niederlassungen, Seriben, besitzen, über ausreichende militärische Bedeckung verfügen und sich im Lauf der Jahre zu Gewaltherrschern dieser weiten Distrikte aufgeworfen haben. Für sie sammeln die Eingeborenen das Elfenbein, um es gegen Kupfer oder mancherlei Erzeugnisse europäischer Kultur, deren Bedürfnis schon bei ihnen unausrottbar geworden ist, auszutauschen, und mit den zahlreichen Potentaten dieser eingeborenen Stämme stehen die Kaufleute aus dem Sudan in den engsten Handelsbeziehungen. In stetem Kampf untereinander, sind die schwarzen Völker vereinzelt wehrlos gegen die Waffen der Handelseroberer, und ihre Häuptlinge benutzen nur zu gern die Gelegenheit, auf Kosten ihrer Untertanen ihren Reichtum an Kupfer und anderen Schätzen durch Lieferung von Elfenbein, weißem und schwarzem, zu mehren und dadurch innerhalb ihres Stammes ihre Macht und ihr Ansehen zu steigern.
Immerhin mag keine allzu behagliche Empfindung euch beseelen, wenn ihr euch, dem Beispiel eures Landsmannes Georg Schweinfurth folgend, an dem Hof solch eines schwarzen Kannibalen-Fürsten häuslich niederlassen sollt. Ihr wisst ganz genau, was der hohe Herr soeben zum Frühstück verspeist hat, wenn er euch die Gnade gewährt, euch in Audienz zu empfangen! Und wenn man auch aus Höflichkeit dem Europäer gegenüber nicht gerade zugestehen mag, dass hier am Hof Menschenfleisch ein begehrter Leckerbissen ist, so habt ihr doch helle Augen genug, um allenthalben aus den Abfällen der Mittagstafel dieses scheußliche Gericht herauszuerkennen. Und wenn ihr noch obendrein wie Schweinfurth Naturforscher seid und als Anthropologen eine sehr dankenswerte Vorliebe für Menschenschädel besitzt, so seht ihr bald mit Entsetzen, dass Menschenköpfe, in rohem oder gekochtem Zustand, hierzulande so billig wie Brombeeren sind und man deren mehr vor euch aufhäuft, als ihr präparieren und für euer Museum mitnehmen könnt!
Wenn ihr dann nachts in eurer Hütte liegt, mitten in der großen Residenz seiner königlichen Hoheit des Kannibalen-Fürsten, wenn unter eurem Lager die Termiten an der Arbeit sind und über euch im Dachstroh zierliche Schlangen Haschen spielen, so verdenke ich euch nicht, wenn ihr euch allerhand krause Gedanken macht, und hin und wieder der böse Traum euch aus dem Schlaf emporrüttelt: Es ist aus mit der Blutsfreundschaft, die der König des Ortes mit den Herren der Karawane geschlossen hatte! Saht ihr nicht heute auf eurem Weg an einem Baum-Ast drei merkwürdige Gegenstände auffallend hingehängt? Einen Maiskolben, eine Hühnerfeder und einen Pfeil! Jetzt besinnt ihr euch: das ist die hier übliche Kriegserklärung! „Nieder mit den Fremden!“ schallt es als Losung durch die dunklen Dorfstraßen – „Nieder mit den Elfenbein- und Sklavenräubern, die alljährlich unser Land aussaugen und unsere Weiber fortschleppen! Nieder auch mit dem weißen ‚Laubfresser’!“ So wurde der botanisierende Schweinfurth von den Eingeborenen wegen seiner ihnen völlig unverständlichen Beschäftigung genannt.
Doch nun soll euer noch jetzt in Berlin lebender berühmter Landsmann erzählen, wie er im Jahr 1870 auf einer seiner vielen Afrikareisen, aus der er den Uelle-Fluss, einen der nördlichen Zuflüsse des gewaltigen Kongos, entdeckte, das Land der Monbuttu besuchte, bei dem Könige dieses Stammes, dem mächtigen Munsa, einem echten Kannibalen-Fürsten, gastfreundschaftlichste Aufnahme fand und als erster Europäer das keineswegs primitive Zeremoniell solch eines schwarzen Fürstenhofes mit Muße studieren konnte!
Uelle-Fluss
Schweinfurth war es gelungen, von einem der mächtigsten Chartumer Kaufleute die Erlaubnis zur Teilnahme an mehreren seiner Geschäftsreisen, auch Beutezügen, zu erhalten. Die Fahrt ging zunächst den Weißen Nil aufwärts, bog dann in den Gazellen-Fluss (Bahr el-Ghasal) ein, in dessen Quellgebiet die Chartumer Seriben lagen, und führte durch das Land der Schilluk-, Nuer- und Dinka-Neger, dieser sonderbaren Sumpfbewohner, die ein Beweis dafür sind, dass das Naturgesetz, das unter gleichen Existenzbedingungen gleiche Formen unter den verschiedensten Klassen der Tierwelt schafft, sich auch an den Menschen bestätigt. Ihr langer Hals, auf dem ein kleiner, schmaler Kopf ruht, und ihre hohen, dürren Beine, auf denen sie gemessenen Schrittes das Schilf durchschreiten, geben ihnen eine unverkennbare Ähnlichkeit mit Reihern oder Störchen, und ihre sonderbare Gewohnheit, nach Art der Sumpfvögel stundenlang auf einem Bein zu stehen, das andere aber mit dem Knie zu stützen, vervollständigt dieses Naturspiel in ganz überraschender Weise. Die Dinka sind ein leidenschaftliches Hirtenvolk, das alle Stämme, die kein Vieh halten, als „Wilde“ bezeichnet; seine Kühe und Rinder sind ihm teurer als Weib und Kind. Obgleich die Dinka große Feinschmecker sind, bringen sie es doch nur ausnahmsweise über sich, eines ihrer Tiere zu schlachten. Für die Beutezüge der Elfenbeinhändler ist aber der Viehreichtum der Dinka eine Lebensfrage.
Den Gazellen-Fluss weiter aufwärts wohnen die ackerbautreibenden Djur; sie haben die komische Gewohnheit, sich gegenseitig anzuspucken, wenn sie sich mit besonderer Herzlichkeit – begrüßen wollen. An ihr Gebiet schließt sich das der Bongo, wo zur Zeit des Besuches Schweinfurths die nubischen Sklavenhändler, wie eine Horde übermütiger Paviane in den Durra-Feldern, hausten und ganze Landstrecken entvölkerten. Gleich den Djur sind auch die Bongo überaus geschickte Schmiede; ihr Land ist sehr eisenhaltig; sie wissen kunstgerechte Eisenschmelzen zu bauen, und selbstverfertigte Lanzen und Spaten sind daher im ganzen oberen Nilgebiet gangbare Münze für den Tauschhandel. Die Bongo und ebenso die ihnen benachbarten Mittu zeigten sich als sehr musikalisch, und ihre orchestralen Versuche, die entfesselten Elemente mit Hilfe lärmender Instrumente musikalisch darzustellen, erinnern heute nicht wenig an die Experimente moderner europäischer Komponisten. Auffallend war bei den Bongo, denen im Übrigen alles, was da kreucht und fleucht, gleichviel in welchem Zustand, mundgerecht erschien, ihre ausgesprochene Abneigung gegen Hunde- und Menschenfleisch, und es bewährte sich weiterhin das Wort des französischen Schriftstellers Bernardin de Saint-Pierre, des bekannten Verfassers der Idylle „Paul und Virginie“, dass der Genuss von Hundefleisch der erste Schritt zum Kannibalismus sei.
Bernardin de Saint-Pierre, * 19. Januar 1737 in Le Havre – † 21. Januar 1814 in Éragny bei Paris, war ein französischer Schriftsteller.
Das weiter südlich wohnende Jäger- und Kriegervolk der Niam-Niam huldigt dagegen schon ganz dieser grässlichen Sitte; sie verspeisen nicht nur die im Krieg gefallenen Feinde, sondern schrecken selbst vor den Toten ihres eigenen Stammes nicht zurück, wenn diese innerhalb des Dorfes keine Familie haben. Dem Menschenfett schreibt man eine berauschende Wirkung zu. Die Zähne der Verspeisten werden auf Schnüre aufgereiht und wie Glasperlen getragen, und die Hütten mit Schädeln wie mit Jagdtrophäen geschmückt. Überraschend bei diesem Tiefstand der Kultur ist die Stellung der Frauen; die Niam-Niam hängen an ihnen mit grenzenloser Liebe, und die arabischen Händler pflegen sich daher zunächst immer einiger Weiber zu versichern; durch deren Gefangenschaft können sie dann von den Männern ohne Mühe alles erpressen, was ihnen zum Unterhalt der Karawanen oder zur Vergrößerung ihrer Beute nur immer erwünscht ist. Von diesen wilden Völkern lässt sich also nicht behaupten, dass die Lage der Frauen für den Stand der Kultur eines Landes beweisend ist.
In allen diesen Gebieten der Eingeborenen hatten Schweinfurths Begleiter ihre Niederlassungen, und in allen ihren Seriben wurde er mit echt orientalischer Gastfreundschaft aufgenommen und monatelang verpflegt, um sich ganz seinen wissenschaftlichen Studien hingeben zu können. Die Achtung, mit der die Besitzer der Karawanen den deutschen Forscher behandelten, imponierte den Eingeborenen selbst gewaltig, und wenn er dann vor ihren Augen seine europäischen Künste spielen ließ, waren sie gerne geneigt, ihn für ein höheres Wesen zu halten. Das größte Erstaunen riefen seine Zündhölzer hervor, und immer wieder musste er das Wunder des Feuermachens vor ihnen ausführen. Wenn ihnen dann selbst mit einem dargereichten Streichholz das Experiment gelang, war die Freude aller Umstehenden eine ausgelassene. „So“, hieß es im Kreis der Männer, „kann der weiße Mann auch Regen und Blitz machen, etwas Ähnliches ist nicht gesehen worden seit Erschaffung der Welt!“ Die Eingeborenen selbst bedienten sich zum Feueranzünden zweier bleistiftdicker Hölzer; durch quirlartiges Reiben des einen senkrecht auf dem anderen wird der Funke erzeugt und dieser in zerriebenem dürren Gras aufgefangen, ein zwar etwas umständliches, aber ganz sicheres Verfahren, das, wie Schweinfurth erzählt, bei starkem Wind oft den Zauber seiner Streichhölzer zuschanden werden ließ.
Dieser Bewunderung der Eingeborenen hatte der Forscher es zu verdanken, dass er allein und unbewaffnet oder nur mit geringer Begleitung in der Nähe der Seriben nach Herzenslust und ungefährdet umherstreifen und bei dem unerschöpflichen Reichtum der Vegetation von jedem Tagesausflug Schätze für seine Herbarien oder seine Zeichenmappe mit heimbringen konnte. Er besuchte ebenso unbehindert die Hütten der Eingeborenen, hielt förmliche Haussuchungen bei ihnen ab, untersuchte ihr Hausgerät und durchstöberte jeden Winkel, zeichnete und maß ihre Bewohner und brachte so eine Fülle wissenschaftlicher Resultate zusammen, die leider zum Teil bei einem späteren Seribenbrand zugrunde gingen, zum anderen Teil aber die Berliner Museen bereichert haben.
Das südlichste Gebiet, auf das sich seine Forschung erstreckte, war das der Monbuttu, eines Kannibalen-Stammes, der von zwei mächtigen Häuptlingen beherrscht wurde, und die Residenz des einen von ihnen, des Königs Munsa, bildete wochenlang Schweinfurths Standquartier. Durch einen der Karawanenbesitzer waren die Monbuttu erst 1867 entdeckt worden, und der schlaue Händler hatte es verstanden, sich die enge Freundschaft dieses Kannibalen-Fürsten zu erwerben. So wurde Schweinfurth Zeuge eines Schauspiels, das bis dahin noch keinem europäischen Reisenden zuteil geworden war.
Munsa hatte die Ankunft seines Chartumer Blutsfreundes, dem die Monbuttu den gemütlichen Namen Mbali, „der Kleine“, beigelegt hatten, mit Ungeduld erwartet; in seinen Speichern lagerte hochaufgestapelt das Elfenbein, die Jagdausbeute eines ganzen Jahres; jetzt sollten ihm dafür aufs neue die Reichtümer des Nordens zufließen und sich in der königlichen Schatzkammer neue Massen roten Kupfers zu den alten häufen. „Wo ist Mbali, wann wird Mbali kommen?“ war Munsas tägliche Frage an die bei ihm stationierten Soldaten seines Freundes gewesen, und es war zugleich die Botschaft, mit der Munsa schon aus weiter Ferne dem Fremden, dessen Nahen ihm gemeldet worden, seinen königlichen Gruß entbieten ließ. Mbali hatte denn auch gleich beim Eintreffen in der Residenz des Königs nichts Eiligeres zu tun, als die mitgebrachten Geschenke zusammenzuraffen und sich schleunigst zu Munsa zu begeben. Erst spät am Abend kehrte er in das große Lagerdorf zurück, das mittlerweile aus dem Urwald emporgezaubert worden war; Hörner- und Paukenschall begleiteten seine Schritte, und große Proviantvorräte sammelten sich, auf Befehl des Königs von Tausenden herbeigetragen, mit staunenswerter Schnelligkeit. Dem weißen Gast der Karawane aber war für den folgenden Morgen ein feierlicher Empfang in der Prunkhalle des Königs in Aussicht gestellt.
Am anderen Morgen sah man dichte Massen schwarzen Volkes sich zwischen den Hallen des Königs und den Behausungen seines Hofgesindes hin und her bewegen, und der dumpfe Schall wilder Paukenschläge übertönte alles. Munsa versammelte seine Trabanten und hielt Heerschau über seine Elefantenjäger; von nah und fern strömten die Familienältesten herbei, um den Elfenbeinmarkt zu beschicken und mit Mbali Lieferungsverträge über Lebensmittel abzuschließen.
Schweinfurth hatte sich in feierliches Schwarz geworfen und schwerbeschlagene Touristenstiefel angelegt, um seiner leichten Figur durch die vermehrte Wucht der Tritte einen imponierenden Charakter zu verleihen. Diese Stiefel brachten ihn übrigens später in den Verdacht, Bocksfüße zu besitzen, eine Vermutung, die durch sein langes Gelehrtenhaar unwillkürlich bestätigt wurde! Nach langem Warten wurde er gegen Mittag von Mbalis schwarzer Leibgarde und seinen Musikanten abgeholt und unter festlichem Geleit zur zweitgrößten der königlichen Palasthallen geführt, die, einem Schuppen gleich, an beiden Giebeln offenstand. Hier harrte der Zeremonienmeister, ergriff schweigend die rechte Hand des Fremden und führte ihn in das Innere, durch die Reihen Hunderter von Trabanten und Vornehmen des Volkes hindurch, die in vollem Waffenschmuck, nach Rang und Würden geordnet, auf zierlichen Bänken saßen. An dem einen Ende der Halle stand die Thronbank des Königs, die vor den übrigen Sitzen nur durch eine Fußmatte ausgezeichnet war. Neben die Thronbank ließ Schweinfurth seinen Rohrstuhl stellen, den man ihm, der Sitte des Landes gemäß, nachgetragen hatte; seine Leute hockten und stellten sich hinter ihn, und nun galt es, auf das Erscheinen des Königs zu warten.
Denn Seine Majestät wurde noch erst in den inneren Wohnhütten der Hofburg von seinen Frauen frisch gesalbt, frisiert und geputzt, um sich in vollem Staat zu präsentieren, und ohne die gelassene Geduld des Audienzsuchenden ging es auch an diesem Königshof nicht ab! Unterdes erschütterte das Toben der Kesselpauken und das Gebrüll der Hörner den luftigen Holzbau, der in seiner Art ein Wunder leichter und doch widerstandsfähiger Konstruktion war, und für die königlichen Trabanten war der weiße Gast eine unerschöpfliche Quelle ausgelassener Belustigung. Durch die offenen Giebel drängte sich das schaulustige Volk, das durch Aufseher mit langen Stöcken in Ordnung gehalten wurde.
Schon eine Stunde hatte der Fremde gewartet, als endlich lauter Hörnerklang, Volksgeschrei und verdoppelter Paukendonner das Herannahen des Herrschers zu verkünden schienen. Das war aber erst das Vorspiel, währenddessen am Eingang der Halle eine großartige Ausstellung von Prunkwaffen, kupfergeschmiedeten Lanzen und Spießen in allen Formen und Größen, errichtet wurde. Die Strahlen der äquatorialen Mittagsonne verbreiteten über diese Anhäufung von rotglänzendem Metall einen blendenden Schein, und ein Glühen wie von flammenden Fackeln ging von den Lanzenspitzen aus, deren symmetrische Reihen einen prächtigen Hintergrund für den Thronsitz eines Herrschers abgaben. Eine wahrhaft königliche Pracht wurde da entfaltet, für zentralafrikanische Begriffe Schätze von unberechenbarem Wert und alles bisher Gesehene weit in den Schatten stellend.
Jetzt aber drängte der Volkshaufe dem Eingang zu, Ausrufer und Festordner rannten hin und her – Ruhe! der König kommt!
Voran schreiten Musikanten, die auf kolossalen, aus ganzen Elefantenzähnen geschnitzten Hörnern blasen oder Eisenglocken schwingen. Den Blick gleichgültig vor sich hin gerichtet, naht derben Schrittes der rotbraun gesalbte Cäsar, gefolgt von seinen Lieblingsfrauen; ohne den Fremden eines Blickes zu würdigen, wirft er sich auf die niedrige Thronbank und – betrachtet seine Füße.
Gleich der Waffensammlung erstrahlte der Herrscher in schwerer Kupferpracht, Arme und Beine, Hals und Brust waren mit Ringen, Spiralen und Ketten geschmückt, auf dem Scheitel erglänzte eine Art Halbmond, alles Erzeugnisse der einheimischen Kunstindustrie. Ein imposanter, anderthalb Fuß hoher, zylinderförmiger Federhut aus Rohrgeflecht beschattete das Haupt, fingerdicke Kupferstäbe staken in den durchbohrten Ohrmuscheln, und der ganze Leib war mit der landesüblichen Schminke von Farbholz eingerieben, die seinem ursprünglich hellbraunen Körper die antike Färbung pompejanischer Helden gab. Seine Kleidung bestand aus einem großen Stück sorgfältig verarbeiteter Feigenrinde, gleichzeitig Kniehosen und Leib-Rock darstellend, und derbe Riemen aus Büffelhaut mit Kupferkugeln hielten das Gewand an den Hüften zusammen. In der Rechten schwang Munsa als Zepter einen sichelförmigen Säbel aus lauterem Kupfer.
Der Selbstherrscher der Monbuttu war gegen vierzig Jahre alt, hoch von Gestalt und stramm von Wuchs. Kinn und Backen waren von einem Bart umrahmt. Aber seine Gesichtszüge waren keineswegs einnehmend. In seinen Augen brannte ein wildes Feuer, und um die aufgeworfenen wulstigen Negerlippen lagerten die Grausamkeit und Habsucht eines Nero. Er lächelte nie.
Eine geraume Zeit verstrich, ehe die Blicke des Königs scheinbar gleichgültig zu dem nie gesehenen Blassgesicht mit dem schulterlangen Haar hinüberstrichen, und nach und nach ließ er durch den Dolmetscher etliche sehr gleichgültige Fragen an den Fremden richten. Sich durch nichts aus seiner königlichen Selbstbeherrschung bringen zu lassen, schien dieses Königs wohlüberlegte Absicht.
König Munsa
Nun ließ Schweinfurth seine Geschenke zu den Füßen des Herrschers ausbreiten: schwarzes Tuch, ein Fernrohr, Porzellangeschirr, Elfenbeinschnitzereien, ein Doppelspiegel usw., und was die Hauptsache war, eine Sammlung von tausend verschiedenen venetianischen Glasperlen. Die Umgebung konnte sich der verschiedensten Laute des Staunens nicht enthalten – der König selbst aber betrachtete alles mit unerschütterlicher Ruhe.
Nach einiger Zeit wandte sich Munsa den bereitliegenden Erfrischungen, gerösteten Bananen usw., zu und rauchte in den Esspausen aus einer Pfeife, einem sechs Fuß langen Eisenrohr, das der Pfeifenträger ihm hinreichte. Jedes Mal warf sich der König dazu in seinen Thronsessel zurück, stützte den rechten Ellenbogen in die Armlehne, schlug ein Knie über das andere und ergriff dann mit der Linken das Rohr. In dieser imposanten Haltung tat er, ganz wie ein vornehmer Türke, einen einzigen langen Zug aus der Pfeife, gab sie dann stolz und gelassen dem Diener zurück und ließ den Rauch langsam aus dem Mund gleiten. Trotz aller Bemühungen war es nicht möglich, ihn, dem schlechterdings nichts imponierte, in eine regelrechte Unterhaltung zu verwickeln, und auch bei späterer Gelegenheit ließ er sich, besonders über geografische Dinge, in keiner Weise ausfragen; das verboten ihm die Bedenken hoher afrikanischer Politik!
Zur Unterhaltung der Gäste traten nun Hornbläser auf, dann Spaßmacher und Sänger, und auch ein Hofnarr fehlte nicht, der über und über mit buschigen Quasten behangen und unermüdlich in Späßen und Albernheiten war. Und zuletzt, als Höhepunkt der Zeremonie, hielt Munsa unter dem Jubel des Volkes und mit sichtlicher Berechnung in der Wahl der Worte und Kunstpausen eine feierliche Rede, mindestens eine halbe Stunde lang, und zum Schluss dirigierte er noch höchsteigenhändig ein Paukenkonzert mit solchem Erfolg, dass sein deutscher Besucher von allem Gesehenen und besonders Gehörten mehr tot als lebendig zurück in seine Hütte kam.
Als Gastgeschenk ließ Munsa ihm am anderen Morgen ein zwanzig Fuß langes transportables Haus aus korbartigem Geflecht überbringen, das dem Naturforscher zum Schutz seines Gepäcks und besonders seiner Sammlungen überaus willkommen war. So konnte er nun in seinen eigenen vier Wänden als Hausbesitzer im Monbuttu-Land seinen Untersuchungen obliegen, während rings um sein Zelt sich die Schar der Neugierigen, besonders der Frauen, drängte, die sich sogar ihre Sitzgelegenheit mitzubringen pflegten, um das fremde Wundertier bei seinem unverständlichen Hantieren in aller Muße anstaunen zu können.
Zwanzig Tage blieb Schweinfurth in der Residenz Munsas, und an Abwechslungen und Überraschungen war dieses Hoflager so reich wie nur irgendein europäisches. Wenn sich Büffel oder Elefanten in der Nachbarschaft blicken ließen, wurden große Treibjagden veranstaltet; Feste auf Feste durchrauschten die königlichen Hallen. Eines Tages tanzte der König sogar, gleich David, in höchsteigener Person vor seinen Frauen und Trabanten so lange, bis er mit der Wut eines heulenden Derwisches durch die Halle raste, während die Zuschauer in tobende Ekstase gerieten. Dann wieder trafen tributbringende Vasallen beim König ein, oder es wurde ein Siegesfest gefeiert. Im Lager bei Munsa sah Schweinfurth auch zum ersten Mal einen der südlich von den Monbuttu wohnenden Zwerge und erhielt sogar vom König einen dieser Akka als Eigentum überwiesen, nachdem er ihm – ein echt afrikanischer Handel – einen seiner Hunde dafür überlassen hatte!
* * *
Timbuktu
Timbuktu
Im Nordwesten Afrikas auf der Riesenzunge, die der Kontinent in den Atlantischen Ozean hinausstreckt, liegt Timbuktu, eine der berühmtesten Städte der Erde.
Timbuktu um 1830
Im Vergleich zu Kairo oder Algier ist Timbuktu eine kleine Stadt, deren drei armselige Moscheen sich nicht mit den prächtigen Gotteshäusern messen können, die unter der französischen, türkischen oder englischen Herrschaft an der afrikanischen Küste des Mittelländischen Meeres ihre schlanken Minarette zum Himmel erheben. Kein einziges Gebäude fesselt die Blicke des Fremden; ein Gewirr von Ruinen graugelber Lehmhäuser mit platten Dächern und ohne Fenster zeigt überall Verfall und Misswirtschaft. Kaum eine Karawanserei lädt baufällig, wie sie alle sind, den Wüstenwanderer zum Verweilen ein. Manche Straßen sind ganz verlassen und andere fußtief mit Flugsand bedeckt, den die Sahara herübersendet.
Timbuktu ist nicht so berühmt wie die funkelnden Juwelen in Asiens Krone: Jerusalem, Mekka, Benares und Lhasa, deren jede durch ihren Namen schon eine ganze Religion zusammenhält. Und doch hat die Stadt Timbuktu während ihres achthundertjährigen Bestehens stolze Namen getragen: die Große, die Gelehrte und die Geheimnisvolle! Zwar wallfahrten keine Pilger dorthin, um am Grab eines Erlösers zu beten oder sich von einem Hohenpriester segnen zu lassen; keine Pyramiden und keine Marmortempel sind hier zu finden; kein Reichtum, keine üppige Vegetation macht die Stadt zu einem Vorhof des Paradieses. Und doch ist auch Timbuktu eine Stadt der Sehnsucht. Millionen Wanderer sehnen sich dorthin, und wer von ihr kommt, sehnt sich gar oft nach ihr zurück. Unzählige Karawanentreiber, die monatelang die endlose Sahara durchwandern, sehnen sich nach den Klängen der Zither, den harmonischen Flötenkonzerten und dem leichten Hinschweben der Tänzerinnen Timbuktus. Palmen und Mimosen-Bäume wachsen hier nur spärlich. Aber nach den Schrecken der Wüste erscheint diese verfallene Stadt mit ihren öden Gassen dennoch als ein paradiesischer Aufenthalt. Die Kaufleute, die so lange den Überfällen der Räuberhorden ausgesetzt waren, begrüßen Timbuktu als eine Erlösung und finden seine grauen Mauern begehrenswerter als die prächtigste aller Städte!
Der Vorzug Timbuktus ist also seine Lage und der dadurch bedingte Handel. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass diese Stadt gleich einer Spinne in einem Netz von Handelsstraßen sitzt, die von den Küsten ausgehen und in Timbuktu zusammenlaufen. Sie kommen von Tripolis und Tunis, aus Algerien und Marokko, vom Senegal und von der Sierra Leone, von der Pfefferküste, der Elfenbeinküste, der Goldküste und der Sklavenküste und aus den Ländern am Meerbusen von Guinea, die Frankreich, England und Deutschland erobert haben. Sie kommen gleichfalls aus dem Inneren der Sahara, wo wilde, kriegerische Nomadenstämme noch heute ihre Freiheit gegen fremde Eindringlinge zu verteidigen wissen.
In Timbuktu treffen Araber, Neger, Mohammedaner und Heiden, Sahara und Sudan, Wüste und fruchtbares Land zusammen. Es liegt auf der Schwelle der großen Wüste und an dem drittgrößten der Flüsse Afrikas. Der Niger ist hier vier Kilometer breit und an seiner Mündung wasserreicher als der Nil, doch nicht so mächtig wie der Kongo. Gleich dem Kongo macht der Niger einen Bogen nach Norden, als wolle er der Sahara Trotz bieten, aber die Wüste bleibt Siegerin, und der Fluss muss sich wieder nach Süden wenden. Und gerade da, wo der Kampf zwischen dem lebenspendenden Wasser und dem alles erstickenden Sand den Höhepunkt erreicht hat, liegt Timbuktu.
Von Norden her kommen die Waren auf Dromedaren, um in langen schmalen Booten mit Mattendächern oder da, wo der Fluss nicht befahrbar ist, durch Ochsen, Maulesel oder Träger weiterbefördert zu werden. Die Dromedare können das feuchte Klima am Niger, der besonders im Winter weit über seine Ufer tritt, nicht vertragen; sie werden daher durch die Sahara zurückgeführt. Sie fühlen sich nirgends wohler als in der Wüste, die der beständig wehende Nordostpassat ausdörrt; in manchen Gegenden der Sahara können Jahre vergehen, ohne dass ein Tropfen Regen fällt.
Und welch eigenartigen Klang hat der Name Timbuktu! Aus ihm klingen das Geheimnis und der Zauber der Sahara. Er erinnert an die größten Wüstengegenden der Erde, an die Einsamkeit langer Wege, an blutige Fehden und verräterische Hinterhalte, an das Läuten der Karawanenglocken und das Klirren der Steigbügel an den Pferden der prächtigen Beduinen. Zwischen den klingenden Vokalen dieses Namens glaubt man die trüben Wellen des Nigers rauschen zu hören. Er klingt wie ein Akkord auf den Saiten der Zither oder wie die Töne der Flöte zu den leichten Schritten der Tänzerinnen. Das weinerliche Bellen der Schakale und das Sausen des Wüstenwindes, das Brüllen der Dromedare vor den nördlichen Stadttoren und das Gepolter der Bootsleute mit Rudern und Stangen im Hafen drunten am Fluss glaubt man darin zu vernehmen.
Wer längere Zeit in Timbuktus Mauern rastet, erhält Kunde von allen Ländern, die rings um die Stadt herum liegen, und trifft mit Menschen aus allen diesen Ländern zusammen, mit Arabern, Sudanesen, Ägyptern und den zahlreichen Mischvölkern dieser Rassen. Sonderbare Gestalten sind darunter! Wie Bündel leichter Mäntel wandeln sie einher, mit Tüchern auf dem Kopf, die bis auf die Schultern herabhängen, Schleier vor dem unteren Teil des Gesichts, um Hals und Schulter ein Gehänge goldener oder roter Talismane aus Leder, Lanzen in den Händen. Das sind Tuaregs, auf die Timbuktus Einwohner sehr schlecht zu sprechen sind. „Hütet euch vor ihnen!“ lautet ihre Warnung. „Sie wohnen im Nordosten der Sahara. Sie versprechen euch Gastfreundschaft in ihrem Land und schneiden euch den Hals ab, wenn ihr hinkommt. Das Wort eines Tuareg gleicht dem Wasser, das man in den Sand gießt. Ja, sie haben Timbuktu gegründet, aber sie sind dennoch Diebe, Hyänen, von Gott verlassene Menschen.“ –
Der Handel des jetzt französischen Timbuktu ist überaus bedeutend. Die Karawanen von der nördlichen Küste bringen Zeug-Stoffe, Waffen, Pulver, Papier, Werkzeuge, Kurzwaren, Zucker, Tee, Kaffee, Tabak und unzähliges andere. Wenn sie ihre Wanderung durch die Sahara antreten, gehen viele ihrer Kamele leer. Sie werden unterwegs mit Salzblöcken beladen, denn nach Salz ist in Timbuktu große Nachfrage. Auf der Rückreise nach Norden tragen die Dromedare Waren aus dem Sudan: Reis, Maniok, Honig, Nüsse, die Früchte des Affenbrotbaums, gedörrte Fische, Gold, Elfenbein, Straußenfedern, Gummi und Leder. Auch eine kleine Anzahl schwarzer Sklaven wird mitgeführt. Der Wert solch einer der jährlichen vierhundert Karawanenladungen beträgt oft eine halbe Million Mark und noch mehr, und fünf große Karawanenstraßen durchschneiden die Sahara in nordsüdlicher Richtung. Die größten Karawanen bestehen aus fünfhundert bis tausend Dromedaren und höchstens fünfhundert Mann. Aber auch die größte Karawane kann froh sein, wenn sie mit heiler Haut durch das Land der Tuareg kommt; im besten Fall erhält sie freien Durchzug nur gegen sehr hohen Zoll.
* * *
Die Sahara
Die Sahara
Wenn es uns in Timbuktu nicht mehr gefällt – falls man einer Stadt, in der das Leben beständig wechselt, überdrüssig werden kann – machen wir uns selbst auf die Reise durch die Wüste. Zuerst wandern wir ostwärts nach dem Tschad-See, der zur Hälfte mit Inseln bedeckt, seicht und sumpfig und vom Schilf fast zugewachsen ist und dessen Spiegel je nach der Wasserzufuhr durch die großen, in ihn einmündenden Flüsse sich abwechselnd hebt und senkt, ähnlich dem Lop-nor in Zentralasien. Siebzig Kubikkilometer Wasser sollen sich jährlich in den Tschad-See ergießen, und da der abflusslose See immer den gleichen Umfang behält, lässt sich denken, wie stark die Verdunstung sein muss. Er gehört den Franzosen, Engländern und Deutschen.
Auf unseren Dromedaren und mit arabischen Führern versehen, auf die wir uns verlassen können, ziehen wir dann vom Tschad-See nach dem östlichen Sudan, wo wir schon früher mit Gordon weilten. Doch ehe wir den Nil erreichen, schwenken wir nach Norden ab, um die Libysche Wüste, den unzugänglichsten, ödesten und daher am wenigsten bekannten Teil der Sahara, der größten Wüste der Erde, zu durchqueren. Vegetation und Tierleben werden immer spärlicher, schon im Sudan sind die Savannen, je weiter wir vordringen, immer magerer und die Steppen immer wüstenartiger. Schließlich herrscht der Flugsand überall vor, und nun gilt es, sich auf solchen Wegen zu halten, die Araber und Ägypter seit Jahrtausenden benutzt haben.
Wir sind bald mitten im Sandmeer. Der rote Flugsand hat sich stellenweise zu Dünen von Kirchturmhöhe aufgehäuft!
Kein Pfad ist mehr zu sehen, der letzte Sturm hat ihn verweht. Aber die Führer haben ihre Merkzeichen und verlieren die Spur nicht. Der Sand wird niedriger und das Land offener. Da ragt ein kahler, wüster Landrücken aus dem Sand auf wie eine Klippe über den Meereswellen. Nach diesem Merkzeichen, das mehrere Tagereisen weit sichtbar ist und später von einem anderen Gipfel abgelöst wird, kann sich der Führer zurechtfinden.
An einem tiefen Brunnen lagern wir in der Nacht, trinken selbst und tränken unsere Kamele und sind am nächsten Tag wieder draußen im Sandmeer. Die Farbe des Himmels hat sich ungewöhnlich verändert; er wird gelb und schillert dann bleigrau, und die Sonne erscheint nur noch als eine rote Scheibe. Kein Lüftchen regt sich. Der Führer ist ernst und sagt mit gedämpfter Stimme: „Samum!“ Der heiße, alles vernichtende Wüstensturm, die Geißel Arabiens und Ägyptens, zieht heran.
Da wir nicht mehr zurückkehren können zum letzten Brunnen, ehe der Sturm da ist, müssen wir vorwärts. Schutz gibt es nicht; die Dünen sind zu flach, um den Wind abzuhalten, der nun heransaust. Die Dromedare bleiben angstvoll stehen und wenden die Köpfe nach der dem Sturm abgekehrten Seite. Wir steigen ab, die Tiere legen sich nieder und bohren die Nase in den Sand. Wir selbst winden uns Tücher ums Gesicht und werfen uns der Länge nach neben unseren Tieren in den Sand, um durch sie ein wenig Schutz vor dem Sturm zu erhalten. So kann man stundenlang nach Atem ringend daliegen und froh sein, wenn man einem Samum lebendig entrinnt. Auch in einer Oase verursacht er Angst, und seine heiße Luft ist Palmen und Äckern gefährlich. Die Temperatur während solch heißen Wüstensturms, der seinen Namen „Gift-Wind“ mit Recht trägt, kann auf fünfzig Grad steigen.
Endlich hat der Samum aufgehört. Die Luft klärt sich, es ist wieder still, und die Sonne leuchtet wieder in goldigem Glanz. Die erhitzte Lust zittert noch über dem Sand, aber es ist nicht mehr so erstickend wie zuvor. Da zeigt sich neben unserem Weg eine Reihe Palmen, und vor ihnen glänzt ein silberner Wasserstreifen! Warum der Führer nur in anderer Richtung weiterzieht? Das Bild, das da vor uns auftaucht, ist nichts weiter als eine Luftspiegelung, und da, wo wir Palmen erblicken, ist auf viele Tagereisen weit keine Oase zu finden!
Gegen Abend aber erreichen wir eine wirkliche Oase und ruhen nun ein paar Tage aus. Hier sickert Wasser in Hunderten von Brunnen aus dem Sand, hier kann der Boden im Schatten der Palmen bestellt werden, und auf saftigem Rasen genießt man in vollen Zügen die feuchte frische Luft.
Die Oase ist eine Insel im Wüstenmeer, und zwischen den Stämmen der Palmen hindurch schimmert nach allen Seiten hin derselbe gleichmäßige Horizont, die ausgedörrte gelbe Wüste und die grenzenlose, von der Sonne grell bestrahlte Fläche.
Wenn wir jetzt nach Nordwesten abbiegen, berührt unser Weg zunächst das gelobte Land der Dattelpalme, Fessan, die südlichste Provinz von Tripolitanien. Die Dattelpalme wächst hier in solch überreichen Mengen, dass selbst Dromedare, Pferde und Hunde mit Datteln gefüttert werden. Das Erdreich ist nicht mehr so karg und mit Flugsand verschüttet wie in der Libyschen Wüste. Hier schon und weiter nach Westen hin wird das Land gebirgig. Bergrücken und einzelne Hügel aus Granit und Sandstein, verwittert und von der Sonne versengt, erheben sich hier und dort. Die weiten mit Geröll bedeckten Hochebenen nennt man Hammada; sie sind Ruinen ehemaliger abgebröckelter Gebirge. In der Sahara ist der Unterschied zwischen der nächtlichen Temperatur und der des Tages überaus groß. Die dunklen, nackten Gestein-Platten erhitzen sich daher, wenn die Sonne auf sie herabglüht, bis zu sechzig Grad, und in der Nacht findet eine so lebhafte Ausstrahlung nach dem klaren Himmel hinaus statt, dass die Temperatur auf den Gefrierpunkt sinkt. Durch diesen beständigen schnellen Wechsel wird das Gestein unaufhörlich ausgedehnt und wieder zusammengezogen, Risse entstehen, Stücke lösen sich ab und fallen herunter. Die härtesten Gestein-Arten leisten am längsten Widerstand und ragen daher wie seltsame Mauern und Türme mitten in der großen Verwüstung empor.
Noch weiter nach Westen ist das Land der Tuareg. Auch hier erheben sich Gebirge, und Hammadas, Sandwüsten wechseln mit Oasen und trefflichen Weideplätzen. Schon in Timbuktu begegneten wir diesem kleinen kräftigen Wüstenvolk, das man an dem Gesichtsschleier erkennt. Alle Tuareg tragen solch einen Schleier und nennen jeden Unverschleierten „Fliegenmaul“. Die Tuareg sind kräftig gebaute, dunkelhäutige Menschen, die durch Vermischung mit den vielen aus dem Sudan geraubten Sklaven Negerblut in den Adern haben. Sie sind ebenso dürr und mager wie der Boden, auf dem sie leben, und die Natur ihres Landes zwingt sie Nomaden zu sein. Groß, einfach und öde ist die Wüste, groß und einfach ist auch das Leben der Nomaden. Aber der schwere Kampf ums Dasein hat ihre Sinne geschärft. Sie sind scharfe Beobachter, klug und listig. Sie kennen keine Entfernungen und keine Müdigkeit. Auf ihren Renndromedaren durchfliegen sie die halbe Sahara und sind eine Geißel ihrer festangesiedelten Nachbarn und der Karawanen.
Aus dem Herzen ihres Landes nach dem weitentfernten Sudan zu reiten, um dort zu plündern, ist für sie eine Kleinigkeit. Den Bewohnern vieler Oasen haben sie das Leben unerträglich gemacht. Was hilft es, die Felder zu bestellen und die Palmen sorgsam zu pflegen, wenn die Tuareg in jedem Fall die Ernte einheimsen? Die Franzosen haben viele heiße Kämpfe mit den Tuareg zu bestehen gehabt, und noch heute ist die Eisenbahn, die durch ihr Land gehen und Algier mit Timbuktu verbinden sollte, nur ein frommer Wunsch. Und dieser Stamm, der seine Freiheit so tapfer gegen Fremde verteidigt, zählt kaum dreihunderttausend Köpfe! Sie sind nicht zu Sklaven geboren, und man muss ihren Freiheitsdurst, ihren Stolz und ihren Mut immerhin bewundern.
Die Wüste selbst hat sie die schwere Kunst des Lebens gelehrt. Auch die Tiere und Pflanzen, die in der Wüste leben, sind aus besonderer Weise ausgerüstet. Einige der Tiere, z. B. Schlangen und Eidechsen, können ohne Wasser bestehen. Das Dromedar kann sich viele Tage hintereinander ohne Trinken behelfen, der Strauß legt ungeheure Entfernungen zurück, um Wasser zu finden. Die Kräuter haben gewaltig ausgebildete Wurzeln, um so viel Feuchtigkeit wie nur möglich aufzusaugen, und viele Pflanzen tragen Dornen und Stacheln statt der Blätter, damit die Verdunstung unbedeutend werde. Viele von ihnen werden durch einen einzigen Regen ins Leben gerufen, entwickeln sich in wenigen Wochen und sterben, sobald die lange Zeit der Trockenheit beginnt. Dann bleiben aber die Keime liegen und warten geduldig auf den nächsten Regen. Oft sehen diese Wüstenpflanzen völlig vertrocknet und wie vom Staub erstickt aus; aber wenn der Regen kommt, treiben sie dennoch grüne Schösslinge.
Wadi heißt jedes Flussbett in der Sahara. Überaus selten fließt aber ein Rinnsal darin. Doch ist in diesen Flussbetten die Vegetation reicher als anderswo, denn hier hält sich die Feuchtigkeit länger. Daher ziehen auch viele Karawanen neben ihnen hin, und Gazellen und Antilopen finden dort ihre Weide.
Trotz aller Schrecken der Wüste zieht der Europäer in die Sahara hinein. In den französischen Städten an der Mittelmeerküste Algiers kann er leben wie in seiner Heimat. Die Eisenbahn führt ihn durch die bewaldeten Berge des Atlas, wo klare Bäche zwischen den Bäumen rieseln. Aber er lässt Eisenbahn und Wälder hinter sich zurück und sieht die Berge immer kahler werden, je weiter er nach Süden vordringt. Schließlich dehnt sich vor ihm die ebene, öde, nur schwachgewölbte Wüste, und wie mit Zaubermacht zieht ihn die Sahara immer tiefer in ihr großes Schweigen und ihre Einsamkeit hinein. Alle Farben werden gedämpft und grau-gelb wie das Fell des Löwen. Der Europäer weiß nicht, warum ihm dies schöner erscheint als die Wälder und Bäche des Atlas. Ihn lockt der geheimnisvolle Horizont in der Ferne, der blutrote Sonnenuntergang und die mächtige, tonlose Stimmung, die über der Wüste liegt und in der man kaum laut zu sprechen wagt! –
Auf diesem Weg von Algier nach Süden durch die Sahara zog vor dreißig Jahren eine große französische Expedition, deren Führer Oberst war.
Paul Flatters, * 16. September 1832 – † 16. Februar 1881
Sie bestand aus ungefähr hundert Mann, darunter sieben französische Offiziere und einige Unteroffiziere; Gepäck und Proviant trugen dreihundert Dromedare. Die Expedition sollte im Auftrag der französischen Regierung das Land der Tuareg erforschen und für eine Eisenbahn eine passende Route abstecken, die quer durch die Sahara hindurch die französischen Besitzungen im Norden und im Süden miteinander verbinden könne. Es war nicht das erste Mal,