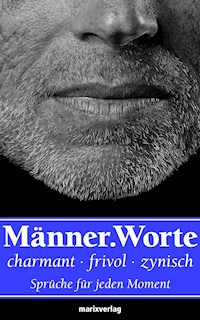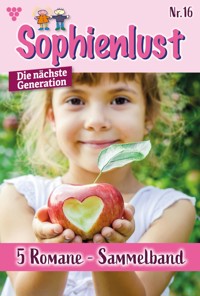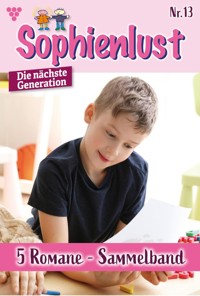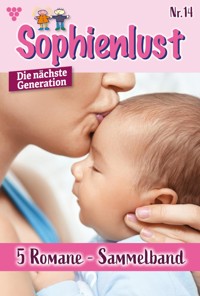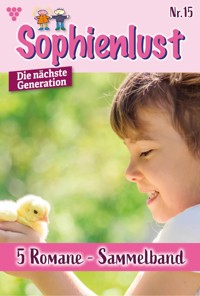25,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami Staffel
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Familie ist ein Hort der Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit. Wir alle sehnen uns nach diesem Flucht- und Orientierungspunkt, der unsere persönliche Welt zusammenhält und schön macht. Das wichtigste Bindeglied der Familie ist Mami. In diesen herzenswarmen Romanen wird davon mit meisterhafter Einfühlung erzählt. Die Romanreihe Mami setzt einen unerschütterlichen Wert der Liebe, begeistert die Menschen und lässt sie in unruhigen Zeiten Mut und Hoffnung schöpfen. Kinderglück und Elternfreuden sind durch nichts auf der Welt zu ersetzen. Genau davon kündet Mami. E-Book 1179: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben E-Book 1180: Er nannte es Vaterliebe E-Book 1181: Das Leben meint es gut mit ihnen E-Book 1182: Entführt… E-Book 1183: Armes reiches Kind E-Book 1184: Julchen, das Wunschkind der Fürstin E-Book 1185: Vier Wochen mit Papa E-Book 1186: Laß mich an ein Wunder glauben E-Book 1187: Das bleibt unter uns, Toffi E-Book 1188: Immer Ärger mit den Nachbarn E-Book 1: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben E-Book 2: Er nannte es Vaterliebe E-Book 3: Das Leben meint es gut mit ihnen E-Book 4: Entführt… E-Book 5: Armes reiches Kind E-Book 6: Julchen, das Wunschkind der Fürstin E-Book 7: Vier Wochen mit Papa E-Book 8: Laß mich an ein Wunder glauben E-Book 9: Das bleibt unter uns, Toffi E-Book 10: Immer Ärger mit den Nachbarn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1261
Ähnliche
Inhalt
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben
Er nannte es Vaterliebe
Das Leben meint es gut mit ihnen
Entführt…
Armes reiches Kind
Julchen, das Wunschkind der Fürstin
Vier Wochen mit Papa
Laß mich an ein Wunder glauben
Das bleibt unter uns, Toffi
Immer Ärger mit den Nachbarn
Mami – 6–
Staffel
1179-1188
Diverse Autoren
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben
Willkommen bei uns, kleiner Mann
Roman von Meare Edna
Irgendwie erinnerte Marlies Gründing Nathalie an eine Barbiepuppe. Genauso blond, genauso schlank, genauso hohl. Wer immer diese entsetzlichen Blondinenwitze aufgebracht hatte, die jetzt allenthalben kursierten, er mußte zuvor eine Unterhaltung mit Marlies geführt haben.
Nathalie Reinke zog unbewußt die Oberlippe über die Zähne, während sie zusah, wie Werner – ihr Noch-Ehemann – dem blonden Püppchen über die zartmanikürte Hand strich. Eine vertrauliche Geste, die das Püppchen beruhigen sollte, aber Püppi wollte sich nicht beruhigen. Püppi wollte ihren Willen durchsetzen, jawohl, und das um jeden Preis.
»Du hast ein Recht auf das Haus!« beharrte es eigensinnig, während die Anwälte verzweifelt die Augen rollten. »Wieso soll es deine Frau bekommen? Wir können auch darin wohnen. Oder willst du, daß wir bis an unser Lebensende in dieser Bruchbude von einem Appartement bleiben?«
Die »Bruchbude« bestand aus einer Vierzimmer-Luxus-Eigentumswohnung, die Werner seiner Püppi zum Geschenk gemacht hatte, und von deren Balkon aus man einen wunderschönen Rundblick auf die Stadt Wiesbaden und den Taunus hatte.
»Liebling«, versuchte Werner, seine Geliebte und zukünftige Ehefrau zu versöhnen. »Natürlich brauchst du nicht ewig in diesem Appartement zu bleiben. Wir werden schon ein hübsches Zuhause für uns finden.«
»Ich will aber nicht irgendwas zum Wohnen, sondern das Haus!« beharrte Marlies-Püppi auf ihrem Willen und jetzt glich sie eigentlich gar nicht mehr einer Barbie, sondern eher einer gereizten Katze, die das Fell sträubt. »Du hast es mir versprochen. Das Haus und den Schmuck und…«
»Anscheinend hat der gute Werner mal wieder den Mund zu voll genommen«, platzte Nathalie heraus. Sie wußte, daß es weise gewesen wäre zu schweigen, aber sie konnte sich einfach nicht länger zurückhalten. Dieser Scheidungskrieg nahm immer groteske Formen an. Und die Ursache dafür saß hier vor ihr, blond, glubschäugig und vollbusig. Eine raffgierige kleine Puppenschlange, die den Hals einfach nicht voll bekam.
»Das ist eine Marotte von ihm, müssen Sie wissen«, spottete Nathalie wütend. »Werner verspricht einem das Blaue vom Himmel, wenn er etwas will. Leider vergißt er seine Versprechungen aber rasch, wenn er erst einmal bekommen hat, was er wollte.«
Marlies bekam schmale Augen.
»Bei mir ist er anders!« fauchte sie katzig. »Und ich schwöre Ihnen, daß er sein Wort halten wird. Ich bekomme das Haus und alles, was er mir versprochen hat. Sonst…«
Sie sprach nicht aus, was passieren würde, wenn Werner sich ihrem Willen widersetzte, aber es schien etwas Unangenehmes zu sein, denn er zuckte wie getroffen zusammen.
»Können wir vielleicht einmal vernünftig miteinander reden?« mischte sich Dr. Berger, Werners Anwalt, ein, bevor Werner zu einer Antwort ansetzen konnte. »Ich denke, das Ehepaar Reinke hat im Vorfeld schon bestimmt Dinge besprochen, die wir jetzt fixieren sollten. Dann kann…«
»Was mein Verlobter im Vorfeld gesagt hat, tut nichts zur Sache«, mischte Marlies sich erneut ein. »Wir sind inzwischen übereingekommen, daß wir alles ganz anders haben möchten. Ich bestehe auf der Herausgabe des Hauses und…«
»Jetzt halten Sie sich endlich raus!« platzte Dr. Hoffmann, Nathalies Anwalt, dazwischen. Ihm ging das Gezeter der blonden Dame auf die Nerven, und er war beileibe nicht der einzige! »Lassen Sie uns vernünftig reden. Herr und Frau Reinke, Sie – Herr Reinke – wollten das Haus Ihrer Gattin überlassen, damit sie und die Kinder ihr Zuhause behalten können. An monatlichen Unterhaltszahlungen…«
»Das Haus gehört mir!« Marlies sprang auf und hackte mit ihren spitzen Absätzen auf dem Boden herum. »Ich will das Haus, Werner. Gib mir das Haus!«
»Und wo bitte soll meine Mandantin mit den Kindern wohnen?« fragte Dr. Hoffmann entnervt.
»Das ist doch nicht unsere Sache«, erwiderte Marlies, plötzlich die Ruhe selbst. »Frau Reinke hat meinen Verlobten lange genug ausgenommen. Jawohl, ich sag ›ausgenommen‹! Immerhin war sie seit der Geburt des ersten Kindes nicht mehr berufstätig, hat also die Versorgung der Familie einzig und alleine meinem Verlobten überlassen…«
»Jetzt reicht’s!« Nathalie hatte keine Lust mehr, dieses entwürdigende und alberne Treffen fortzusetzen. »Werner, wenn du nicht in der Lage bist, diese kleine Schla…« Rechtzeitig trat Dr. Hoffmann seiner Mandantin unterm Tisch gegen das Schienbein, so daß Nathalie vor Schreck den Rest des Wortes verschluckte. »In der Lage bist, diese Unterredung ohne die Einflüsterungen deiner Geliebten durchzuführen, sollten wir das Treffen abbrechen. Ich sehe nicht, daß wir momentan zu einer Einigung kommen können.«
»Ich auch nicht«, zischte Marlies. »Werner hat genug bezahlt. Jetzt gehört er mir und wird sich um mich kümmern. Er kann nicht für zwei Familien aufkommen.«
»Wollen Sie nicht einen kleinen Schaufensterbummel machen?« schlug Dr. Berger, am Ende seiner Geduld angelangt, vor. »Ich habe drüben in der Boutique ›Für Sie‹ ein wunderschönes Sommerkleid gesehen, das Ihnen bestimmt hervorragend stehen würde. Und die passenden Schuhe standen auch daneben.«
»Ich brauche kein Kleid, ich brauche ein Zuhause«, schmetterte Marlies den Einwand des Anwalts ab. Sie war wild entschlossen, ihre Pläne durchzusetzen.
Unter dem Tisch hieb sie ihren spitzen Absatz auf Werners Fuß, der daraufhin gequält das Gesicht verzog.
»Ja, also«, begann er sofort loszuhaspeln. »Sie haben es ja gehört und du auch, Nathalie. Was wir da mal so besprochen haben, also das hat keinen Bestand mehr. Weißt du, bei mir hat sich einiges geändert, mußt du wissen. Es ist einfach so, daß ich das Haus brauche. Und ich kann dir leider auch nicht soviel zahlen, wie ich zuerst dachte. Es ist so…« Verlegen wanderten seine Blicke zu Marlies, die zu einem neuen Tritt ansetzte. Als sich ihr Pfennigabsatz in seinen Schuh bohrte, sprach Werner hastig weiter. »Es ist so, daß mir nach der letzten Steuererklärung eigentlich gar nichts mehr geblieben ist. Zum Glück hat mir Marlies unter die Arme gegriffen und ihr Kapital beigesteuert. Dafür mußte ich ihr allerdings die Firma und alle Werte überschreiben. Ja also, ich bin im Grunde ein Habenichts. Tut mir leid, Nathalie…«
Er hatte so schnell gesprochen, daß weder die Anwälte noch Nathalie so richtig begriffen, was er ihnen eigentlich sagen wollte. Dr. Berger und Dr. Hoffmann wechselten ein paar leicht irritierte Blicke miteinander, dann holte Dr. Berger tief Luft und lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
»Stimmt, so ist die Sachlage«, hob er an, um eine sichere Haltung bemüht. »Ihr Mann hatte leider in den vergangenen Monaten ein paar Verluste. Dazu kam eine Steuerschuld von mehreren tausend Mark – Herr Braumeister, der Steuerberater Ihres Gatten, kann das besser erklären als ich – jedenfalls ist es so, daß sich Ihr Gatte gezwungen sah, seine Firma in die Hände einer dritten Person zu überantworten, um seine persönliche Habe vor dem Fiskus zu retten.«
Dr. Hoffmann und Nathalie sahen einen Moment betreten drein. Dann hob Nathalie den Kopf und sah abwechselnd in die Gesichter ihres Ehemannes und seiner Geliebten. Selbstzufriedene Siegesgewißheit strahlte ihr entgegen. Die beiden hatten ein hübsches Süppchen angerührt, das ihnen die fettesten Brocken garantierte.
Werner Reinke war nach wie vor der Chef des Betriebes. Aber für den Fiskus war Marlies Gründing mit sofortiger Wirkung als Inhaberin der Bauschreinerei Reinke, nunmehr »Reinke und Co.« anzusehen. Damit konnte sich Werner auch vor allen Unterhaltsverpflichtungen drücken.
Genau das war der Sinn der Sache. Schuldbewußt lächelnd eröffnete Werner seiner Frau, daß er leider total verschuldet sei und deswegen nicht in der Lage, seinen Kindern und ihr die monatlichen Zahlungen zukommen zu lassen. Nach dem Motto »Faß’ einem nackten Mann in die Tasche« hatte er sich allen Verpflichtungen entzogen.
Diese Nachricht traf Nathalie wie ein Schlag ins Gesicht. Als Werner ihr damals eröffnete, daß er sich in seine Sekretärin verliebt hatte und fortan mit ihr leben wollte, war das Paar übereingekommen, die Trennung ohne den ganzen Scheidungskrieg hinter sich zu bringen, den andere Paare in dieser Situation anzetteln.
Eine saubere Trennung, bei der alle Beteiligten ihr Gesicht und ihre Würde behielten, war angestrebt gewesen. Nein, Nathalie hatte sich nicht gegen die Scheidung gewehrt. Sie und Werner hatten sich schon vor langer Zeit auseinandergelebt. Aber um der Kinder willen hatten sie stets versucht, ihre Differenzen in sauberer, anständiger Form auszutragen, vor allem nicht vor den Augen und Ohren der Kinder.
In aller Ruhe hatten sie sich zusammengesetzt und einen Plan aufgestellt. Nathalie sollte das Haus behalten, damit sie und die Kinder ein Dach über dem Kopf hatten. Werner überwies jeden Monat pünktlich einen bestimmten Betrag, der ausreichte, die Famlie zu ernähren. Nathalie arbeitete vormittags in der Boutique einer Freundin, so daß sie finanziell gut über die Runden kam.
Alles schien seinen Gang zu gehen. Man hatte die Achtung voreinander behalten, respektierte sich und ging freundschaftlich miteinander um. Aber dann waren die Zahlungen unregelmäßig geworden, blieben auch mal ganz aus, und schließlich hatte Werner kleinlaut zugegeben, sich in finanziellen Schwierigkeiten zu befinden.
Die Zeiten waren aber auch schlecht. Es gab kaum einen Betrieb in der Baubranche, der nicht über Verluste klagte. Also hatte Nathalie sich verständnisvoll gezeigt und Werner die ausstehenden Unterhaltszahlungen gestundet. Aber jetzt, während sie hier mit ihm an diesem Tisch im Café Walther saß und in die selbstzufriedenen Gesichter des Paares blickte, begriff sie, daß die beiden sie schlichtweg betrogen.
Nathalie selbst hätte noch auf die Zahlungen verzichten können. Was sie jedoch maßlos ärgerte, war die Art und Weise, in der sich Werner seinen Kindern gegenüber verhielt. Es schien gerade so, als wollte er mit seiner Trennung von Nathalie auch seine ganze Vergangenheit abstreifen.
Seine nächsten Worte untermauerten diesen Verdacht.
»Ich kann schließlich nicht dauernd für etwas bezahlen, das lange hinter mir liegt«, erklärte er, ohne den Anflug schlechten Gewissens. »Marlies und ich, wir wollen unser eigenes Leben aufbauen, Kinder haben. Nein, ich bin noch nicht zu alt, Babys zu haben. Aber wenn ich für drei andere Kinder bezahlen muß, kann ich mir keinen weiteren Nachwuchs mehr leisten.«
»Das hättest du dir vielleicht vorher überlegen sollen!« platzte Nathalie heraus. Ihr Anwalt tippte ihr unter dem Tisch warnend ans Schienbein.
»Sie können sich nicht so ohne weiteres Ihren Verpflichtungen entziehen«, fiel er Nathalie ins Wort, bevor sie fortfahren konnte. »Herr Reinke, Ihren Kindern steht eine gewisse Unterhaltszahlung zu. Sie sind verpflichtet, für die drei zu sorgen.«
Werner warf Marlies rasch einen fragenden Seitenblick zu, dann lehnte er sich zurück. Die über der Brust gekreuzten Arme verrieten, daß er nicht bereit war, auf irgendwelche Friedensangebote der Gegenseite einzugehen.
»Ich sage es noch einmal, ich selbst bin mittellos«, beharrte er auf seinem Plan. »Mir gehört nicht mal das Schwarze unter dem Nagel. Wie also wollen Sie mich dazu bringen, zu zahlen?«
Marlies lächelte boshaft.
»Falls Sie einen Pfennig bei meinem Verlobten finden, dürfen Sie ihn gerne behalten«, verkündete sie großzügig. »Aber vielleicht möchte Frau Reinke ja für meinen Verlobten aufkommen. Ist es nicht so, daß immer der wirtschaftlich stärkere Partner für den Schwächeren aufkommen muß?«
Hier platzte Nathalie endgültig der Kragen. Sie hatte absolut keine Lust mehr, sich diesen Unsinn anzuhören. Marlies war vielleicht dumm wie ein Stuhl, aber sie wußte, wie sie ihre Pfründe sichern konnte. Diese Barbiepuppe besaß nicht einen Funken Ehre oder Anstand in ihrem Modelleib!
»Ich sehe die Unterredung als beendet an!« Bevor Dr. Hoffmann oder sonst jemand am Tisch sie zurückhalten konnte, war Nathalie aufgesprungen und eilte durch den Gastraum auf den Ausgang zu.
»Warten Sie doch, Frau Reinke!« rief ihr ihr Anwalt noch hinterher, aber Nathalie war nicht in der Stimmung, sich weitere Lügen und Frechheiten anzuhören.
Wütend stürmte sie aus dem Gastraum, preschte an der Kuchentheke vorbei, ohne auf die erstaunten Gesichter der Verkäuferinnen zu achten, und riß die Ladentür auf.
»Aua!« Der elegant gekleidete Herr, der sich gerade anschickte, die Konditorei zu betreten, hielt sich krampfhaft am Türrahmen fest. Vor Schreck wußte er gar nicht genau, was ihm mehr weh tat. Die Füße, über die diese aufgebrachte Megäre gerade hinwegtrampelte, seine Brust, an den der Holzkopf der Dame geprallt war, oder seine Finger, die zwischen der Zarge und dem zufallenden Türblatt steckten.
»Verdammt, was stehen Sie da herum!« herrschte Nathalie den heftig Malträtierten an. »Gehen Sie endlich zur Seite, ich hab’s eilig.«
Die Finger des Mannes steckten immer noch im Türspalt. Vor Schmerzen fiel ihm keine passende Entgegnung ein. Und die Tränen in seinen Augen machten es ihm unmöglich, die Xanthippe genauer anzusehen. Er wußte nur eins: Falls er seine Finger jemals wieder würde gebrauchen können, würde er sie dieser Frau um den Hals legen und zudrücken.
Nathalie drängelte sich rücksichtslos an ihm vorbei. In diesem Moment gelang es dem Mann endlich, seine Finger zu befreien. Der Schmerz löste Wut in ihm aus. Eine Wut, die ihn für die Pein momentan unempfindlich machte.
»Sie Trampel!« brüllte er Nathalie an, wobei er heftig die Hand schüttelte. Eine unbewußte Handlung, die eigentlich das Pochen in seinen Fingern beruhigen sollte, von Nathalie jedoch gründlich mißverstanden wurde.
Bevor der Ärmste richtig begriff, was mit ihm geschah, hatte Nathalie ihm eine schallende Ohrfeige versetzt.
»Drohen Sie, wem Sie wollen!« schrie sie ihn an. »Aber nicht mir, verstanden? Mit mir können Sie das nicht machen.«
»Sie sind ja verrückt!« schrie der Ärmste zurück. Er verstand die Welt nicht mehr. Er hatte nichts anderes vorgehabt, als sich ein Kuchenstückchen zu kaufen, und jetzt befand er sich mitten in einem Krieg. Diese Frau konnte nicht ganz normal sein! »So was wie Sie dürfte überhaupt nicht frei herumlaufen! Sie gehören eingesperrt. Sie sind ja eine Gefahr für die Umwelt.«
»Und Sie sind ein aufgeblasener Angeber!« tobte Nathalie zurück. »Aber was will man schon von einem Ihres Geschlechts verlangen! Ich sage bloß ›Männer‹. Bah!«
»Himmel, eine militante Emanze!« Der Fremde wedelte erneut mit der Hand, ließ den Arm aber rasch sinken, als er das Aufblitzen in Nathalies Augen bemerkte. »Ihr Mann sollte Sie am Herd festbinden, anstatt Sie frei in der Stadt herumlaufen zu lassen.«
»Und Sie sollten sich überlegen, was Sie sagen«, lautete die Gegenoffensive. »Das heißt, falls einer wie Sie überhaupt denken kann.«
Der Mann schnappte empört nach Luft. Diesen Umstand nutzte Nathalie, ihm noch ein wütendes »Dummschwätzer!« an den Kopf zu werfen und davonzustürmen. Sie war so wütend, daß sie am liebsten jeden Passanten, der ihr entgegenkam, gebissen hätte.
Zum Glück gab sie diesem Verlangen nicht nach. Zornig stieg sie in ihren Wagen und brauste davon, während ihr Opfer kopfschüttelnd die Konditorei betrat.
Dort erlöste ihn kaltes Wasser und ein Glas Cocnac von den schlimmsten Qualen. Der Ärmste schimpfte noch auf die rücksichtslose Megäre, die ihn beinahe amputiert und reichlich ramponiert hatte, als Nathalie längst ihren Wagen in die stille Seitenstraße lenkte, in der sie seit fünfzehn Jahren mit ihrer Familie lebte.
*
Regina Klee wohnte direkt nebenan und freute sich immer, wenn sie auf Stephanie, den jüngsten Sproß der Familie Reinke, aufpassen durfte. Da den Klees selbst Kindersegen bisher versagt geblieben war, besaß Regina noch diesen unerschütterlichen Glauben, daß alle Kinder nett, süß und liebenswert sind. Davon konnte sie auch Steffis manchmal beachtlichen Dickkopf nicht abbringen.
»War sie artig?« wollte Nathalie wissen, als sie ins Wohnzimmer kam, in dem Steffi ihre gesamte Legokollektion ausgebreitet hatte.
Die Kleine sah nur kurz von ihren Bauarbeiten auf, lächelte ihrer Mutter zu und widmete sich dann wieder ihrem Spiel.
»Sehr artig«, behauptete Regina überzeugt. »Wir haben Milchreis gegessen und dann haben wir einen schönen Turm gebaut, nicht wahr, Steffi?«
Die Kleine nickte, ohne ihr Spiel zu unterbrechen.
»Und wie war’s bei dir?« wollte Regina nun ihrerseits von Nathalie wissen.
Allein die Art, wie Nathalie bei dieser Frage das Gesicht verzog und die Fäuste ballte, war schon Antwort genug.
»Hast du dir schon mal gewünscht, daß jemanden der Blitz trifft?« erkundigte sich Nathalie mit leiser Stimme, um Steffi nicht auf sich oder vielmehr auf das Gespräch aufmerksam zu machen.
»Ich verstehe«, nickte Regina hastig. »War diese – du weißt schon wer – dabei?«
»Paps neue Fleundin«, meldete sich Steffi aus dem Untergrund. Zweimal die Woche besuchte Nathalie mit ihr eine Logopädin, da Stephanie einfach kein »R« sprechen konnte, aber bisher wurden alle sprachpädagogischen Anstrengungen von wenig Erfolg gekrönt. »Sie ist doof.«
»Ja, sie war dabei«, seufzte Nathalie. Die Erinnerung an dieses Treffen jagte ihren Blutdruck erneut in die Höhe. »Ich erzähle dir alles nachher. Jetzt brauche ich erst einmal einen Kaffee. Einen Kaffee und mindestens fünf Zigaretten, damit ich wieder auf Normal Null komme.«
»Legina sagt, Lauchen macht klank«, meldete sich Steffi erneut. »Walum lauchst du, Mama?«
»Weil deine Mama unvernünftig ist, jawohl«, erwiderte Nathalie wahrheitsgemäß. »Und weil deine Mama heute ganz furchtbar schlechte Laune hat. Also solltest du sie nicht dauernd irgendwas fragen, sonst wird ihre Laune vielleicht noch schlechter.«
»Walum hast du schlechte Laune?«
»Weil –« Nathalie seufzte. »Ach, das erzähle ich dir ein anderes Mal. Jetzt räum mal deine Steine weg und dann sieh nach, was Sandra macht. Sag ihr, daß ich Punkt drei Uhr mit ihr losgehen möchte.«
»Wohin?« Steffi war im besten Fragealter.
»Zum Optiker«, seufzte Nathalie, der die Unterhaltung mehr und mehr auf die Nerven ging. »Du weißt doch, daß sie eine Brille braucht. Heute bin ich genau in der richtigen Stimmung für einen solchen Kauf.«
»Glaubst du?« mischte sich Regina skeptisch ein.
»Ja, das glaube ich«, beharrte Nathalie auf ihrem Vorsatz und scheuchte Steffi aus dem Zimmer.
Doch den Frauen blieb keine Zeit, sich über die Ereignisse im Café Wagner zu unterhalten, denn kaum hatte Steffi die Treppe ins Obergschoß erklommen, da erhob sich oben ein mittelschwere Sturm, der mit Türenschlagen und hysterischem Gekreische Einzug hielt. Gleich darauf stolperten schwere Doggers die Treppenstufen herunter.
»Nein, Mama, das darfst du mir nicht antun!« Sandra Reinke erschien total aufgelöst im Wohnzimmer. »Ich will keine Brille, hörst du! Wenn ich so ein Ding aufsetzen muß, gehe ich nie mehr auf die Straße. Ich schließe mich den ganzen Tag in mein Zimmer ein und komme nie wieder heraus.«
Nathalie musterte ihre Tochter mit einem langen, abschätzenden Blick. Als sie sprach, ließ ihr Ton keinen Widerspruch mehr zu.
»Wir diskutueren jetzt seit drei Wochen über dieses Thema. Du bist blind wie ein Maulwurf, das wissen wir inzwischen beide, nicht wahr? Und heute wird endlich etwas dagegen getan. Ich kann mir leider keinen Blindenhund für dich leisten.«
»Aber eine Brille macht mich unmöglich!« kreischte Sandra, obwohl sie der Ton ihrer Mutter hätte warnen müssen. »Keine Castingagentur nimmt mich mit so einem Ding auf der Nase. Du vernichtest meine Karriere, wenn du mich zwingst, damit herumzulaufen.«
Nathalie stemmte die Fäuste in die Seiten.
»Paß auf!« forderte sie barsch. »Ich habe heute sehr, sehr schlechte Laune. Und du weißt, wenn ich schlechte Laune habe, lasse ich nicht mit mir handeln. Also hör’ auf, mich anzuschreien, und finde dich mit deinem grausamen Schicksal ab. Heute bekommst du eine Brille. Und du wirst sie tragen. Ende der Diskussion.«
Sandra schossen die Tränen in die Augen. Sie war ein hübsches Mädchen, mit langen, honigblonden Haaren, die sie im Nacken mit einem roten Band zusammengebunden hatte.
Gerade vierzehn Jahre alt, steckte sie mitten in diesem schrecklichen Alter, in dem man nie weiß, was man nun eigentlich ist. Gehörte man schon zu den Großen? War man noch ein Kind? Die ganze behütete, herrliche Zauberwelt, in der man bisher gelebt hatte, war plötzlich aus den Fugen geraten, und ein Traum nach dem anderen wurde einem geraubt. Wie gesagt, keine leichte Zeit!
Irgendwann war es Nathalie aufgefallen, daß Sandras Nase beim Lesen buchstäblich an den Buchseiten klebte. Die anschließende Untersuchung beim Augenarzt hatte dann ergeben, daß das Mädchen extrem kurzsichtig war und dringend eine Sehhilfe benötigte.
Das gefiel Sandra natürlich überhaupt nicht. Seit drei Wochen versuchte sie nun, den Gang zum Optiker zu vermeiden, aber so wie es aussah, schien heute der Tag X gekommen zu sein, an dem die Brille nicht mehr zu umgehen war.
Sandra wollte es noch nicht ganz wahrhaben.
»Ich ziehe das Ding nicht auf!« verkündete sie bockig, wobei die ersten Tränen in ihren schönen, bernsteinfarbenen Augen glitzerten. »Da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Sobald ich dieses Haus verlasse, ziehe ich das häßliche Ding ab und werfe es in den nächsten Gully.«
»Dann bekommst du eine neue und verzichtest für den Rest deines Teenagerlebens auf Taschengeld«, lautete Nathalies Antwort. Sie ging in die Küche, um die Kaffeemaschine in Gang zu setzen. Sandras zorniges Aufheulen folgte ihr.
»Eine Brille ist doch kein Weltuntergang«, versuchte Regina die Nachbarstochter von den Vorzügen einer Sehhilfe zu überzeugen. »Schau doch mal, du wirst viel besser sehen und mußt dich nicht…«
»Laß mich in Ruhe!« kreischte Sandra und raste die Treppe hinauf. Das letzte, das Regina und Nathalie von ihr hörten, war ein zorniges Kreischen und dann das Zuschlagen ihrer Zimmertür.
»Oje!« Regine kam dann in die Küche und sah besorgt zu, wie Nathalie Kaffeepulver in den Filter häufte.
»Vielleicht solltest du heute doch besser auf den Gang zum Optiker verzichten«, versuchte Regina, ihre Freundin von dem Vorhaben abzubringen. »Das ist heute nicht dein Tag, fürchte ich. Du hast dich schrecklich über Werner geärgert und willst jetzt Dampf ablassen. Das ist okay, aber du solltest dafür nicht deine Kinder mißbrauchen.«
Nathalie fuhr so abrupt herum, das Regina erschrocken zurücksprang.
»Ich habe mir heute wirklich genügend Unsinn anhören müssen!« fuhr Nathalie die Nachbarin unbeherrscht an. »Jetzt komm du mir nicht auch noch mit Vorwürfen und weiß ich was für seltsame Umschreibungen und Ausreden. Alles, was ich will, daß meine Tochter ohne Blindenbinde und Stock über die Straße gehen kann. Wenn du das als Mißbrauch oder Willkür auslegen möchtest, dann halte jetzt besser deinen Mund.«
»Nein, nein!« Regina hob abwehrend die Hände. »Ich will dir natürlich keine Vorschriften machen. Sicher hast du recht, wenn du dir um die Gesundheit deines Kindes Sorgen machst. Ich befürchte einfach nur, daß heute nicht der richtige Tag dafür ist. Wieso gehst du nicht morgen mit Sandra los?«
»Weil ich genau heute in der richtigen Stimmung bin«, erwiderte Nathalie grimmig. »Morgen überredet mich das kleine Biest wahrscheinlich doch wieder, nicht zum Optiker zu gehen. Ich lasse mich von ihren Tränen und Vorhaltungen weichklopfen, und zum Schluß hat sie ihren Kopf doch durchgesetzt. Nein, heute bekommt Sandra eine Brille, so wahr ich hier stehe, und auch du, liebste Regina, wirst mich nicht von meinem Vorhaben abbringen.«
Regnia seufzte nur entsagend. Sie kannte Nathalie lange genug, um zu wissen, wann man besser damit aufhörte, auf sie einzureden. Nathalie konnte nämlich nicht nur verdammt stur, sondern auch äußerst unfreundlich sein, wenn man sie allzusehr bedrängte.
»Soll ich auf Steffi aufpassen, wenn ihr beim Optiker seid?« erkundigte sich Renate daher nur freundlich und gab alle weiteren Versuche auf, das Unheil von Sandra abzuwenden.
»Ja, das wäre nett«, nahm Nathalie das Angebot erleichtert an. Steffi war ein liebes, aber lebhaftes Kind, das wie alle Kinder in diesem Alter ruck zuck einen Laden verwüsten konnte, wenn es sich langweilte. Und Steffi langweilte sich schnell.
»Dann bin ich so gegen halb drei wieder hier«, meinte Regina nachdenklich. »Erzählst du mir noch, wie die Besprechung war, oder sprichst du momentan nicht so gerne darüber?«
Nathalie warf einen raschen Blick auf die Diele hinaus. Von Steffi und Sandra war weit und breit nichts zu sehen.
»Also gut«, hob sie an, während sie an den Geschirrschrank trat, um Teller und Tassen herauszunehmen. »Es war – mit einem Wort – schrecklich. Werner hat seine Freundin mitgebracht, ohne die er ja scheinbar keinen Schritt mehr tut. Angeblich ist er pleite. Steuerschulden, behauptete er. Um die Firma vor dem Konkurs zu retten, hat dieses Puppengesicht einige Mark reingebuttert. Dafür mußte er ihr allerdings die Firma überschreiben.«
»Nein!« Regina war unter ihrer Sonnenbrille blaß geworden. »Also das hätte ich ihm nun wirklich nicht zugetraut. Das ist doch ein ganz mieser Trick, um sich vor den Zahlungen zu drücken. Was willst du denn jetzt machen?«
Nathalie ließ die Arme sinken.
»Wenn ich das wüßte.« Plötzlich wirkte ihre Miene verzweifelt. »Ohne Werners monatliche Zahlungen kommen wir nicht über die Runden. Ich werde vielleicht wieder ganztags arbeiten gehen müssen.« Sie seufzte. »Aber das ist noch nicht alles. Seine Freundin will unbedingt das Haus haben.« Zornesröte schoß ihr ins Gesicht. »Du glaubst nicht, was ich mir von der habe anhören müssen. Von wegen, ich hätte lange genug auf Werners Kosen gelebt und könne jetzt selbst mal zusehen, wie ich meine Brut und mich selbst ernähre. Und Werner saß dabei und hat ein dummes Gesicht gemacht.«
Regina schüttelte den Kopf. Sie verstand die Welt nicht mehr. Damals, als sie in diese Straße gezogen waren, hatte die Ehe der Reinkes einen sehr intakten, harmonischen Eindruck gemacht. Regina hatte geglaubt, das ideale Ehepaar vor sich zu sehen. Erst nach und nach war ihr bewußt geworden, daß nicht alles, was so goldig aussah, auch tatsächlich so war.
Aber dann hatten sich die beiden doch wieder zusammengerauft. Das Resultat war Steffi gewesen, die heute vier Jahre alt war. Schon bald nach der Geburt der Kleinen hatte es jedoch zwischen den beiden erneut zu kriseln begonnen. Und irgendwann war dann Marlies Gründing aufgetaucht.
»Wenn ich dir irgendwie helfen kann«, murmelte Regina, in Gedanken noch in der Vergangenheit gefangen.
Nathalie schüttelte den Kopf.
»Ich schaffe es schon«, erklärte sie entschlossen. »Bisher ist es immer irgendwie weitergegangen.« Sie nahm die Kanne aus der Maschine und schenkte Kaffee ein. »Ich werde versuchen, einen Ganztagsplatz im Kindergarten zu bekommen. Und falls das nicht klappen sollte, müssen eben Sandra und Dennis auf Steffi aufpassen. Die beiden sind alt genug, um gewisse Aufgaben in der Familie zu übernehmen.«
»Ich kann doch Steffi nehmen!« bot Regina sofort an, wofür sich Nathalie mit einem Lächeln bedankte. Aber im stillen wußte sie bereits, daß sie dieses Angebot nicht annehmen würde. Regina war eine reizende Frau, die sich sicherlich aufopfernd um die Kleine kümmern würde. Aber sie würde Steffi auch nach Strich und Faden verziehen. Und genau das wollte Nathalie vermeiden.
»Wir reden noch darüber«, wich Nathalie deshalb aus. »Ich muß erst einmal sehen, ob ich überhaupt ganztags arbeiten kann. Die Boutique läuft gut, aber ich glaube nicht, daß sich Hannelore eine Ganztagskraft leisten kann.
Komm, laß uns Kaffee trinken und über etwas Netteres sprechen«, schlug sie vor, bevor Regina das Thema weiter verfolgen konnte. »Magst du ein Stück Kuchen?«
Regina ließ sich sofort ablenken.
»O Gott, nein!« wehrte sie beinahe entsetzt ab. »Ich habe ein Kilo zugenommen. Das muß ich erst wieder runterhaben, bevor ich an irgend etwas Süßes auch nur denken darf.«
In den kommenden Minuten vertiefte sie sich darin, Nathalie genau zu erklären, mit welchen Mitteln und Diäten sie dem überschüssigen Kilo den Garaus machen wollte.
*
Sandra sprach auf der ganzen Fahrt in die Innenstadt kein Wort mit ihrer Mutter. Mürrisch die Unterlippe vorgeschoben saß sie auf dem Beifahrersitz und starrte vor sich hin, während Nathalie den Kleinwagen geschickt durch den dichten Cityverkehr lenkte.
In der Tiefgarage unter dem Luisenplatz fanden sie einen Stellplatz. Immer noch schlechtgelaunt, die Arme demonstrativ vor der Brust verschränkt, lief Sandra neben ihrer Mutter her und ließ sich nicht einmal von den bunten Auslagen der Kaufhäuser und Boutiquen, die ihren Weg säumten, ablenken.
In der Fußgängerzone herrschte das übliche Gewimmel. Junge Leute in XXL-Outfits, Baseballkappen im Nacken und Walk- oder Discman auf den Ohren scateten geschickt auf ihren Bladers zwischen den Fußgängern herum, jede kleine Lücke ausnutzend, um ihre Kunst vorzuführen.
Alte Damen mit kleinen Hündchen bevölkerten die Bänke rund um die Kastanien, arme Häute, die, ihre gesamte Habe in Plastiktüten verpackt, bittend die Hand ausstreckten oder teilnahmslos in einem Hauseingang hockten, Rentner, die die Stöcke aufgebracht schwingend über Politik diskutierten oder den Scatern hinterherschimpften, Pärchen, die händchenhaltend herumschlenderten – kurz, das ganze buntgemischte Bild einer Großstadt hatte sich hier konzentriert und erfüllt die Straße mit Leben.
Ab und zu warf Nathalie einen verstohlenen Blick zu ihrer Tochter hinüber, aber Sandra war nicht so leicht zu versöhnen. Ihre Haltung, die zusammengepreßten Lippen, das vorgeschobene Kinn – alles erinnerte Nathalie an Werner. Auch er konnte stundenlang schmollen, wenn etwas nicht nach seinem Kopf ging.
Andererseits konnte Nathalie ihre Tochter sehr gut verstehen. Sie hätte in Sandras Alter wahrscheinlich auch keine Luftsprünge gemacht, wenn man ihr eine Brille verordnet hätte. Für ein vierzehnjähriges Mädchen, das davon träumte, als Schauspielerin oder Fotomodell Karriere zu machen, war dieses Urteil »Brillenträger« geradezu eine Katastrophe.
Dabei nützte es gar nicht, Sandra zu erzählen, daß weiß Gott wie viele der Stars, die sie bewunderte, ebenfalls kurzsichtig waren und Brillen oder Kontaktlinsen trugen. Mädchen in Sandras Alter wollten so etwas nicht hören, sie glaubten ganz einfach, daß ihre angebeteten Stars vollkommen sind, und das ist ja wohl auch irgendwo richtig so.
Nach drei Wochen unergiebiger Diskussionen hatte Nathalie es jedenfalls aufgegeben, ihr Töchterchen umstimmen und überzeugen zu wollen.
Jetzt deutete sie auf die Auslage eines bekannten Brillenherstellers, der seine Ladenkette über ganz Deutschland verbreitet hatte.
»Schau mal, da sind ein paar ganz flotte Modelle dabei«, versuchte Nathalie, das Interesse ihrer Tochter zu wecken.
Sandra warf nur einen Blick auf den Namenszug über dem Schaufenster und erstarrte.
»Nein!« entschied sie entsetzt. »Da setze ich keinen Fuß rein.«
»Verlangt ja niemand von dir«, erwiderte Nathalie gelassen. »Du sollst dir einfach mal die Brillen ansehen. Ich wette mit dir, daß du noch gar keine Vorstellung davon hast, was du überhaupt tragen möchtest.«
»Stimmt«, fauchte Sandra. »Ich will nämlich überhaupt keine Brille tragen. Und falls du dir einbildest, daß ich mit so einem No-Name-Produkt auf der Nase herumlaufe, dann kannst du die Sache endgültig vergessen. Ich lasse mich doch nicht von den anderen auslachen.«
»Okay, es muß also ein Markengestell sein«, seufzte Nathalie nachgiebig. »Und was ist da bei euch in der Klasse so angesagt?«
Sandra zuckte die Schultern und bockte.
Sie war nicht bereit, es ihrer Mutter auch nur ein kleines bißchen leichter zu machen.
»In Ordnung«, beschloß Nathalie. »Dann gehen wir eben weiter.«
Ohne auf Sandras verbissene Miene zu achten, setzte Nathalie ihren Weg fort und erreichte bereits nach wenigen Metern das nächste Geschäft.
»Ist das genehm?« erkundigte sie sich bei ihrer Tochter, die stur zu Boden starrte. »Schau mal, die haben sogar eine recht flotte Joung Collection. Eh, da sind ein paar echt witzige Modelle dabei. Jetzt guck doch mal.«
»Mhmmm«, machte Sandra nur, ohne den Kopf oder wenigstens die Lider zu heben.
Nathalie schluckte ihren Ärger hinunter, packte Sandra am Ärmel ihres XXL-Sweatshirts und zerrte sie in den Laden.
Die Einrichtung und Dekoration war genau auf den Geschmack junger Leute abgestimmt. Futuristische Accessoires, Dance-, Biker-, Raver- und Hiphop-fans kamen hier voll auf ihre Kosten. Welcher Überzeugung man auch angehörte, Teens und In-Twens brauchten hier keine Angst zu haben, daß ihre Brille etwa nicht dem neuesten Stand entsprach.
Nathalie atmete erleichtert auf, als sie sah, daß Sandras Augen doch ein wenig interessiert zu funkeln begannen, während sie sich vorsichtig in dem schicken Laden umsah. Doch Nathalie war schlau genug, Sandra nicht auf das Ambiente anzusprechen, etwa in der Form: »Na, was sagst du, das ist doch genau das, was dir gefällt?«
Mütter wußten nie, was ihren Töchtern gefiel. Sie waren hoffnungslos altmodisch und hatten keine Ahnung. Das war eine Tatsache, die man als Erwachsener besser akzeptierte, sonst machte man sich in den Augen der Teenies hoffnungslos lächerlich.
Statt sich also begeistert über das Interieur zu äußern, wandte Nathalie ihre Aufmerksamkeit dem Verkäufer zu, der gerade aus einem Nebenraum trat und mit einem verbindlichen Lächeln auf den Lippen zu ihnen kam. Aber das Lächeln gefror zu einer grotesken Maske auf seinem Gesicht, als er die Kundin erkannte.
Nathalie erstarrte ebenfalls. Sie kam sich vor, als hätte ihr jemand mit einer riesigen Turbospritze das gesamte Blut mit einem einzigen Zug aus den Adern gesogen. Der Schrecken über dieses unverhoffte Wiedersehen fuhr ihr so in die Glieder, daß sie tatsächlich am ganzen Körper zitterte.
Ihr Gegenüber erholte sich schneller von dem Schock. Seine Miene wurde abweisend.
»Sie wünschen?« erkundigte er sich eisig.
»Meine Mutter wünscht«, maulte Sandra, die nichts von den Spannungen spürte, die plötzlich wie Elektrizität in der Luft schwirrten. »Ich kann auf so’n Omading verzichten.«
»Halt den Mund, Sandra!« Nathalies Stimme klang schärfer als beabsichtigt. Hastig versetzte sie ihrer Tochter einen leichten Stups in die Seite und wandte sich erneut dem Verkäufer zu.
Das Schicksal meinte es heute wirklich nicht sonderlich gut mit ihr.
Aber sie war nicht der Typ, der den Kopf in den Sand steckte und hoffte, daß das Unheil an ihr vorbeiging, ohne sie zu bemerken. So was tat ein mißgünstiges Schicksal nie.
Nathalie beschloß, die ganze Sache positiv zu sehen und sich zu entschuldigen. Vielleicht war es ja genau das, was die Vorsehung von ihr wollte?
»Es tut mir leid«, hob sie an. »Und es ist mir schrecklich peinlich. Ich habe mich wirklich unmöglich benommen.«
Der Verkäufer betrachtete sie einen Moment voller Argwohn, dann entspannte sich seine Miene.
»Also gut«, gab er nach. »Jeder hat mal einen schlechten Tag.«
»Das kann man wohl sagen«, entfuhr es Nathalie erleichtert. »Mich hat’s heute besonders schlimm erwischt. Deshalb war ich auch so ungehalten.« Sie musterte ihn einen Moment, suchte nach Spuren ihres Zusammenstoßes. »Hat es sehr wehgetan?«
»Was?« fragte der Mann zurück, ein kleines Lächeln spielte um seine Lippen. »Meinen Sie die Finger, die Sie mir in der Tür gequetscht haben, das Brustbein, das Sie mir eingerannt haben, oder die Ohrfeige, die ich auch noch einstecken mußte?«
Sandra belauschte die Unterhaltung mit offenem Mund.
»Wovon redet ihr?« erkundigte sie sich erstaunt.
»Halt den Mund«, beschied Nathalie ihr kurz und wandte sich wieder ihrem Opfer zu. »War ich wirklich so rabiat?« fragte sie entsetzt.
»Nun ja, sanft waren Sie jedenfalls nicht«, erwiderte der Verkäufer lächelnd. »Ich dachte, mich überfährt ein Bus. Aber ich hab’s überlebt, und die Finger sind auch schon wieder abgeschwollen. In dem Café würde ich mich an Ihrer Stelle aber nicht so schnell sehen lassen. Die fanden Sie äußerst unsympathisch.«
»Kein Wunder.« Jetzt war Nathalie tatsächlich zerknirscht. »O Gott, wie kann ich das bloß wiedergutmachen?«
»Kaufen Sie eine Brille bei mir, und alles ist vergessen.« Der Mann schien wenigstens Humor zu besitzen. »Ich verrechne es als Gefahrenzulage.«
Nathalie starrte beschämt zu Boden, aber dann raffte sie sich auf.
»Eine Brille brauchen wir tatsächlich«, ging sie auf den lockeren Ton des Verkäufers ein. »Meine Tochter kann kaum die eigene Hand vor den Augen sehen. Sie will es zwar nicht wahrhaben, aber der Augenarzt wollte ihr schon einen Blindenhund mitgeben. Meinen Sie, daß Sie etwas Passendes haben, was einem sehr modebewußten Teenager gefallen könnte?«
»Bloß nichts, was meiner Mutter gefällt«, kam es protestierend aus Sandras Mund. »Sie hat einen unmöglichen Geschmack.«
Der Verkäufer behielt sein geduldiges Lächeln, während er an die futuristisch gestylten Regale trat, in denen sich eine Kollektion wirklich rasanter Brillengestelle befand.
»Schau dich doch mal in aller Ruhe um«, schlug er mit einer einladenden Handbewegung vor. »Was dir gefällt, nimmst du heraus und probierst es an. Da drüben haben wir eine Kamera. Da kannst du dich direkt auf dem Fernsehschirm ansehen.«
»Ehrlich?« Sandras Augen begannen interessiert zu leuchten. »So’ne richtige Videoanlage?«
»Genau das.« Der Verkäufer trat an einen Fernseher und schaltete ihn ein. »Da, schau es dir an. Und dann setz’ mal eine der Brillen auf. Du wirst staunen, wie sehr man damit seinen Typ verändern kann.«
Jetzt war Sandra nicht mehr zu halten. Begeistert trat sie an die Regale und begann, die Modelle eingehend zu studieren.
»So, für die nächsten Stunden wäre die Madame beschäftigt«, meinte Nathalie, als sie sah, daß Sandra bereits die erste Auswahl traf. »Ich gebe Ihnen inzwischen schon mal das Rezept.«
Während Sandra in aller Ruhe aussuchte und anprobierte, besprachen die Erwachsenen schon einmal, wie die Gläser gearbeitet sein sollten. Später mußten sie dann die verschiedenen Modelle begutachten, die Sandra zusammengetragen hatte.
Bewundernd sah Nathalie zu, wie geschickt es der Verkäufer verstand, seine junge Kundin für eine randlose Brille zu begeistern, die eher schlicht wirkte und bei der Nathalie ihren Sonntagshut verwettet hätte, daß Sandra sie niemals nehmen würde.
Aber sie mußte dem Mann recht geben. Das Exemplar stand Sandra hervorragend.
»Damit sind Sie unabhängig«, erklärte der Mann, während er die Videokamera einrichtete. »Sehen Sie, Sie können jede Haarfarbe und jedes Outfit dazu tragen. Vor allem aber verändert es Ihren Typ nicht. Es betont Ihr Gesicht, ohne aufzufallen. Passen Sie auf, einige Ihrer Klassenkameraden werden zuerst gar nicht merken, daß Sie eine Brille aufhaben.«
»Stimmt.« Sandra gefiel das Modell. »Mama, schau mal, was meinst du?«
»Ich find’s super«, beteuerte Nathalie ehrlich begeistert. »Diese Brille ist wie für dich gemacht.«
»Eine Brille ist heute ein Accessoire, wie eine modische Handtasche oder Modeschmuck«, mischte sich der freundliche Verkäufer wieder ein. »Ich habe Kunden, die tragen sie tatsächlich nur, um ihren Typ zu betonen, seriöser zu wirken oder einfach, um modisch top zu sein. Es klingt verrückt, aber die haben tatsächlich nur pures Fensterglas vor den Augen.«
»Ich nehme sie«, verkündete Sandra stolz.
Jetzt hätte sie die Brille am liebsten sofort mitgenommen, aber da mußte sie sich leider noch gedulden. Zuerst wurden die Gläser noch passend geschliffen, eingetönt und entspiegelt. Erst, wenn sie dann ins Gestell eingepaßt waren, konnte Sandra ihr Schmuckstück endlich abholen.
»Das dauert ungefähr eine Woche«, erklärte der nette Verkäufer. »Soll ich anrufen, wenn sie fertig ist?«
Sandra antwortete, bevor Nathalie überhaupt den Mund aufmachen konnte.
»Och ja, bitte!« Schon zückte sie Bleistift und Papier. »Ich schreibe Ihnen unsere Nummer auf.« Hastig kritzelte sie ein paar Zahlen auf den Zettel und schob ihn über den Verkaufstisch. »Kann ich jetzt zu Maggy?« erkundigte sich Sandra, während sie bereits ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trat. »Ich muß ihr unbedingt von dem Kauf erzählen. Die wird platzen vor Neid.«
»In Ordnung«, gab Nathalie erleichtert nach. Sie war froh, daß die Geschichte endlich erledigt war, und das sogar ohne größere Aufstände, Zankerei und Tränenausbrüche. »Wenn du wartest, können wir zusammen…«
»Ich nehme den Bus!« verkündete Sandra und schoß aus dem Laden, bevor Nathalie noch irgend etwas sagen konnte.
»Eine temperamentvolle junge Dame«, stellte der Verkäufer mit einem kleinen, hintergründigen Lächeln fest. »Ganz die Mama, nicht wahr?«
»Ich fürchte, ja«, seufzte Nathalie. Dann wandte sie sich dem Mann zu. »Hören Sie«, begann sie entschlossen. »Ich habe Ihnen Schaden zugefügt. Das tut mir wirklich leid. Würden Sie eine Einladung zu Kaffee und Kuchen annehmen? Als Schmerzensgeld sozusagen?«
Der Mann sah sie einen Moment erstaunt an, dann nickte er.
»Das klingt gut«, entschied er lächelnd. »Woher wissen Sie, daß ich für Kuchen meine Großmutter verkaufen würde?«
»Wir sind in einer Konditorei zusammengerasselt«, erwiderte Nathalie, auf seinen neckenden Tonfall eingehend. »Wann hätten Sie dann Zeit?«
»Von mir aus sofort.«
»Sofort?« Nathalie war kurzfristig verwirrt.
»Sofort«, bestätigte er und wandte sich um. »Roman, übernimmst du bitte mal. Ich muß weg.«
»Okay, Chefchen, bin im Anmarsch«, klang es aus irgendeinem Nebenraum. Gleich darauf erschien ein junger Mann mit knallroten Haaren und einer lustigen, runden Brille auf der Nase, der Nathalie fröhlich angrinste.
Sie erwiderte das Grinsen, ohne sich dessen bewußt zu sein. Zwei Minuten später stand sie mitten auf der Langgasse, einen Mann neben sich, den sie noch keine Dreiviertelstunde kannte, und um sich herum lauter kaufwütige, freizeitgestimmte Passanten, die keinerlei Notiz von ihr nahmen.
Was tu ich hier? fragte sich Nathalie vollkommen verstört. Auf was lasse ich mich da ein?
Ist doch piepegal, erwiderte ein kleines Stimmchen in ihrem Hinterkopf. Du gehst Kaffeetrinken mit einem äußerst gutaussehenden, anscheinend recht erfolgreichen Herrn in den besten Jahren. Nicht mehr und nicht weniger. Hör’ auf, eine Staatsaffäre draus machen zu wollen.
In diesem Moment nahm dieser erfolgreiche, gutaussehende Herr in den besten Jahren behutsam ihren Arm.
Nathalie warf alle Fragen und Bedenken über Bord.
*
Er sah wirklich umwerfend gut aus. Obwohl sich Nathalie reichlich albern vorkam, mußte sie ihrem Begleiter, der sich indessen als Clemens Hochdahl vorgestellt hatte, immer wieder heimliche Seitenblicke zuwerfen. Dabei klopfte ihr Herz, als hätte sie soeben einen zweihundert Kilometer langen Marathonlauf hinter sich gebracht.
Himmel, sie war doch nun wirklich aus dem Teenageralter heraus, in dem man sich Hals über Kopf in jeden halbwegs interessant aussehenden Mann verliebte. Die Ideal- und Traumbilder von einst waren von der Realität geradegerückt worden. Eine Frau in Nathalies Alter, Mutter von drei Kindern, dauernd getrennt lebend, weil der holde Gatte seiner eigenen Jugend hinterherjagte, wußte, daß sie Millionen Frösche küssen konnte, ohne daß sich auch nur einer in einen Prinzen verwandelte. Umgekehrt wurde da schon eher ein Schuh draus! Nein, eine solche Frau behielt Herz und Verstand in ihren beiden tatkräftigen Händen und sah ansonsten zu, daß ihr Lebensschiffchen und das ihrer Familie nicht allzusehr aus dem Fahrwasser geriet.
Doch was nützten alle Vorhaltungen? Nathalies Herz klopfte trotzdem wie verrückt gegen die Rippen, und in ihrem Bauch hatte sich ein ganzer Bienenschwarm eingenistet, der wild durcheinanderschwirrte, sobald Clemens Hochdahl das Wort an sie richtete.
Sie saßen sich im »Café Schlick«, einem wunderbar altmodischen Restaurant, gegenüber, in dessen plüschbezogenen Fauteuils man beinahe bis zu den Ohren versank. Die erlesenen Torten- und Kuchenspezialitäten waren weit über die Grenzen der Stadt berühmt, aber Nathalie schmeckte so gut wie nichts von ihrer leckeren Sachertorte.
Im Gegenteil, sie hatte das Gefühl, daß sich jeder Bissen in ihrem Munde zu Stroh verwandelte, das sie mit reichlich Kaffee herunterspülen mußte.
»Köstlich«, log sie dennoch tapfer, als Clemens sich erkundigte, ob sie mit ihrer Torte zufrieden sei.
Er nickte, während er mit gutem Appetit in seine Herrentorte piekste.
»Kuchen ist eine meiner heimlichen Leidenschaften«, vertraute er Nathalie mit einem kleinen, verschmitzten Lächeln an. »Wenn ich ein Stück Sahnetorte oder Napfkuchen vor mir sehe, kann ich mich einfach nicht zurückhalten. Da nützen die besten Vorsätze nichts.«
»Das sieht man Ihnen aber nicht an!« rutschte es Nathalie spontan heraus. Im selben Moment hatte sie sich für diese Bemerkung am liebsten die Zunge abgebissen. »Ich meine – äh…« Ach, jetzt war es schon egal. »Ich meine, Sie haben eine gute Figur«, plapperte sie weiter, frei noch dem Motto: ›Wenn ich schon mal dabei bin, mich zu blamieren, kann ich es auch gleich richtig tun!‹ »Kein Gramm Fett zuviel, muskulös und schlank, da hat nicht ein Kuchenkrümel seine Spuren hinterlassen.«
Clemens Hochdahl nahm das Kompliment mit einem fröhlichen Lachen an.
»Danke.« Er legte die Gabel aus der Hand und betrachtete Nathalie eingehend. »Sie sind sehr ehrlich, geradeheraus, nicht wahr. Das gefällt mir.« Dann wurde seine Miene ernst. »Aber ich will auch ehrlich sein. Meine Figur verdanke ich zuerst mal einem ausgiebigen Sporttraining. Ich gehe zweimal in der Woche Squash spielen. Und dann fahre ich noch ganz gerne Rad. Das allerdings nur, wenn das Wetter schön ist, und auch nicht so exzessiv wie manche Hobbysportler, die wie die Wilden durch den Taunus strampeln. Ich lasse mir lieber Zeit und schaue mir die Gegend an.« Hier entfleuchte Clemens ein kleiner Seufzer. »Dummerweise kann ich dabei selten an einem Café vorbeifahren, ohne abzusteigen und wenigstens ein Puddingstückchen zu kaufen.«
Nathalie legte den Kopf schief und sandte einen nachdenklichen Blick aus dem Fenster auf die belebte Wilhelmstraße hinaus.
»Ich treibe eigentlich viel zu wenig Sport«, überlegte sie laut, während sie zusah, wie eine Mutter mit zwei Kleinkindern versuchte, den Kinderwagen, die Einkäufe und ihre beiden brüllenden Rangen irgendwie über die Straße zu bringen. »Irgendwie fehlt mir ständig die Zeit dazu. Wissen Sie, bei uns ist dauernd irgend etwas los. Bei drei Kindern bleibt einem leider nur wenig Zeit für die eigenen Interessen.«
»Das glaube ich gern.« Clemens nickte lebhaft. »Mein Bruder hat fünf. Eine laute, fröhliche Rasselbande, die das ganze Haus auf den Kopf stellt. Ich frage mich immer, wie meine Schwägerin das durchhält.«
»Fünfe, du guter Gott!« Nathalie schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Ich stelle mir da immer die Kochtöpfe vor, die man für eine solche Familie füllen muß. Und die Wäscheberge, die anfallen. Ich komme ja schon kaum nach, und bei mir laufen zwei Maschinen im Keller.«
»Stimmt.« Clemens lachte. »Wenn Rosi kocht, dann geht’s zu wie in einer Großküche. Dazu haben die fünf auch noch einen gesegneten Appetit. Da kommen Mengen zusammen, ich sage Ihnen!«
Nathalie dachte an ihren Ältesten, Dennis, der ihr auch beinahe die Haare vom Kopf futterte. Er war vor wenigen Wochen sechzehn geworden und steckte mitten in der tiefsten Pubertätskrise. Pickel, Konzentrationsstörungen und ständiger Heißhunger waren im Moment seine größten Probleme.
»Wie alt sind Ihre Kinder?« mischte sich Clemens Stimme in Nathalies Überlegungen.
Sie blickte auf, erinnerte sich, wo sie sich befand, und schüttelte die Gedanken mit einer kleinen, anmutig wirkenden Kopfbewegung von sich ab.
»Sechzehn, vierzehn und vier Jahre alt«, antwortete sie mit einem kleinen, zärtlichen Lächeln, das mütterlichen Stolz und Liebe verrieten. »Sandra haben sie ja bereits kennengelernt. Dennis, mein Ältester, sitzt am liebsten den ganzen Tag vor seinem Computer. Und meine Jüngste, Stefanie, nun, die hat eigentlich nur Unsinn im Kopf. Aber sie ist unheimlich süß und furchtbar verschmust.«
Clemens Hochdahls Gesicht hatte sich bei Nathalies Worten verändert. Der entspannte, freundliche Ausdruck war daraus verschwunden und hatte einer ernsten, eher abweisenden Miene Platz gemacht.
»Dann haben Sie ja wirklich alle Hände voll zu tun«, meinte er, während er, plötzlich appetitlos geworden, seine Torte mit der Gabei zerkrümelte. »Ihr Mann ist sicherlich schrecklich stolz auf seine Familie.«
Jetzt war es Nathalie, die abweisend dreinblickte.
»Mein Mann und ich, wir haben uns vor eineinhalb Jahren getrennt.« Ihre Stimme klang spröde. Es fiel ihr immer noch schwer, über das Scheitern ihrer Ehe zu sprechen, aber sie war nicht der Typ, der sich in Lügen flüchtete oder nur halbe Wahrheiten erzählte. Deshalb sprach sie mutig weiter. »Wir haben die Scheidung eingereicht. Ich kümmere mich seitdem alleine um die Kinder.«
Obwohl das Thema alles andere als lustig war, hatte sich Clemens’ Miene wieder entspannt. Ein erleichterter Glanz lag auf seinem Gesicht. Ja, er wirkte beinahe fröhlich.
»Das tut mir leid«, beteuerte er, obwohl dies eine faustdicke Lüge war. Nein, er bedauerte es ganz und gar nicht, daß sich dieser dreifache Familienvater aus dem Staub gemacht hatte. Dieser Dussel wußte gar nicht, was er da aufgegeben hatte! »Sie haben es bestimmt nicht leicht, alleine, mit drei halbwüchsigen Kindern.«
Nathalie wischte die Bemerkung mit einer achtlosen Handbewegung fort.
»Nun, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Die drei sind eigentlich ganz friedlich.« Sie unterbrach sich, um Clemens eingehend zu mustern. »Haben Sie Kinder?«
Diese Frage brannte ihr seit Minuten auf der Zunge.
Clemens schüttelte mit einem bedauernden Schulterheben den Kopf.
»Leider nein.« Er griff erneut nach seiner Kuchengabel und wollte zu essen beginnen, aber als er sah, was er während der Unterhaltung mit seiner Herrentorte angestellt hatte, schob er den Teller angewidert von sich.
»Meine Frau ist vor zehn Jahren verstorben«, fuhr Clemens ohne falsches Pathos fort. »Es ging so schnell, so vollkommen unerwartet, daß ich Monate gebraucht habe, um ihren Tod überhaupt zu begreifen. Und dann habe ich noch mal beinahe drei Jahre benötigt, um mit dem Schmerz fertig zu werden.« Er hob erneut die Schultern. Es war eine ratlose, aber auch abschließende Geste, die andeuten sollte, daß er es aufgegeben hatte, sich über dieses Thema den Kopf zu zerbrechen. »Es ging eben einfach alles zu schnell.«
Nathalie starrte betreten auf die Tischdecke. Sie traute sich nicht, Clemens anzusehen, weil sie fürchtete, er könnte die Freude in ihren Augen sehen, die seine Worte in ihr ausgelöst hatten.
Es war völlig verrückt. Sie kannte diesen Mann erst seit zwei, höchstens drei Stunden und schon war sie bis über beide Ohren in ihn verliebt. So verliebt, daß sie sich – schämen sollte sie sich eigentlich dafür! – sogar darüber freute, daß er Witwer war, anstatt sein herbes Los von Herzen zu bedauern. Sie mußte wirklich komplett – wie drückte Sandra das immer aus? – »durchgeknallt« sein!
»Ah, das… das tut mir leid«, schaffte sie es, herauszubringen, obwohl ihr Herz so wild pochte, daß sie das Gefühl hatte, es steckte ihr mitten im Hals. »Woran – ich meine – wie konnte das – so schnell…«
Himmel, jetzt fing sie auch noch an zu stammeln! Sie entwickelte sich zurück! Gerade hatte sie den geistigen Stand einer Dreijährigen erreicht.
Zum Glück verstand Clemens sie auch so.
»Meine Frau litt an Diabetes«, erklärte er nüchtern. »Das war uns allerdings nicht bekannt. Ich habe es erst in der Klinik erfahren…« Jetzt seufzte er doch. Die Erinnerung an den schrecklichsten Tag in seinem Leben weckte den alten Schmerz, der immer noch in einem Winkel seiner Seele lauerte. »Sie ist beim Einkaufen mitten in einem Supermarkt ohnmächtig zusammengebrochen und nicht mehr zu sich gekommen. Die Ärzte sagten mir später, daß Petra ins Zuckerkoma fiel. Drei Tage lang haben sie um ihr Leben gerungen, dann war es vorbei.«
Er gab sich einen Ruck. Das alte, sympathische Lächeln erschien wieder auf seinem Gesicht.
»Genug Trübsal geblasen«, verkündete Clemens entschlossen. »Erzählen Sie mir von ihren Kindern. Was tun sie, welche Hobbys haben sie, gehen sie gerne zur Schule?«
Nathalie war froh, das Thema wechseln zu können. Bereitwillig erzählte sie von Dennis, Sandra und Stephanie, und Clemens hörte ihr aufmerksam zu.
Ab und an lachte er herzlich, wenn Nathalie einen besonders witzigen Streich ihrer Rangen schilderte, aber als sie über die Schulschwierigkeiten ihres Ältesten sprach, wurde seine Miene äußerst aufmerksam.
»Dennis kann seinen Mathelehrer nicht ausstehen«, berichtete Nathalie besorgt. »Wissen Sie, wenn ich ehrlich sein soll, dann muß ich zugeben, daß ich den Typen auch nicht ausstehen kann. Ein schrecklicher Mensch, der ständig in einem trockenmoosgrünen Anzug herumläuft und sich die Hände reibt. Kaum einer in der Klasse versteht die Matheaufgaben. Der Durchschnitt lag voriges Jahr bei Zwei-Komma-zwei. Inzwischen ist mindestens die Hälfte der Schüler auf eine glatte Vier abgerutscht.«
»Wir hatten damals in der Oberstufe auch so einen Lehrer«, wußte Clemens zu berichten. »Der hat so umständlich erklärt, daß wir nur noch Bahnhof verstanden. Irgendwann hat’s uns gereicht. Wir sind geschlossen zum Direx marschiert und haben ihn aufgefordert, an einer Mathestunde teilzunehmen. Danach haben wir einen neuen Lehrer bekommen.«
Nathalie horchte auf.
»Hört sich gar nicht so dumm an«, stellte sie nach kurzem Überlegen fest. »Wissen Sie was, genau diesen Vorschlag werde ich meinem Sohnemann unterbreiten.«
Die Erwähnung ihres Ältesten rief Nathalie die reichhaltigen Pflichten in Erinnerung, die noch auf sie warteten.
Sofort war das schlechte Gewissen da, als sie daran dachte, daß sie Steffi heute praktisch den ganzen Tag Reginas Obhut überlassen hatte.
Hastig, bevor sie es sich wieder anders überlegen und der Versuchung, die Zeit mit diesem faszinierenden Mann noch ein wenig in die Länge zu ziehen, erliegen konnte, erklärte Nathalie:
»Tur mir leid, aber ich muß diese nette Unterhaltung abbrechen. Meine Kinder haben mich heute noch so gut wie gar nicht gesehen.« Während sie sprach, sah sie sich bereits nach der freundlichen Bedienung um. »Die Kleine war heute den ganzen Tag bei der Nachbarin. Die ist zwar sehr kinderlieb, aber ich möchte ihre Gutmütigkeit trotzdem nicht über Gebühr beanspruchen.«
Clemens warf einen raschen Blick auf seine Armbanduhr und nickte.
»Ja, für mich wird es auch Zeit, wieder ins Geschäft zurückzukehren.« Er betrachtete Nathalie einen Moment nachdenklich, dann zuckte er die Schultern. »Schade, die Zeit ist viel zu schnell vergangen.«
In diesem Moment näherte sich die Kellnerin. Es gab einen kurzen Disput, als Nathalie ihr Portemonnaie zuckte und Clemens Hochdahl darauf bestand, die Rechnung zu begleichen. Aber Nathalie ließ sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen.
»Ich habe Ihnen beinahe die Finger abgequetscht und Sie auch noch geohrfeigt, da werden Sie doch wohl diese kleine Entschädigung annehmen«, wehrte sie sein Begehren ab und beglich die Rechnung, ehe Clemens noch einmal Widerspruch einlegen konnte.
Gemeinsam verließen sie das Café. Draußen schlug ihnen der Verkehrslärm der stark befahrenen Hauptstraße entgegen. Drüben im Kurpark sonnten sich ein paar Rentner auf den Bänken. Mütter schoben Kinderwagen über die kiesbestreuten Wege.
»Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den netten Nachmittag«, wandte Clemens sich an Nathalie. Er wirkte plötzlich verlegen. »Ähm –« Verlegen sah er an Nathalie vorbei auf den Park. »Würden – könnten…« Er gab sich einen Ruck. »Könnten wir dieses Treffen vielleicht noch einmal wiederholen?«
Nathalies Herz machte einen so kühnen Sprung, daß sie fürchtete, es könne ihr einfach zum Mund heraushüpfen.
»Ge-gerne«, stammelte sie, aufgeregt wie ein Teenager, der sein erstes Rendezvous trifft.
Clemens atmete erleichtert auf.
»Vielleicht schon morgen abend?« schlug er nicht minder erregt vor. »Wir könnten zusammen essen? Oder ins Kino gehen? Oder beides?«
»Ja!« Am liebsten hätte Nathalie gelacht und geweint und sonst irgend etwas Verrücktes gemacht, um dem Glücksgefühl, das sie durchströmte, Ausdruck zu verleihen. Aber sie beherrschte sich. »Im Kino war ich schon lange nicht mehr.«
»Dann also Kino«, beschloß Clemens. »Und anschließend gehen wir essen.« Er überlegte kurz. »Darf ich Sie zu Hause abholen?«
»Ja.« Nathalie kramte bereits in ihrer Handtasche nach dem Visitenkärtchen.
»Dann bin ich um Viertel nach sieben bei Ihnen«, erklärte Clemens, während er die Karte sorgfältig in seine Brieftasche steckte. »Ich freue mich auf morgen.«
»Ich auch«, seufzte Nathalie selig. Dann reichten sie sich die Hand, und Nathalie eilte zu ihrem Wagen.
Ihr Abschied glich beinahe einer Flucht. Sie war so durcheinander und aufgeregt, daß sie fürchtete, sich im letzten Moment noch fürchterlich zu blamieren. Nichts wie weg, war ihr einziger Gedanke. Weg, und in Ruhe nachdenken!
Clemens sah ihr so lange hinterher, bis sie im Gewühl der Passanten untergebracht war. Dann wandte er sich um und schritt langsam die Wilhelmstraße entlang zu seinem Geschäft.
Ein kleines glückliches Lächeln lag auf seinem Gesicht.
*
Der Fernseher brüllte im Wohnzimmer. Nathalie erkannte die Stimmen von Kermit und Krümelmonster, als sie die Haustür aufschloß und die Diele betrat. Aha, Steffi sah ihre Lieblingssendung.
Da das Gerät derartig lärmte, bemerkte niemand ihr Eintreten. Sie blieb einen Moment unter der Tür stehen, um das Bild, das sich ihren Augen bot, in Ruhe zu betrachten.
Sandra, die erstaunlicherweise schon zu Hause war, lag bäuchlings auf dem Sofa, den Walkman auf den Ohren, und blätterte in einem Jugendmagazin. Steffi saß auf dem Fußboden, so dicht vor dem Gerät, daß ihr Näschen beinahe die Mattscheibe berührte, Dennis, ebenfalls Kopfhörer auf den Ohren, spielte mit seinem Gameboy, das Dudeln und Klingeln vermischte sich mit den Dialogen der Fernsehpuppen, und inmitten des ganzen Tohuwabohus hockte Regina, bequem in einen Sessel gelehnt und las ein Buch.
»Hallo!« Nathalie mußte schreien, um den Lärm zu übertönen. Sofort sprang Steffi auf und stellte den Apparat leiser.
»Mama!« Mit ausgebreiteten Armen kam die Kleine auf sie zu. »Mama, das Klümelmonsta hat alle Kekse aufgegessen und will jetzt auch noch Kelmit’s haben.«
»Hallo, Natty!« Regina warf ihr Buch achtlos zu Boden und sprang auf. »Sandra hat mir schon alles erzählt. Du hast eine Eroberung gemacht?«
Nathalie blinzelte verwirrt. Woher sollte Sandy das wissen? Was hatte sie noch von dem Gespräch zwischen Clemens und ihr mitbekommen?
»Versuch’s erst gar nicht abzustreiten«, meldete sich da Sandras Stimme aus den Tiefen des Sofas. Wenn sie wollte, konnte sie sogar mit dem Walkman auf den Ohren und einem Jim-Hughes-Song im Gehörgang noch sehr gut verstehen, was um sie herum gesprochen wurde. »Der Typ ist voll auf dich abgefahren, Mum. Das habe ich gleich gemerkt. So wie der dich angeguckt hat, ha, da wußte ich gleich, was die Glocke geschlagen hat.«
»So, wußtest du das?« Nathalie versuchte ein spöttisches Lächeln, aber es mißlang gründlich. Sie war immer noch viel zu aufgeregt, um ihre wahren Gefühle verbergen zu können. »Nun ja, er war ja auch recht sympathisch.«
»Recht sympathisch, so, so«, Regina schmunzelte vielsagend.
»Und wo hast du die ganze Zeit über gesteckt?« wollte Sandra neugierig wissen.
»Ich hab’ ganz doll auf dich gewartet«, mischte sich Steffi ein, die sich wieder vor das Fernsehgerät gehockt hatte.
»Mein Gott, so lange war ich ja nun auch wieder nicht weg«, behauptete Nathalie lächelnd, während sie die wachsende Neugierde beobachtete, die sich auf den Gesichtern ihrer Zuhörer abzeichnete. »Also gut«, gab sie schließlich nach. »Ich war noch eine Tasse Kaffee trinken. Ist das okay?«
»Alleine?« fragte Sandra sofort mißtrauisch. Man konnte ihr einfach nichts vormachen.
Nathalie seufzte. »Nein, nicht alleine.« Sie sah zu Regina hinüber, die von einem Ohr zum anderen grinste. »Ich war mit diesem netten Optiker im Café, ihr alten Schlitzohren. Er heißt Clemens Hochdahl, und das Geschäft gehört ihm.«
»Wau, dann hat er Kohle«, stellte Sandra zungenschnalzend fest. »Hoffentlich hast du dich mit ihm verabredet.«
»Alter Geldgeier!« Nathalie schüttelte den Kopf. »Übrigens, weil wir gerade von Geld sprechen. Heute abend ist Familienrat angesagt. Würdest du das auch deinem Bruder sagen, falls er irgendwann mal die Kopfhörer von seinen Ohren nimmt?«
Sandra schob die Unterlippe vor. Wenn Mutter den Familienrat einberief, bedeutete das immer irgendwelche Unannehmlichkeiten, über die man diskutieren sollte. Eklige Sachen wie die Frage, wann wer spülen oder die Mülltonne raustragen mußte, daß das Taschengeld gekürzt wurde oder der Familienurlaub mal wieder in den Harz führen sollte, anstatt nach Gran Canaria, auf das man sich schon so gefreut hatte.
Früher, als Papa noch bei ihnen gewesen war, da hatten sie nie über solche Dinge reden müssen. Da war immer ausreichend Geld vorhanden gewesen, um die diversen Wünsche der einzelnen Familienmitglieder erfüllen zu können. Aber seit Papa ausgezogen war und bei seiner neuen Freundin wohnte, mußte ständig gespart werden.
»Zieh kein Gesicht«, mahnte Nathalie ihre Tochter. »Und damit du zufrieden bist: Ja, ich habe mich mit Herrn Hochdahl verabredet. Wir gehen morgen zusammen ins Kino.«
»Ich will mit!« meldete sich Steffi, die der Meinung war, daß sie lange genug auf ihre Mutter verzichtet hatte.
»Spinnst du!« fuhr ihre große Schwester sie an. »Wenn der Typ dich sieht, macht er sich gleich vom Acker.«
»Gaa nich waah!« protestierte Steffi. Tränen schimmerten in ihren großen, braunen Augen. Aber es waren eher Tränen des Protests als des Kummers. »Mama, ich will mit!«
»Kannste aber nich!«
»Kann ich doch.«
»Halt den Mund, Sandy«, ging Nathalie dazwischen. »Und du bist ebenfalls still, Steffi. Niemand geht mit, damit das klar ist. Ich gehe alleine aus.«
»Ich bleibe bei dir«, kam Regina ihrem Liebling sofort zu Hilfe. »Laß du mal die Mama ruhig ausgehen. Wir machen es uns hier zu Hause so richtig gemütlich.«
Steffi vergaß ihren Kummer Neugierig musterte sie Reginas Gesicht, dann strahlte sie glücklich.
»Machst du Popcoon?«
»Kann ich machen.« Regina lächelte milde.
»Und daaf ich Dellik sehen?«
»Nein, ganz bestimmt nicht«, kam Nathalie Regina zuvor. »Derrik ist ganz bestimmt nichts für kleine vierjährige Kindergartenmädchen. Ich besorge dir einen Zeichentrickfilm aus der Videothek, den darfst du angucken. Aber Derrick und alle anderen Sendungen, die nach zwanig Uhr laufen, sind gestrichen.«
»Mama«, Sandra kam näher und schmiegte ihre Wange an Nathalies Schulter. »Wenn du ausgehst, darf ich dann auch mal weggehen?« Nathalie öffnete die Lippen zum Protest, aber Sandra sprach rasch weiter. »Bitte, bitte, Mutsch, Mutschilein, ich bin auch ganz bestimmt pünktlich zu Hause. Aber im Planet läuft morgen abend eine Big-Rave-Party. Alle meine Freundinnen gehen hin. Bitte, Mutsch, laß mich auch.«
Nathalie begann der Kopf zu schwirren. Es war gar nicht so einfach, sich mal für ein paar Stunden von der Familie abzusetzen.
»Schluß«, bestimmte sie schließlich. »Wir reden nachher über alles. Jetzt mache ich erst einmal Abendessen. Regina, wie ist es, magst du mitessen?«
Regina lehnte dankend ab. Ihr Mann Tom würde in einer Stunde nach Hause kommen und hungrig wie ein Löwe nach seinem Schnitzel verlangen.
»Es wird Zeit, daß ich mich darum kümmere.« Sie schmatzte Steffi noch einen dicken Kuß auf die Wange, winkte Sandra und Nathalie zu und verließ das Wohnzimmer.
Sandra sah ihr sehnsüchtig hinterher.
»Das müßte meine Mutter sein«, bemerkte sie mit einem lauernden Seitenblick auf Nathalie, die sich anschickte, das Chaos im Raum einzusammeln. »Regina würde mir bestimmt erlauben, in die Disco zu gehen.«
»Ich erlaube dir, den Tisch zu decken«, versetzte Nathalie ungerührt und drückte Sandra einen Stoß Jugendhefte in die Arme. »Und ich erlaube dir, ganz alleine und ohne genauere Anweisungen diese Zeitungen auf dein Zimmer zu tragen. Ende der Diskussion.«
Ärgerlich vor sich hinmaulend schlurfte Sandra davon.
*
Nathalie schlief schlecht in dieser Nacht. Immer wieder mußte sie an Clemens Hochdahl denken, der ihr Herz schneller schlagen ließ. Sie brauchte nur die Augen zu schließen, dann stand sein Bild vor ihr. Sein Gesicht mit den markanten, männlichen Zügen, das Lächeln, das stets in den Mundwinkeln lauerte, der Blick seiner dunklen, unergründlichen Augen, all das hatte sich bereits in ihre Erinnerungen geprägt.
Die Gefühle, die er in ihr geweckt hatte, verwirrten sie. Damals, als Werner und sie noch glücklich miteinander gewesen waren, hatte sie sich nicht mal im Traum vorstellen können, einen anderen Mann lieben zu können.
Werner war ihr Traumprinz gewesen. Sie hatte ihn wirklich von ganzem Herzen geliebt. Als er sich entschloß, beruflich auf eigenen Beinen zu stehen, hatte sie sich kopfüber in die Arbeit gestürzt. Mehrere Jahre war sie als seine »rechte Hand« im Betrieb tätig gewesen, hatte sich um die Kinder und den Haushalt gekümmert und versucht, allen und allem gerecht zu werden.