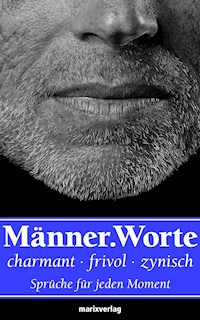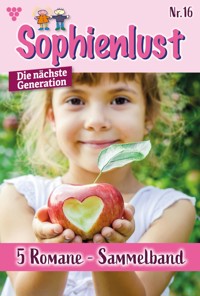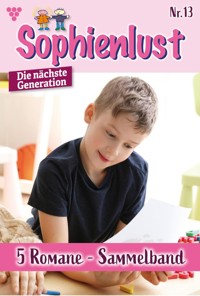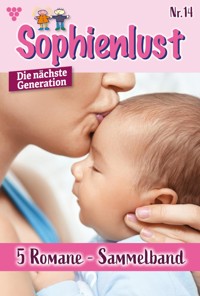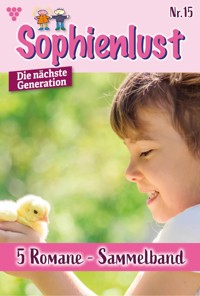25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Familie ist ein Hort der Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit. Wir alle sehnen uns nach diesem Flucht- und Orientierungspunkt, der unsere persönliche Welt zusammenhält und schön macht. Das wichtigste Bindeglied der Familie ist Mami. In diesen herzenswarmen Romanen wird davon mit meisterhafter Einfühlung erzählt. Die Romanreihe Mami setzt einen unerschütterlichen Wert der Liebe, begeistert die Menschen und lässt sie in unruhigen Zeiten Mut und Hoffnung schöpfen. Kinderglück und Elternfreuden sind durch nichts auf der Welt zu ersetzen. Genau davon kündet Mami. E-Book 1: Wir haben dich gewollt E-Book 2: Hallo, ich bin Raya E-Book 3: Eine trügerische Idylle E-Book 4: So lieb – und sooo frech E-Book 5: Es war nicht immer so ... E-Book 6: Nur ein einziger Augenblick ... E-Book 7: Als der Papa heimkam ... E-Book 8: Ein Knirps in Turnschuhen E-Book 9: Wir finden den Papi E-Book 10: Drei endlich im Glück
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1193
Ähnliche
Inhalt
Wir haben dich gewollt
Hallo, ich bin Raya
Eine trügerische Idylle
So lieb – und sooo frech
Es war nicht immer so ...
Nur ein einziger Augenblick ...
Als der Papa heimkam ...
Ein Knirps in Turnschuhen
Wir finden den Papi
Drei endlich im Glück
Mami – Staffel 18 –
E-Book 1898-1907
Diverse Autoren
Wir haben dich gewollt
Für ein junges Paar verändert sich die Welt
Roman von Myrenburg, Myra
Als Hildegard Kranzler erfuhr, daß sie Großmutter werden sollte, war sie fünfundvierzig Jahre alt. Sie saß vor ihrem Toilettentisch und musterte sich kritisch in dem schwungvoll geformten dreiteiligen Spiegel. Sie hatte soeben ihr erstes graues Haar entdeckt, und wenn das, was Judith in diesen Minuten äußerte, kein Hirngespinst war, würde sich die Zahl der grauen Haare in Windeseile verzehnfachen.
»Sag es noch einmal, Schätzchen«, bat Hildegard, obwohl sie viel darum gegeben hätte, es nicht mehr hören zu müssen, zumindest nicht in den nächsten drei Jahren, aber das Schicksal hatte bereits anders entschieden.
»Ich bekomme ein Baby«, wiederholte Judith und biß herzhaft in einen Schokoriegel, dessen bunt bedrucktes Silberpapier durch das offene Fenster entschwebte.
»Aaah ja?« sagte Hildegard gedehnt. Sie kam sich unsagbar tö-richt vor, weil ihr sonst nichts einfiel, einfach gar nichts, denn die verzweifelte Hoffnung, es könne sich nur um einen dummen Scherz handeln, beseelte sie immer noch.
»Im März«, fuhr Judith kauend fort, »so um den fünfzehnten herum.«
Hildegard sank auf dem flauschigen Hocker zusammen. Eine derart konkrete Angabe löschte auch den letzten Hoffnungsfunken aus.
»Woher weißt du es so genau, Schätzchen?« fragte sie mit dumpfer Verwunderung, denn ihre Tochter war siebzehneinhalb und mit der Terminologie einer Schwangerschaft keineswegs vertraut.
»Von Elaine«, sagte Judith in beschwichtigendem Ton, offenbar nahm sie an, daß dies zur Beruhigung beitrug, denn Elaine war nicht nur Hildegards Freundin, sondern auch die erfolgreichste Gynäkologin in Torreval, der schönen heißen Stadt an der karibischen Küste.
Hildegard ließ die silberne Haarbürste auf die Glasplatte der Frisierkommode fallen, daß es klirrte.
»Du hast – du hast dich untersuchen lassen?« stieß sie fassungslos hervor, ungläubig und heiser vor Erregung.
»Na sicher«, erwiderte Judith schlicht, »was denn sonst?«
Minutenlang blieb es still in dem damenhaften Schlafzimmer mit den matt glänzenden pfirsichfarbenen Wänden, den wehenden cremeweißen golddurchwirkten Vorhängen und dem dunkel gebeizten Holzdekor.
»Wer ist der Vater?« fragte Hildegard flüsternd.
»Benjamin natürlich«, sagte Judith laut und ein wenig vorwurfsvoll. »Wir sind doch schon ewig zusammen.«
Ewig? Anderthalb Jahre vielleicht, und abgesehen davon, war die Jugend denn nicht hinreichend aufgeklärt? War sie nicht, im Gegensatz zu den früheren bedauernswerten Generationen in der glücklichen Lage, ihr Schicksal selbst zu bestimmen?
»Ich habe das nicht eingesehen«, murrte Judith, als habe sie die Gedanken ihrer Mutter gelesen, »mich immerzu vollzustopfen mit Hormonen, kann doch nicht gesund sein.«
Immerhin bewahrt es dich vor unerwünschtem Nachwuchs, wollte Hildegard sagen, aber sie hielt an sich und murmelte statt dessen matt: »Darüber, beispielsweise, hättest du mit Elaine sprechen können – vorher allerdings, nicht nachher.«
»Tja«, seufzte Judith und lächelte verloren zum Fenster hinaus, »hinterher ist man meistens schlauer, nicht wahr?«
Dann schlug sie wieder den arglosen Beschwichtigungston an.
»Komm, mach keinen Streß, Mutsch! Ich dachte, du würdest es nicht so tragisch nehmen.«
»Na, hör mal! Du hast im nächsten Jahr dein Abitur vor dir. Statt dessen wirst du die Schule schmeißen und niederkommen, und der Himmel weiß, was danach sein wird. Und das soll ich nicht tragisch nehmen? Was sagt Benjamin denn dazu?«
Judith hob die Schultern unter dem lappigen alten T-Shirt, das sie zusammen mit zerknitterten schwarzen Boxershorts als Nachtwäsche trug und blinzelte ihre Mutter im Spiegel an. »Benjamin? Er freut sich.«
Hildegard mußte die Augen schließen beim Gedanken an Gerald und Lucie Holborn, Benjamins Eltern, amerikanische Geschäftsleute, die ständig zwischen Torreval und Washington und Miami Beach hin- und herpendelten, lederhäutig, hartgesotten, mit gebleichtem Haar und scharfen hellen Augen. Sie hatten zwei längst erwachsene, verheiratete Töchter irgendwo auf der Welt. Benjamin war der Nachzügler, deshalb hatten sie ihn so genannt.
Während der letzten drei Jahre war er in Torreval in die amerikanische Schule gegangen, hatte vor ein paar Wochen seinen Abschluß gemacht und man konnte getrost davon ausgehen, daß er für das Herbstsemester bereits an einer Universität eingeschrieben war.
»Soso, er freut sich«, murmelte Hildegard. »Soll das heißen, er will dich heiraten?«
»Er will unbedingt. Die Frage ist nur, ob ich es will«, antwortete ihre Tochter mit einem grüblerischen Ausdruck im weichen, sanft gerundeten Gesicht. »Das steht nämlich noch gar nicht fest. Wenn ich mir ansehe, was aus den meisten geworden ist, wenn sie erst mal verheiratet sind – nimm nur Robert und Lioba oder Alex und Cindy – solange sie nur miteinander gingen, waren sie ein Herz und eine Seele, und kaum waren sie verheiratet – boing –« Julia schlug sich mit der rechten Faust auf die linke Handfläche, »gab es nur noch Zoff und Zank und Tränen. Also, das fällt mir wirklich auf. Ist doch komisch, nicht?«
»Vielleicht waren sie zu verwöhnt oder zu unreif, wer weiß das schon. Ihr alle habt keine Ahnung vom Ernst des Lebens, Schätzchen, und was dich und Benjamin betrifft – ihr seid noch dazu so schrecklich jung. Er kann doch höchstens achtzehn sein.«
»Stimmt, aber wenn das Baby kommt, ist er neunzehn, und außerdem«, Judith massierte sich die nackten braunen Unterarme und starrte gedankenverloren vor sich hin, »sind ältere, verheiratete Leute ja auch nicht übermäßig happy. Sie machen vielleicht kein so großes Drama daraus wie Robert und Lioba, aber irgendwie – also, ich weiß nicht, vielleicht ist nach so langer Zeit einfach die Luft raus. Kann ja sein, nicht?«
»Schon möglich«, sagte Hildegard stirnrunzelnd und ein wenig irritiert, »aber auf die anderen kommt es nicht an, nur auf dich und Benjamin und in gewisser Weise wohl auch auf das Kind. Ich nehme an, du willst es bekommen und behalten.«
»Klar! Wieso nicht?«
»Es wird dein Leben total verändern, Schätzchen.«
»Ach sooo«, Judith klang hörbar erleichtert, »ich dachte schon, du willst mich aufmerksam machen auf die Kellers und die Achenbachs, die so gern ein Kind adoptieren würden und bis jetzt nicht weitergekommen sind wegen der neuen strengen Gesetze hier. Und überhaupt, es soll ja gar nicht so einfach sein.«
»Richtig.«
»Also, für mich käme das nie in Frage«, sagte Judith sehr entschlossen und zog einen zweiten, sehr zerdrückten Schokoriegel aus der Tasche ihrer Boxershorts. »Und für Benjamin auch nicht. Ich glaube«, sie knüllte das Silberpapier zu einem Kügelchen zusammen, warf es in die Luft und fing es geschickt wieder auf, »wir sollten doch lieber heiraten, damit keiner von euch auf so komische Gedanken kommt. Heute ist Zeugnisverteilung und an-schließend die übliche Schuljahresabschlußfeier. Was meinst du, soll ich anziehen?«
»Egal was«, rief Hildegard mit einem Blick auf die kleine, antike Uhr unter dem Glassturz, »Hauptsache es geht schnell. Du hast noch zehn Minuten Zeit.«
»Ach, das schaffe ich locker«, erwiderte Judith lässig, küßte ihre Mutter auf die Schläfe und war im nächsten Moment verschwunden wie ein Geist.
Es war halb acht.
Die Geräusche des Hauses drangen nur gedämpft hinauf in das pfirsichfarbene Zimmer. Unten ging alles seinen gewohnten Gang, wie immer um diese Tageszeit. Letitia führte die Oberaufsicht in der Küche. Armando, der Fahrer, war von seiner ersten Dienstfahrt schon zurück und konnte Judith gleich zur Schule bringen.
Rupert Kranzler, der Herr des Hauses, deutscher Botschafter in Torreval, hatte bereits um sechs Uhr ein paar Runden im Pool geschwommen, anschließend gefrühstückt, die Nachrichten gehört und die Zeitung gele-
sen. Seit zwanzig Minuten saß er an seinem überdimensionalen Schreibtisch in einem alten Kastell mit Blick über den Hafen, das die deutsche diplomatische Vertretung beherbergte.
Hildegard versuchte sich zu sammeln und den Terminplan ihres Mannes zu rekapitulieren. Um ihm die jüngste Neuigkeit so schonend wie möglich beizubringen, mußte man einen günstigen Moment erwischen. Rupert war ein Stimmungsmensch. Sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, daß seine Reaktion weitgehend von seiner inneren und äußeren Verfassung abhing. Je nachdem, wie schwer er die ganze Sache nahm, mußte sie mit massiven Vorwürfen rechnen, denn Rupert vertrat den Standpunkt, daß die Erziehung seiner Tochter aus-schließlich in den Händen der Mutter lag. Wie es gewesen wäre, wenn sie einen Sohn gehabt hätten, blieb dahingestellt, denn Judith war ihr einziges Kind, das ihnen bisher keine nennenswerten Sorgen gemacht hatte.
Am besten, dachte Hildegard, wartete man den frühen Abend ab, wenn Rupert noch einmal geschwommen und sich umgezogen hatte. Dann, wenn er in Erwartung des Essens mit einem leichten Drink auf der Terrasse saß, konnte man am ehesten auf eine entspannte Atmosphäre und eine milde Stimmung hoffen.
Normalerweise, bei den vielen kleinen Unebenheiten, die es im Leben eines Kindes auszugleichen galt, hatte sie ihn gar nicht zugezogen. Aber diesmal kam sie nicht daran vorbei. Diesmal ging es nicht um Nachhilfestunden in Mathematik, nicht um die Wahl eines Ferienlagers, nicht um die Aufgabe des Klavierunterrichts, nicht einmal um die Frage, ob und mit wem Judith übers Wochenende nach Costa Hermigua fahren durfte.
Nun ja.
Manches konnte man sich nicht aussuchen. Man mußte es nehmen, wie es kam, und das, was jetzt wie ein schwerer Schicksalsschlag aussah, würde sich später vielleicht als Vorteil erweisen.
Kann sein, dachte Hildegard, kann auch nicht sein. Jedenfalls wollte sie so lange wie möglich an ihrer positiven Grundeinstellung festhalten. Ohne einen gewissen angeborenen Optimismus hätte sie die vielen Stationen auf Ruperts beruflichem Weg gar nicht bewältigen können, deren jede mit einem mehr oder weniger krassen Ortswechsel verbunden gewesen war. Und bei weitem nicht überall hatte sie eine so angenehme, heiter beschwingte Umgebung vorgefunden wie hier in Torreval, wo keine politischen Spannungen herrschten und man bei aller karibischen Lebensfreude nicht auf die Segnungen des technischen Fortschritts und der europäischen Kultur zu verzichten brauchte.
Insofern, dachte Hildegard, hätte sich manches schlechter fügen können, zum Beispiel im Kongo oder in Malaysia, nicht zu reden von den vielen neuen Republiken, die aus dem alten Rußland hervorgegangen waren, oder auch in China, wo die Sprache ein schier unüberwindliches Hindernis darstellte.
Nachdem sie sich auf diese Art ermutigt und innerlich gerüstet hatte, stand Hildegard auf und ging zum Telefon, das neben ihrem Bett stand, um Elaine Thompson anzurufen.
*
Die Jahresabschlußfeier der internationalen Schule war ein erhebendes Ereignis, von musikalischen Beiträgen umrahmt und verschiedenen Ansprachen begleitet.
Judith saß zwischen ihren Freundinnen Valerie und Patricia, blätterte verstohlen in ihrem Zeugnisheft und unterdrückte nur mit Mühe ihre Ungeduld. Erstens kam ihr die Feier zum Gähnen langweilig vor, zweitens war sie noch vor dem Mittagessen mit Benjamin an der Uferpromenade verabredet. Außerdem, da sie wußte, daß sie das nächste Schuljahr nicht mehr abschließen würde, hatte sie das Gefühl, als gingen sie das alles jetzt schon nichts mehr an.
Schade um die ziemlich guten Noten, die das Zeugnis zierten und als Basis für ein annehmbares Abitur durchaus geeignet gewesen wären. Aber, wie ihre Mutter immer sagte: alles kann man nicht haben. Und das Baby, die aufregendste Sache der Welt, war dem Abitur natürlich vorzuziehen.
Noch wußten Valerie und Patricia nichts von den glücklichen Umständen, in denen sich Judith befand, und es konnte sogar sein, daß sie diese Umstände nicht für besonders glücklich hielten, was allerdings kaum vorstellbar war.
Judith nämlich fand sich selbst eher beneidenswert als bemitleidenswert, schon deshalb, weil Benjamin so treu und unerschütterlich zu ihr stand; weil sie immer noch lieb miteinander umgingen, vergnügt miteinander waren und sich immer umeinander kümmerten. Ja, das taten sie, das hatten sie von Anfang an getan.
Keine Sorge, die sie nicht geteilt, keine Hilfe, die sie einander verweigert hätten. Sie hatte ihm Gesellschaft geleistet, wenn seine Eltern in den Staaten waren und er sich in dem großen Haus verloren fühlte, er hatte ihr Rückenschwimmen beigebracht und die richtige Atemtechnik, so daß sie endlich keine Panikanfälle im Wasser mehr bekam.
Sie hatte ihm in seinen schwachen Fächern geholfen, Fremdsprachen hauptsächlich, und er ihr in Mathematik. Sie hatten schon lange keine Geheimnisse mehr voreinander. Sie vertrauten einander rückhaltlos, und so war es ihnen gelungen, gemeinsam alle großen und kleinen Ängste abzubauen.
All dies konnte man anderen Leuten natürlich nicht erklären, weder Valerie noch Patricia noch Benjamins Schulfreunden und am allerwenigsten den beiderseitigen Eltern.
Man mußte schon froh sein, wenn sie einem keine Steine in den Weg legten, beispielsweise die Zustimmung zur gesetzlichen Eheschließung verweigerten. Denn, wie Elaine Thompson ihr kürzlich erklärt hatte, brauchte Judith dazu die schriftliche Einwilligung ihrer Eltern, weil sie noch nicht großjährig war.
Nun, am zehnten Januar wurde sie achtzehn. Notfalls würden sie mit der Hochzeit so lange warten. Aber sie glaubte nicht ernstlich daran, daß es derart gravierende Schwierigkeiten geben würde. Mit ihrer Mutter keinesfalls, und ihr Vater war erfahrungsgemäß viel zu beschäftigt, um sich mehr zu engagieren als unbedingt nötig war.
Die Feier neigte sich dem Ende zu. Der gemischte Chor, dem Judith früher einmal angehört hatte, sang einen schönen deutschen Kanon und anschließend ein englisches Volkslied, und wie immer schloß er mit der französischen Version von ›Nehmt Abschied, Brüder‹.
Dann erhob sich das übliche freudige Raunen, begleitet vom Scharren unzähliger Füße. Man wünschte sich gegenseitig schöne Ferien und drängte dem Ausgang zu.
Judith verabschiedete sich von Patricia, die schon morgen mit ihren Eltern nach London reisen würde, und verabredete sich lose mit Valerie für einen Tag in der nächsten Woche, vorzugsweise den Dienstag, dann gab es im Café Europa Waffeln mit heißen Kirschen und Vanilleeis.
Es war elf Uhr vormittags.
Die Straßen wimmelten von Autos, auf den Bürgersteigen drängten sich Schulkinder, Hausfrauen, schwadronierende alte Männer, Hunde jeglicher Rasse und Matrosen aus aller Herren Länder.
Judith bahnte sich ihren Weg in südlicher Richtung bis zur Uferpromenade, wo Benjamin auf einer Bank saß, den schmalen hellen Kopf über ein Buch gebeugt, das, wie sich herausstellte, ein Leitfaden für werdende Eltern war.
»Zeig mal«, sagte Judith und setzte sich neben ihn. Sie waren beide fast gleich groß, trugen beide Bermuda-Shorts, locker fallende Hemden und offene Sandalen. Er trug den gleichen kleinen goldenen Ohrring am linken Ohr wie sie und das gleiche dünne Kettchen am Handgelenk. Obwohl sein Haar kurz getrimmt und blond war und sein Gesicht schmal und wie gemeißelt, während sie brünett und rundgesichtig war, wirkten sie fast wie Geschwister.
Eine Weile versenkten sie sich in die Anatomie eines Embryos in der achten Schwangerschaftswoche und staunten über das rasche Wachstum des winzigen Wesens während der ersten Monate, über die Bildung seiner Organe und Gliedmaßen.
»Kaum zu glauben, wie rasant es sich entwickelt«, murmelte Benjamin ehrfürchtig. »Muß doch irgendwie anstrengend sein, meinst du nicht?«
»Keine Ahnung«, seufzte Judith. »Elaine hat nichts davon gesagt. Nur daß der Mensch in seinem ersten Lebensjahr so viel aufnehmen und umsetzen muß wie später nie mehr. Während der Schwangerschaft wächst er sozusagen von allein und braucht sich um nichts zu kümmern.«
»Na hoffentlich stimmt das auch. Wir dürfen jedenfalls nicht versäumen, ihm das Wachstum zu erleichtern. Du nimmst doch deine Kalziumtabletten und die Vi-tamine?«
»Ja, sicher. Uns fehlt es an nichts, und mit meiner Mutter habe ich auch schon gesprochen, ganz kurz nur heute morgen, aber im Prinzip weiß sie Bescheid. Wie sieht es bei dir aus?«
»Gut, sehr gut sogar. Ich hatte gestern abend alle beide vor der Flinte.« Benjamin lachte und klappte das Buch zu. »Sie waren ausnahmsweise weder zum Bowling noch im Club noch irgendwo eingeladen – so günstig trifft sich das ja nur selten.«
»Wie haben sie es aufgenommen?« fragte Judith gespannt.
»Cool«, sagte Benjamin, »ganz cool. Mein Dad hat mir erstmals erzählt, daß es ihm und Mummy genauso gegangen ist, daß er deshalb sein Medizinstudium abbrechen mußte, um Geld zu verdienen, daß er damals umgesattelt und es nie bereut hat, weil er an der Börse genau am richtigen Platz war. Na, dann folgte der übliche Vortrag über die Kinder, die es so viel besser haben als ihre Eltern, und es endete damit, daß er mir das Geld, das er für mein Studium vorgesehen hat, auf mein Konto legt, die ganze Summe auf einmal, und es mir überläßt, was ich damit anfange. Meine Mutter legt noch etwas drauf aus ihrem Erbteil. Damit bin ich sozusagen ausgesteuert, und solange sie leben, habe ich nichts mehr zu erwarten. Wie findest du das?«
»In Ordnung«, sagte Judith langsam, »sie haben nun einmal diese Art, klipp und klar, ex und hopp. Aber man weiß wenigstens, woran man ist.«
»Ganz genau. Immerhin haben sie sich erkundigt, was ich nun vorhabe.«
»Weißt du es schon?«
»Nein, das werden wir gemeinsam überlegen und beschließen, du und ich.«
»Fein, dann kannst du mir jetzt schon mal ein Eis kaufen, und sobald ich meinen Vater vor die vollendete Tatsache gestellt habe, daß er demnächst Großvater wird, besorgen wir uns die Heiratspapiere. Wird sowieso wochenlang dauern, bis wir alles zusammen haben.«
Hand in Hand schlenderten sie die Promenade entlang bis zum nächsten Kiosk. Selbst im Schatten der Palmen wurde es bereits mittäglich heiß. Sie besprachen die verschiedenen Möglichkeiten einer Hochzeitsfeier, aber außer einem verschwiegenen Gang zum Standesamt und anschließendem Imbiß mit ein paar guten Freunden konnten sie sich nichts vorstellen, am allerwenigsten eine Familienzusammenführung der Kranzlers und der Holborns.
Nachdem sie ein großes Eis gegessen hatten, gingen sie noch ein Stückchen weiter bis zum Platz der Republik, wo man auf das schöne, alte Kastell aus längst vergangenen Piratenzeiten stieß, denn Judith hatte gerade beschlossen, ihren Vater in der Botschaft abzuholen und mit ihm im Wagen nach Hause zum Mittagessen zu fahren.
Benjamin wartete, bis der schwarze Mercedes mit Armando am Steuer vorfuhr, winkte noch einmal und verschwand unter dem Glasdach der Bushaltestelle.
Er hatte es nicht eilig. Seine Eltern würden erst abends daheim eintreffen, ihre diversen Aktivitäten hielten sie jeweils den ganzen Tag irgendwo fest. Soweit er sich erinnern konnte, war er in Gesellschaft wechselnder Hausmäd-chen großgeworden, was ihn frü-her oft verstört hatte. Obwohl er inzwischen erwachsen und an die unpersönliche Atmosphäre gewöhnt war, die im Hause Holborn herrschte, freute er sich kindisch auf die ganz andere Familie, die er gründen würde, auf die Geborgenheit, das Zusammensein mit Frau und Kind, das Miteinander und Füreinander, das ihm so schmerzlich gefehlt hatte, seit er denken konnte.
*
Abgesehen von den üblichen Ärgernissen, hervorgerufen durch ein defektes Faxgerät, eine gestörte Telefonleitung nach Übersee, zwei gestrandete deutsche Existenzen, die irgendwie sobald wie möglich ins Heimatland zurückbefördert werden mußten, hatte Rupert Kranzler an diesem Vormittag den Wunsch seiner Sekretärin nach einem freien Montag nicht länger ignorieren, sondern widerwillig erfüllen müssen. Außerdem hatte er festgestellt, daß der Sportarzt immer noch nicht imstande war, ihm die letzten Ergebnisse der Allround-Untersuchung durchzugeben, da die Laborwerte noch nicht vorlagen. Der Doktor, so schien es, nahm den Patienten Rupert Kranzler nicht übermäßig ernst, da bisher außer ein paar unbedeutenden Schwankungen der Herztätigkeit nichts vorlag.
Seit seinem fünfzigsten Geburtstag besuchte Rupert Kranzler regelmäßig ein Fitness-Studio, schwamm täglich morgens und abends je fünfzehn Minuten im Pool, beschränkte sich auf ein Minimum an Alkohol, was bei offiziellen Anlässen nicht ganz einfach war, und ließ sich regelmäßig untersuchen. Schließlich hatte er fünfundzwanzig Jahre im auswärtigen Dienst hinter sich, meist in Südamerika, und wie man wußte, zehrte das tropische Klima enorm an der Gesundheit des Mitteleuropäers.
Der Gedanke, daß wegen des bevorstehenden Wochenendes vorerst keine Hoffnung auf die Untersuchungsergebnisse bestand und darüber hinaus am Montag sein Vorzimmer unbesetzt sein würde, stimmte den Botschafter nicht gerade heiter.
Als er im Hinausgehen seiner Tochter ansichtig wurde, die bereits am Wagen lehnte und offenbar mit ihm nach Hause fahren wollte, seufzte er unhörbar. Denn nichts interessierte ihn im Augenblick weniger als das Zeugnisheft, mit dem sich Judith gerade etwas Kühlung zufächelte.
»Hallo, Paps«, begrüßte sie ihn, ohne seine abweisende Miene zur Kenntnis zu nehmen, »ich dachte, ich komme gerade noch rechtzeitig, um dich abzuholen. Es ist nämlich so, daß ich dir etwas erzählen muß.«
»Können wir es nicht auf heute abend verschieben?« fragte Rupert Kranzler ziemlich hoffnungslos, denn der Eifer in der Stimme seiner Tochter zeigte deutlich an, daß sie nicht gewillt war, ihr Programm zu ändern.
Statt vorn neben Armando Platz zu nehmen, ließ er sich im Rücksitz neben Judith nieder, zog die Trennscheibe vor und lehnte sich abwartend zurück.
In seinen Augen war sie immer das gleiche liebenswerte Kind geblieben, unfertig, sprunghaft, unreif, eher ein Spätzünder.
»Wir müssen froh sein, wenn sie mit einundzwanzig annähernd weiß, was sie will«, pflegte er zu seiner Frau zu sagen. Entsprechend dieser Erkenntnis, um Judith vor allzu weitschweifenden Umwegen zu bewahren, hatte er die kommenden Jahre für sie fest verplant. Allzu viel Spielraum tat ihr nicht gut. Nach einem gewissen Schema, von ihm aufgestellt und eisern vorgegeben, mußte sie sich richten, Punkt, Schluß, basta. Keine Diskussion. Zuerst kam das Abitur, kein Weg führte daran vorbei, dann Studium Generale an einer deutschen Universität, damit sie einen Überblick über alle Fächer gewann, die es gab, nur zur Information, und nur zwei Semester. Danach, egal, was sie für sich ausgewählt hätte, folgten zwei Jahre Business-School in Washington, ein teurer Spaß, aber sein Geld wert, weil sie sich dort das Rüstzeug erwarb für eine solide eigene Existenz. Was sie daraus machte, war dann aus-schließlich ihre Sache, denn bis dahin war sie zweiundzwanzig und hoffentlich erwachsen.
»Deshalb«, hörte er Judith sagen, »möchten wir so bald wie möglich heiraten.«
Moment – Moment mal – da mußte ihm wohl etwas Entscheidendes entgangen sein. Normalerweise brauchte man dem kindlichen Geplauder nicht von Anfang bis Ende zuzuhören. Hier schien eine Ausnahme vorzuliegen.
»Heiraten? Jetzt? In absehbarer Zeit? Du bist ja nicht gescheit.«
»Na gut, dann warten wir, bis ich achtzehn bin«, erwiderte Judith friedlich und blies sich eine haselnußbraune Locke aus der Stirn.
»Noch mal das Ganze von vorn, bitte«, befahl der Botschafter, dem es plötzlich vom Magen her etwas flau wurde, oder vielleicht war es auch der Kreislauf.
»Im März«, sagte Judith mit sanfter Ungeduld, »kommt ja schon das Baby. Von mir aus brauchten wir den ganzen Streß mit der Trauung und dem Papierkram gar nicht zu machen, aber Benjamin hätte gern von Anfang an alles richtig geregelt, nicht unbedingt kirchlich, aber gesetzlich, verstehst du, behördenmäßig. Wir beide heiraten, das Kind auf seinen Namen, egal, wie kompliziert das ist im Ausland. Später, sagt er, wird es höchstens noch komplizierter, also tun wir es gleich.«
Rupert Kranzler starrte blicklos durch die getönte Trennscheibe und versuchte mittels autogenem Training, seinen Blutdruck zu kontrollieren und einen Ausbruch seines galligen Temperaments zu vermeiden.
»Was sagt denn deine Mutter dazu?« brachte er schließlich krächzend hervor.
»Na ja, sie ist nicht gerade wild begeistert, aber sie wird sich daran gewöhnen, sie ist ja flexibel, nicht?«
»Und Benjamins Eltern?«
»Ach. Sie haben Theater gemacht.«
»Aha, dann laß dir von mir sagen, daß ich nicht so flexibel bin«, schnaubte Rupert und umklammerte seine Knie mit beiden Händen. »Im Gegenteil! Ich bin der Nein-Sager, ich bin der Spielverderber, das hast du dir ja sicher schon gedacht.«
Judith biß sich auf die Lippen.
»Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie du mit deinen siebzehn Jahren dein Leben ruinierst«, fuhr ihr Vater bebend vor Erregung fort. »Du weißt ja gar nicht, worauf du dich da einläßt. Du hast keine Ahnung, was es bedeutet, an Mann und Kind gekettet zu sein. Du hast noch nichts gelernt, noch nichts geleistet, noch nichts aufzuweisen, du bist nicht imstande, auf eigenen Füßen zu stehen und, was noch schlimmer ist, dasselbe gilt auch für Benjamin. Nein, nein, Judith, tut mir leid, wenn ich dich enttäusche – aber ich bin dagegen. Ich lebe nicht im Wolkenkuckucksheim. Ich bin Realist. Alles, was ihr euch da zusammengesponnen habt, wird auf uns ausgehen, auf deine Mutter und mich, denn mit den Holborns ist kaum zu rechnen, und ich sage dir, ich sage dir hier in allem Ernst – ich lasse das nicht zu. Ich lasse mich nicht derart unter Druck setzen.«
Er riß ein Päckchen Papiertaschentücher auf und trocknete sich die verschwitzten Schläfen.
Judith rollte ihr Zeugnisheft zusammen und atmete ein paarmal tief durch.
»Okay, Paps, du hast mir deine Meinung gesagt, jetzt bin ich dran. Und ich sage dir, daß ich ein Baby bekomme, daß ich es behalte und Benjamin heirate.«
Der Wagen bog in die Einfahrt des Hauses ein, dessen Mauern mit üppigen orangefarbenen Blüten und glänzendem dunkelgrünem Blattwerk über und über berankt waren. Auf der Terrasse standen zwei aufgespannte, leuchtend gelbe Sonnenschirme.
Hildegard lehnte sich über die Brüstung, sah die heftige Armbewegung, mit der sich Rupert aus dem Fond hervorarbeitete, sah seine finstere Miene und Judiths fest zusammengepreßte Lippen und dachte: Ach herrje, das ist ja voll danebengegangen. Konnte sie denn nicht warten bis heute abend?
*
Es war nicht so einfach, zwischen den verhärteten Fronten zu vermitteln. Es war sogar noch schwieriger, als Hildegard es sich vorgestellt hatte, denn Rupert bestand darauf, daß seine Tochter das Abitur ablegte, bevor sie sich auf das dünne Eis der fragwürdigen Existenz begab, die Benjamin Holborn ihr bieten konnte.
»Als ob ich mit Abitur besser dran wäre«, empörte sich Judith und tippte sich an die Stirn. »Es ist doch nur ein Schulabschluß, keine Ausbildung.«
»Gewiß, gewiß«, wiegelte Hildegard ab, »aber daß du mit Abitur besser dran wärest, läßt sich einfach nicht leugnen. Das Ärgerliche ist ja nur, daß du so kurz davor stehst und im allerletzten Moment abschwenken willst – beziehungsweise mußt.«
»Wenn es euch beruhigt, kann ich ja zur Schule gehen, bis die Wehen einsetzen, das kann dann vielleicht am Tag der schriftlichen Mathearbeit sein oder auch mitten in der mündlichen Prüfung. Kannst du mir erklären, was daran so wahnsinnig toll wäre? Was ich davon hätte?«
Judith fuchtelte mit dem Teelöffel in der Luft herum, denn sie saßen beim Frühstück, der einzigen Mahlzeit, die sie ohne Rupert einnahmen.
»Es geht ja nur darum, daß du den guten Willen zeigst«, sagte Hildegard gedämpft, »daß du es wenigstens versuchst, solange es irgend möglich ist.«
»Also geht es gar nicht um das Abitur an sich, sondern nur darum, daß Paps das Gefühl hat, sich wieder einmal durchgesetzt zu haben. Ist es das, was du mir verklickern willst, Mutsch?«
Hildegard senkte den Blick auf die Teetasse und rührte endlos darin herum. Sie fühlte sich unangenehm durchschaut. Erziehung, so hatte sie dereinst gelernt, funktioniert nur dann, wenn beide Eltern an einem Strang ziehen.
In letzter Zeit hatte sie allerdings das ungute Gefühl, daß sie selbst der Strang war, an dem Rupert und Judith mit aller Macht zogen, jeder in eine andere Richtung. Die Frage war nur, wie lange sie diese Zerreißprobe aushielt.
»Du hast doch nichts versäumt«, sagte sie schwach, »ob du nach den Ferien zur Schule gehst oder nur hier herumsitzt – ich meine, jetzt kannst du noch gehen, jetzt bist du noch Herr deiner Zeit – später, wenn das Kind da ist, sieht alles anders aus.«
»Glaubst du, das wird Paps dazu bewegen, meine Papiere zu besorgen und mir die Heiratserlaubnis zu erteilen?«
»Es wäre zumindest hilf-
reich, wenn du ihm diesen einen Schritt entgegenkommen könntest, Schätzchen.«
Judith seufzte, bestrich sich einen Toast mit Butter und Marmelade und biß herzhaft hinein. Die Fehde mit ihrem Vater schien sie nicht besonders zu belasten. Manchmal hatte man sogar den Eindruck, daß es ihr Genugtuung verschaffte, ihm seine Grenzen zu zeigen.
»Sieh mal, du hast jetzt Ferien, kannst dich ausruhen und ablenken, vielleicht bist du froh, wenn du im August wieder regelmäßig etwas zu tun hast, dich geistig anstrengen mußt. Eine Schwangerschaft ist schließlich keine Krankheit.«
»Haa, das klingt ganz nach Elaine«, kicherte Judith, trank ihren Tee aus, ließ ein Glas Milch folgen und griff sich eine Orange.
»Wir sehen uns heute eine Wohnung an«, sagte sie beiläufig, »so gegen elf Uhr holt Benjamin mich ab. Wartet also nicht mit dem Mittagessen auf mich.«
»Eine Wohnung?« wiederholte Hildegard dumpf.
»Ja, sein Freund Reginald hat uns den Tip gegeben. Er wohnt gleich neben der Uni in einem ziemlich großen Haus. Er sagt, im ersten Stock wird demnächst etwas frei.«
»Aber Judith – wozu denn das? Davon war doch bis jetzt noch nie die Rede.«
»Weil wir immer nur auf dem einen einzigen Thema herumreiten, Mutsch, auf diesem dämlichen Abitur. Dabei gibt es noch so viele andere Sachen, die viel wichtiger sind und viel früher geregelt werden müssen. Zum Beispiel das mit der Wohnung.«
»Willst du wirklich ausziehen, Schätzchen?« fragte Hildegard mit zitternder Stimme.
Ihre Tochter sah sie aus weit geöffneten, golden schimmernden Augen an.
»Ja, sicher! Wir wollen doch zusammensein, Benjamin und ich. Wir wollen eine Familie haben, unsere eigene. Oder hast du gedacht, er würde hier einziehen? Das täte er nie. Ebenso wenig, wie ich zu seinen Eltern ziehen würde.«
»Aber du bist schwanger, Judith. Du hast keine Ahnung, was das heißt – in einem halben Jahr wirst du dich kaum mehr bücken können.«
»Aber in der Schulklasse sitzen, das kann ich, nicht wahr? Das wollt ihr mir doch alle einreden.«
»Unterbrich mich nicht! Hier hast du deine Ordnung, hier lebst du in einem Haushalt, der ohne dein Zutun wie am Schnürchen läuft – und immer gelaufen ist. Ich kann ja begreifen, daß du nicht immer hierbleiben willst, aber gerade jetzt – ausgerechnet jetzt – solltest du keine so einschneidende Änderung vornehmen. Denk doch mal an das Kind. Hier hat es von Anfang an alles, was es braucht – reichlich Platz und Bequemlichkeit und genügend Leute, die sich kümmern – glaub mir, das alles spielt eine große Rolle, auch für dich und Benjamin. Ihr seid beide an Luxus gewöhnt. Ihr könnt doch nicht von heute auf morgen umschalten und auf Sparflamme kochen – was heißt überhaupt kochen. Du lieber Gott, wer soll das denn alles machen und wo – in einer kleinen Mietwohnung?«
Hildegard schlug die Hände überm Kopf zusammen und warf einen verzweifelten Blick in die Runde des Eßzimmers, das nach der Terrasse hin offen und durch eine verglaste Theke mit den Küchenräumen verbunden war.
»Weißt du, was komisch ist, Mutsch?« murmelte Judith, und bevor sie eine Antwort erhielt, fuhr sie bereits tiefsinnig fort: »Alles, was bis jetzt überhaupt kein Thema war, alles, was wir immer hatten, zumindest seit ich auf der Welt bin, das werft ihr mir plötzlich vor. Als ob ich etwas dafür könnte, daß wir einen hohen Status haben. Daß ein Diplomat wie Papa nicht in einer mickrigen Dreizimmerwohnung hausen kann, sondern eine große Villa mit Personal haben muß. Das kann doch jeder einsehen, das gehört einfach zu seinem Job. Aber was hat das mit mir zu tun? Wieso heißt es jetzt auf einmal dauernd, daß ich sooo verwöhnt bin, daß ich keine Ahnung vom Ernst des Lebens habe – ich meine, das ist doch irgendwie komisch, nicht? Daß euch das jetzt erst einfällt, und daß es immer so klingt, als hätte ich das in der Hand gehabt, als hätte ich bestimmen können, wie ich groß werde – mit oder ohne Dienstwagen, mit oder ohne Köchin, mit oder ohne Ferienlager, mit oder ohne eigenes Badezimmer. Verstehst du, was ich meine?«
Sie beugte sich vor und starrte ihrer Mutter angelegentlich ins Gesicht.
»Ja«, sagte Hildegard langsam, »ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, du mißverstehst da etwas. Von Vorwurf kann keine Rede sein, eher von einer Warnung. Wir sind ganz auseinander vor Sorge um dich, Schätzchen. Die Situation ist nicht gerade alltäglich für uns, wir müssen uns erst hineinfinden. Also tu mir den Gefallen und lege nicht jedes Wort auf die Waagschale, sondern hab’ ein bißchen Geduld mit deinen verknöcherten Eltern.«
»Keine Angst, Mutsch, dir tue ich jeden Gefallen«, versicherte Judith strahlend, warf eine Handvoll Vitamine ein, sprang auf und zauste ihrer Mutter gründlich das Haar. Dann schlenderte sie über die Terrasse zu den berankten Mauern, knipste einen Zweig ab und musterte ihn prüfend.
»So was hätte ich auch gern in unserer Wohnung«, rief sie Hildegard zu. »Das sieht schön aus und wächst von allein. Wie mache ich das? Kann ich einfach einen Ableger nehmen oder muß ich Samen sammeln und in kleinen Töpfen ziehen?«
»Frag Letitia«, rief Hildegard zurück, »und sieh dich erst einmal um, ob du so was überhaupt brauchen kannst. Da du weder eine Terrasse noch einen Garten haben wirst – wo willst du diese Pflanzen ranken lassen?«
»Mal sehen«, sagte Judith unbekümmert.
Eine Stunde später war sie mit Benjamin auf und davon, unter Zurücklassung ihrer Haussandalen mitten auf der Terrasse, eines Frottierhandtuchs, das sie nach der Haarwäsche achtlos über den Geländerpfosten geworfen hatte, und ihres Mini-Rucksacks neben dem Küchentelefon, den sie entweder vergessen oder absichtlich dort abgelegt hatte.
Letitias kleine gebeugte Gestalt huschte umher wie ein Schatten, um gewohnheitsgemäß alles aufzusammeln und hinauf zu tragen in das große, luftige Zimmer mit angrenzendem schmetterlingsgelbem Bad, das Judith bewohnte.
»Laß es liegen«, befahl Hildegard und wedelte mit der erhobenen Hand.
»Alles?« fragte Letitia ungläubig.
»Alles«, wiederholte Hildegard mit fester Stimme. Für erzieherische Maßnahmen war es natürlich viel zu spät, aber ein kleiner Fingerzeig konnte nicht schaden.
*
Die Wohnung lag im ersten Block eines breit angelegten dreistöckigen Gebäudes, das mehrere Eingänge und einen großen Hinterhof hatte, der mit Zweirädern gänzlich zugeparkt war.
Im Treppenhaus waren die Wände mit Grafitti bedeckt, man hörte Rumbarasseln und Bongotrommeln und die monotone Stimme eines Nachrichtensprechers.
»Hier«, sagte Reginald, ein baumlanger Engländer mit wehendem Rauschebart, und drückte Benjamin einen Schlüssel in die Hand. »Apartment Nummer fünf. Geht rein und seht euch um. Die Leutchen sind vorgestern ausgezogen, aber ihr Mietvertrag läuft noch bis zum Monatsende. So lange ist der Schlüssel bei mir. Danach kriegt ihn der Hausmeister, der hat immer ein paar Anwärter für jede Wohnung, nimmt wahrscheinlich einen Bakschisch für die Vermittlung. Also, bis später, ihr beiden, ich muß schleunigst los, mein Seminar hat schon angefangen. Werft mir den Schlüssel in meinen Briefkasten, und viel Spaß bei der Palastbesichtigung.«
»Danke«, riefen Benjamin und Judith hinter ihm her, stiegen die letzten Stufen zum ersten Stock hinauf und steckten den Schlüssel in die Tür von Nummer fünf.
Die Wohnung bestand aus einem Hauptraum mit Küchenzeile, die unmittelbar neben dem Eingang lag. Eine offene Nische war als Wohnzimmer vorgesehen, eine zweite bestand aus einem Balkon, der mit Gitterdraht umgeben war wie ein Käfig. Drei schmale Türen führten in zwei kleine Schlafzimmer und in ein noch kleineres Bad. Es gab weder Diele noch Flur, nur diesen einen durch Türen und Nischen vielfach unterbrochenen Küchen- und Allzweckbereich, spartanisch anmutend und nur mit dem Nötigsten versehen, wie auch das Bad.
»Was meinst du?« fragte Judith zweifelnd und kickte ein paar Müllsäcke beiseite, die von den Vormietern offenbar vergessen worden waren.
»Man könnte etwas daraus machen«, murmelte Benjamin versonnen. »Mit ein paar Eimern Farbe…«
»Vor allem mit heißem Wasser und Scheuermitteln«, ergänzte Judith schaudernd, »die ganze Bude ist doch ziemlich verkommen.«
»Wir müssen sie nicht nehmen, Sweetie, wir können uns noch jede Menge andere ansehen. Diese hier hat den Vorteil, günstig zu liegen, das heißt neben der Uni, und der Preis stimmt auch. Aber eigentlich wäre es dumm, die erstbeste zu nehmen.«
»Genau, wir haben ja gar keine Vergleichsmöglichkeit.«
Sie schlossen die Tür hinter sich, warfen den Schlüssel in Reginalds Briefkasten mitsamt einem Zettel, der besagte, daß sie sich gegen Abend melden würden, und stürmten davon.
An diesem Tag lernten sie Torreval besser kennen als in den ganzen Jahren vorher.
Eine Liste mit Maklerangeboten in der Tasche klapperten sie insgesamt fünfzehn verschiedene Adressen ab. Ohne den kleinen wendigen Zweisitzer, den Benjamin zum Abitur bekommen hatte, wären sie bis zum Nachmittag gar nicht fertig geworden.
Es gab natürlich sowohl größere als auch gepflegtere Apartments in guten Stadtlagen für nicht viel mehr Geld. Aber die bekam man nur, wenn man verheiratet war und ein regelmäßiges Einkommen nachweisen konnte.
Dann gab es die wirklich schönen Wohnungen mit Innengarten und neuer Einbauküche, deren Mietpreis Benjamin und Judy gar nicht in Erfahrung brachten, weil die Vermieter ihnen lächelnd nahelegten, ihre Eltern mitzubringen und den Vertrag abschließen zu lassen.
Außerdem gab es Reihenhäuser, die man anzahlen und abstottern konnte, aber so was suchten sie nicht.
Nach einer längeren Pause auf ihrer Lieblingsbank an der Uferpromenade kamen sie überein, daß Nummer fünf im ersten Stock neben der Uni gar nicht so übel war.
Wenn sie schon dort wohnten, befand Benjamin, konnte er auch ein Studium beginnen, wobei er sich über das Fach noch nicht im klaren war.
Judith beschloß bei sich, im Hinblick auf die groben Reinigungsarbeiten eine bewährte Kraft zu Rate zu ziehen, nämlich Letitia, die für jeden Hausputz eine ganze Truppe Hilfswillige zu mobilisieren pflegte.
Alsdann riefen sie Reginald an, um ihre Zusage durchzugeben, aber damit war es nicht getan, weil sich inzwischen noch andere Anwärter eingefunden hatten, denen es allerdings an der sofort zu hinterlegenden ersten Monatsmiete mangelte.
Diese Bedingung brachte auch Benjamin und Judith vorübergehend in Verlegenheit, denn die Banken waren bereits geschlossen und keiner von ihnen verfügte bisher über eine Kreditkarte.
Schließlich liehen sie sich das Geld von Benjamins Mutter, die gar nicht fragte, wofür sie es brauchten.
Nach einer hektischen Fahrt durch den Hauptverkehr am frühen Abend erreichten sie das Apartment Nummer fünf gerade rechtzeitig, bevor der Hausmeister für diesen Tag die Verhandlungen abbrach.
Alles, was er ihnen aushändigte, als er das Geld kassiert hatte, waren eine ziemlich unleserliche Quittung und der Schlüssel.
»Kein Mietvertrag?« fragte Benjamin stirnrunzelnd.
»Kommt später«, war die knappe Antwort.
»So was gibt’s hier nur nach mehrmaliger Anfrage«, bemerkte Reginald gelassen und schnappte sich einen der Müllsäcke. »Ihr wollt ja sicher komplett renovieren. Also, wenn ihr eine Leiter braucht, die habe ich, und einen extra starken Staubsauger hat Thom, der wohnt neben euch. Falls ihr ein paar kostspielige Sächelchen mitbringt – Computer oder größere Musikanlagen oder auch Teppiche, die was wert sind – empfehle ich euch ein doppelt gesichertes Schloß an der Tür und einen Riegel innen.«
Sprach’s und griff sich auch noch den zweiten Müllsack und polterte laut pfeifend die Treppe hinunter.
»Wird ein ganz neues Leben sein, das wir hier führen«, murmelte Benjamin und drückte Judiths Hand.
»Das ist schon okay«, erwiderte sie tapfer. »Genau das ist es ja, was wir wollen.«
Sie ließ den Blick über die zerschrammten Wände gleiten, über die kümmerlichen Reste verdorrter Pflanzen am Balkongitter und die nackte Glühbirne, die einsam von der Decke baumelte.
»Ein Glück, daß wir Ferien haben«, sagte sie aufatmend. »Wenn erst mal alles sauber ist, male ich eine große Blume an die Wand zwischen den Türen – und dann nehme ich mir das Bad vor, das sieht ja einfach trostlos aus. Was hältst du von Mintgrün als Grundfarbe und einem bunten Fries oben an der Decke entlang?«
»Kann ich mir gut vorstellen«, antwortete Benjamin und sah sich noch einmal gründlich um. »Und was wir gleich brauchen, ist ein Telefon.«
»Und einen großen Schreibtisch, um alles zu notieren, was uns einfällt, was wir besorgen müssen – zum Beispiel den Riegel für die Tür.«
»Und einen Mietvertrag.«
»Und Geld«, sagte Judith. »Und zwar auf der Hand!«
An diesem Abend trennten sie sich eilig vor dem Haus der Kranzlers, nachdem sie fürs erste Stillschweigen vereinbart hatten. So, wie sich ihr künftiges gemeinsames Nest zur Zeit noch präsentierte, würde es eine Woge der Entrüstung auslösen, und darauf wollten sie es nicht ankommen lassen.
Auf dem Weg zu ihrem Zimmer fand Judith ihre Haussandalen und ihren Mini-Rucksack, beides auf der untersten Treppenstufe, und ein Frottierhandtuch über dem Geländerpfosten. Kopfschüttelnd stieg sie darüber hinweg, dann, plötzlich verhielt sie den Schritt und fragte sich, warum um alles in der Welt niemand das feuchte Handtuch draußen auf die Leine gehängt hatte.
Langsam ging sie noch einmal zurück, hob alles auf und nahm es mit nach oben. Sie wußte nicht, was dies zu bedeuten hatte, aber eine leise Ahnung beschlich sie, während unten das Essen aufgetragen und Vorbereitungen für eine Abendgesellschaft getroffen wurden.
Judith fühlte sich zu Unrecht ermahnt. Gewiß, sie war nie besonders ordentlich gewesen, weil dazu keine Notwendigkeit bestand. Aber das würde sich ganz von selbst ändern, sobald sie nicht mehr hier lebte.
Viel wichtiger war das bemalte Holzkästchen, in dem sie ihr Taschengeld aufbewahrte und die Frage, wieviel sich darin befand. Bisher hatte es keine große Rolle gespielt, denn alles, was sie brauchte, bekam sie sowieso. Ihre Mutter entnahm dem Safe im Ankleidezimmer jeden Morgen eine bestimmte Summe, ohne daß darüber groß geredet wurde.
Judith hatte nie gelernt, mit Geld umzugehen. Nach ihrem achtzehnten Geburtstag würde sie kein Taschengeld mehr ausgezahlt sondern ein eigenes Konto mitsamt Kreditkarte bekommen, damit sie, wie ihr Vater zuweilen ernst bemerkte, den Wert des Geldes schätzen lernte. Judith hielt das für einen der hohlen Sprüche, die Erwachsene bei passenden und unpassenden Gelegenheiten von sich geben.
Auf der Suche nach dem Kästchen durchwühlte sie ihre sämtlichen Kommodenschubladen und ärgerte sich maßlos, weil sie nach dem neuen ungeschriebenen Gesetz all die wild herausgeschleuderten Sachen wieder einräumen mußte.
Inzwischen war es höchste Zeit zum Abendessen, nicht nur wegen der verhaltenen Rufe Letitias, sondern auch wegen des Magens, der ihr schon seit einer Weile vernehmlich knurrte.
»Du siehst ja schrecklich aus«, raunte Hildegard, als sich ihre Tochter mit verstaubtem Haar und aufgeschürftem Ellenbogen zu Tisch setzte.
»Oh, mir geht’s gut«, erwiderte Judith und lächelte überlegen in die Runde.
*
»Man kann uns nicht nachsagen, daß wir unsere Zeit vergeudet hätten«, stellte Benjamin nach Ablauf der großen Ferien mit hörbarer Zufriedenheit fest, und das galt nicht nur für die Instandsetzung der kleinen Wohnung.
Im Bestreben, die verhältnismäßig große Summe, die ihm sein Vater überantwortet hatte, sinnvoll anzulegen, war er zu Don Damian Devento gegangen, dem bekanntesten Rechtsanwalt in Torreval, dem er auch die Frage nach der Notwendigkeit eines gültigen Mietvertrages vorlegte.
Nach ein paar Gesprächen hatte ihm Don Damian vorgeschlagen, als Volontär in seinem Büro zu arbeiten und sich für das Jurastudium an der Universität einzuschreiben. Probehalber sozusagen, nur um einen Einblick zu gewinnen und die Erfahrung zu machen, was es bedeutet, berufstätig zu sein.
Es sei ungeheuer wichtig, hatte Don Damian erklärt, jedem Tag eine gewisse Struktur zu geben, denn auch für den aufgeklärten Menschen gäbe es kein größeres Mysterium, als das unaufhörliche Verrinnen der Zeit. Wer nicht imstande sei, sich diesem Phänomen auf philosophischem Wege zu nähern, der müsse sich jener anderen Hilfsmittel bedienen, die das Leben für ihn bereithalte.
Benjamin war beeindruckt gewesen, aber noch nicht ganz überzeugt.
Sobald er nützliche Arbeit leisten könne, hatte Don Damian hinzugefügt, werde er auf der Gehaltsliste einen respektablen Platz einnehmen, mit steigender Tendenz, versteht sich.
Da die meisten Studenten in Torreval tagsüber einer geregelten Tätigkeit nachgingen, fanden alle Vorlesungen abends zwischen sieben und zehn Uhr statt. Benjamin zweifelte keinen Augenblick daran, daß er sowohl den Job bei Don Damian als auch die Abend-Uni locker unter einen Hut bringen und dabei noch reichlich Zeit für seine kleine Familie haben würde.
Vor allem hoffte er, Judiths Vater mit diesem Programm stark genug beeindrucken zu können, um dessen an Halsstarrigkeit grenzenden Widerstand zu brechen.
Aber letzten Endes war es Hildegard, die mit schier übermenschlicher Überredungskraft das Unmögliche erreichte, nämlich eine Ziviltrauung in ihrem Hause, vorgenommen von einem Standesbeamten und protokolliert von zwei konsularischen Angestellten, einem amerikanischen und einem deutschen, verbunden mit einer kleinen, stilvollen Feier und einem zwanglosen Fondue-Essen im Gesellschaftsraum, zu dem außer Benjamins Eltern und seinem Freund Reginald auch Elaine Thompson geladen war, sowie Judiths beste Freundinnen Valerie und Patricia.
Die Eltern Holborn verabschiedeten sich bei dieser Gelegenheit gleich für die nächsten drei Monate, und es war Hildegard völlig klar, daß man mit ihnen nie viel zu tun haben würde.
Judith war inzwischen im vierten Monat und fand überhaupt nichts dabei, als einzige Schülerin der Internationalen Schule sowohl verheiratet als auch schwanger zu sein. Im Gegenteil, sie schien diesen Ausnahmezustand sogar zu genießen. Noch ging es ihr glänzend, besser denn je, und obwohl sie mitsamt ihrem Kleinkram in die Wohnung Nummer fünf übergesiedelt war, kam sie abends, wenn Benjamin in der Vorlesung war, regelmäßig auf ein Stündchen vorbei, um mit ihrer Mutter zu plaudern.
Hildegard hatte es sich nicht nehmen lassen, die winzigen Räume sparsam zu möblieren, die abgenutzten Küchengeräte zu ersetzen und gemeinsam mit Letitia den trostlosen Balkon-Käfig in eine kleine blühende Oase zu verwandeln. Gottlob gedieh im ewigen Sommerklima der karibischen Küste jeder Zweig, den man in die Erde steckte, binnen weniger Wochen so üppig, daß man ihn beschneiden mußte. Aber es wurde auch sehr heiß um diese Jahreszeit, und der Ventilator verbreitete den üblichen unangenehmen Luftzug, der immer Erkältungen hervorrief.
Hildegard machte sich darüber bereits große Sorgen, besonders im Hinblick auf das Baby.
Sie selbst hatte nie anders als in vollklimatisierten Häusern gewohnt. In den Tropen, so ihre festgefügte Meinung, war eine Klimaanlage genauso unverzichtbar wie in den kalten Ländern eine Heizung. Sich mit einem Ventilator behelfen zu müssen, kam ihr auf die Dauer recht ungesund vor und natürlich primitiv.
Aber nach allem, was sie in letzter Zeit in Bewegung gesetzt hatte, konnte sie fürs erste an keinen weiteren Vorstoß denken. Sie ging einfach davon aus, daß Judith das Baby so oft wie möglich bringen würde, zumal ihr das Zimmer im ersten Stock nach wie vor zur Verfügung stand und Letitia immer noch die schmackhaftesten Mahlzeiten zubereitete, die man sich vorstellen konnte.
Nach und nach legte Hildegard einen wachsenden Vorrat an Säuglingswäsche an, den sie in Judiths leerem Schrank stapelte, und genau da sollte er auch bleiben.
Über Weihnachten und Neujahr flogen sie und Rupert traditionsgemäß nach Deutschland, diesmal allerdings ohne ihre Tochter, aber zu Judiths achtzehntem Geburtstag waren sie natürlich wieder zurück.
Um diese Zeit begannen die schriftlichen Abiturarbeiten, die Valerie und Patricia in begreifliche Aufregung versetzten, wäh-rend Judith sich nicht aus der Ruhe bringen ließ. Es war, als gingen von dem kleinen Wesen, dessen Entwicklung sie mit Benjamin im bebilderten Buch wie gebannt verfolgte, eine heilsame Kraft aus, die sie vor Nervenkrisen und Überreaktionen bewahrte.
Außerdem, wie sie oftmals zu Valerie sagte, hatte das Abitur für sie keinen besonders hohen Stellenwert. Im Vergleich zu der Prüfung, die sie Mitte März erwartete, kamen ihr selbst die mathematischen und lateinischen Arbeiten läppisch vor. Am zwanzigsten Februar erhielt sie die Mitteilung, daß sie aufgrund ihrer schriftlichen Noten von der mündlichen Prüfung befreit wurde.
Kurz danach sprach sich bereits die erstaunliche Tatsache herum, daß Judith Kranzler-Holborn das beste Abitur der Klasse abgelegt hatte.
»Das hast du allein mir zu verdanken«, sagte Rupert, als sie das freudige Ereignis mit Sekt und Kullerpfirsich auf der Terrasse feierten. »Wenn ich nicht darauf bestanden hätte, wärest du überhaupt nicht mehr in die Schule gegangen.«
Benjamin wollte zu einer Erwiderung ansetzen, aber Hildegard winkte im Hintergrund kopfschüttelnd und lächelnd ab, und später raunte sie ihrer Tochter zu: »Laß ihm den Triumph, es kostet euch doch nichts, und er kann ihn gebrauchen.«
»Wieso?« fragte Judith stirnrunzelnd.
»Ist er krank?« erkundigte sich Benjamin leise.
»Nein«, sagte Hildegard, »er ist topfit, aber es mangelt ihm an Bestätigung. Dieser Posten hier…«, sie brach ab, weil das Telefon klingelte und Rupert an ihnen vorbei stapfte, und sie kam auch später nicht mehr darauf zu sprechen, weil es Wichtigeres gab als das schwankende Wohlbefinden eines kerngesunden Mannes in den zweitbesten Jahren.
*
»Es müßte sich allmählich drehen«, sagte Elaine Thompson nach der Untersuchung, die nun wöchentlich stattfand, und notierte etwas auf ihrem Schreibtischblock.
»Von rechts nach links?« fragte Judith zweifelnd.
»Nein, von oben nach unten, wenn wir mit einem glatten Geburtsvorgang rechnen wollen, und das tun wir selbstverständlich. Sieht nicht so aus, als käme es pünktlich zum errechneten Termin.«
»Wäre das schlimm?«
»Überhaupt nicht. Das erste Kind läßt sich meistens länger Zeit, aber sicherheitshalber möchte ich dazu raten, daß du am fünfzehnten in die Klinik kommst. Hast ja nichts zu versäumen, machst es dir hier mit ein paar Büchern gemütlich und plauderst ein bißchen mit deinen Schicksalsgenossinnen. Okay?«
»Okay, es ist nur wegen Benjamin – er möchte bei der Geburt dabei sein, und ich möchte das auch«, wandte Judith ein, und zum ersten Mal klang sie leicht verängstigt.
»Kein Problem«, meinte Frau Dr. Thompson beruhigend, »er wird sich eben ein Handy anschaffen, notfalls kann er sich für diese Zeit eins leihen.«
Benjamin, als er davon hörte, war sofort einverstanden. Nur nichts darauf ankommen lassen, hieß seine Devise. Nur nicht zu Hause sitzen und auf die Wehen warten und dann mit Tatütata in die Klinik hetzen müssen, vielleicht gerade zur Hauptverkehrszeit oder bei einer Straßensperre. Nein, nein, nur kein Risiko.
Noch am gleichen Abend ließ er sich von seinen Eltern ein Handy geben, und bereits am Abend des vierzehnten März brachte er Judith in die Privatklinik von Frau Dr. Thompson.
Noch immer befand sich das Kind nicht in der normalen Geburtslage.
»Wenn es sich weigert, eine komplette Drehung zu machen, wird es noch mit den Füßchen zuerst auf die Welt kommen«, seufzte Judith.
»Das hätten wir aber gar nicht gern«, murmelte Elaine und wechselte einen Blick mit der Hebamme, die zu einer Akupunktur riet, was von Judith und Benjamin jedoch vehement abgelehnt wurde.
In den frühen Morgensdtunden des achtzehnten März, als das letzte Mondlicht über die Wand des kleinen Schlafzimmers von Nummer fünf geisterte, richtete sich Benjamin plötzlich ruckartig auf, saß minutenlang kerzengerade und total benommen auf dem Bett und lauschte angestrengt in die Dunkelheit. Was hatte ihn geweckt? Das Telefon? Die Haustürklingel? Krach auf der Straße?
Aber alles blieb still, bis auf die gewohnten Nachtgeräusche. Benjamin massierte sich den Nacken und schwang die Füße auf den Boden. Inzwischen war er hellwach, aber immer noch stand er unter dem Eindruck, daß ihn jemand gerufen habe.
Der Wecker auf dem Nachttisch zeigte halb drei. Er starrte auf das Leuchtzifferblatt und schrak zusammen, als das Telefon auf der Küchentheke zu klingeln begann.
Sekundenlang hämmerte sein Herz so schmerzhaft, daß er sich nicht rühren konnte. Dann schüttelte er mit aller Kraft die Beklemmung ab, sprang auf, hetzte in langen Sätzen durch den mondhellen Raum und riß den Hörer an sich.
Eine fremde Stimme sprach am anderen Ende. Er konnte sie kaum verstehen, weil gerade die Nachtmaschine nach Miami über die Stadt dröhnte. Nur soviel stand fest: Die Geburt hatte begonnen. Er mußte sofort in die Klinik fahren. In seiner Zerfahrenheit fand er minutenlang weder den Autoschlüssel noch seinen Führerschein, der unumgänglich war, weil nachts regelmäßig Polizeikontrollen stattfanden. Als er endlich alles beisammen hatte, zeigte der Wecker bereits drei Uhr drei Minuten. Er stürzte hinaus, warf die Tür mit einem Knall hinter sich ins Schloß und sprintete zum Wagen auf dem Uni-Parkplatz. Als er den Motor anließ, bemerkte er, daß er barfuß war.
Egal! Keine zehn Pferde brachten ihn noch einmal zurück in die Wohnung. Dafür hatte er nun keinen Nerv mehr. Nur gut, daß die Verkehrsampeln um diese Zeit ausgeschaltet und nicht allzu viele Leute unterwegs waren.
Als er die hell erleuchtete Eingangshalle der Klinik betrat, bemerkte er flüchtig ein leises Befremden im Blick der Aufsichtsperson, die hinter einem erhöhten Pult thronte und sich seine Ausweispapiere zeigen ließ. Zum Glück hatte er den Führerschein griffbereit in der Brusttasche seiner schwarz-weiß gestreiften Schlafanzugjacke, die er immer noch trug.
Leichtfüßig, auf nackten Sohlen, lief er durch die stillen Korridore bis zu einer Tür, über der ein gedämpftes rotes Licht leuchtete. Es war nur der Vorraum, wie er gleich darauf feststellte, und dort, in einem umfangreichen Sessel, lehnte Judith mit bleichem, spitzem Gesicht, das sich bei seinem Anblick sofort aufhellte.
»Du siehst ja aus wie ein Landstreicher«, kicherte sie und griff nach seiner hilflos ausgestreckten Hand. »Denk mal, unser Kind hat sich vor einer Stunde in die vorschriftsmäßige Position begeben. Jetzt ist es bereit zum Aufbruch in die Welt.«
»Ich komme also nicht zu spät?« flüsterte Benjamin atemlos vor Aufregung.
»Aber nein«, erwiderte Judith mit einem kleinen Seufzer. »Mir ist zwar gar nicht wohl und ziemlich weh tut es auch, aber Elaine sagt, wir können noch mindestens eine Runde Scrabble spielen, bis es richtig ernst wird.«
»Dann machen wir das doch«, sagte Benjamin munter und sah sich um. »Gibt es hier eine Spielesammlung oder so was?«
»Drüben im Regal. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt darauf konzentrieren kann.«
»Du kannst, Sweetie! Und ob du kannst! Wie ich dich kenne, wirst du sogar haushoch gewinnen.«
»Na dann«, murmelte Judith kläglich lächelnd. »Hilf mir mal aus dem Sessel – oder nein, laß mich sitzen und bring das Tischchen herüber. Ja, so müßte es gehen. Wieviel Uhr ist es?«
»Viertel nach vier.«
»Und welches Datum?«
»Der achtzehnte März.«
»Merk es dir gut, Bennie!«
»Aber sicher. Das wird der Geburtstag unseres ältesten Kindes sein. Den vergessen wir nie, solange wir leben.«
»Du bleibst doch bei mir, bis es da ist?«
»Ich schwöre es bei Gott.«
»Egal, wie lange es dauert?«
»Ganz egal«, sagte Benjamin mit fester Stimme. »Ich rühre mich nicht weg, und falls ich kalte Füße kriege, rufe ich Reginald an, daß er mir Socken und Schuhe bringt.«
»Gut«, seufzte Judith und lehnte sich beruhigt zurück, um gleich darauf mit einem kleinen Schmerzenslaut zusammenzuzucken.
»Alles in Ordnung? Soll ich mal auf die Klingel drücken?« fragte Benjamin.
»Nein, nein, erst wenn sich das alle paar Minuten wiederholt.«
»Haha, du glaubst doch nicht, daß ich es soweit kommen lasse? Dies ist eine Klinik. Hier muß etwas für dich getan werden, sonst hätten wir ja genauso gut zu Hause bleiben können.«
»Jetzt nimm dir sieben Buchstaben aus dem Kästchen und fang an zu spielen«, befahl Judith streng. »Und auf die Klingel drückst du nicht, bevor ich es dir sage!«
*
Hildegard trat in dem neuen blattgrün gemusterten Morgenmantel vor den dreiteiligen Spiegel, betrachtete sich kritisch von allen Seiten und stellte wieder einmal fest, daß ihr die Farbe Grün nicht stand.
Der Morgenmantel war ein Geschenk ihres Mannes zum letzten Weihnachtsfest gewesen. Vermutlich hatte er ihn eigens deshalb ausgesucht, um eine farbliche Lücke in ihrer Garderobe zu schließen. Nun ja, solange es nur ein Kleidungsstück war, das man überzog, um es gleich wieder abzulegen, konnte man einen solchen Fehlgriff leicht verschmerzen.
Sie ließ sich auf dem flauschigen Hocker nieder und löste das Handtuch, das sie wie einen Turban um den Kopf geschlungen hatte. Während sie sich langsam und methodisch das Haar trockenrieb, hielt sie gewohnheitsmäßig Ausschau nach den grauen Fäden, die sich leider immer zahlreicher in das hübsche Rostbraun mischten. Daran war nicht nur die krasse Veränderung im Leben ihrer einzigen Tochter schuld, sondern auch die zunehmende Schwierigkeit im Umgang mit ihrem Mann.
Er war nie eine Frohnatur gewesen, mit keinem sonnigen Gemüt gesegnet und schon daher nicht leicht zu behandeln. In seiner beruflichen Position, die ebenso oft Fingerspitzengefühl erforderte wie auch die sprichwörtliche gute Miene zum bösen Spiel, hätte er sich gar nicht halten können ohne die Umsicht und das diplomatische Geschick einer geeigneten Frau an seiner Seite.
Er sah indessen nicht so aus, als wüßte er die unschätzbaren Dienste zu würdigen, die Hildegard ihm seit nunmehr zweiundzwanzig Jahren erwies. Da sie ihn kannte, kränkte sie sich nicht besonders darüber. Was ihr viel mehr zu denken gab, war die Tatsache, daß er an seiner Karriere schon seit einiger Zeit nicht mehr arbeitete.
Abgesehen davon, daß Torreval im Vergleich zu seinen vorhergehenden Stationen nicht gerade als Aufstieg gewertet werden konnte, hatte er sich nach Ablauf der üblichen vier Jahre um keine Versetzung bemüht, und merkwürdigerweise war er auch nicht dazu aufgerufen worden. Jedes Gespräch über dieses Thema lehnte er kategorisch ab, was um so unverständlicher war, als er seinen Dienst mit einer Verdrossenheit versah, die allmählich allen Beteiligten auffallen mußte.
Hildegard, seit eh und je daran gewöhnt, ihn zu decken und abzuschirmen, stellte bei sich selbst erstmals Ermüdungserscheinungen fest. Der gemeinsame Strang, der ihr schon in der Kindererziehung gefehlt hatte, schien sich ganz allgemein aufgelöst zu haben. Wenn überhaupt noch jemand daran zog, dann nur sie allein, und da nicht sie den Posten des Botschafters bekleidete, sondern Rupert, war ihr Bemühen angesichts seiner Gleichgültigkeit die reine Zeitverschwendung. Wenn sie dennoch nicht nachließ, ihren vielfältigen gesellschaftlichen Pflichten nachzukommen und sein Image immer wieder aufzupolieren, dann nur deshalb, weil ihr jetzt gerade sehr viel daran lag, die Stellung in Torreval zu halten.
Judith und Benjamin hatten sich tatsächlich häuslich eingerichtet, wie bescheiden auch immer, sie hielten eisern an ihrem Glück im kleinen Winkel fest, an ihrer rührenden Eigenständigkeit, auf die sie mit Recht stolz waren, und vorläufig, wenn nicht sogar auf unabsehbare Zeit, würden sie in Torreval bleiben.
Hildegard, die dem Enkelkind mit freudiger Erwartung entgegensah und im Grunde ihres Herzens gar nicht glaubte, daß die junge Familie ohne sie zurechtkommen würde, zumal Benjamins Mutter keine übertriebene Anhänglichkeit bewies, hoffte zuversichtlich, daß Rupert stillschweigend auf seinem Posten belassen wurde. Es war ja nicht auszuschließen, daß er wieder mehr Interesse aufbrachte und mehr Elan an den Tag legte. Schließlich war er erst fünfzig Jahre alt, und die Midlife-Krise, falls er sich darin befand, würde ja nicht ewig dauern.
Das Telefon neben ihrem Bett begann zu klingeln. Hildegard sprang wie elektrisiert vom Hocker.
»Good morning, grandma«, hörte sie Elaine sagen, munter und aufgeräumt, und gleich darauf Judiths Stimme, nicht weniger frisch und fröhlich: »Puuuh, das war eine turbulente Nacht. Menschenskind, Mutsch – ich bin ja so happy, daß alles vorbei ist – warte mal –«
Ein ganz zartes, schnaufendes Meckern erklang für einen Augenblick. Dann wieder Judith, selig und triumphierend: »Das war Timothy Leonard Holborn, dein erster Enkel. Willst du ihn dir nicht ansehen?«
»O mein Gott, doch, natürlich, sofort. Ich bin schon unterwegs. Geht’s dir gut, Schätzchen? Wann ist er denn angekommen? Vor zwanzig Minuten? Ist ja herrlich. Ist ja unglaublich. Gestern abend war doch noch keine Rede davon. Hat er sich allein in Bewegung gesetzt? Oder hat Elaine nachgeholfen? Nicht? Sehr brav. So ein tüchtiger Junge. Willst du Vater selbst anrufen – oder soll ich ihm die frohe Botschaft rasch durchsagen? Klar, mach ich das. Bis gleich, ich bin schon total durchgedreht – ich glaube, ich lasse mich von Armando fahren.«
Hildegard warf den Morgenmantel ab und zog das nächstbeste Kleid über. Sie schwebte wie auf Wolken durchs Haus, nahm die Glückwünsche des versammelten Personals entgegen, trank im Stehen eine Tasse Tee und zerbrach sich den Kopf über dies und jenes, das ihr immer wieder entfiel.
Blumen. Richtig. Was noch? Geld natürlich, Münzen und Scheine. Trinkgelder mußten großzügig verteilt werden, und wer weiß, was sonst noch alles zu besorgen war.
Rupert, kurz angebunden, aber hörbar bewegt, schickte ihr Armando mit dem Dienstwagen in sausender Eile und ohne die übliche zeitliche Begrenzung, erinnerte sie an den Fotoapparat und ließ seinerseits Blumen schicken, die nicht allzu stark dufteten, weil das Zimmer vermutlich nicht dauernd gelüftet werden konnte.
Hildegard war ihm dankbar für den Tip und beschränkte sich fürs erste auf einen Topf mit Glücksklee, von Letitia selbst gezogen, und das dünne Goldkettchen mit dem Medaillon, das sie für Judith vorgesehen hatte.
Auf dem Parkplatz der Klinik herrschte bereits Hochbetrieb, als sie ausstieg und Armando sich mit einer Zeitung auf eine längere Wartezeit einrichtete.
An ihr vorbei rannte ein Freak in indischer Kutte mit wehendem langen Bart, der in jeder Hand einen Schuh trug. Hildegard sah zu ihrer Verblüffung, daß er ohne zu zögern die Klinik ansteuerte und im gläsernen Eingang untertauchte. Es war neun Uhr.
Elaine kam ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen, stellte ihr die mollige junge Hebamme Louisa vor und fragte über die Schulter, ob sie nicht zusammen frühstücken sollten, gleich, nach der Besichtigung des Kronprinzen, der ein schwerer Junge war, ein Achtpfünder von fünfundfünfzig Zentimetern Länge, und offensichtlich überfällig gewesen, sie hatten ihm die Fingernägelchen bereits abknipsen müssen.
Hildegard lauschte benommen, nickte zu allem, trat in das rosig getönte Zimmer, schloß ihre Tochter in die Arme, die strahlend und aufrecht im Bett saß, und wurde angewiesen, sich nebenan die Hände zu waschen.
Dann, wieder in Judiths Zimmer, wurde ihr ein winziges Bündel in die Arme gelegt, das Köpfchen umhüllt mit einem weißen Tuch, die Äuglein fest geschlossen, lange, dunkle Wimpern auf zarter Haut, hell wie Alabaster, still, in sich versunken ruhte er aus von seinem Eintritt in die Welt, der kleine Timothy Holborn.
Hildegard war ganz erschüttert. Dieser neugeborene Enkel rührte sie zu Tränen. Der Impuls, ihn an sich zu nehmen und vor allem zu bewahren – vor jeglichem Unheil, auch vor der Unkenntnis und Unerfahrenheit seiner Eltern – überfiel sie völlig unerwartet und erschreckte sie.
Lange schon war es her, seit sie ein nur wenige Stunden altes Kind auf dem Arm gehalten hatte, genauer gesagt: achtzehn Jahre und zwei Monate. Ob sie damals auch so stark gefühlt und so rabiat gedacht hatte? Hildegard wußte es nicht mehr.
Aber sie bemerkte den aufmerksamen Blick in Judiths Augen und unterdrückte einen wehmütigen Seufzer, als sie das Baby wieder abgeben mußte.
»Frühstück!« rief Elaine und klatschte in die Hände.
»Hier?« fragte Hildegard verwirrt.
»Nein, drüben bei mir. Unsere junge Mutter hier sollte jetzt ein Stündchen schlafen, sie hat die ganze Nacht kein Auge zugetan – und ich übrigens auch nicht. Timothy war der letzte von drei gesunden Neuankömmlingen – und der einzige Junge. Wo ist denn der tapfere junge Vater abgeblieben?«
»Heimgefahren«, erwiderte Judith, die zum stummen Erstaunen ihrer Mutter ein knielanges T-Shirt trug, das mit knallbunten Micky-Maus-Motiven über und über bedeckt war.
»Er wollte mal duschen und sich anziehen und mal kurz bei Don Damian vorbeigehen, Bescheid sagen und den Tag freinehmen«, fuhr Judith gähnend fort. »Er hat nur noch auf Reginald gewartet, der ihm seine Schuhe bringen sollte.«