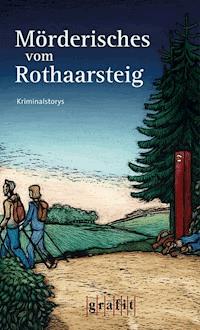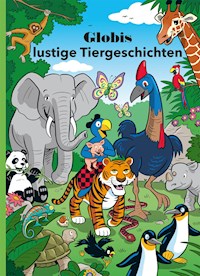156,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami
- Sprache: Deutsch
Die Familie ist ein Hort der Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit. Wir alle sehnen uns nach diesem Flucht- und Orientierungspunkt, der unsere persönliche Welt zusammenhält und schön macht. Das wichtigste Bindeglied der Familie ist Mami. In diesen herzenswarmen Romanen wird davon mit meisterhafter Einfühlung erzählt. Die Romanreihe Mami setzt einen unerschütterlichen Wert der Liebe, begeistert die Menschen und lässt sie in unruhigen Zeiten Mut und Hoffnung schöpfen. Kinderglück und Elternfreuden sind durch nichts auf der Welt zu ersetzen. Genau davon kündet Mami. E-Book 1: Drei sind nicht zuviel E-Book 2: Ich war noch nie so glücklich E-Book 3: Zu Hause auf dem Stolze-Hof E-Book 4: Die Kinder aus dem Nachbarhaus E-Book 5: Wenn wir dich nicht hätten! E-Book 6: Der Sonnenschein in meinem Leben E-Book 7: Ein Garten voller Glück E-Book 8: Entschädigt für so viele Tränen ... E-Book 9: Jessica hat Sehnsucht nach der Mami E-Book 10: Kleine Fremde - wir haben dich lieb E-Book 11: Bange Stunden um Ricky E-Book 12: Mein Sohn Henry E-Book 13: Die Kinder aus dem Waisenhaus E-Book 14: Ein geheimes Töchterchen E-Book 15: Hab' mich lieb, kleiner Mann E-Book 16: Auf in ein neues Leben! E-Book 17: Aus Liebe zu diesen beiden E-Book 18: Von zu Hause ausgerissen ... E-Book 19: Kim und Mara – ein tolles Gespann E-Book 20: Wenn Kinder wieder glücklich sind E-Book 21: Jan muß nicht mehr traurig sein E-Book 22: Adoptiertes Glück E-Book 23: Wir haben einen großen Bruder E-Book 24: Der verlorene Zwilling E-Book 25: Lieb und lustig – doch ohne Vater E-Book 26: Ich bin dein großer Bruder E-Book 27: Bald kannst du wieder spielen E-Book 28: Das Kind seines Bruders E-Book 29: David und Oliver – nie mehr getrennt? E-Book 30: Peter, der Stolz seines Vaters E-Book 31: Doch die Mutterliebe war stärker E-Book 32: Daniel hat eigene Pläne! E-Book 33: Diese Oma ist spitze! E-Book 34: Sascha – nie mehr allein E-Book 35: So sehr gewünscht – so sehr geliebt E-Book 36: Ein Papi auf Abwegen? E-Book 37: Ein Kind geht auf die Reise U E-Book 38: Stummer Ruf nach Liebe E-Book 39: Stiefmütter sind so lieb E-Book 40: Auf einmal stimmt die Welt nicht mehr E-Book 41: Hoppla, jetzt kommen wir! E-Book 42: Hurra, wir erben! E-Book 43: Das Glück der Erde E-Book 44: Nur er weiß, wer Susannes Vater ist E-Book 45: Zwei Kinder verstehen die Welt nicht mehr E-Book 46: Die Überraschung hat einen Namen E-Book 47: Wenn Kinder wieder glücklich sind E-Book 48: Helfen kann nur Dr. Herold E-Book 49: Wir brauchen keinen neuen Papi! E-Book 50: Das Baby gibt den Ton an
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 5820
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Drei sind nicht zuviel
Ich war noch nie so glücklich
Zu Hause auf dem Stolze-Hof
Die Kinder aus dem Nachbarhaus
Wenn wir dich nicht hätten!
Der Sonnenschein in meinem Leben
Ein Garten voller Glück
Entschädigt für so viele Tränen ...
Jessica hat Sehnsucht nach der Mami
Kleine Fremde - wir haben dich lieb
Bange Stunden um Ricky
Mein Sohn Henry
Die Kinder aus dem Waisenhaus
Ein geheimes Töchterchen
Hab' mich lieb, kleiner Mann
Auf in ein neues Leben!
Aus Liebe zu diesen beiden
Von zu Hause ausgerissen ...
Kim und Mara – ein tolles Gespann
Wenn Kinder wieder glücklich sind
Jan muß nicht mehr traurig sein
Adoptiertes Glück
Wir haben einen großen Bruder
Der verlorene Zwilling
Lieb und lustig – doch ohne Vater
Ich bin dein großer Bruder
Bald kannst du wieder spielen
Das Kind seines Bruders
David und Oliver – nie mehr getrennt?
Peter, der Stolz seines Vaters
Doch die Mutterliebe war stärker
Daniel hat eigene Pläne!
Diese Oma ist spitze!
Sascha – nie mehr allein
So sehr gewünscht – so sehr geliebt
Ein Papi auf Abwegen?
Ein Kind geht auf die Reise U
Stummer Ruf nach Liebe
Stiefmütter sind so lieb
Auf einmal stimmt die Welt nicht mehr
Hoppla, jetzt kommen wir!
Hurra, wir erben!
Das Glück der Erde
Nur er weiß, wer Susannes Vater ist
Zwei Kinder verstehen die Welt nicht mehr
Die Überraschung hat einen Namen
Wenn Kinder wieder glücklich sind
Helfen kann nur Dr. Herold
Wir brauchen keinen neuen Papi!
Das Baby gibt den Ton an
Mami – Paket 5 –
E-Book 1929-1978
Diverse -
Drei sind nicht zuviel
Für Kevin ergibt sich eine ganz neue Perspektive
Roman von Lindberg, Rosa
Genau genommen wußte Lilli auch nicht, warum Christine wieder heiraten sollte. Sie hatte keine finanziellen Sorgen, die Werbeagentur, die sie mit Jan-Peter Rüssmann betrieb, lief gut bis sehr gut, das Haus war, bis auf eine Mini-Hypothek, bezahlt und eine stille Reserve war auch da. Warum bloß schlug sie dieses ledige Thema immer wieder bei ihrer Tochter an?
Keine Ahnung!
Lilli sah Dominik mit Bingo durch den Garten kommen. Irgendwie sahen Herrchen und Hund sonderbar schuldbewußt aus. O nein, bitte, lieber Gott, laß sie nicht wieder etwas angestellt haben!
Als sie Dominik an der Küchentür vorbei zum Bad stiefeln sah, war ihr klar, warum sie wünschte, Christine würde wieder heiraten. Weil ein Junge wie Dominik – und einer wie sein Bruder Gerald und ein Mädchen wie seine Schwester Stine – einen Vater brauchten! Genau das war es!
Und dann gab es ja da auch noch die Liebe, die eine Frau in den besten Jahren brauchte! Sie waren so schnell vorbei, diese besten Jahre. Das wußte Lilli aus eigener leidvoller Erfahrung. Sie war auch früh Witwe geworden…
Sekundenlang starrte sie blicklos auf die Möhre in ihrer Hand. Gäbe es eine Möglichkeit, nur eine kleine, oh, sie hätte manche, manche Korrektur an ihrem Leben vorgenommen! Sie, sie hatte den Fehler begangen, dem Glauben nachzuhängen, Liebe gäbe es nur einmal im Leben. Nicht das allein, sie hatte auch geglaubt, der Kinder wegen auf ein neues Glück verzichten zu müssen. Wie falsch das gewesen war, wie falsch! Aber nun, sie blickte auf und seufzte, nun war nichts mehr zu ändern.
Bingo kam in die Küche und blieb an ein Tischbein gepreßt stehen. Es gab keinen Hund, der derart mit Liebe überschüttet wurde, und keinen, der so überzeugend bei Fremden den Eindruck erwecken konnte, von seinen Besitzern ständig geprügelt zu werden.
»Bingo«, sagte Lilli streng, »laß die Faxen! Du bist zu Hause!«
Es sah aus, als ob Bingo grinste.
Sie hatten ihn aus dem Tierheim. Lilli und Christine hatten an einen netten Dackel für die Kinder gedacht. Die erblickten jedoch Bingo, der auf dem Boden kauerte, erbärmlich zitterte und die Augen verdrehte, als erwarte er eine Tracht Prügel. Alle drei Conradis, mit dem butterweichen Herzen ihrer Mutter und der alles umfassenden Güte ihres verstorbenen Vaters gesegnet, wollten Bingo. Nur ihn. Nein, keinen anderen. Auch keinen noch so niedlichen! Lilli hatte Bingo tief in die demütigen Augen geblickt und erkannt, daß er ein Schauspieler war. Es war, als hätte Bingo sich durchschaut gefühlt, denn er kniff Lilli, die bereit war, das jederzeit zu beschwören, ein Auge zu! Wirklich und wahrhaftig! Er war ein Mischling, gemischter ging’s nicht, und seit dem Tage Familienmitglied im Hause Conradi. Es konnte keinen treueren und anhänglicheren Hund geben.
Lilli lauschte. Komisch! Es hörte sich an, als würde Dominik am hellichten Tag und freiwillig Zähneputzen und Gurgeln. Und so ausgiebig!
So war es. Dominik wollte Zeit gewinnen. Ihm war ein bißchen flau in der Magengrube, denn in der letzten Zeit hatten sich seine Unfälle gehäuft. Er hatte aber auch eine Pechsträhne! Es konnte alles nur noch besser werden! Die Frage jetzt war: Es erst Omi, oder erst Mami sagen?
»Erst Omi!« entschied er laut und ging in die Küche.
»Mami nicht da?«
»Sie ist drüben im Büro.«
Für die Agentur hatte Christine vor wenigen Jahren die erste Etage des hübschen Jugendstilhauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite anmieten können, was dem Familienleben der Conradis sehr guttat.
Als Dominik nichts mehr sagte, fragte Lilli:
»Warum?«
Dominik rutschte auf die Eckbank. Er und Bingo kreuzten einen langen, ergebenen Blick.
»Weil… weil… Da unten an der Ecke steht ein Porsche.«
Lilli ahnte Schlimmes.
»Und das wolltest du deiner Mutter sagen? Glaubst du, sie hätte noch nie einen Porsche gesehen?«
»Es ist ein Cabrio. Das Verdeck war runter.«
»Warum nicht? Es sieht nach Regen aus.«
»Hm. Ich hab’ ihn mir angeguckt. Schööönes Auto!«
»Das ist allgemein bekannt.«
Dominik ließ seine Blicke auf dem schmalen Nacken unter dem bleigrauen hochgesteckten Haar seiner Großmutter ruhen. Er hatte sie so lieb! Er hätte ihr auch gern was anderes gebeichtet. Aber das Leben ist nicht immer himmelblau. Selbst er wußte das schon.
»Ja, ne? – Ich wollte dann auch mal sehen, wie weit der Außenspiegel sich verstellen läßt.«
Lilli drehte sich um und reichte ihm ein Stück geschälter Möhre.
»Und wie weit ließ er sich verstellen?«
Dominik nahm die Möhre.
»Nicht so weit wie ich gedacht hatte.«
Bingo legte den Kopf zwischen die Pfoten und schloß die Augen. Großmutter und Enkel blickten sich an.
»Und wo ist er jetzt?«
Dominik biß in die Möhre und kaute.
»Wer?«
»Der Außenspiegel.«
»Ich habe ihn auf den Beifahrersitz gelegt.«
Wenn, überlegte Lilli, Dominik von niemanden gesehen wurde, könnte man diesen blöden Außenspiegel da liegen lassen und vergessen! Könnte man. Geht aber nicht. Schon aus erzieherischen Gründen! Was soll aus Kindern werden, denen man nicht beibringt, zu dem zu stehen, was sie getan haben? Was? Keinesfalls das, was sie für ihren Enkel erhoffte und wünschte!
Lilli sah an sich herab, nahm ihre Schürze ab und strich über ihre Frisur. Dann sah sie Dominik an.
»Wem gehört der Wagen denn?«
Dominik war blaß um die Nase herum und seine Augen glänzten verdächtig.
»Das weiß ich nicht.«
Einen langen Augenblick lang überlegte Lilli. Dann streckte sie Dominik ihre Hand entgegen.
»Komm. Dann laß uns die Sache regeln.«
*
In der Regel nahm Christine alles mit der sturmerprobten Gelassenheit hin, die sie als berufstätige Frau, Witwe, Mutter und Tochter erworben hatte. Das bot in der Regel dringend notwendigen Schutz. In den letzten Wochen jedoch funktionierte das nicht mehr so, wie es sollte.
»Ich bin urlaubsreif«, sagte sie zu ihrer Assistentin Petra, die nach Lilli der Mensch war, dem Christine am meisten vertraute.
»Und wie! Hätte ich hier das Sagen, ich würde dich noch in dieser Stunde in irgendeinen stillen Wald scheuchen!«
Zwar lachte Christine, dachte aber, daß Jan-Peter alles andere plante, als einen Urlaub in einem stillen Wald.
Überhaupt – Jan-Peter… Sie waren Geschäftspartner, schon bei Leonard, ihrem verstorbenen Mann, war er zunächst Mitarbeiter, dann Teilhaber geworden. Er hatte sich eine damalige Durststrecke Leonards zunutze gemacht, und war mit einem nicht unbeachtlichen Betrag in die Firma eingestiegen. Was er jetzt – kein bißchen diskret oder heimlich – anstrebte, war die private Partnerschaft, sprich: Ehe. Er behauptete, Christine zu lieben, würde jedoch niemals die Kinder in Kauf nehmen, für die er an eine Unterbringung in einem Internat gedacht hatte.
Christines Zuneigung für ihn hielt sich in Grenzen, was nicht bedeutete, daß sie ihn nicht mochte. Seit Leonards tödlichem Unfall hielt sich ihre Zuneigung zu jedem männlichen Wesen immer in sehr engen Grenzen.
»Ich glaube«, hatte sie einmal zu Petra gesagt, »ich kann mich gar nicht mehr verlieben!«
»Du kannst«, hatte die geantwortet, »wenn es der Richtige ist! Aber nur dann. So bist du eben verpackt. Und damit mußt du leben.«
Sie stand jetzt noch, einen Entwurf überfliegend, an Petras Schreibtisch, als Jan-Peter hereinkam. Ausgerechnet jetzt! Es mußte so etwas wie das Gesetz des richtigen Zeitpunkts geben, so wie es das Gesetz der Schwerkraft gibt, etwas, wodurch Menschen immer im verkehrten Augenblick kommen.
»Hallo…!« Er strahlte mit seinen makellosen Zähnen um die Wette. »Soviel Schönheit blendet ja geradezu!«
»Sonnenbrille aufsetzen hilft«, sagte Petra trocken.
Sie lachten gemeinsam, bis Jan-Peter Christine fragte, ob sie ein paar Minuten Zeit für ihn hätte.
»Eigentlich…«
»Wirklich nur ein paar Minuten! Ich möchte dir nur etwas zeigen! Bitte…«
Seine Blickte hatten den beschwörenden Charme wie bisweilen die Bingos, wenn er etwas partout erreichen wollte. Selbst stärkere Naturen als Christine konnten dem nur selten widerstehen.
»Also gut…«, sie legte den Entwurf zurück auf Petras Schreibtisch, sie würde ihn gleich weiterlesen, »dann zeig’s mir.«
Jan-Peter nahm ihren Arm. Er tat das seit einiger Zeit mit so selbstverständlicher Besitzergeste, die Christine nicht nur irritierte, sondern auch keineswegs gefiel. Sie bemerkte Petras Blick, in dem etwas lag, was sie nicht deuten konnte.
»Wir müßten schon ein paar Schritte gehen«, sagte Jan-Peter, während er sie zur Tür dirigierte. Mit einer beiläufigen Bewegung befreite Christine ihren Arm. Sie lächelte dabei, wollte ihn ja nicht kränken, sondern nur die unsichtbare Grenze eingehalten wissen, die zwischen ihnen sein und bleiben mußte. Wenn Jan-Peter die kleine Zurechtweisung bemerkt hatte, so ließ er sich doch nichts anmerken. Er lächelte ebenfalls.
Vor der Tür fragte Christine:
»Wie weit müssen wir denn gehen?«
»Wirklich…«, er begann zu gehen, Christine folgte ihm, »nur ein paar Schritte!«
Plötzlich blieb er stehen und lächelte nicht mehr so herzlich wie zuvor. Sein Blick lag auf einem in der Sonne herausfordernd glänzenden Sportwagen, an dem zwei Gestalten sich zu schaffen machten.
Christine wunderte sich, daß Omi und Dominik an dem Wagen waren, von dem sie ahnte, daß es die Überraschung war, die sie sich ansehen sollte.
Als Dominik und Lilli die beiden kommen sahen, erstarrten sie zu Salzsäulen. Mit allem hatte Dominik gerechnet, wirklich, aber nicht damit, daß der Wagen Jan-Peter Rüssmann gehörte! Wer konnte denn so was auch bloß ahnen! Bis vor ein paar Tagen hatte dieser Rüssmann doch noch so einen Englischen gefahren! Ausgerechnet der! Dominiks Abneigung Jan-Peter gegenüber war nicht unbegründet. Menschen, die keine Kinder mochten, keine Hunde, eigentlich überhaupt keine Tiere und immer so permanent lächelten, als wären sie aus Honigkuchen, konnte Dominik nicht leiden. Und Herr Rüssmann gehörte zu diesen Menschen. Außerdem scharwenzelte der immer um Mami herum, daß es schon manchmal peinlich war!
Jetzt standen sie voreinander, er neben Omi und Mami neben Jan-Peter Rüssmann. Dann veränderte sich etwas, was nicht nur mit dem Stellungswechsel, sondern auch mit der Wutstimmung, in der Rüssmann gelaufen gekommen war, zu tun hatte, denn Mami stand unvermittelt hinter ihm und hatte beide Hände auf seine Schultern gelegt. Und wohl zum hundertsten Mal erkannte Dominik Conradi, daß auf nichts in der Welt mehr Verlaß ist als auf Mütter. Niemand sagte etwas.
»Was ist hier los?« preßte Jan-Peter endlich in meisterhaft gespielter Gleichgültigkeit hervor. In seiner Stimme jedoch lag jede Menge Zorn, den er nicht kaschieren konnte.
»Also, ich – ich wollte es bestimmt nicht!« begann Dominik und fuhr tapfer weiter fort, weil er den leichten Druck spürte, den Mamis Hände auf seine Schultern ausübten. »Es – es ist so ein schönes Auto und ich wollte nur mal sehen…« Er wußte nicht mehr weiter, deshalb hob er die Hand, in der er den Außenspiegel hielt.
Jan-Peter sah darauf, dann kurz in Christines Gesicht. Es war, bis auf einen Hauch Erwartung, gänzlich ausdruckslos. Trotz seiner Wut erkannte Jan-Peter, daß für ihn eine Menge von seiner Reaktion abhängen konnte. Nach kurzem Zögern lächelte er, nahm Dominik den Spiegel ab und bewegte ihn in seiner Hand, als prüfe er das Gewicht.
»Du hast auch eine Schwäche für Autos, habe ich recht?«
»Ja«, gestand Dominik verwundert, er hatte mit einem Donnerwetter erster Güte gerechnet.
»Genau wie ich«, sagte Jan-Peter, und sein verstehender Blick wirkte ziemlich aufrichtig. Er schickte ein kleines, rasches Lächeln zu Christine.
Dominik wußte nicht, was er sagen sollte, bis ihm siedendheiß etwas einfiel.
»Ich – ich bezahle natürlich die Reparatur! Ich hab’ ganz schön was gespart!«
Als habe er das gar nicht gehört, ging Jan-Peter vor Dominik in die Hocke. Der Bengel hatte die gleichen Augen wie seine Mutter: scheu aber unerschrocken!
»Du wolltest vermutlich testen, wie weit sich das Ding hier drehen läßt, was?«
»Genau.«
»Das…« er stand auf und blickte in die Runde, »hätte mir, als ich so alt war wie du, auch passieren können! Im übrigen ist der Schaden schnell wieder behoben! Mach dir also keine Gedanken mehr.«
»Danke…«, sagte Dominik leise und fühlte sich komischerweise mehr unbehaglich als erleichtert.
Hätte er geahnt, daß Mami ähnliche Empfindungen hatte, hätte er sie darauf angesprochen. So aber…
Tatsächlich bewirkte Jan-Peters doch wirklich faires Verhalten Dominik gegenüber in Christine keine Freude, eher so etwas wie – Mißtrauen. Jan-Peter war so – so wandlungsfähig, um nicht zu sagen unberechenbar. Und nie wußte man bei ihm, wo der Scherz aufhörte und der Ernst begann oder umgekehrt. Er gehörte zu den Menschen, mit denen man jahrelang bekannt ist, die man aber im Grunde überhaupt nicht kennt.
»Ich danke dir auch«, sagte sie nun, »aber ich finde, Dominik sollte den Schaden schon bezahlen!«
Obwohl Dominiks Ersparnisse gering, seine Fähigkeiten, mit dem Taschengeld zu haushalten noch geringer waren, wurde ihm bei dem Gedanken, irgendwann dies hier abgegolten zu haben, zusehends wohler.
Er nickte eifrig Zustimmung und überlegte schon, wen er anpumpen könnte. In einer Lage wie dieser – da war er ganz sicher – würde niemand in der Familie ihm einen kleinen Kredit verweigern.
»Na, gut«, Jan-Peter boxte spielerisch und kumpelhaft Dominiks Oberarm, »ich schicke dir die Rechnung!«
Als Lilli und Dominik zurück zum Haus gingen und Christine allein mit Jan-Peter an dem Wagen stand, legte sie ihm unvermittelt ihre Hand auf den Arm. Halbherzig stieg ein bißchen Mitleid in ihr auf. Er war doch immer so stolz auf seine Errungenschaften!
»Du wolltest mir das neue Auto zeigen, stimmt’s?«
In einer fast wilden Bewegung warf Jan-Peter den Rückspiegel hinter die Sitze. Dieser Wurf zeigte seine ganze unterdrückte Bitterkeit, wenn er auch grinste, als sei er über alle Maßen amüsiert.
»Neu mit kleinem Fehler! Würdest du trotzdem für eine kleine Probefahrt einsteigen?«
Sie drehten eine Runde um den Block, und Christine bewunderte den Wagen mit viel zu vielen Worten. Doch die war sie ihm schuldig, denn Jan-Peter hatte ihr zuliebe versucht, über seinen Schatten zu springen, aus welchem Grunde auch immer. Ein solcher Versuch ist immer lobenswert.
*
Stine Conradi war ein sehr beliebtes Kind mit vielen Freundinnen und Freunden. Obwohl sie, die ältere Schwester von zwei jüngeren Brüdern, es nicht immer leicht hatte, bewahrte sie ihren Humor und ihre Herzlichkeit. Sie war harmoniebedürftig wie ihre Mutter und versuchte immer, der Eiseskälte von Streitigkeiten ihre kleine Wärme entgegenzusetzen. Sie war jetzt neun Jahre alt, würde im kommenden Jahr aufs Gymnasium wechseln, später Veterinär-Medizin studieren, um Tierärztin zu werden. Sie würde nicht zu früh heiraten, einen Mann der ebenfalls Tierarzt sein sollte und vier Kinder bekommen. Sie würden auf dem Lande leben, und die ganze Familie, einschließlich Bingo, würden bei ihnen wohnen, denn daß sie ein großes Haus haben würden, stand außer Zweifel.
Ihr Lebensplan stand fest, und schon jetzt arbeitete sie an seiner Realisierung, indem sie sich bemühte, eine gute Schülerin und ein guter Mensch zu sein. Sie war hilfsbereit, ließ abschreiben und sagte vor, ließ sich anpumpen, weil sie zu den wenigen Mädchen gehörte, die sich aus Süßigkeiten nichts machte und auch sonst nicht viel brauchte. An ihrem Äußeren hatte sie nichts zu meckern, sie würde eines Tages aussehen wie Mami, nur mit Papis dunklen Augen.
Papi…
Das war eine Sache, die Stine ein bißchen zu schaffen machte. Sie war noch keine fünf Jahre alt gewesen, als er verunglückte, konnte sich noch an ihn erinnern, wenn auch nur schwach. Empfindungen jedoch hatte sie keine für ihn, wußte auch nicht mehr, wie das damit zu seinen Lebzeiten ausgesehen hatte.
»Ihr habt euch unheimlich liebgehabt«, hatte Mami gesagt, als sie einmal mit ihr darüber gesprochen hatte. »Du warst seine Prinzessin! Prinzessin Tausendschön…«, und in Mamis Augen hatten sich Tränen gesammelt. Stine hatte daraufhin das Thema gewechselt. Sie wollte nicht, daß Mami traurig war. Sie hatte es sowieso schwer genug. Aber – so machten Stines Gedanken sich selbständig – sie hätte es nicht so schwer, wenn sie einen neuen Mann für sich und einen neuen Vater für sie suchen und finden würde. Klar, sie hatte Omi, aber Omi war nur – erstens – Mamis Mutter und auch nur – zweitens – eine Frau. In Stines Bild vom Leben gehörte aber immer auch ein Mann.
Sie deckte den Abendbrottisch heute mit dem rustikalen braunen Geschirr, denn es gab Bauernomlett mit grünem Salat, danach dicken Milchreis mit brauner Butter und Zucker und Zimt. Sie war Ästhet, ohne es zu wissen. Erzogen von zwei Frauen, für die die Kultur bei den Tischmanieren begann und die Schöngeistigkeit für eine Notwendigkeit auch im Alltag hielten, hatte sie alles aufgenommen wie ihr tägliches Brot.
»Stine…«
»Ja, Omi?«
»Sammelst du die Familie ein? Ich setze jetzt den HOPPEL-POPPEL an.«
»Mach’ ich! – Was ist mit Mami?«
»Lauf rüber und frag sie.«
»Können wir nicht anrufen?«
»Können wir nicht unser Geld zum Fenster rauswerfen?«
Stine lachte. Omis Sparsamkeit war ihr so vertraut wie Mamis Großzügigkeit, über die Omi manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Bildlich gesprochen. Sie lief nach oben, wo Dominik mit Gerald nervtötend Blockflöte übte. Gerald, seit kurzem in der Musikvorschule, war versessen darauf, tat sich aber schwer, es zu lernen. Dominik hatte Musik und Rhythmus im Blut. Deshalb hatte er auch vor, entweder ein großer Dirigent zu werden oder Rennfahrer. Formel I natürlich.
»Essen in zehn Minuten!« rief Stine ihren Brüdern zu, bevor sie wieder hinunterlief. »Und Händewaschen nicht vergessen!«
»Gerade jetzt, wo ich es so schön kann!« maulte Gerald.
»Wenn du es so schön kannst, kannst du es auch später noch, sonst kannst du es nicht schön!«
Über diesen klugen Satz mußte Gerald so intensiv nachdenken, daß Dominik die Gunst der Sekunde nutzte und die Blockflöte in ihren Kasten legte.
»Es gibt dicken Milchreis!« sagte er lockend und schob Gerald automatisch die braune Locke aus der Stirn, die immer wieder da hinein fiel. Ach, der kleine Dicke! Er liebte seinen so wahnsinnig gutmütigen aber etwas schwerfälligen kleinen Bruder so sehr, wie sie ihn alle liebten. Irgendwo in ihm saß immer so eine kleine Angst um ihn, diesen Zutraulichen, Freundlichen, daß ihm jemand weh tun könnte, verletzen. Oh, dann würde man aber Dominik, den Gewalttätigen, kennenlernen! Wer seinem Bruder etwas antat, tat es auch ihm an!
Das Haus, die Büroräume und auch die Menschen darin natürlich waren Stine vertraut. Sie war gern hier in den Büros, in denen nie eine Tür geschlossen war, außer manchmal. Wenn sie nicht Tierärztin werden wollte und mußte, weil sie gar nicht anders konnte, dann würde sie hier bei Mami arbeiten. Aber man kann nicht alles haben, man mußte sich für eine Sache entscheiden, sagte Omi immer. Mamis Tür stand auch offen. Sie hörte Petras Stimme sagen:
»Sag bloß, du hast nicht bemerkt, daß er darauf aus ist, dich zu heiraten!«
»Na ja…«, antwortete Mamis Stimme, »schon. Ein bißchen jedenfalls. Aber ich glaube nicht…«
»Christine Conradi! Hör endlich auf, mir und dir selbst was vorzumachen! Du wirst dich entscheiden müssen, das weißt du ganz genau. Und hör endlich auf, an dem Radiergummi rumzupfriemeln. Deine Nervosität macht mich mit nervös. Warum nur
fährst du nicht ein paar Tage irgendwohin?«
Mami lachte leise auf.
»Jan-Peter möchte mit mir nach Andalusien fahren, tanzen, feiern, singen, fröhlich sein; er meint, ich hätte das wirklich verdient.«
Einen Moment war es still.
»Und was meinst du?« fragte Petra dann.
Die Antwort bekam Stine kaum mit, weil ihr der Schreck in alle Glieder gefahren war. Um ein Haar wäre sie lang hingeschlagen! So sehr sie dafür war, einen Vater zu bekommen, so war sie aber keinesfalls für den erstbesten! Und keinesfalls für Herrn Rüssmann! Den doch nicht! Das war kein Vater. Das war ein – ein…
»Ach ich…«, kam jetzt Mamis Stimme wieder an Stines Ohr und Gedanken, »ich würde am liebsten ein paar Tage nach Masuren fahren. Ganz allein. Nur Ruhe, Stille, Weite, Wald und Wasser. Alles das in sich aufnehmen, ganz langsam und leise…«
Mamis Stimme klang richtig sehnsüchtig.
»Und warum in drei Teufels Namen tust du es dann nicht?«
Petras Stimme war klare Sachlichkeit und Nichtverstehen.
»Ja«, sagte da Mami nach einer Weile, »ja. Warum eigentlich tue ich es nicht?«
In Mamis Lachen hinein bellte Bingo, der Stine unauffällig gefolgt und dem es jetzt zu langweilig war.
Stine stürmte mit ihm in Mamis Büro. Sie begrüßte Petra mit einem Wangenkuß, Petra war nämlich unheimlich in Ordnung, und verkündete:
»Essen in ein paar Minuten. Es gibt Bauernomlett und dicken Milchreis mit Zimtzucker. – Willst du auch mitessen, Tante Petra?«
Die Einladung konnte Stine ohne Bedenken aussprechen, denn bei Conradis hieß es: Für ein, zwei Leute mehr reicht es allemal.
»Danke, meine Süße du, aber ich bin mal wieder auf Diät!«
»Als ob du bei deiner Figur darauf achten müßtest!«
»Dies wäre nicht meine Figur, Süße, wenn ich es nicht täte!«
Was zutraf, denn Petra Jung war rothaarig, klein und wohlgeformt. So wohlgeformt, daß jede Kartoffel zuviel diese reizende, bei richtiger Kleidung aufreizende, Form zerstören könnte. Und HOPPELPOPPEL und DICKER-MILCHREIS haben es nun einmal in sich und waren gottlob-gottlob auch eigentlich nicht so unbedingt ihre Sache.
Sie sah dem hübschen Mutter-Tochter-Paar mit Hund mit einem kleinen Lächeln nach. Mensch, Christine! Warum nur hat dieser Narr von Jan-Peter bloß Augen für dich und nicht für mich? Kannst du mir das mal erklären? Dabei paßt ihr zueinander wie – wie – jedenfalls überhaupt nicht! Er ist doch eigentlich ein kluger Mann, der das erkennen müßte. Aber ich glaube, er will es nicht einsehen! Nicht, daß ich glaube, daß er scharf auf den Laden hier
ist, no, no. Ganz sicher nicht, andernfalls hätte ich mich total in ihm getäuscht. Gut – gut, er ist POWERMAN und ERFOLGSMENSCH! Aber ist das denn wirklich so etwas SCHLIMMES? Leonard war das irgendwie auch, zwar auf eine subtilere und zurückhaltendere Art, aber er war es auch!
Petra fühlte, wie Tränen in ihr hochschossen. Nicht Christine allein war überarbeitet, sie war es auch! Sie rackerte sich ab für diesen Laden, als gehöre er ihr. Doch sie tat es nicht nur, weil man sie überdurchschnittlich gut bezahlte, sondern weil es ihr Freude machte, große Freude, und die Agentur irgendwo so etwas wie ihre Heimat war.
Seit dem Autounfall vor jetzt genau acht Jahren konnte sie keine Kinder bekommen. Daraufhin hatte sich Paul Jansen, den sie für ihre große Liebe gehalten hatte, der jetzt aber nur noch verschwommen durch ihre Erinnerungen geisterte, von ihr getrennt. Die Anwandlung, vom Dach des Hochhauses, in dem sie damals ein Appartement hatte, zu springen, verging so schnell wie sie gekommen war. Die Erkenntnis, daß ja eigentlich der Gold- und Silberglanz ihrer Liebe schon ein bißchen angelaufen war, tat ein übriges. Sie erkannte dann plötzlich, daß auch Arbeit glücklich machen kann, auf irgendeine Art jedenfalls. Ihr Freundeskreis war nicht groß, dafür treu und verläßlich. Als Jan-Peter dann seinerzeit in die Firma kam, stellte Petra erleichtert fest, daß man sich immer wieder verlieben kann! Sie verliebte sich sozusagen vom Fleck weg in ihn. Da diese Liebe jedoch keine Erwiderung fand, leistete sie sich ab und an eine kleine Liebelei, die nicht viel bedeutete, das Leben aber verschönte.
Jemand rief:
»Bis morgen dann…!« Eine Tür schlug zu, dann war es still.
»Bis morgen…«, antwortete Petra automatisch.
»Wieso? Ich bin ja noch da!«
Jan-Peter! Wenn man an die Sonne denkt, dann scheint sie! Petra hoffte, daß er ihre Träne nicht sah. Sie täuschte sich!
»Alles in Ordnung mit dir?« Er sah sie dabei scharf an.
»Aber ja doch! – Ich dachte, du wärst mit den Leuten von Interstant essen?«
»Ist vertagt worden.« Er blätterte gedankenlos ein paar Zeitschriften auf ihrem Schreibtisch durch. »Hast du denn schon gegessen?«
Geistesgegenwart gehörte zu Petras Stärken.
»Nein. Warum?«
»Nun, vielleicht könnten wir zusammen irgendwo einen Happen nehmen und einen Schluck trinken.«
Als emanzipierte Frau muß man imstande sein ohne mit der Wimper zu zucken als Ersatzmann einzuspringen. Schauspieler, Sänger und Sportler mußten das auch!
»Warum nicht?«
»Prima! Wann wärst du denn soweit?«
»In einer halben Stunde etwa.«
»Okay. Ich komm’ dann wieder vorbei.«
Als er weg war, ließ Petra sich auf ihren Stuhl plumpsen. Nicht zu fassen! Sie ging tatsächlich nach Jahren der Hoffnungslosigkeit und der Entsagung zum ersten Mal mit Jan-Peter allein essen! Die Betonung lag auf ALLEIN, denn mit der Mannschaft waren sie häufig gemeinsam zum Essen gegangen. Wie das eben so ist in gut funktionierenden Bürogemeinschaften. Petra schloß die Tür und betrachtete sich im Spiegel. Wie gut, daß sie sich heute morgen für dieses dunkelblaue Etwas entschieden hatte, in dem sie bei schummriger Beleuchtung schlank wie Audrey Hepburn wirken konnte. Sie würde den violetten Lidschatten…
Nein. Sie würde gar nichts! Sie würde sein, wie sie immer war. Entweder man mochte sie – oder man mochte sie nicht! Sie war schließlich keine lächerliche Siebzehn mehr! ICH BIN ZU ALT,
UM NUR ZU SPIELEN – sie war neulich seit langer Zeit mal wieder im Theater gewesen und vollendete den klassischen Satz – ZU JUNG, UM OHNE WUNSCH ZU SEIN.
Wie auch immer – was auch immer! Wie sagte Großmutter immer?
»Heute Gänsebraten, morgen Federn!«
Also auf zum Gänsebraten! Heute. Was man mit den Federn von morgen tat, das würde sich finden.
*
Zu Christines Erleichterung kam Jan-Peter nicht mehr auf einen gemeinsamen Urlaub zu sprechen. Vielleicht deshalb, weil die Agentur sich plötzlich vor Aufträgen nicht retten konnte. Er war ein Arbeitstier, wie es im Buche stand und sogar an den Wochenenden im Büro, wo Petra ihm zur Hand ging.
Einmal hörte Christine wie er fast lachend zu Petra sagte:
»Wir zwei sind ein großartiges Team, findest du nicht auch?«
»Unschlagbar!« hatte Petra zugestimmt, und in ihrer Stimme lagen drei Schichten purer Freude.
Ja, dachte Christine, das sind zwei, die die Arbeit völlig ausfüllt. Ich arbeite auch gern, aber weder die Agentur noch meine Aufgaben in ihr sind mein Lebensinhalt. Mein Leben ist die Familie, für die ich versuche, den Laden zu erhalten. Obwohl, sie lächelte unwillkürlich, was soll ein großer Dirigent oder eine Tierärztin oder ein Astronaut, die Karriere, die Gerald anstrebte, mit einer Werbeagentur?
Sie stellte sich ans Fenster. Drüben vorm Haus mähte Dominik den Rasen. Der großer Dirigent oder Rennfahrer in spe bei der Gartenarbeit! Stine und Gerald kamen mit Bingo und einer Einkaufstüte vom Supermarkt. Gerald redete auf Stine ein, die geduldig zuhörte und ab und zu zustimmend nickte.
Ihre Große! Sie standen sich sehr nahe, und Christine freute sich schon auf die Zeit mit ihrer Tochter, in der sie von Frau zu Frau miteinander reden würden. Sie würde sich bemühen, ihr nicht nur Mutter, sondern stets auch eine gute Freundin zu sein.
Sie legte die flache Hand gegen die Stirn, hinter der ein leichter aber anhaltender Kopfschmerz pochte. Den konnte sie sich jedoch im Moment am allerwenigsten leisten. Der Boom in der Agentur verschonte auch sie nicht. Auf ihrem Schreibtisch stapelte sich die Arbeit. Christine ging zur Tür, die sie ausnahmsweise einmal geschlossen hatte, weil ein Ruhebedürfnis sie überfallen hatte, ganz jäh und mit einer Nervosität, die sie nicht an sich kannte.
Petra blickte sie an. Sie sah heute besonders unternehmungslustig aus, was daran lag, daß sie ihre rötliche Haarpracht schneiden und in unzählige Löckchen hatte legen lassen. Es sah geradezu verwegen aus und machte aus der etwas mehr als dreißigjährigen Petra gut und gern eine gut Zwanzigjährige.
»Hast du vielleicht eine Aspirin für mich?«
»Kopfschmerzen?«
»Ein bißchen. Eigentlich möchte ich mehr vorbeugen.«
Petras Blick überflog Christines Gesicht.
»Du mickerst, bist du sicher, daß sonst alles in Ordnung ist bei dir?«
»Ganz sicher!«
Dabei war sie so sicher nicht. Sie fühlte sich schwach, und hin und wieder verschwamm die vertraute Umgebung vor ihren Augen. Es hatte schon heute morgen angefangen, als sie vor dem Spiegel stand und den braunen Gürtel um das leinene sandfarbene Kleid legte. Vorher hatte sie schon eine Weile wachgelegen und überlegt, was sie anziehen sollte. Es würde heiß werden. Zu ihrer eigenen Verwunderung entschied sie sich gegen eine Hose, denn sie trug seit ewigen Zeiten fast nur noch Hosen, und für ein Kleid. Die Auswahl war nicht sehr groß, aber gut sortiert. Als sie sich so ansah, fragte sie sich, warum sie ihre ganz besonders hübschen schlanken Beine eigentlich ständig in Hosen versteckte. Sie waren so praktisch! Richtig. Aber was war bei ihren Tätigkeiten unpraktisch an Röcken oder Kleidern?
»Das sagst du immer. Vermutlich auch noch, wenn du bereits aus den Pantinen gekippt bist.«
Petras Sorge war echt, und sie war wirklich ärgerlich. Immer und inzwischen schon viel zu lange mutete Christine sich zuviel zu. Sie hing inzwischen so fest in einem sich täglich wiederholenden total verplanten Alltag, daß sie vermutlich schon meinte, das müßte so sein. Dabei war sie so ganz und gar nicht die Frau für das Leben, das sie führte! Was Christine dringend brauchte, das war eine Schulter zum Anlehnen, eine Halsbeuge zum Ausweinen, starke Arme zum Festhalten und eine Natur, die die Entscheidungen eines gemeinsamen Lebens übernahm, oder zumindest m i t übernahm. Bei Kindern, Haus und Betrieb war das für Petra die schrecklichste Vorstellung: für alles, aber auch wirklich alles immer ganz allein verantwortlich zu sein! Leonard war ein so idealer Partner für Christine gewesen, daß es schwer sein würde, einen neuen zu finden. Außerdem war er ihre große Liebe gewesen und sie, Christine, die seine. Ein Bilderbuchpaar. Trotzdem müßte sie ein wenig suchen. Für die Kinder wäre es auch gut, wenn endlich wieder ein Mann ins Haus käme. Ausschließlich mit Liebe läßt sich die Karre des Lebens nun mal nicht lenken! Sie warf die Tablette in das Wasserglas, wo sie sich langsam auflöste. Während sie das Glas leicht schwenkte, betrachtete sie die Frau, die ihr Freundin geworden war. Die lehnte blaß an der Türfüllung und sah zum Umarmen einsam aus.
»Was soll ich denn machen?« fragte Christine leise, und dieser winzige Satz, diese kleine Frage sagte mehr über ihren Zustand aus als tausend Worte.
Petra ging zu ihr, streichelte mit den Fingerrücken der einen Hand Christines Wange und reichte ihr mit der anderen das Glas.
»Ich weiß es ja auch nicht, Chris; leider. Aber spann doch erst mal ein paar Tage aus, schaff Abstand, und dann – dann wird man weitersehen.«
In kleinen Schlucken begann Christine das Glas zu leeren.
»Bald…«, sagte sie dazwischen, »sind ja Ferien. Dann werden wir mit den Kindern…«
»Chris!« Am liebsten hätte Petra Christine geschüttelt. »Mit den Kindern! Und mit Lilli! Also bei aller Liebe, vor einem solchen Urlaub brauchst du erst einmal eine kleine Erholung für dich. Für dich ganz allein.«
Schritte näherten sich, und Jan-Peter stand in der Tür von Petras Büro. So salopp hatte Christine ihn selten gesehen: Cord und Karo. Er sah von der schweigenden zornig aussehenden Petra zu der blassen, stillen Christine und zurück.
»Störe ich?« fragte er.
Und Petra antwortete ruhig:
»Ja.«
Woraufhin Jan-Peter ernst nickte, bemerkte:
»Ich schau dann später noch mal rein.« Er ging, wobei er die Tür leise hinter sich zuzog.
Als hätte es die kleine Störung gar nicht gegeben, fuhr Petra fort: »Sie haben dich sowenig, daß sie in den Ferien, Menschenskind, das weißt du doch selbst gut genug, ihren ganzen Nachholbedarf decken wollen und werden. Und der ist nicht gering, wie wir alle wissen! Chris! Sie lieben dich – und du liebst sie, ja-ja-ja. Alles klar. Nur: Wem ist damit geholfen, wenn du langsam aber sicher in einen völligen Nervenzusammenbruch hineinsegelst, hm? Wem? Der Familie? Dem Betrieb? Dir? Nein, nicht einmal Bingo wäre damit gedient. Uns hier auch nicht übrigens. Schon mal was vom BURNOUT gehört, meine Liebe? Genau das nämlich trifft auf dich zu. Du bist ausgebrannt, Chris. Die ganzen letzten Jahre, sie sind dir nicht in den Kleidern stecken geblieben, Christine Conradi. So was bleibt keinem in den Kleidern stecken und schon gar nicht einer Seele wie dir. Wenn du nicht wirklich bald dagegen ansteuerst, dann gehst du vor die Hunde. So…«, Petra nahm Christine das inzwischen geleerte Glas aus der Hand, »und jetzt kannst du mich rausschmeißen, wenn du es für richtig hältst!«
Sie sahen sich schweigend an, bis Christine langsam ein blasses Lächeln lächelte.
»Danke. – Danke, Petra! Du hast ja recht!«
»Gott weiß das.«
»Ich jetzt auch.«
»Und?«
»Und was?«
»Wirst du dir meine Worte nicht nur merken, sondern auch etwas tun gegen deine Talfahrt in die Krise?«
Christine zögerte. Sie wußte bereits seit einiger Zeit, daß sie an einem Punkt angelangt war, der ihre schon lange aufgetauchten aber immer unterdrückten Selbstzweifel wuchern ließ. War es richtig, das Leben, das sie mit ihrer Familie führte? Was bei einem solchen Leben auf der Strecke bleibt, stellt man in der Regel erst spät fest. Oft zu spät. Und Gesundheit ist ein Gut, mit dem man nicht Raubbau treiben sollte.
»Ja«, sagte sie entschieden. Und noch einmal: »Ja. Ich spreche noch heute abend mit meiner Familie! Und dann…« Sie vollführte mit ihrer hübschen schmalen Hand eine wellenartige Bewegung des Wegfliegens.
Petra nickte und fuhr mit der Hand an Christines bloßem Oberarm auf und ab.
»Prima. Und um den Krempel hier…«, sie maß das gesamte Büro mit einem Blick, »mach dir keine Sorgen! Du hast mein Wort, daß alles glattläuft. Verlaß dich auf mich. Zur Not arbeite ich Tag und Nacht.«
Christine lachte ihre Rührung beiseite.
»Das bringst du fertig.«
»Ja«, bestätigte Petra ernsthaft, »das bringe ich. Weißt du, ich bin anders als du. Wußtest du nicht, daß ich der Prototyp der berufstätigen Frau bin? Die muß es schließlich auch geben.«
»Und ob!« sagte Christine. Die Kopfschmerzen waren jetzt eigentlich nicht mehr der Rede wert.
*
Am selben Abend bekam Christine aber erst einmal hohes Fieber, Schwindelanfälle und Erbrechens-Attacken, die sie so sehr erschöpften, daß Lilli sich gezwungen sah, den Arzt zu rufen.
»Die handfesteste Sommergrippe, die mir in letzter Zeit untergekommen ist. Sie machen wirklich Nägel mit Köpfen, Frau Conradi.«
Frau Conradi hätte anderes lieber gemacht, als Nägel mit Köpfen, aber die Grippe wählt ihre Opfer nach eigenen Gesetzen. Viele Jahre ihrem Ausleseverfahren entkommen, traf sie sie jetzt mit voller Wucht.
Die Kinder, die sie noch nie krank erlebt hatten, schlichen durchs Haus, um sie zu schonen, versuchten, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen und brachten ihr Blumen und Pralinen. Stine versorgte sie unentwegt mit Fruchtsäften, Dominik las ihr Gedichte vor, er hatte eine sanfte Stimme, und Gerald malte ihr ausdauernd bunte Bilder. Es waren liebenswürdige, anmutige Bilder, die sein Wesen in einer Weise widerspiegelten, das Christine die Tränen in die Augen trieb. Sie hatte gar nicht gewußt, daß ihr Jüngster so schön malen konnte! Was – sie mußte trocken schlucken – wußte sie sonst noch nicht von ihm? Von ihm und seinen Geschwistern?
Sie umarmte ihn so heftig, daß er sich erstaunt freiruckelte. Er war ein Kind, das die Blicke auf sich zog. Nicht, weil er ganz besonders hübsch war, sondern weil er eine so ruhige, alles umlächelnde Liebenswürdigkeit ausstrahlte. Er weckte Beschützerinstinkte selbst da, wo sie nicht sehr ausgeprägt vorhanden waren.
Petra kam täglich auf einen Sprung vorbei, um Bericht zu erstatten, und brachte ihr, als es ihr wieder besserging, Prospekte aus dem Reisebüro.
»Da ist auch was über dieses Masuren bei, falls du wirklich dahin willst.«
Endlich war es dann soweit!
Trotz anfänglicher Bedenken freute sich Christine plötzlich auf diese Reise allein. Sie war einmal – mein Gott, wie lange das alles zurücklag – mit Leonard an einem der traumhaften Seen dort oben gewesen und hatte nie das Gefühl vergessen, das sie da überfallen hatte: daß die Zeit stehenzubleiben schien, daß Frieden auf der ganzen Welt war und nichts Böses mehr existierte. Für diese, ihre erste Alleinreise hatte sie sich für einen Gasthof entschieden, der Stille und Einsamkeit versprach. Genau das, was sie suchte. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, würde sie auch die Orte besuchen, in denen sie mit Leonard war. Vielleicht!
Sie mußte von Gerald die schönsten Bilder mitnehmen und versprechen, sie jeden Tag zu betrachten. Stine hatte ihr mit Lillis Hilfe einen Picknickkorb gepackt.
»Mit Überraschungen!« kicherte sie.
Dominik hatte ihr – er hatte mal wieder bei Stine einen kleinen Kredit aufnehmen müssen – zwei Kassetten fürs Autoradio gekauft.
Niemand, dachte Christine während sie in mäßigem Tempo über die Autobahn fuhr, war traurig! Mit amüsiertem Erstaunen überlegte sie, ob Mütter nicht viel mehr in ihre Beziehung zu ihren Kindern hineingeheimnisten als tatsächlich war. Sie überdachte ihr Verhältnis zu Lilli, kramte in Kindheits- und Jugenderinnerungen, förderte aber nicht mehr zutage, als eine gute, ordentliche Mutter-Tochter-Beziehung. Sie liebte Lilli – und Lilli liebte sie. Kein Zweifel daran. Aber verstand sie Lilli auch? Und verstand Lilli sie? Wußte sie eigentlich, was früher in Lilli vorgegangen war, als sie Witwe wurde und damit alleinerziehende Mutter. Was wußte sie von ihren Sehnsüchten und Ängsten? Und – weiter – was wußte Lilli von ihren Sehnsüchten und Ängsten. Und Zweifeln. Und Unsicherheiten. Was?
Christine erkannte, daß da etwas aufzuarbeiten war. Wenn sie richtig überlegte, so waren ihr und Lillis Leben eine einzige Aneinanderreihung von Zeitmangel füreinander. Der Alltag verlangte entschieden zuviel. Doch wie entgeht man ihm? Es gibt kein Entrinnen, es sei denn man veränderte sein Leben kategorisch. Aber wer kann sich das schon leisten? Man muß sorgen!
Christine schob diese Gedanken behutsam beiseite, nicht weg. Sie würde weiter darüber nachdenken, nur nicht jetzt, während der Fahrt. Sie legte eine von Dominiks Kassetten ein und lauschte mit Zärtlichkeit im Herzen Mozart. Wie konnte sie nur befürchten, er habe ihr etwas von der wilden, lauten Musik geschenkt, die er bevorzugte? Doch nicht ihr Sohn! Ach, lieber, lieber Gott, ich danke dir, danke dir sehr, für diese meine Kinder. Nie werde ich aufhören, diese Geschenke zu lieben. Nie.
»Sagt, holde Frau, die ihr sie kennt,
sagt, ist es Liebe, was hier so brennt…«
sang es von Dominiks Kassette. Christine summte die Melodie mit. Liebe… Ach, Liebe…
Christine beschleunigte das Tempo ein wenig.
*
Aus einer Stimmung heraus entschied Christine nach einer Weile, von den großen Straßen auf die kleinen zu wechseln, auch wenn die Fahrt dadurch etwas länger dauerte, sie hatte ja Zeit! Endlich einmal. Als sie an einer Kreuzung in einer kleinen Stadt halten mußte, betrachtete sie ihr Gesicht im Rückspiegel. »Buttermilch und Spucke« würde Petras Großmutter sagen und wieder einmal recht haben. Die Blässe wäre noch kleidsam gewesen – man wirkte damit ja geradezu exotisch in einer Welt, in der man sonnenbankbraun herumlief, um Sportlichkeit, Fitness und so weiter vorzutäuschen – aber die dunkle Fläche unter den Augen, die mußte weg. Sie machten das ganze blasse Gesicht müde. Und eigentlich war sie es auch.
Jetzt war sie seit Stunden unterwegs, hatte einmal zwischendurch Stines Überraschungs-Picknick-Korb geöffnet und einen wirklich köstlichen Obstsalat genossen. Grün. Sie fuhr weiter und sah sich, als sie das Städtchen hinter sich gelassen hatte, ein wenig um. Eine Sommerlandschaft mit dem satten Grün gesunden, feuchten Bodens. In einigen Senken schwebten leichte Nebel, kündigten baldigen Abend an. Durch die Dunkelheit unbekannte Strecken zu fahren, gehörte nicht eben zu Christines Vorlieben. Zwar war sie, trotz des bisweilen teuflischen Verkehrs, immer noch Autofahrerin aus Passion, aber Dunkelheit, noch dazu einsam und unbekannt, – ach nein. Sie fuhr rechts ran und kramte nach dem Plan, den der umsichtige Dominik ihr gekauft hatte. Der nächste Ort schien etwas größer zu sein, würde wohl auch ein Hotelchen oder einen Gasthof haben. Und urplötzlich kam sich Christine Conradi, gestandene Frau und Mutter vor, als befände sie sich auf einem Abenteuertrip. Sie fühlte sich jung und geradezu verwegen neugierig. Neugierig einfach auf etwas anderes, als das ganze ach so Vertraute der letzten drei-, vier-, fünftausend Tage ihres Leben.
Sie dachte an ihren Bruder, der sich eines Tages einen Satz karierter Hemden und Cordhosen, sowie festes Schuhwerk und einen Jeep gekauft hatte, ihr und Lilli und damals auch noch Leonard mitteilte, daß er sich die Welt ansehen und vielleicht Farmer in Neuseeland werden wollte.
»Schafe?« hatte Leonard lachend gefragt, denn Robert, der auch heute noch Bobo genannt wurde, hatte auf Lehramt Theologie und Englisch studiert. Mit Erfolg. Er hatte seine Referendarzeit gerade abgeschlossen.
»Vielleicht…«, hatte Bobo, ebenfalls lachend, geantwortet, »wer weiß das schon?«
Inzwischen war er, sehr erfolgreich und sehr glücklich, Farmer in Neuseeland, Ehemann und Vater und Deutschlehrer an der kleinen Schule des Dorfes, das mehr und mehr von Touristen besucht wurde, die vorwiegend aus Deutschland kamen.
Christine fühlte unvermittelt eine kleine Sehnsucht nach ihm in sich aufsteigen. Sie hatten sich so lange nicht gesehen! Lilli plante einen Besuch im nächsten Frühjahr. Vielleicht sollten sie alle wieder einmal rüberfliegen. Es war ja überhaupt kein Problem mehr, die Welt war so klein geworden.
Christine trat abrupt auf die Bremse. War das da drüben nicht ein Hotel? Es war eines. Klein, nicht besonders fein aber urgemütlich und ruhig. Die Räumlichkeiten waren alt und rustikal, die Wirtsleute wortkarg und freundlich. Das kleine frühe Abendessen, das Christine bestellte, war von unaufdringlicher erster Qualität.
Christine duschte, zog sich um und sah sich den fremden Ort an, dessen traditionsreiche, leicht übergraute Schönheit man erst auf den zweiten Blick erkannte. Es ist etwas Eigenartiges mit neuen Städten: Sie vermitteln das Gefühl, irgendwie und nebulös, ja, aber immerhin, eines Neuanfangs. Als stünde man davor, neue Wege zu gehen. Hinter den Rippen stellte sich eine geradezu flügelschlagende Erwartung ein, die sich unentwegt vermehrte. Später dann zog sich dieses Phänomen still und leise zurück. Was blieb, das war, etwas erkannt zu haben, von dem man nicht wußte, was es eigentlich war.
Zwei Kinder standen vor dem Schaufenster, das Christine eben passierte und einer der Jungen blickte hoch zu ihr und lächelte. Er hatte auch diese großen, stillen, zutraulichen Augen wie Gerald! Nur die Farbe war anders, von einem gelbdurchsprenkelten Flaschengrün, das von der dichten Wiese der Sommersprossen ablenkte, die das kleine Gesicht übersäten. Die unwahrscheinlich schwarzen Wimpern waren kurz und drahtig. Ein Kindergesicht zum malen! Und eines, dem man schon jetzt ansah, daß es eines Tages ein interessantes Männergesicht sein würde.
Sie konnte gar nicht anders: ihre Hand durchfuhr den festen, kurzen Haarschopf. Noch einmal der Austausch eines Lächelns, dann stapften die zwei Burschen davon, die Hände tief in den Taschen der ausgebeulten Jeans.
Plötzlich begann Christine zu laufen, zurück zum Hotel, wo sie zu Hause anrief.
»Was denn…«, Stine war am Apparat, »bist du etwa schon da?«
Lachend verneinte Christine! Ach, tat das gut, die wohlbekannte Mädchenstimme zu hören! Ihr Herz badete in einer warmen Woge von Zärtlichkeit.
»Ich fahre erst morgen weiter…«
Sie erzählte, wo sie war, daß die Fahrt wunderschön gewesen sei und der Picknickkorb großartig, was Stine wortreich freute.
»Und wie fühlst du dich so?« fragte Stine. Da wußte Christine, daß es gar nicht mehr lange dauern würde, bis ihre Tochter ihr Freundin – und sie ihr – sein würde. »Die Zeit hat Hummeln im Hintern!« war eine von Petras Großmutter viel zitierter Satz. Sie ist ruhelos und eilig, das konnte Christine nur bestätigen. Viel zu eilig! Sie jagte nur so! Eh’ man sich’s versah, war wieder ein Jahr um, und noch eines und noch eines…
»Gut«, Christine überlegte jetzt selbst erst einmal, wie sie sich fühlte, »ein bißchen ungewohnt, aber, ja, gut!«
»Das ist schön! Omi fragt, ob es noch was zu berichten gäbe, weil das Gespräch sonst ein Vermögen kostet.«
Christine lachte und fühlte sich einen großartigen Augenblick lang so glücklich über ihre Familie, über ihr Nest, daß sie Lilli ausrichten ließ, sie sei die beste Frau der Welt. Sie bekam eben noch zu hören, daß die Jungen zu einem Radrennen, das die Schule veranstaltete, waren und es angefangen habe zu regnen, mittags schon, und wie! Dann flogen ein paar geschmatzte Küsse durch die Leitung, die danach leer war. Erst jetzt fiel es Christine ein, daß sie ihr Handy vergessen hatte! Das konnte auch nur ihr passieren, weil sie das Ding nicht so liebhatte wie der Rest der Menschheit. Sie sah die Notwendigkeit, immer und überall erreichbar zu sein nicht ein, fand sie sogar ein wenig lächerlich. Und irgend etwas als Statussymbol zu besitzen widerstrebte ihr. Aber sie mußte es, laut Jan-Peter und Petra einfach haben! Und zugegeben, jetzt wäre es ja wirklich nicht schlecht, es dabeizuhaben.
Vor dem weit geöffneten Fenster verebbte das Getriebe des Tages, Ruhe kehrte ein. Von irgendwoher kam Bratenduft und die unverkennbare Durchdringlichkeit von Gurkensalat. Eine Mischung, die Christine als Kind immer als Sonntagsduft empfunden hatte. Unter einem solchen Sonntagsduft hatte sie Leonard kennengelernt. Damals, bei einer Party der damaligen Freundin ihres Bruders Bobo in deren Studentenbude. Die Freundin hatte Bobo bald darauf verlassen, er war ihr zu strebsam und zu wenig amüsierbereit, dafür hatten Leonard und sie angefangen, sich ineinander zu verlieben. Es war ein stilles Wachsen ihrer Liebe geworden, sie waren beide keine Feuerköpfe.
Niemals vorher und auch nie wieder danach hatte Christine sich in der Nähe eines Mannes so sicher gefühlt, so geborgen. Von Natur aus eher ängstlich, hätte sie an der Seite von Leonard ohne geringstes Zaudern den Nanga-Parbat bestiegen, oder den Ärmelkanal durchschwommen, obwohl Wasser bei Gott nicht ihr Element war.
Unten auf der Straße gingen, Arm in Arm, drei sehr junge Mädchen vorüber, feierabendfein und übermütig. Frisuren und Haarfarben waren bunt, die Jeans eng und die Stimmen laut vor Unsicherheit. Sie sahen verwegen aus, viel verwegener als Christine zu ihrer Zeit, aber im Grunde hatte sich nichts geändert. Ein paar Burschen von der gegenüberliegenden Seite riefen ihnen etwas zu. Sie kicherten das Kichern, das hunderte von Generationen vor ihnen gekichert hatten, und viele, viele nach ihnen noch kichern würden.
Auch, Christine wandte sich ab und entschied, ganz früh schlafen zu gehen, Stine. Auch sie. Ach, meine Kleine, meine Süße… In der Nacht träumte Christine von ihrem Großvater, der aus dem seenreichen Land stammte, in das sie jetzt fuhr. Christine hatte ihn geliebt, diesen großen, weit- und helläugigen stillen Mann.
»Er war ein aufrechter, treuer Mann…«, hatte der Pastor bei der Beerdigung gesagt, und Christine hatte es nie vergessen. Nie vergessen hatte sie auch, daß er der einzige war, der ihre Mutter nicht Lilli, sondern immer Elisabeth nannte; es war ihr Taufname.
Am Morgen, nach dem ausgezeichneten Frühstück und der fast herzlichen Verabschiedung der Wirtsleute stellte sie fest, daß ihre Freude auf das Ziel ihrer Reise so sauber und klar war wie das Wasser der Seen dort.
*
Sie durchfuhr langsam das Pommersche. Immer und überall diese grenzenlose Weite! Felder bis zum Horizont! Blauer, kuppelgewölbter blaßblauer Wolkenbogen, mehr Himmel als Land.
Vor dem Dorf durchfuhr sie eine endlose Allee mit alten Linden. Die Bäume waren so hoch, daß sie sich über der Mitte trafen und den Fahrweg zu einem schattigen, kühlen Tunnel machten. Es roch nach Wasser und Sand, ein bißchen auch nach Moder und hauchzart nach Fisch, der irgendwo geräuchert wurde. Ein sonderbares Land! Still und weit, dabei gleichzeitig einladend auf eine verhaltene Weise. Es versprach nichts, ließ aber unvorstellbar erscheinen, daß nicht überall auf der Welt Frieden war. Es war kein reiches Land, nie reich gewesen, über das der Großvater einmal gesagt hatte.
»Und? Ach, Marjellchen! Die Menschen werden nicht besser, wenn es ihnen bessergeht! Vielleicht… vielleicht im Gegenteil.«
Christine passierte eine steinerne Brücke, unter der ein Flüßchen träge seine Bahn zog, umgeben von einem Gemälde aus Schilf, Wasser und Kiefern. Im Hintergrund sah man die roten Dächer des Dorfes unter blauem Rauch. Wie gut, daß sie ihre Kamera nicht vergessen hatte! Endlich würde sie wieder einmal dazu kommen, ihrem Hobby zu frönen.
Als sie ausstieg, fühlte sie erst die Steifheit in ihren Gliedern, dann eine feuchte, kalte Schnauze an ihrem nackten Bein. Der Hund wedelte freundlich und freudig mit einer behaarten Rute, obwohl sein Fell eher als kurzhaarig zu bezeichnen war.
Christine beugte sich zu ihm.
»Na, du! Bist du hier der Empfangschef! Danke für das freundliche Willkommen!«
Ihr Jeans-Hosen-Rock wurde bezupft, bis eine Frauenstimme rief:
»Kolja! Hierher! Kolja…«
Kolja gehorchte sehr, sehr langsam und widerstrebend. Ein Lachen näherte sich, und vor Christine stand eine Frau, die ungefähr in ihrem Alter sein mußte. Eine Hand streckte sich ihr entgegen, und in makellosem Deutsch sagte die dunkle Stimme:
»Sie müssen Frau Conradi sein! Herzlich Willkommen bei uns. Ich bin Kristina Marek und führe – mit meinem Mann und meiner Mutter – das Cranka hier.«
Christine nahm die Hand, lachte.
»Kristina! So ein Zufall! Ich heiße Christine! Und Sie sprechen ein tolles Deutsch!«
»Kunststück!« sagte Kristina Marek. »Wir sind Deutsche! Besser: waren. Mein Mann ist Pole, aber sein Deutsch ist ebensogut wie meines!«
Sie wies auf das Haus.
»Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wohl fühlen!«
Es war ein langgestrecktes eineinhalbgeschossiges Gebäude, aus dessen reetgedecktem voluminösem Dach die kleinen blanken Fenster wie Augen blickten. Aus dem ein oder anderen wehte der Saum weißer Gardinen, und die Geranien vor allen Fenstern waren so leuchtend rot und von einer Üppigkeit, wie sie Christine noch nie gesehen hatte. Die linke Seite des Hauses wurde von einer Markise überdeckt, unter der kleine Tischgruppen standen. Die Haustür war zweiflügelig und schwer, als gehörte sie zu einer Burg. Offensichtlich Eiche. Die Messingklinken und -beschläge sahen aus, als wären sie aus Gold.
Christine sah ihre Fast-Namensbase lächelnd an.
»Davon bin ich fest überzeugt.«
»Einfach so? Auf der Stelle entschieden?«
»Ja. Einfach so. Ich entscheide meist nach Gefühl!«
»Sind Sie nie enttäuscht worden?«
Ein paar Sekunden überlegte Christine, während sie langsam nach hinten zum Kofferraum ging.
»Selten«, antwortete sie dann, »wirklich ganz selten.«
Als sie den Kofferraum öffnete, griff Kristina zu Tasche und Koffer. Christine hatte nur noch winziges Handgepäck zu tragen. Ach ja – und den Picknickkorb.
»Genau wie ich!«
Fast im Gleichschritt gingen sie zum Haus, dessen Tür von innen geöffnet wurde. Ein Mann stand in ihrem Rahmen, ein kleines Tablett mit drei Gläsern in der Hand.
»Das Willkommen«, sagte er, und regelrecht romantische dunkle Augen sahen Christine an. Guter Gott! So einen schönen Mann hatte Christine noch nie gesehen! Omar Sharif zu seinen Dr. Schiwago-Zeiten war nur ein Abglanz dieser breitschultrigen sonnenbraunen Männlichkeit. Gott sei Dank wurde diese prachtvolle Männlichkeit durch eine runde Nickelbrille ein kleines bißchen gemildert. Sie wirkte zwar wie ein Scherz, diese Brille, verfehlte aber ihre Wirkung nicht. Der Mann lachte.
Und Christine fiel ein, daß sie damals mit Leonard in ihrem Gasthof auch einen Wodka kredenzt bekommen hatte. Aber da waren sie am Abend angekommen, jetzt war heller Sonnentag!
»O nein!« sagte sie, hoffte von Herzen, nicht unhöflich zu erscheinen. »Vielen, vielen Dank! Alkohol immer erst nach Sonnenuntergang.«
»Ist mir bekannt!« lachte der masurische Omar Sharif. »Alte Regel aus den Tropen, nicht wahr? Dies aber ist Wodka. Er poliert das Blut.«
Kristina setzte das Gepäck ab, forderte Christine auf, ein Glas zu nehmen, wie auch sie es tat. Ihr Blick sagte zu Christine: Jetzt aufgepaßt! Sie nahm keinen Schluck, sondern ließ den Wodka praktisch nur ihre Zungenspitze berühren, dann hob sie das Glas über die Schulter und leerte es dahinter. Aufmunternd Christine anlächelnd, forderte sie sie auf, es ihr nachzutun. Was Christine tat.
Herr Marek allerdings leerte sein Glas, nicht ohne vorher über das Verhalten der Damen mißbilligend den Kopf geschüttelt zu haben.
»Schade um den Wodka!« bemerkte er dann.
»Gut für die Rosen!« entgegnete Kristina ungerührt und
nahm das Gepäck wieder auf. Jetzt erst entdeckte Christine, was das für ein großartiger Rosenstrauch war, der die Eingangstür bekränzte.
Das Zimmer mit den beiden kleinen Fenstern war behaglich und kühl, der Blick aus den Fenstern still, weit und friedlich wie ein Gebet, machte Christine für einen Augenblick stumm.
»Es ist wunderschön!« sagte sie endlich, und Kristina Marek bestätigte ohne falsche Bescheidenheit:
»Ja, nicht wahr?«
Sie brachte Koffer und Tasche entsprechend unter, öffnete sie, wies auf die Schränke und bot an:
»Ich räume Ihnen gern alles ein, wenn sie unten vielleicht derweil eine kleine Erfrischung nehmen möchten?«
Das DERWEIL erheiterte Christine, es erinnerte an den Großvater, und sie erinnerte sich doch so gern an ihn.
»Vielen Dank! Aber ich möchte mich jetzt erst einmal ein bißchen frisch- und danach ein bißchen langmachen. Und dann sehen wir weiter.«
»Gut! Dann bis später!«
»Ach…«, rief Christine dann doch noch, als Kristina schon die Tür geöffnet hatte, »kann ich nachher wohl irgendwo telefonieren?«
»Aber ja! Ich kann Ihnen auch hier oben ein Telefon einstöpseln, wenn Sie wollen. Die meisten Gäste wollen es nicht, weil sie ein Handy dabeihaben.«
»Ich habe meines vergessen«, gestand Christine, »deshalb nähme ich sehr gern eines, wenn es keine Mühe macht!«
»Nicht die geringste!«
Minuten später kam Omar-Marek und stöpselte ein Telefon ein. Sein Lächeln, stellte Christine hinterher fest, ist gütig, ja, und er wirkt, als habe er nicht die geringste Ahnung, welch ein toller Mann er war.
Sie rief zu Hause an, niemand ging jedoch an den Apparat. Seltsam. Um diese Zeit… Als sich der Anrufbeantworter nach dem fünften Durchläuten mit ihrer eigenen Stimme meldete, sprach Christine darauf lächelnd die Nachricht, daß sie gut angekommen sei.
*
»Das ist gut«, krächzte Lilli, als sie Christines Stimme gehört hatte, »Stine wird später zurückrufen, daß alles in Ordnung ist.«
»Findest du das richtig?« fragte Petra die schweigende Stine.
»Ja«, sagte diese ruhig.
Beide blickten auf Lilli. Die Grippe, die Lilli kurz nach Christines Abreise auf das Laken geschleudert hatte, stand in ihrer Heftigkeit der von Christine kein bißchen nach. Es war lediglich deshalb schwieriger, weil Lilli keine so geduldige Patientin war wie Christine und die Kinder und Petra, die Stine in ihrer Ratlosigkeit rübergeholt hatte, zur Raserei brachte.
»Kein Arzt!« hatte sie als erstes befohlen, obwohl sie vor Fieber glühte. »Wadenwickel tun’s auch!«
Sie taten es nicht.
Ein paar Stunden ließ Petra die starrsinnige Lilli wurschteln, dann fuhr sie zu ihrer Großmutter, bei der sie wohnte, packte die und kleines Gepäck für den Notfall in den Wagen, fuhr sie ins Haus Conradi und quartierte sie und sich dort ein. Da sie ja nun den Betrieb am Hals hatte und mit Stine der Meinung war, Christine da oben in Masuren in Ruhe zu lassen, arbeitete sie mit Großmutter einen Plan aus. Großmutter Babette sah zunächst Lilli lange an, dann verschaffte sie sich einen Überblick über Haus, Garten und Vorräte, informierte sich über die Pflichten und Rechte der Kinder und band ihre Schürze um.
»Als erstes…«, verkündete sie, »rufen wir den Arzt.«
»Das werden wir nicht!« Lillis Augenfunkeln wetteiferte zwischen Zorn und Fieber.
Großmutter Babette funkelte gleichmütig zurück.
»Wer ist der Hausarzt?«
»Dr. Adam…«, sagte Stine schnell, weil Lillis Krankheit ihr nun doch ein bißchen Angst machte. »Die Nummer ist gespeichert.«
Schweigend reichte ihr Großmutter Babette das schnurlose Telefon, damit sie es einschlägig betätigte. Sie selbst lehnte diesen Schnickschnack ab und weigerte sich, sich von ihrem alten schwarzen Kasten zu trennen, bei dem die Lochränder in der Wählscheibe schon dünngewählt waren wie eine Küchenmesserklinge.
Nachdem sie Dr. Adams Zusage, in ein bis zwei Stunden dort zu sein, hatte, schickte sie Petra zurück in ihr Büro und Stine in ein Feinkostgeschäft, ein frisches Suppenhuhn zu holen.
»Habt ihr Suppengrün im Garten?« fragte sie.
Durch Lillis roten Zorn und die fiebrige Hilflosigkeit schlängelte sich die schöne Erkenntnis von Seelenverwandtschaft. In Lillis rasselnder Brust sammelte sich Frieden.
»Selbstverständlich!« Ihre Stimme war so matt wie leise.
Zwei alte Frauen maßen sich mit einem langen glatten Blick. In beider Augen stand geschrieben, daß sie das Leben kannten. Sie wußten, was Ehe und Kinder und Schicksal hieß, hatten alles mit Anstand absolviert, ohne ihre Güte und ihren Glauben an die Menschheit verloren zu haben. Ein Glücksfall bei dem Quantum, sozusagen ein Leckerchen vom lieben Gott, für anständiges Wohlverhalten. Bei Männern würde man wohl von Tapferkeit sprechen, aber mit der Tapferkeit war das so eine Sache, sie ist manchmal blinde Dummheit, nicht selten Geltungsbedürfnis, was beides weder auf Lilli noch auf Großmutter Babette zutraf.
Dann schloß Lilli mit einem langen Atemzug die Augen. Sie hatte sich ergeben. Dem Schicksal und dieser Frau, die Petras Großmutter war und Augen besaß, die eine Menge gesehen hatten. Sie wußte nicht, wieviel Zeit vergangen war, aber mit einemmal erreichte kräftiger Suppenduft ihre Nase, die Stimme von Dr. Adam ihr Ohr.
»Ich hoffe bloß, daß der Rest der Familie sich nicht auch noch ansteckt! Wie fühlen Sie sich denn so?«
Und Lilli genoß den Luxus, weil ja diese seelenverwandte Großmutter Petras hier das Regiment übernommen hatte, ohne schlechtes Gewissen dafür mit Erleichterung zu gestehen: »Ich fühle mich so mies wie schon lange nicht mehr…«
Dr. Adam hörte ab, spritzte und verschrieb einer gelassenen Lilli eine Reihe von Medikamenten, gegen die sie normalerweise protestiert hätte. Sie baute auf Kamillentee und Hühnersuppe, war bisher gut damit gefahren. Aber nichts ist für die Ewigkeit, alles verändert sich, und Hühnersuppe zusätzlich zu trinken konnte nicht schaden.
»Soll ich jetzt Mami anrufen?« fragte Stine, als Dr. Adam gegangen war.
»Ja…«, Lilli versuchte ein Lächeln, »aber untersteh dich, irgend etwas…«
Stine blickte ihre Großmutter an, wobei sie eine Augenbraue hob, wie Lilli es oft tat.
»Bin ich von gestern?«
»Nein…«, Lilli erkannte in dem Kindergesicht eine Menge von sich selbst, »nein, das bist du nicht. Du bist ein großartiges Mädchen!«
Um ein Haar wäre Stine das Telefon aus der Hand gefallen. Omis sagenhafte Sparsamkeit traf auch auf das Verteilen von Komplimenten zu. Das Lob beflügelte Stine zu einem so heiteren Gespräch mit Mami, daß sie ganz stolz auf sich war. Sie gab den Hörer an Dominik weiter, der das Spiel fortsetzte. Nur Gerald hätte sich beinahe verplappert in seiner Unschuld, doch wirklich nur beinahe.
An diesem Abend hätte Stine getrost im Büro anrufen können, um Petra zu fragen, ob sie zum Abendessen käme. Nach einem langen, liebevollen Blick auf die schlafende Lilli tat sie es nicht.
In den Büros war immer noch Betrieb, obwohl die Feierabendzeit längst überschritten war. Die Regeln kennend, entledigte Stine sich ohne unnötigen Aufenthalt ihres Auftrags.
»Kommst du gleich zum Essen rüber, Tante Petra?«
Petra sah geistesabwesend auf die Uhr.
»Geht nicht, Süße. Ich schaue später noch einmal zu euch rein, ja? Macht eure Sache drüben gut, okay? Wir versuchen es hier zu tun.«
»Alles klar. Tschüs dann.«
»Tschüs dann…«
Und Petra hatte drüben vergessen und konzentrierte sich auf die neuen Tütensuppen.
»Hab’ ich das richtig verstanden…«, Jan-Peter stand an Christines Schreibtisch, auf dem der Gesamtentwurf ausgebreitet war, »du und deine Großmutter, ihr habt drüben Quartier aufgeschlagen?«
Petra strich einen Teil der Vorschläge für die Tütensuppen. Sie lachte.
»Genau! Du weißt doch, wie das ist, Familien müssen zusammenhalten! Eine hilft der anderen.«
Einen Augenblick war es still, dann sagte Jan-Peter: »Nein, ich weiß nicht, wie das ist.«
Petra hatte die Antwort erst gar nicht mitbekommen. Als sie sie endlich erreichte, ließ sie langsam Tütensuppen Tütensuppen sein und sah Jan-Peter durch die offene Tür an.
»Wieso weißt du nicht, wie das ist? Was meinst du damit?«
»Das heißt, ich kenne das nicht. Ich habe keine Familie.«
»Du hast keine Familie?« wiederholte Petra verständnislos und dann verstehend. Ihr Herz begann wie wild zu klopfen.
»So ist es.«
Das klang gleichmütig. Und doch war es Petra, als schwinge da ein Unterton mit – ach was, Untertöne, die nach etwas klangen, was sie nicht erkannte.
»Aber…«
Mit ruhigen langen Schritten kam Jan-Peter von Christines Schreibtisch zu ihrem. Er stellte sich neben sie und blickte interessiert auf die Entwürfe.
»Ich bin in einem Waisenhaus aufgewachsen.«
»In – einem…«
»Wai-sen-haus…«, vervollständigte er, als Petra nicht weitersprach und betrachtete weiter die Vorschläge auf dem Schreibtisch.
Petra betrachtete sein Profil. Es war das Profil eines erfolgreichen Mannes, klar geschnitten, hohe Stirn, energisches Kinn, festes Haar. Sie mußte trocken schlucken, weil sie sich blitzartig vorstellte, wie dieses Profil ausgesehen haben mochte, als es – nun etwa in Dominiks Alter war, oder vielleicht in dem Geralds… Ein Kinderprofil. Ätzende Hitze machte ihre Kehle eng.
»Lange?« konnte sie endlich fragen, aber nicht verhindern, daß ihre Stimme belegt klang.
»Immer.«