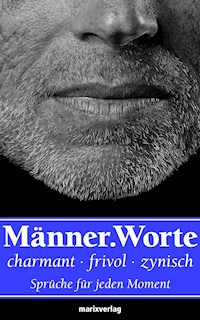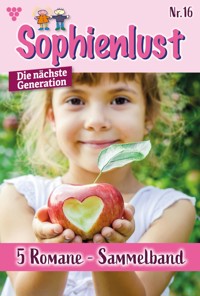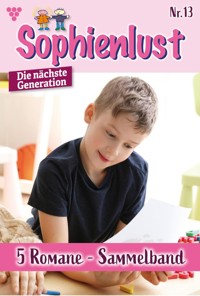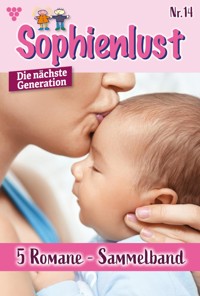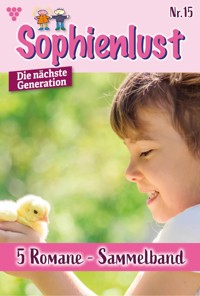25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Familie ist ein Hort der Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit. Wir alle sehnen uns nach diesem Flucht- und Orientierungspunkt, der unsere persönliche Welt zusammenhält und schön macht. Das wichtigste Bindeglied der Familie ist Mami. In diesen herzenswarmen Romanen wird davon mit meisterhafter Einfühlung erzählt. Die Romanreihe Mami setzt einen unerschütterlichen Wert der Liebe, begeistert die Menschen und lässt sie in unruhigen Zeiten Mut und Hoffnung schöpfen. Kinderglück und Elternfreuden sind durch nichts auf der Welt zu ersetzen. Genau davon kündet Mami. E-Book 1: Doch die Mutterliebe war stärker E-Book 2: Daniel hat eigene Pläne! E-Book 3: Diese Oma ist spitze! E-Book 4: Sascha – nie mehr allein E-Book 5: So sehr gewünscht – so sehr geliebt E-Book 6: Ein Papi auf Abwegen? E-Book 7: Ein Kind geht auf die Reise U E-Book 8: Stummer Ruf nach Liebe E-Book 9: Stiefmütter sind so lieb E-Book 10: Auf einmal stimmt die Welt nicht mehr
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1172
Ähnliche
Inhalt
Doch die Mutterliebe war stärker
Daniel hat eigene Pläne!
Diese Oma ist spitze!
Sascha – nie mehr allein
So sehr gewünscht – so sehr geliebt
Ein Papi auf Abwegen?
Ein Kind geht auf die Reise U
Stummer Ruf nach Liebe
Stiefmütter sind so lieb
Auf einmal stimmt die Welt nicht mehr
Mami – Staffel 24 –
E-Book 1958-1967
Diverse Autoren
Doch die Mutterliebe war stärker
Roman von Holm, Gitta
»Meine Damen und Herren! Wir landen in wenigen Minuten auf dem Flughafen von Rabat. Darf ich Sie bitten, das Rauchen einzustellen und die Gurte anzuschnallen? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Marokko!«
Während die Chefstewardeß ihre Ansage über das Bordmikrofon auf englisch, französisch und arabisch wiederholte, leisteten die Passagiere der Frankfurter Chartermaschine der Aufforderung gehorsam Folge. Nur ein junger Mann auf dem Mittelplatz der dritten Reihe schien auf seinen Ohren zu sitzen und nichts gehört zu haben.
Wie gebannt starrte Konstantin Berghoff, frisch gebackener Doktor der Rechtswissenschaften, auf das junge Mädchen in der feschen blauen Luftfahrtuniform. Sie war so hübsch, daß sein Herz augenblicklich in Brand geriet. Groß, blond, schlank, besaß sie das makelloseste Profil, das er je gesehen hatte.
Als sie ihm den Kopf zuwandte, blickte er in zwei haselnußbraune Augen, die einen aparten Kontrast zu ihrem silberblonden Haar bildeten, das lockig und in unbezwingbarer Fülle auf ihre Schultern fiel.
»Mein Herr, darf ich auch Sie bitten, jetzt die Gurte anzulegen?« fragte sie mit leisem Vorwurf, doch er vernahm nur den Klang ihrer weichen, melodischen Stimme, der ihm süßer als Himmelsglocken in den Ohren tönte.
»Aber selbstverständlich… selbstverständlich«, murmelte er leicht erschrocken und sah sie dabei mit einem so bezwingenden Lächeln an, daß sie unwillkürlich zurücklächeln mußte.
Silbern tanzte das Licht des Mondes auf der Weite des Atlantischen Ozeans. Die Lichter der großen Stadt kamen näher. Dann setzte die Maschine zur Landung in der Hauptstadt Marokkos an.
Junge Mädchen in ihrer alten, goldbestickten Nationaltracht begrüßten die fremden Touristen mit Blumen. Am Rande des Rollfelds sah man einen Reisebus stehen. Sprachfetzen schwirrten durcheinander, Deutsch und Französisch, Englisch, Holländisch, Finnisch. Auf den Flugplatzschildern sah man fremdartige arabische Schriftzeichen, darunter die französischen Bezeichnungen.
Konstantin Berghoff, nur knapp sieben Stunden von der Heimat getrennt, fühlte sich inmitten einer völlig neuen Welt. Lau war hier die Luft, und der süße Duft von Mimosen und Bouganvillea strich durch die Nacht. Wie milliardenfache Diamanten glitzerten die Sterne und hingen so tief über dem Horizont, als seien sie aus der Erde entstiegen. Wie gebannt starrte er in die Höhe, das ungewöhnliche Schauspiel genießend.
»Sie werden Ihren Reisebus verpassen, Monsieur!« sagte jemand auf französisch zu ihm. Es war der Flugkapitän, der mit langen Schritten über das Rollfeld stapfte, in einigem Abstand von seiner Crew gefolgt. Darunter die Chefstewardeß Pamina Petersen.
Das junge Mädchen erblickend, folgte Konstantin einer plötzlichen Eingebung. Ursprünglich hatte er vorgehabt, sich der kleinen Reisegesellschaft, die aus vierzehn Personen bestand, anzuschließen. Von einer Sekunde zur anderen änderte er seinen Entschluß und sagte in seinem etwas holperigen Schulfranzösisch:
»Oh, nein, ich gedenke, mir einen Leihwagen zu mieten, Monsieur le Capitaine. Der Reisebus kann ohne mich starten.«
»Das ist natürlich etwas anderes. Bonne chance, Monsieur.« Der Flugkapitän tippte lässig gegen seine Mütze und ging weiter.
Da näherte sich auch schon der Rest der Crew, die meisten etwas müde und erschöpft. Nur der blonden Chefstewardeß merkte man den anstrengenden Dienst kaum an. Das marineblaue Käppi saß wie ein lustiger Tupf auf dem silberblonden Haar.
»Was meinst du, Corinne?« hörte Konstantin sie zu einem braunhaarigen Mädchen sagen. »Nehmen wir vor dem Schlafengehen noch einen kleinen Imbiß ein oder –«
»Nein«, fiel die Kollegin ihr ins Wort. »Ich muß sofort mit meiner Schwester telefonieren. Muß hören, wie es ihr geht. Sie erwartet ein Baby, weißt du. Entschuldige, wenn ich dich allein lasse.« Damit eilte sie zum Telefon-Service der Flughalle.
»Kommen Sie mit uns, Pamina«, schlug der Co-Pilot vor. Und sein Freund, der Bordfunker, nickte. Zu dritt schlenderten sie über das Rollfeld zum Restaurant hinüber.
Enttäuscht blickte Konstantin den dreien hinterher. Schade, dachte er. Keine Chance, drei Worte allein mit diesem entzückenden blonden Engel zu wechseln.
Er wollte den dreien auch nicht folgen, um sie von einem entfernten Tisch beim Abendessen zu beobachten. So etwas widerstrebte seinem Naturell. Zum Spionieren besaß er kein Talent.
Die Gelegenheit, seine heimlich Angebetete wiederzusehen, ergab sich am nächsten Morgen. Als er den Frühstücksraum des Flughafenhotels betrat, sah er sie allein an einem Fenstertisch sitzen. Blitzschnell bemerkend, daß kein zweites Frühstücksgedeck aufgelegt war, näherte er sich ihrem Platz.
»Guten Morgen, schöne Frau«, grüßte er charmant. »Ist es gestattet, hier Platz zu nehmen?« Bevor Pamina, total verblüfft, ein Wort erwidern konnte, saß er auch schon und fragte, ihr tief in die Augen schauend: »Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, wie wunderhübsch Sie sind?«
Eine leichte Röte färbte ihre Wangen, bevor sie lächelnd erwiderte: »Nicht so direkt, würde ich sagen.« Dann zog ein plötzliches Erkennen über ihr Gesicht. »Jetzt weiß ich, wer Sie sind. Sie sind der Passagier, der vergessen hatte, sich vor der Landung anzuschnallen.«
»Genau der bin ich. Konstantin Berghoff ist mein Name. Und Sie sind die blonde Stewardeß, die mich an mein Versehen erinnerte.«
»Ich dachte, Sie gehören mit zu der Reisegesellschaft, die gestern abend mit Blumen von einer Trachtengruppe empfangen wurde.«
»Nein, ich reise als Single. Mein Herr Papa war so freundlich, mir diese Studienreise nach Marokko zu spendieren.«
»Studienreise? Sind Sie etwa Archäologe?«
»Nein, ich bin nur ein simpler Jurist, der gerade sein Staatsexamen bestanden hat und demnächst als Sozius in die Anwaltspraxis seines alten Herrn eintreten wird. Womit Sie im Telegrammstil schon das Wichtigste über mich wissen.«
Während er sprach, kam der Frühstückskellner, ein weißgekleideter Araber mit Turban, an seinen Tisch und erkundigte sich nach seinen Wünschen.
Als er nicht genau wußte, was ein Fünf-Minuten-Ei auf französisch hieß, übersetzte Pamina es für ihn. Doch sie tat es auf arabisch.
»Sie beherrschen die Landessprache?« fragte Konstantin beeindruckt.
»Ich habe einen Teil meiner Kindheit hier verbracht. Mein Vater war deutscher Konsul in Tanger. Außer arabisch spreche ich noch türkisch neben englisch, französisch und deutsch. Aber das mußte man schon können, wenn man Diplomdolmetscherin im Auswärtigen Dienst werden wollte. Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Das wird Sie kaum interessieren, Herr Dr. Berghoff.«
»Es interessiert mich sogar mehr, als Sie glauben«, versicherte er lebhaft und sah sie dabei wieder mit einem so zärtlichen Lächeln an, daß Pamina verschämt die Augen niederschlug.
Dieser Mann ist ein durchtriebener Schürzenjäger, flog es ihr durch den Kopf. Aber nein, dafür sah er eigentlich zu seriös aus. Ihr gefiel sein männlich markantes Gesicht mit der klugen hohen Stirn, den stahlgrauen Augen, der geraden Nase, dem noch jungenhaft weichen Mund.
Ihr Herz begann zu klopfen. Was, um Himmels willen, ist mit mir geschehen? dachte sie. Was zieht mich zu diesem Menschen hin, den ich erst seit gestern kenne? Da hörte sie ihn fragen:
»Was machen wir mit dem langen Tag, der vor uns liegt? Oder müssen Sie schon wieder mit einem dieser Riesenvögel weiterfliegen?«
»Zum Glück habe ich ein paar Tage dienstfrei.«
»Na, fabelhaft. Wie wäre es mit einem erstklassigen Bummel?« rief er unternehmungslustig und sprang auf, um sich gleich darauf wieder auf seinen Stuhl fallen zu lassen. »Verzeihen Sie, ich habe noch gar nicht gefragt, ob… ob Sie nicht schon mit jemandem verabredet sind. Außer daß ich Sie hinreißend und anbetungswürdig finde, weiß ich so gut wie gar nichts über Sie. Lediglich Ihren Vornamen kenne ich. Irgend jemand aus Ihrer Crew nannte sie Pamina.«
»Pamina Petersen«, ergänzte sie ohne Zögern.
»Ich finde, wir sind beide noch in einem Alter, wo man sich gleich beim Vornamen nennt. Einverstanden, Pamina?«
»Einverstanden, Konstantin«, sagte sie und schlug in seine ausgestreckte Rechte ein.
»Und jetzt, da die üblichen Präliminarien erledigt sind, hinein ins Vergnügen!«
Sie schlenderten durch die lärmerfüllten Gassen des Souk, des arabischen Marktes, besuchten eine Moschee, schauten den Kindern zu, die, auf Bastmatten und Teppichen sitzend, eifrig ihren Koran lernten. Einmal wurden sie in einer Synagoge begrüßt, ein andermal in einer Teppichweberei, ein drittes Mal in einem Pferdegestüt mit den wertvollsten, feurigen Araber- und Berberhengsten.
Konstantin war dem Rat des Hotelportiers gefolgt. Dieser hatte ihm dringend empfohlen, keinen Leihwagen zu mieten, sondern sich lieber einem einheimischen Taxifahrer anzuvertrauen.
»Wie teuer ist solch eine Besichtigungsfahrt?« wollte Konstantin wissen.
»Das kommt darauf an, wie gut man sich aufs Verhandeln versteht, Monsieur«, grinste der braunhäutige Portier verschmitzt.
Das kann ja heiter werden, dachte Konstantin, der in seinem ganzen Leben noch mit keinem Orientalen um Geld gefeilscht hatte.
Das brauchte er auch gar nicht. Denn diese heikle Aufgabe löste seine landeskundige Begleiterin mit Bravour.
Er konnte nur staunend dastehen, während Pamina gestenreich auf arabisch mit dem Fahrer eines uralten klapprigen Taxis den Endpreis aushandelte.
»Wir haben uns auf 1500 Dirham geeinigt«, verriet sie ihm das Ergebnis. Und als sie ihm noch sagte, wieviel das in D-Mark ausmachte, war er einfach erschlagen.
»Das ist ja geschenkt, Pamina. Kommen Sie, steigen Sie ein! Lassen wir uns von den Wundern des Orients verzaubern!«
*
Wie zwei übermütige Kinder genossen sie die gebotenen Sehenswürdigkeiten. Am nächsten Tag stand ein Ausflug nach Fes auf dem Programm. Sie dinierten in einem pompösen Palast, der heute als Hotel diente. Man saß auf goldbrokatenen Kissen. Das Licht brach sich in Spiegeln, Mosaikwänden und silbernen Tabletts. Weiche Teppiche dämpften jeden Schritt. In einer feierlichen Zeremonie wurde das Essen aufgetragen. Messer und Gabel lagen bereit. Aber arabische Hotelgäste aßen nach Landessitte mit den Fingern der rechten Hand.
Nach der Hauptmahlzeit folgte die feierliche Zeremonie der Teezubereitung. Zu dem sehr süßen Pfefferminzgebräu wurden Datteln gereicht.
Konstantin wollte es scheinen, als seien hier all die versponnenen Geschichten aus Tausendundeiner Nacht zu einem traumhaft schönen Erlebnis verwoben. Und die Krönung dieses Traums war das bildhübsche Geschöpf, daß an seiner Seite saß und mit Appetit die gebotenen Köstlichkeiten verzehrte.
Sie war zum Greifen nahe, und das Herz wurde ihm weit vor Liebe und Sehnsucht. Am liebsten hätte er sie in seine Arme gezogen und vor allen Leuten geküßt, aber das wäre in einem so sittenstrengen Land wie Marokko eine Todsünde gewesen.
Hier gab es zwar Hotelpaläste, neonbeleuchtete Wasserspiele, Verkehrsampeln, schneeweiße Hochhäuser mit Klimaanlagen und Eisschränken, doch daneben tiefverschleierte Frauen. Dieser überaus reizvolle Kontrast prägte das Gesicht aller marokkanischen Städte.
Im Anschluß an das Diner beförderte sie das Taxi zu einem besonders reizvollen Aussichtspunkt. Sie stiegen aus und standen auf einer sanft sich hinziehenden Anhöhe. Tief unten lag das unwahrscheinlich blaue Meer. Weiße Marmorpaläste inmitten herrlicher Gärten. Und gleich hinter den Mauern der Gärten bis zu ihren Füßen herauf erstreckte sich eine uralte Gräberstadt.
»Das ist der schönste Friedhof, den ich je gesehen habe. Es scheint mehr ein Garten der Lebendigen als der Toten zu sein«, bemerkte Konstantin hingerissen. »Schauen Sie nur, es gibt keine Grabsteine, sondern kleine Tempel und Denkmäler. Umgeben von Palmen und Zypressen. Ist das nicht wunderbar?«
»Einmalig schön«, stimmte Pamina ihm zu, obgleich der Anblick eines Friedhofs schmerzliche Erinnerungen an ihren verstorbenen Vater in ihr wachrief.
»Er erinnert nicht an die Vergänglichkeit des Daseins«, stellte Konstantin sinnend fest. »Wenn meine Zeit gekommen ist, möchte ich gerne hier ruhen.«
»Reden Sie keinen Unsinn!« sagte Pamina fast heftig. »Zum Sterben sind Sie viel zu jung.«
»Achtundzwanzig. Aber das besagt gar nichts. Niemand weißt, wann seine Stunde gekommen ist. Heute, morgen oder in fünfzig Jahren.«
»Noch leben Sie ja!« versuchte Pamina zu scherzen.
»Eigentlich habe ich bisher noch gar nicht gelebt. Aber ich habe die Absicht, jetzt damit zu beginnen. Wollen Sie mir dabei helfen, Pamina?«
»Wie könnte ich Ihnen dabei helfen?«
»Haben Sie noch nicht bemerkt, daß ich Sie liebe, Pamina? Bitte, schauen Sie nicht weg. Sehen Sie mich an. Ja, es ist wahr. Ich habe mich in sie verliebt und ich möchte Sie heiraten.«
»Das ist nicht Ihr Ernst«, stieß Pamina hervor.
»Es ist mein voller Ernst. So wahr ich hier vor Ihnen stehe. Und jetzt sagen Sie mir: haben Sie mich auch ein wenig gern?«
»Ich finde Sie sehr nett, Konstantin, und ich freue mich, ein paar schöne Urlaubstage mit Ihnen zu verbringen, aber wir kennen uns doch viel zu kurz, um…«
»Um was?«
»Um sagen zu können, daß wir einander lieben. Geschweige, denn, um an eine Heirat zu denken.«
»So etwas soll es vor uns schon gegeben haben.«
»Was denn?«
»Die Liebe auf den ersten Blick.«
»Das ist doch nicht möglich«, murmelte Pamina und schloß die Augen. Durch die geschlossenen Augenlider hindurch spürte sie, wie er sie ansah. Und eine niederträchtige Schwäche machte sich in ihrem Körper breit. Erwartung schwang in der Luft. Das Gefühl, es geschehe etwas, vor dem man sich ebenso fürchtet, wie man es herbeisehnt.
Konstantin blickte sich kurz um. Das Taxi stand in einer schattigen Kurve, von Palmen fast verdeckt. Von dem Fahrer war nichts zu sehen. Wahrscheinlich nutzte er die kurze Rast für ein Nickerchen. Sie waren unbeobachtet und allein.
Behutsam legte er seine Hände um Paminas Gesicht und fühlte keinen Widerstand. Da zog er sie an sich und küßte sie. Ehe sie wußte, was mit ihr geschah, fühlte sie seine Lippen auf ihrem Mund. Er küßte sie sanft und gleichzeitig fest. Es war, als nehme er mit diesem Kuß Besitz von ihr.
Pamina spürte, wie ein ungeheures Glücksgefühl die letzten Fasern ihres Wesens durchdrang. Sie hörte nichts mehr, sah nichts mehr, fühlte sich wie auf gläsernen Schwingen davongetragen in ein Land, in dem allein die Liebe herrschte.
»Lieber Himmel!« sagte sie atemlos, als sein Mund sie freigab, und schien aus einem sehr tiefen und sehr schönen Traum in das nüchterne Wachsein zurückzukehren.
Verwirrt hob sie den Kopf. Und als sich ihre Blicke mit denen von Konstantin kreuzten, blühte auf ihrem Gesicht das schönste Lächeln, das er je gesehen hatte. Sie sahen sich an und brauchten keine Worte mehr, um einander zu sagen, was sie fühlten.
Wie im Fluge vergingen die nächsten anderthalb Tage. Dann nahte die Stunde des Abschieds. Auf Paminas Dienstplan stand ein Rundflug über die Türkei mit diversen Zwischenlandungen, bevor es über Spanien nach Deutschland zurückging.
Abschiednehmend schlenderten sie noch einmal durch die engen Gassen des Souk. Noch einmal saßen sie in einem maurischen Café mit leuchtend blau gestrichenen Wänden, hörten den monotonen Singsang eines Liedes und sahen einem Wasserträger zu, der seine schwarze Ziegenhaut mit Wasser füllte.
Sie liebten sich. Daran bestand kein Zweifel. Und wenn es nach Konstantin gegangen wäre, hätte er auf der Stelle die Verlobungsringe gekauft. Pamina war es, die bei aller Verliebtheit einen klaren Kopf behielt. Sie trat dafür ein, sich und dem Geliebten eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen.
»Im Augenblick befindest du dich in einem Ausnahmezustand«, stellte sie sachlich fest. »Marokko mit seiner gigantischen Bergwelt, der grenzenlosen Weite seiner Wüste, der Buntheit seines Lebens, seinen liebenswerten Menschen, hat dich verzaubert. Unsere Begegnung war ein Teil dieser Verzauberung. In den nüchternen Alltag zurückgekehrt, wirst du vielleicht zu der Erkenntnis gelangen: das Ganze war ein wunderschöner Urlaubsflirt. Aber ich frage dich im Ernst: reicht das für ein ganzes Leben?«
»Ich verstehe deine Skepsis, Pamina«, sagte er leise. »Sicher hast du bei deinen Flügen rund um die Welt schon Paare erlebt, bei denen es über eine Urlaubsliebe nicht hinausging.«
»Oh, ja, das habe ich«, nickte sie ernst. »Und manchmal wuchsen daraus sogar kleine Tragödien. Ich habe auf den Heimflügen manche Frau und sogar einige Männer um ihre Fassung ringen sehen.«
»Deshalb will ich dich auch nicht bedrängen, Liebste«, versprach er kompromißbereit. »Alles, was ich mir wünsche, ist, dich so bald wie möglich wiederzusehen.«
»Das wünsche ich mir auch«, sagte sie und gab ihm einen innigen Kuß, bevor sie sich zu der Chartermaschine nach Istanbul begab, um die wartenden Fluggäste mit einem charmanten Lächeln in Empfang zu nehmen.
*
Leise plätscherten die Wellen gegen die Bordwand. Pamina lag auf dem blanken, warmen Holz des Segelboots und gab sich ganz dem leise schaukelnden Getragenwerden hin.
Wenn sie die Augen öffnete, sah sie die anderen Boote, die in der Flensburger Förde kreuzten, Sonnenschirme am Strand, die bunten Zelte eines Campingplatzes. Wenn sie aber die Augen schloß, war nur Konstantin da, das Wissen um seine starke Hand, die das Boot sicher führte, Wärme, Glück und Geborgenheit. Das war schöner als alles andere auf der Welt.
Nach einer kurzen Wende lenkte er das Boot in eine kleine Bucht und warf den Anker aus. Dann hockte er sich nieder, beugte sich über sie und küßte sie zart.
»Bist du glücklich, Pamina?« fragte er leise.
»Ich bin glücklich, seit ich weiß, daß ich nicht nur eine vorübergehende Urlaubsliebe für dich war.«
Voller Zärtlichkeit sah er sie an. »Ach, Pamina«, raunte er und küßte sie erneut. »Sag, wie sind deine Eltern eigentlich darauf gekommen, dir einen so romantisch klingenden Namen zu geben?«
»Mein Vater war ein großer Mozartfan. Seine Lieblingsoper war die ›Zauberflöte‹. Pamina, die entführte Tochter der Königin der Nacht, erschien ihm als Figur so reizvoll, daß er seine Tochter, sofern er eine bekäme, ebenfalls so nennen wollte. Als ich dann zur Welt kam, war meine Mutter glücklich, ihm seinen Herzenswunsch erfüllen zu können.«
»Eine hübsche Geschichte«, sagte Konstantin leicht gerührt. Und fügte sinnend hinzu: »Deine Eltern müssen sich sehr geliebt haben.«
»Oh, ja, das haben sie«, bestätigte ihm Pamina. »Es war eine überaus glückliche Ehe, und Mutter hat Vaters Tod vor fünf Jahren bis heute nicht verwunden.«
Sie schwiegen eine Weile. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Dann sprang Konstantin auf die Füße. »Ich hole uns jetzt einen Drink«, verkündete er und verschwand unter Deck. Mit einem Lächeln sah Pamina ihm nach.
Wenige Minuten später kehrte er zurück, in jeder Hand vorsichtig ein Glas Orangensaft mit einem Schuß Gin vor sich her tragend.
Pamina richtete sich auf. »Heißen Dank, Käptn!« sagte sie spaßhaft und nahm einen großen Schluck.
Konstantin hockte sich neben ihr nieder. »Ich muß mit dir reden«, begann er. Es klang ganz ernst.
Pamina schüttelte ihr silberblondes Haar zurück und straffte die schmalen Schultern, die nur von den Trägern ihres gelben Bikinis bedeckt waren. »Ich höre!« gab sie im gleichen Tonfall zurück, doch ihre Augen lachten.
»Ich finde, wir sollten bald heiraten«, sagte Konstantin und schwenkte den Inhalt seines Glases ein wenig. »Worauf wollen wir noch warten? Oder hast du irgendeinen Einwand vorzubringen?«
»Keinerlei Einwände, Käptn.« Es klang noch immer halb im Spaß. Das kam vom Drink. Oder von der Sonne. Oder weil sie so schrecklich glücklich war.
»Eine Wohnung könnten wir sicher bald bekommen«, fuhr Konstantin fort. »Ein Mandant meines Vaters ist Bauunternehmer. Der baut Eigentumswohnungen am Rande der Stadt.« Die Berghoffs lebten seit mehreren Generationen in einer reizvollen Kreisstadt Schleswig-Holsteins. Ihre Notars- und Awaltspraxis gehörte zur festen Tradition unter der angesehenen Bürgerschaft, die mit Gerichtsfällen in Berührung kam.
Pamina setzte ihr leeres Glas ab und sah ihn an. »Du bist also fest entschlossen, mich zu heiraten?« fragte sie, und es klang gar nicht mehr heiter, sondern überaus ernst.
»Ja«, nickte er. »Ich möchte, daß Stunden wie diese keinen Seltenheitswert haben, sondern daß wir immer beisammen sind. Verstehst du, was ich meine?«
»Ich wünsche mir doch auch nichts sehnlicher als das. Aber«, sie zögerte, »mein Vertrag mit der Chartergesellschaft läuft noch ein halbes Jahr. Ich möchte ihn gern erfüllen, weil ich ungerne vertragsbrüchig werden will.«
Konstantin sah etwas unbehaglich vor sich hin. »Muß es denn sein? Es gibt doch ernsthafte Gründe, um einen Vertrag zu lösen. Zum Beispiel…«
»Nein«, sagte Pamina entschieden. »Das verstieße gegen mein Pflichtgefühl. Das mußt du verstehen. Es würde sich ja doch nur um irgendwelche hergesuchten Ausflüchte handeln.«
Mit dem Pflichtgefühl hatte sie an sein eigenes Pflichtgefühl appelliert. Er war das Produkt einer konservativen Erziehung und bis in die Fingerspitzen korrekt. »Na, schön«, gab er nach. »Ich will dich nicht daran hindern, deine Verpflichtungen einzuhalten, aber ich werde keine ruhige Minute haben, wenn ich dich so weit fort weiß.«
Pamina legte die Hand auf die seine. »Mir wird schon nichts passieren, Liebster. Unsere Gesellschaft hat noch niemals eine Katastrophe zu verzeichnen gehabt. Toi-toi-toi!« Sie klopfte rasch dreimal auf die Holzplanke. »Und wenn ich zurückkomme, heiraten wir.« Ihre Augen strahlten ihn an.
Er nickte und senkte die Lider, als dächte er über etwas nach. Dann trank er sein Glas leer und äußerte beiläufig: »Ja, auch wenn ich deiner Mutter als Schwiegersohn nicht gerade willkommen zu sein scheine.«
Betroffen wandte Pamina den Kopf ab, ihr Gesicht verdunkelte sich. Sie blickte über die weite See, die nur durch leichten Wellenschlag bewegt wurde. Sie dachte an ihre Mutter und an deren fast unhöflich ablehnende Haltung, als sie den Begleiter ihrer Tochter in dem schmucken Reetdachhaus am Hamburger Elbufer empfing.
Was hatte sie nur gegen Konstantin einzuwenden? Sein Vater war wohlbestallter Notar und Rechtsanwalt in einer Kreisstadt Schleswig-Holsteins. Er selbst, promovierter Jurist, war als Juniorpartner in die väterliche Kanzlei eingetreten. Mit Sicherheit würde er wie sein Vater Karriere machen. Jede andere Mutter würde mit Freuden ihre Tochter einem solchen Mann anvertrauen.
Aber war es mit Holger Björnsen vor zwei Jahren nicht dasselbe gewesen? Holger war Flugkapitän bei einer schwedischen Air-Line. Sie hatten sich auf einem Ball über den Wolken in einem Nobelhotel der Hansestadt kennengelernt. Ach nein, es war nicht die große Liebe gewesen, mehr ein verliebtes Spiel, aber auch damals hatte die Mutter schon so schroff reagiert. Sie, die sonst so ein offenes, freundliches und umgängliches Wesen hatte.
»Weißt du, Konstantin«, sagte Pamine leise und gedankenvoll, »ich glaube, Mutter hat ganz einfach Angst, mich zu verlieren. Sie war schon dagegen, daß ich Stewardeß werden wollte. Am liebsten hätte sie mich als Diplomdolmetscherin im Diplomatischen Dienst gesehen. In Hamburg wimmelt es von Konsulaten. Da hätte sie mich immer in der Nähe gehabt. Nein, nicht du bist es, den sie ablehnt. Welchen Grund hätte sie dafür? Sie wehrt sich instinktiv gegen jeden Mann, der sich mir nähert und mich ihr eventuell fortnehmen könnte.«
»Aber damit muß sich doch jede Mutter abfinden, daß ihr Kind erwachsen wird und eines Tages aus dem Hause geht«, wandte Konstantin ein. »Sie wird dich ja auch nicht verlieren. Ihr könnt euch jederzeit besuchen.«
»Das ist nicht dasselbe, Konny.« Ihre Stimme warb um Nachsicht und Verständnis. »Ihre Tage werden dann leerer sein als jetzt, wo sie für mich sorgen und mich verwöhnen kann, wenn ich dienstfrei habe. Sie hat doch nur mich, seit mein Vater vor fünf Jahren starb. Nun mach nicht solch ein bedrücktes Gesicht, Liebster. Mutter wird sich schon mit den Tatsachen abfinden. Wenn sie sieht, wie glücklich ich mit dir bin, wird sie dich rasch auch liebgewinnen.«
Das Gesicht des jungen Anwalts hellte sich auf. Sein Optimismus gewann die Oberhand. »Das denke ich auch«, stimmte er ihr zu. »Und wenn sie jetzt nur dich hat, so wird sie bald eine ganze Familie haben. Enkelkinder, eins nach dem anderen.« Mit der Hand deutete er an, wie er sich den Nachwuchs der Größe nach vorstellte.
»Du hast dir ja viel vorgenommen!« lachte Pamina.
Es war ein herrlicher Tag, den kein Schatten trüben konnte.
*
Pamina und Konstantin heirateten ein halbes Jahr später. Sie waren so glücklich, wie zwei Menschen nur sein können. Und sie freuten sich wie närrisch auf ihr Baby, das sich schon angemeldet hatte. Es war ein Wunschkind.
Pamina erlebte die Stunde der Geburt nicht bei Bewußtsein. Als sie aus der Narkose erwachte, war es sehr still um sie. Die Vorhänge vor dem Fenster der Entbindungsstation waren zugezogen. Nur eine kleine Lampe brannte neben ihrem Bett. Sie horchte und wartete, immer noch wie in einer sanften Betäubung, müde und losgelöst von aller Erdenschwere.
Endlich wurde die Tür geöffnet. Eine Schwester kam herein, Pamina wollte sich aufrichten, doch sie wurde sogleich sanft in die Kissen zurückgedrückt. Fragend hing ihr Blick an den Lippen der Schwester.
»Mein Baby?« flüsterte sie schließlich, als diese ihr nur zulächelte und sich an dem Bett zu schaffen machte.
»Es ist ein Mädchen«, antwortete die Schwester.
Ein Mädchen. Sie hatte immer von einem Jungen geträumt. Aber es war genauso wunderbar, ein Mädchen zu haben, eine kleine Tochter. Die Schwester nahm ein Glas vom Nachttisch. »Ich bringe Ihnen jetzt ein Täßchen Suppe«, sagte sie beim Hinausgehen.
»Wann darf ich mein Baby sehen?« fragte Pamina rasch.
»Das bestimmt Professor Abendrot. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen.« Eilig verließ die Schwester das Zimmer.
Wie wollen wir sie nennen? überlegte Pamina. Kirsten? Solveig? Konstantin gefielen nordische Mädchennamen. Seine Mutter hieß Greta und seine Großmutter Kristina. Unwillkürlich blickte sie zur Tür, als müsse diese sich jeden Augenblick auftun und ihn hereinlassen.
»Sie haben doch meinen Mann benachrichtigt?« fragte Pamina den Professor, als dieser kurz darauf erschien.
»Aber selbstverständlich«, antwortete der Arzt und faßte nach ihrem Puls. »Nun, wie fühlen Sie sich, Frau Berghoff?«
»Ich möchte mein Baby sehen! Bitte, lassen Sie es mir bringen, Herr Professor!« Ihre Hand umklammerte die seine.
»Ganz ruhig bleiben«, sagte dieser. »Zuerst müssen Sie sich gründlich ausschlafen, und Ihr Baby ebenfalls. Es hat es nämlich nicht leicht gehabt, auf die Welt zu kommen.«
»Es ist doch gesund? Es fehlt ihm doch nichts?« fragte Pamina mit angehaltenem Atem.
»Es ist gesund. Morgen früh werden Sie sich davon überzeugen können. So, und nun machen Sie mal den Arm frei, damit ich Ihnen noch eine kleine Spritze geben kann.«
Erst morgen, dachte Pamina enttäuscht, als sie mit einer matten Bewegung das Nachthemd von ihrem Arm zurückschob. Dann überkam sie wieder diese große Müdigkeit. Sie ließ alles mit sich geschehen, weil sie das Gefühl hatte, es geschähe zu ihrem Besten.
Auf dem Gang begegnete Professor Abendrot der Oberschwester. Sie wies mit dem Kopf auf die Tür von Nr. 7 und erkundigte sich beiläufig: »Weiß der Mann von Frau Berghoff schon Bescheid?«
Das Gesicht des Arztes verdüsterte sich. »Er kam sofort, nachdem wir ihn telefonisch benachrichtigt hatten. Es war ein schwerer Schlag für ihn. Er taumelte davon wie ein Betrunkener.«
Die Oberschwester blickte besorgt. »Wir haben schon mehrfach Mischlingsgeburten bei uns gehabt«, bemerkte sie. »Doch stets waren die Elternteile von verschiedener Hautfarbe. Weißhäutige Eltern mit einem Mischlingskind erleben wir hier das erste Mal.«
*
Dr. Friedrich Berghoff, hochangesehener Jurist, der in dem Ruf stand, kaum einen Prozeß zu verlieren, war nicht leicht aus der Fassung zu bringen. Aber jetzt war sein Gesicht doch aschfahl geworden. Er starrte seinen Sohn an, als zweifelte er an dessen Verstand.
»Ein Mischlingskind?« stieß er hervor. »Bist du verrückt geworden?«
»Fast glaube ich das selbst.« Konstantins Hände umklammerten eine Stuhllehne, so daß die Knöchel weiß hervortraten. »Wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, dann…« Seine Stimme erstarb. In dem Blick, mit dem er seinen Vater ansah, lagen Grauen und Entsetzen.
»Aber was hat denn der Arzt gesagt? Vielleicht ist das Kind krank und hat deshalb die braune Hautfarbe. Es gibt doch solche Krankheiten…«
»Es ist nicht krank!« unterbrach Konstantin seinen Vater. »Es ist völlig gesund. Ein gesundes Mischlingskind, verstehst du?« Er schrie die letzten Worte heraus.
Mit verstörter Miene sah Ferdinand Berghoff auf die aufgeschlagenen Akten auf seinem Schreibtisch. Er zog die Schublade auf und nahm sich eine Zigarette, obwohl er nur selten rauchte. Als er sie anzündete, bemerkte er, daß seine Hände zitterten. Nie zuvor in seinem Leben hatten seine Hände gezittert. Eine Dunkelhäutige in seiner Familie! Fassungslos schüttelte er den Kopf. Da hatte man sich so auf das erste Enkelkind gefreut, und nun dies!
»Wie ist das nur möglich?« stöhnte er, um fortzufahren: »Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Pamina hat dich mit einem Schwarzen betrogen, und zwar ungefähr um die Zeit eurer Eheschließung. Es klingt zu brutal, als daß man es glauben könnte, und doch habe ich keine andere Erklärung dafür.«
»Sie flog überwiegend die Afrika-Route. Ich habe sie ja auch in Marokko kennengelernt«, sagte Konstantin. Sein Blick traf sich mit dem seines Vaters.
»Natürlich.« Der Senior griff sich an die Stirn. »Warum haben wir nicht gleich daran gedacht?« Sein Gehirn arbeitete jetzt wieder logisch und systematisch. Seine Schwiegertochter hatte eine Affäre mit einem Schwarzen gehabt, die nicht ohne Folgen geblieben war. Jetzt galt es, möglichst schnell und ohne Aufhebens die Konsequenzen zu ziehen.
»Man muß dafür sorgen, daß nichts an die Öffentlichkeit dringt«, sagte er knapp und sachlich. »Am besten wäre es, wenn Pamina mit dem Kind die Stadt verließe. Damit würde jeder Gesellschaftsklatsch im Keime erstickt. Die gesetzliche Trennung eurer Ehe wird sehr bald erfolgen. Das kann ich dir versprechen.«
»Vater!« sagte Konstantin erstickt. Sein Gesicht war kalkweiß.
»Du darfst jetzt nicht die Nerven verlieren, mein Junge. Du wirst morgen mit deiner Frau sprechen. Pamina wird vernünftig genug sein, um einzusehen, daß es nicht anders geht.«
Mit zuckendem Gesicht wandte Konstantin sich ab. »Ich kann das nicht«, stammelte er. »Ich will sie nicht sehen. Es – es ginge über meine Kraft. Nie hätte ich gedacht, daß sie mir so etwas antun könnte. Nie!« Aus seiner Kehle drang ein unterdrücktes Schluchzen.
Mit zusammengepreßten Lippen starrte Ferdinand Berghoff auf die gebeugten Schultern seines Sohnes. Nach einer kurzen Pause fragte er: »Traust du dir zu, den Fall Brandstätter zu übernehmen? Dann müßtest du morgen früh nach München fahren, und wir müßten heute abend noch alle wichtigen Punkte für die Hauptverhandlung durchsprechen. Fühlst du dich dazu in der Lage?«
Hilflos begegnete Konstantin dem Blick seines Vaters. Etwas Zwingendes, eine gewisse Härte lag in dessen Augen, so, als wollte er sagen: reiß dich zusammen… zeig, daß du ein Mann bist!«
Wegfahren, dachte Konstantin. Alles hinter sich lassen wie einen bösen Traum. Sich ganz auf die Arbeit konzentrieren… an nichts anderes mehr denken.
»Ich fahre nach München!« verkündete er entschlossen.
*
Als Pamina erwachte, schien eine blasse Herbstsonne in das Zimmer. Die junge Mutter dehnte sich ein wenig und lächelte. Ein tiefes, reines Glücksgefühl durchströmte sie. Ich habe ein Kind, eine kleine Tochter! Wunderbare Dinge sollten heute geschehen. Sie würde ihr Töchterchen im Arm halten, Konstantin würde kommen, ein fröhlicher, strahlender Ehemann und Vater. Sicher würde auch ihre Mutter kommen und die Schwiegereltern – ach ja, es würde ein wunderschöner Tag werden.
Nachdem sie sich mit Hilfe einer Schwesternschülerin gewaschen und frisiert sowie ein leichtes Frühstück eingenommen hatte, erschien Professor Abendrot.
»Wann bekomme ich mein Baby zu sehen, Herr Professor?« fragte Pamina sofort.
Der Arzt schob die Hände in die Taschen seines weißen Arztkittels und sah mit einem eigenartigen Ausdruck auf sie hinab. In Paminas Augen flackerte Unruhe auf. Warum schwieg er? War es nicht sonderbar, daß man ihr das Kind noch nicht gebracht hatte?
»Ist etwas nicht in Ordnung mit meinem Baby?« flüsterte sie.
»Es ist gesund«, betonte der renommierte Frauenarzt, in dessen Privatklinik Pamina ihr Kind zur Welt gebracht hatte. »Ich sagte es Ihnen schon gestern.« Er bemerkte ihr Aufatmen, griff nach ihrer Hand und fuhr fort: »Aber es ist nicht weiß, Frau Berghoff.«
»Nicht weiß? Was heißt das?« fragte Pamina verständnislos.
»Es ist braunhäutig.« Behutsam legte er ihre Hand auf die Decke zurück. Er war froh, daß es gesagt war.
Pamina starrte ihn an. Dann flog ein leichtes, verwundertes Lächeln über ihr Gesicht. »Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen, Herr Professor. Ich kann schließlich kein Negerbaby geboren haben.«
»Natürlich nicht«, murmelte er. »Es ist ein Mischblut.«
Draußen auf dem Gang hörte man die Stimmen der Stationsschwestern. Professor Abendrot ging zur Tür und öffnete sie. »Bitte bringen Sie das Kind Berghoff!« befahl er und wandte sich wieder ins Zimmer.
Paminas Finger nestelten nervös an der Schleife ihres Bettjäckchens. »Sie haben einen Scherz gemacht, nicht wahr?« Ihrer Stimme war anzuhören, daß sie für diese Art von Scherzen nicht viel übrig hatte.
»Leider nein«, gab der Professor kurz zurück. Er ging der Schwester entgegen, die mit einem kleinen Bündel auf dem Arm ins Zimmer trat.
»Es ist gut«, nickte er und nahm es ihr ab. »Warten Sie draußen, bis ich Sie rufe!« Die Schwester verschwand, und er legte der jungen Mutter das Kind in die Arme.
»Das ist nicht mein Kind!« erklärte Pamina spontan mit aller Bestimmtheit. Ihre Stimme klang hoch und schrill vor Erregung. »Da liegt eine Verwechslung vor!«
»Es ist Ihr Kind«, versicherte Abendrot sehr ernst und nachdrücklich. »Ich habe es mit meinen eigenen Händen geholt. Es war eine komplizierte Steißgeburt. Die Hebamme und mein Assistent Dr. Wiechert können es bezeugen.«
Langsam wich alles Blut aus Paminas Gesicht. Sogar ihre Lippen wurden weiß. Unmöglich konnte sie länger an den Worten des angesehenen Gynäkologen zweifeln. Sie begann zu zittern. Eine Minute, die sich endlos dehnte, war alles Nebel, Schwindel, Wahnsinn. Dann schwand der Nebel, und es wurde wieder klar vor ihren Augen. Sie sah das kleine, runzlige braune Gesicht, das winzige Näschen, den schwarzen Flaum auf dem Köpfchen…
»Nein! Nein!« Hatte sie geflüstert oder geschrien? Alles in ihr versteifte sich vor Abwehr, vor diesem winzigen fremdrassigen Geschöpf, das sie zur Welt gebracht haben sollte. Sie bäumte sich auf. »Nehmen Sie es fort!« keuchte sie. »Wenn mein Mann dieses Kind sieht…«
»Er hat es gesehen. Gestern nachmittag. Sie lagen noch in der Narkose.«
Sie warf einen Blick auf sein Gesicht und brauchte nicht weiter zu fragen. Daß Konstantin nicht wiedergekommen war, sagte ihr genug. Professor Abendrot ging zur Tür und rief die Schwester herein.
Letztere nahm ihr das Baby ab und brachte es auf die Säuglingsstation.
»Wie ist es möglich, Herr Professor«, fragte Pamina, »daß weiße Eltern so ein Kind bekommen? Ist das ein grausames Spiel der Natur?«
Der Professor zog einen Stuhl heran und setzte sich neben die Patientin. Er mußte versuchen, den Schock abzufangen, damit keine Komplikationen eintraten. Nach sekundenlangem Zögern fragte er vorsichtig: »Es besteht kein Zweifel, daß Ihr Gatte der Vater des Kindes ist?«
Paminas Gesichtsausdruck wechselte jäh. »Ich habe nie mit einem anderen Mann geschlafen, falls Sie das meinen!«
»Entschuldigen Sie, ich wollte Sie keinesfalls beleidigen, Frau Berghoff. Immerhin liegt die Vermutung nahe, rein sachlich betrachtet.«
»Ich schwöre bei Gott, daß mein Mann der Vater meines Kindes ist!« versicherte Pamina emphatisch.
»Ich glaube Ihnen«, erwiderte der Arzt und betrachtete nachdenklich seine Hände. »Doch wenn Sie denken, es könnte sich um ein Spiel der Natur handeln, so muß ich Sie berichtigen. So etwas gibt es nicht. Es muß in Ihrer oder in der Familie Ihres Mannes ein kleiner, dunkler Streifen sein, wie wir das nennen. Irgendein Vorfahre…«
»Aber das ist völlig absurd!« rief Pamina erregt. »Das wüßten wir doch!«
Professor Abendrot wiegte leicht den Kopf. Bevor er etwas erwidern konnte, klopfte es an der Tür. Eine Schwester erinnerte ihn: »Der Termin um halb zwölf, Herr Professor. Im OP I ist alles vorbereitet.«
»Oh, ja!« Der Arzt sprang auf. »Frau Berghoff, nehmen Sie es nicht allzu tragisch, bitte. Hauptsache, Ihr Kind ist gesund. Es liegt jetzt bei Ihnen, wie sich sein weiteres Leben entwickelt!« Er nickte ihr zu, drückte ihr leicht die Hand und eilte hinaus.
*
Es war Besuchszeit, doch niemand kam. Weder ihr Mann noch ihre Mutter – niemand. Pamina fühlte sich wie in einem Vakuum, in dem sie grübelnd lag. In stumpfer Ergebenheit, dann wild aufbegehrend, von Weinkrämpfen geschüttelt. Sie bekam Fieber. Das Zimmer begann um sie zu kreisen. Man gab ihr eine Spritze. Sie merkte es kaum. Schließlich versank sie in einem Dämmerzustand, der alle Gedanken auslöschte.
Ein neuer Tag brach an. Am Nachmittag bekam sie den ersten Besuch: ihre Schwiegermutter. Sie brachte Blumen und Obst, redete mit gezwungener Munterkeit und wich ihrem Blick beharrlich aus.
»Warum kommt Konstantin nicht zu mir?« fragte sie schließlich. Hinter ihren Augen brannten Tränen. »Macht er mich dafür verantwortlich, daß unser Kind nicht weiß ist?«
Frau Berghoffs Lippen schlossen sich herb. »Mein Sohn ist in München. Er hat von seinem Vater einen interessanten Fall übertragen bekommen.«
»Ach so.« Pamina starrte zur Decke. Dann fragte sie mit geborstener Stimme: »Und wo bleibt meine Mutter? Läßt sie mich ebenfalls im Stich?«
»Sie ist krank.« Greta Berghoff räusperte sich. »Deine Mutter hat einen Nervenzusammenbruch erlitten. Eine Nachbarin kümmert sich um sie.«
Ihre Mutter krank? Sie war schon seit längerem nervlich nicht in Ordnung. Ich muß so schnell wie möglich aufstehen, dachte Pamina, damit ich mich um Mutter kümmern kann.
»Ja, also – dann gehe ich jetzt, Pamina«, sagte Greta Berghoff. »Ich habe noch einiges zu besorgen. Brauchst du irgend etwas?«
Pamina schüttelte gleichgültig den Kopf. Sie sah zu, wie die Schwiegermutter ihre Sachen zusammenraffte. Die Verabschiedung war kurz und kühl. Kein Wort davon, ob sie das Kind gesehen hatte oder sehen wollte. Natürlich wollte sie es nicht sehen. Wenn die eigene Mutter es nicht einmal sehen wollte…
Armes, kleines Ding. Zum erstenmal dachte Pamina es, als sie wieder allein in ihrem stillen Einzelzimmer lag. Niemand wollte das winzige Wesen haben. Und es konnte doch nichts dafür, daß es aus einem rätselhaften Grund eine braune Haut hatte.
Ihre Gedanken drehten sich wie ein Kreisel im Kopf. Dieser Besuch ihrer Schwiegermutter war ein reiner Höflichkeitsbesuch gewesen. Und Konstantin war vor ihr geflüchtet. Das fraß und brannte wie eine ätzende Wunde.
Tausend Worte der Liebe, tausend Umarmungen und Zärtlichkeiten… doch wenn die erste Prüfung kam, lief man einfach davon. Ließ den anderen allein. Oh, wie das schmerzte. Es war kaum auszuhalten. Vor lauter Verzweiflung schluchzte sie auf.
*
Acht Tage später packte Pamina den kleinen Koffer, den sie in die Klinik mitgenommen hatte. Konstantin hatte ihr noch beim Packen geholfen. Wie glücklich waren sie damals gewesen. Damals? Kaum zwei Wochen war das her! Und in dieser kurzen Zeit war ihre glückliche, heile Welt in Trümmer gegangen.
Würde sie Konstantin je verzeihen können, daß er sich nicht um sie gekümmert hatte, seit dieses Kind zur Welt gekommen war? Es war so unverständlich, so unfaßbar kalt und grausam. Wie konnte sie da noch an seine Liebe glauben?
Nun würde sie mit dem Kind nach Hause fahren. Und dann? Sie hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte.
Mit einer müden Bewegung klappte sie ihr Köfferchen zu und wandte den Kopf, als die Tür aufging. Da stand schmächtig und leicht gebeugt ihre Mutter. Ein dünnes Lächeln um den Mund, das Pamina ins Herz schnitt.
»Mutter!« sagte Pamina und ging auf sie zu. Mein Gott, wie alt sie geworden war! Und wie eingefallen ihre Züge…
»Grüß dich, Mutter!« sagte sie herzlich und küßte die ältere auf beide Wangen. »Seit wann bist du wieder gesund? Was hat dir eigentlich gefehlt?«
»Kreislaufstörungen hab ich gehabt. Aber inzwischen geht’s schon wieder. Ich hatte angerufen, um zu hören, wann du entlassen wirst, und da habe ich mich aufgerafft.«
Um Paminas Mund zuckte es. »Schön, daß du gekommen bist, Mama!« Ihre Augen füllen sich mit Tränen, und dann warf sie sich in die Arme ihrer Mutter.
»Paminakind«, murmelte Frau Petersen und strich mit bebenden Fingern über die Schultern der jungen Mutter. »Meine arme Kleine!«
»Ich hab dich so vermißt«, flüsterte Pamina. »Niemand ist gekommen, auch Konny nicht. Er ist böse auf mich, weil das Baby…«
»Ja, ja, ich weiß«, stammelte Frau Petersen.
Pamina hob den Kopf. »Du zitterst ja, Mama. Komm, setz dich hierher.« Sie führte sie zum Stuhl.
»Ich habe das Taxi unten warten lassen, Pamina. Wie ich sehe, bist du ja schon fertig. Du kommst erst einmal mit zu mir.«
Paminas Blick irrte ab. »Ich weiß nicht. Es könnte doch sein, daß Konstantin zu Hause auf mich wartet.« Aber sie glaubte selbst nicht an ihre Worte.
»Er ist noch immer in München. Ich habe mit seinem Vater telefoniert.«
»Und wie verhielt er sich am Telefon?«
Frau Petersen sah ihre Tochter mitleidig an. »Höflich und distanziert.«
»Sie richten eine Mauer gegen mich auf, Mutter! Plötzlich scheint die Familie Berghoff nichts mehr mit uns zu tun haben zu wollen«, brach es erbittert aus Pamina heraus. »Warum nur, frage ich dich? Warum? Ist es nicht ebenso Konstantins Kind wie meins? Kann ich etwas dafür, daß es nicht weiß ist?«
Frau Petersen starrte zum Fenster hinaus und schwieg. Nach einer Weile, während Pamina sich ausgehfertig machte, fragte sie leise: »Wie heißt mein Enkelchen denn?«
Pamina dachte an die nordischen Namen, die ihr als erste eingefallen waren, als sie hörte, daß sie ein Töchterchen geboren hatte. Aber jetzt? Wie sollte man ein braunes Baby nennen? »Ich… habe mich noch nicht entschieden«, antwortete sie und spürte einen Knoten im Hals. »Ich gehe sie jetzt holen.«
Das Baby hatte die Augen geöffnet, als ihre Großmutter sich über sie beugte und sacht eines der winzigen Fäustchen in ihre Hände nahm. »Was für wunderschöne Augen sie hat!« flüsterte sie ergriffen.
Mit einem gequälten Ausdruck blickte Pamina auf ihr Kind, das weich und warm in ihren Armen lag. »Gehen wir!« sagte sie herb. »Fahren wir nach Hamburg. Es wird für alle Beteiligten das Beste sein.«
Ihr Gesicht war sehr blaß und verschlossen, als sie neben ihrer Mutter die Klinik verließ und in das wartende Taxi stieg. Diese Heimfahrt hatte sie sich anders vorgestellt.
Es war behaglich warm in dem kleinen Reetdachhaus am Elbhang. Ihr Vater hatte es kurz vor seinem Tod erworben. Es sollte sein Altersruhesitz sein. Zuletzt wohnte seine Witwe hier ganz allein. Aber jetzt kam neues Leben ins Haus.
Alles war vorbereitet für sie und das Kind. Pamina vermerkte es mit leiser Rührung. Im Erker des Wohnzimmers stand ein mit rosa Spitze ausgeschlagener Stubenwagen für das Baby bereit. Der Kaffeetisch war sorgfältig gedeckt. Es duftete verlockend nach frischem Kuchen.
»Du bist so gut, Mama«, äußerte Pamina gerührt und gab ihrer Mutter einen Kuß auf die Wange. »Ich wüßte gar nicht, was ich heute ohne dich anfangen sollte.«
Mit leidvollen Augen sah die ältere Frau sie an. »Ich hoffe nur, du wirst dich niemals von mir abwenden, Pamina«, sagte sie gepreßt.
»Wie kannst du nur so etwas sagen?« gab diese zurück. »Du bist doch meine Mutter.«
»Ich bin es nicht, Pamina.«
Lähmende Stille herrschte nach diesen Worten. Pamina starrte entsetzt in das vertraute Gesicht, das so alt geworden war.
»Sag das noch einmal«, flüsterte sie.
»Ich bin nicht deine Mutter, Liebes. Ich hätte es dir längst sagen müssen. Aber ich war zu feige. Ich hatte einfach Angst, dich zu verlieren.« Ihr Atem ging schwer.
In Paminas Kopf wirbelten die Gedanken durcheinander. Nicht ihre Mutter? Aber sie war doch immer ihre Mutter gewesen, solange sie zurückdenken konnte. Erinnerungsfetzen aus der Kinderzeit tauchten auf. Als sie eine schwere Lungenentzündung hatte, saß sie nächtelang an ihrem Bett. Immer war sie für sie da. Hatte sie irgendeinen Kummer, wurde sie von ihr getröstet. Sie hatte eine wundervolle Kindheit, und das verdankte sie vor allem ihr.
»Du hättest keine Angst zu haben brauchen«, sagte sie weich. »Ich muß dir deine Liebe nur um so höher anrechnen. Aber wer war denn nun meine leibliche Mutter?«
»Sie war die Frau, die dein Vater über alles geliebt hat!« antwortete Evamaria Petersen.
»Oh, sag nicht, Vater hätte dich nicht geliebt!« rief Pamina impulsiv. »Ihr habt doch eine ideale Ehe geführt.«
»Es war eine andere Art von Liebe, die dein Vater für mich empfand. Sie basierte auf Kameradschaft und Vertrauen. Wir kannten uns so lange, wir waren ja Nachbarskinder. Ich habe mir nie etwas anderes gewünscht, als seine Frau zu werden, und er hatte mich auch sehr gern. Vielleicht hätten wir schon früher zusammengefunden, wenn er Isabella Cameron nicht kennengelernt hätte.
»Isabella Cameron? Die weltberühmte Primadonna, die zu den größten Opernsängerinnen ihrer Zeit zählte? Bin ich etwa das Kind von Isabella Cameron?«
»Ja, du bist ihre Tochter. Eine ihrer glanzvollsten Opernpartien war die Königin der Nacht in Mozarts ›Zauberflöte‹, deren Tochter Pamina heißt. Deshalb wünschte sich dein Vater, daß du auf diesen etwas ungewöhnlichen Namen getauft wirst. Und so geschah es dann auch.«
»Aber warum haben die beiden nicht geheiratet?«
»Isabella weigerte sich.«
»Warum denn?«
»Isabella weigerte sich aus rassischen Gründen. Es hätte nämlich sein können, daß ihr Kind als Mischling zur Welt käme. Sie war eine Viertelnegerin. Ihr Großvater, der Großgrundbesitzer auf Jamaika war, hatte eine Schwarze geheiratet. Dein eigener Vater war zu jener Zeit deutscher Konsul in der Türkei. Ein dunkles Kind hätte seiner Karriere als Diplomat eventuell schaden können. Aus diesem Grunde verzichtete sie auf eine Heirat mit ihm.«
»Jedoch ich kam mit weißer Haut und blondem Haar auf die Welt. Warum haben sie ihre Verbindung nicht nachträglich legalisiert?«
»Isabella starb wenige Tage nach deiner Geburt am Kindbettfieber. Dein Vater ließ sie in aller Eile bestatten, denn zur gleichen Zeit brachen in der Türkei Unruhen aus. Auf unser Konsulat wurde ein Anschlag verübt. Ich war als Sekretärin deines Vaters für Paßangelegenheiten zuständig. Vom Außenministerium erhielten wir den Auftrag, sofort das Land zu verlassen. Wir konnten nur das Nötigste mitnehmen.«
»Und dann? Was geschah mit mir?«
»Wir nahmen dich mit. Ein deutscher Standesbeamter hat uns getraut, und wir gaben dich als unsere vorehelich geborene Tochter aus. Deine Geburtsurkunde war im allgemeinen Aufruhr jener Tage verlorengegangen. Auf Grund unserer Angaben wurde ein neues Dokument ausgestellt, in dem ich als deine leibliche Mutter eingetragen bin. Es ist das einzige Mal, daß wir das Gesetz verletzt haben. Auch deshalb habe ich bis heute geschwiegen. Ich wollte vermeiden, daß ein Schatten des Makels auf deinen toten Vater fällt.« Evamaria Petersen schwieg erschöpft. Sie war am Ende ihrer Kraft angelangt, doch Pamina sah über sie hinweg, als wäre sie nicht vorhanden.
Sie stand auf und ging mit steifen Schritten zu dem Erker, wo die Wiege stand, und sah hinab auf das Kind, das braun in den weißen Kissen lag. Jetzt wußte sie auch, warum. Sie ging in die Mitte des Raums zurück, wo ihre Mutter reglos am Kaffeetisch sitzengeblieben war.
»Wie konntest du mir das verschweigen?« fragte sie mit einer Stimme, die heiser vor innerer Erregung war. »Wie konntest du mich heiraten lassen, ohne mich vorher über meine Abstammung aufzuklären?« In ihren Augen stand eine harte Anklage.
»Pamina, bitte hör mich an, bevor du mich verurteilst!« flehte Evamaria Petersen. »Ich hatte mit mehreren Ärzten gesprochen, als dein Vater noch lebte. Wir haben Gutachten von Wissenschaftlern eingeholt, die sich mit Fragen der Erbbiologie befassen. Natürlich haben wir uns Gedanken um deine Zukunft gemacht. Aber immer wieder hieß es, die Wahrscheinlichkeit, daß du ein dunkelhäutiges Kind zur Welt bringen würdest, sei sehr gering. Trotzdem habe ich um dich gezittert und gebangt. Ich dachte, du würdest vielleicht ledig bleiben und in dem Beruf, den du dir ausgesucht hast, Befriedigung finden und…«
»Ach, hör doch auf!« schrie Pamina außer sich. »Du hast mich blind in eine Situation rennen lassen, vor der du mich unter allen Umständen hättest bewahren müssen. Mich und Konstantin.«
»Glaubst du, ich wollte das nicht?« Frau Petersen verkrampfte die Hände im Schoß. »Wie oft bin ich nach einer schlaflosen Nacht morgens aufgestanden und habe mir geschworen: heute sage ich es. Aber, mein Gott, ihr ward so glücklich, so fröhlich und unbekümmert – ich brachte es nicht übers Herz. Ja, ich war schwach, und aus dieser Schwäche wuchs meine Schuld.« Sie hob die Hände und ließ sie wieder sinken, mit einer unsäglich müden, resignierten Bewegung. »Es hätte ja gutgehen können. Wie sehr habe ich darum gebetet.«
Mit finsterem Gesicht drehte Pamina sich um und ging zum Fenster, starrte hinunter auf die Straße, ohne wirklich etwas zu sehen. Seltsam zu denken, daß sie fremdes Blut in den Adern hatte. Und doch war ihre Haut weiß, ihre Haare hellblond.
Eine lastende Stille hatte sich über den Raum gesenkt. Völlig in sich zusammengesunken saß die ältere Frau am Tisch, während die jüngere mit einem schweren Entschluß zu ringen schien. Endlich sagte Pamina mit spröder Stimme:
»Ich möchte jetzt heimfahren. Ist es dir recht, wenn ich ein Taxi rufe?«
Frau Petersen nickte stumm. Mit schmerzlichem Blick beobachtete sie die junge Mutter, die ihr Baby aus der Wiege hob, nachdem sie telefonisch ein Taxi bestellt hatte. Wie fern sie auf einmal war, wie fremd. Mit bangem Herzen wartete Evamaria Petersen auf ein gutes Wort.
Als Pamina mit dem Baby auf dem Arm das Zimmer verlassen wollte, trafen sich ihre Blicke. Doch Paminas Gesicht blieb undurchdringlich. Es schien keine Brücke mehr zwischen ihnen zu geben.
»Gib mir das Kleine«, bat die Ältere. »Ich halte es, bis du dir deinen Mantel angezogen hast.«
Es schellte an der Haustür.
»Das ist der Taxichauffeur«, sagte Pamina. Im linken Arm ihr Kind, in der rechten Hand ihr Köfferchen tragend, ging sie die Treppe hinunter. Frau Petersen folgte ihr auf dem Fuße.
»Willst du so gehen?« fragte sie leise und traurig. »Ich bitte dich, Pamina, verurteile mich nicht so hart.«
»Ich muß das erst verkraften«, gab diese herb zurück. »Du hast unverantwortlich gehandelt.« So verließ sie ihr altes Heim, in dem sie so viele harmonische Stunden mit den geliebten Eltern verlebt hatte. Ihre Füße waren schwer wie Blei.
*
Es herrschte graues Nebelwetter, als Konstantin München verließ. Die Autobahn in Richtung Norden war naß und stellenweise glatt. Graupelschauer versperrten die Sicht. Er mußte die Nebelscheinwerfer anstellen, um dichte graue Schwaden zu durchdringen. Zur Sicherheit mußte er das Tempo drosseln. Er hätte auch gar nicht schneller fahren mögen, denn je näher er seiner Heimatstadt kam, desto elender wurde ihm zumute.
Den Fall Brandstätter, der zunächst ziemlich hoffnungslos aussah, hatte er erfolgreich abgeschlossen. Damit hatte er seine erste Bewährungsprobe als Strafverteidiger bestanden. Sein Vater durfte mit ihm zufrieden sein. Der Gerichtsfall hatte ihm seine ganze Aufmerksamkeit abverlangt. Da blieb kaum Zeit, über sein Privatproblem nachzudenken.
Jetzt aber hieß es, Pamina gegenüberzutreten, und davor grauste ihm. Pamina, die er über alles geliebt hatte und die ihn kurz vor der Hochzeit betrog. Es schüttelte ihn, wenn er daran dachte. Und sie war von ihrem letzten Afrikaflug zu ihm zurückgekehrt, als wäre nichts geschehen. Ein amouröses Abenteuer – es gab ja genug Mädchen, die lächelnd darüber hinwegsahen. Aber er hatte Pamina so hoch über die anderen gestellt.
Er bog von der Autobahn ab, sah die Stadt mit ihren Lichtern vor sich liegen. Sollte er zuerst zu seinen Eltern fahren oder die Aussprache gleich hinter sich bringen? Konstantin entschloß sich für das letztere. Um sein Herz lag es wie ein Eispanzer. Er mußte sich mit Härte wappnen, um das, was jetzt vor ihm lag, durchzustehen.
Vor dem Neubau, in dem seine Eigentumswohnung lag, stoppte er und warf einen Blick nach oben. Die Wohnzimmerfenster waren beleuchtet. Sie war also daheim. Er parkte seinen Wagen in der Tiefgarage, dann ging er auf die Haustür zu und schloß auf. Seine Kehle war trocken und eng.
Mit dem Lift fuhr er in den dritten Stock. Als er die Wohnungstür aufschloß und das Licht in der Diele anknipste, sah er sich mit einem verlorenen Blick um. Alles stand noch am selben Platz. Natürlich – was hätte auch verändert sein sollen? Pamina kam aus dem Wohnzimmer. Ihr Gesicht war weiß und angespannt. Sie lehnte sich an den Türrahmen und schlug die Arme übereinander.
»Erstaunlich!« sagte sie, und ihre Stimme klirrte vor eisigem Spott. »Wirklich erstaunlich, daß der Herr sich noch daran erinnert, daß er eine Frau und ein Kind hat!«
Konstantin starrte sie sprachlos an. Alles hatte er erwartet – Bitten, Flehen, Beteuerungen. Jedoch daß sie ihm erhobenen Hauptes entgegentrat, die gekränkte Unschuld mimte, war einfach ungeheuerlich. Zorn stieg wie eine dunkle heiße Woge in ihm hoch, erstickte ihn fast. Plötzlich haßte er sie mit einer Wut, die ihn selbst erschreckte. Er wünschte, ihr nie begegnet zu sein.
»Ein Kind?« fragte er höhnisch. »Habe ich ein Kind, dessen Vater ich bin? Tatsächlich?« Er trat so rasch auf sie zu, daß ihr Kopf unwillkürlich zurückzuckte. »Du wagst es, mir Vorwürfe zu machen? Ausgerechnet du?«
Schweigend starrten sie sich an. Konstantin konnte sehen, wie die blaue Halsschlagader unter der dünnen weißen Haut seiner Frau klopfte. Abrupt wandte er sich ab, zog seinen Mantel aus und warf ihn achtlos über einen Garderobenhaken. Pamina stieß sich vom Türrahmen ab, gegen den sie sich gelehnt hatte, weil ihre Knie zitterten, und ging ins Wohnzimmer.
Konstantin kam nach. Sein Gesicht war hart und verbissen. »Machen wir es kurz, Pamina. Du wirst verstehen, daß für mich ein weiteres Zusammenleben mit dir unmöglich ist. Wir werden uns also scheiden lassen. Als Grund geben wir Unvereinbarkeit unserer Charaktere an. Die Ehe wird in gegenseitigem Einverständnis getrennt. Das bedeutet: keiner von uns hat an den Ex-Partner irgendwelche Ansprüche zu stellen. Ich würde dir empfehlen, mit dem Kind die Stadt zu verlassen. Das wäre unter den gegebenen Umständen die beste Lösung.« Er hatte rasch, akzentuiert, nahezu unbeteiligt gesprochen. So als handelte es sich um den Fall einer x-beliebigen Mandantin, deren Interessen er wahrzunehmen hatte.
Pamina hatte das Gefühl, als zöge jemand den Boden unter ihren Füßen fort. Sie tastete nach einem Stuhl und ließ sich darauf nieder. Konstantins Gesicht, dieses liebe, geliebte und vertraute Gesicht, jetzt zynisch, kalt und böse, verschwamm vor ihren Augen.
»Hast du mich verstanden?« drang seine Stimme hart und erbarmungslos an ihr Ohr.
»Ja«, hauchte sie und saß wie gelähmt. Sie war verzweifelt gewesen, als er sie in der Klinik nicht besuchte. Bitterkeit und Empörung schossen in ihr hoch, weil er sie in den schwersten Stunden ihres Lebens allein gelassen hatte. Doch daß er jetzt erbarmungslos die Konsequenzen ziehen wollte, weil sein Kind eine andere Hautfarbe als die seinige besaß, war für sie der schwerste Schock.
»Ich habe es doch nicht gewußt«, murmelte sie trostlos vor sich hin. »Ich schwöre dir, ich hatte keine Ahnung, daß…«
»Das glaube ich dir gern.« Mit einem zynischen Lächeln blickte er auf sie herab. »Es muß eine unangenehme Überraschung für dich gewesen sein. Aber wer der Vater ist, weißt du doch sicher?« Ich bin gemein, brutal, schoß es ihm durch den Kopf. Aber schließlich hat sie mir das Schlimmste angetan, was einem Mann passieren kann.
»Konstantin!« schrie Pamina auf. »Du glaubst doch nicht…«
»Was soll ich nicht glauben?« unterbrach er sie kalt. »Daß du mich betrogen hast? Der Beweis dafür dürfte im Kinderzimmer in der Wiege liegen. Oder hast du den Bastard zu deiner Mutter gebracht?«
Pamina sprang hoch und stürzte auf ihn zu. »Sprich nicht weiter!« keuchte sie. »Du kannst doch nicht im Ernst glauben, ich hätte dich betrogen. Es ist heller Wahnsinn, so etwas auch nur zu denken. Ich habe immer nur dich geliebt, Konny. Es gab keinen anderen Mann in meinem Leben. Das schwöre ich bei allem, was mir heilig ist.« Ihre Stimme erstarb in einem leisen Wimmern.
Er sah, wie sie zitterte. Das konnte keine Komödie sein. Für einen Augenblick war ihm, als renne in seinem Kopf etwas davon, daß er unter allen Umständen einholen mußte, wenn er nicht verrückt werden wollte.
»Willst du damit sagen, es ist mein Kind?« würgte er schließlich stockend hervor.
Paminas Gesicht war jetzt hektisch gerötet. »Es ist dein Kind!« beteuerte sie. »Ich…« Sie schluckte, »ich bin nicht reinrassig, Konstantin. Meine Mutter war eine Viertelnegerin.«
In seinen Augen lag Nichtbegreifen. »Deine Mutter?«
»Ja. Sie war die weltberühmte Opernsängerin Isabella Cameron. Mein Vater hatte eine kurze, leidenschaftliche Romanze mit ihr. Mutter hat mir heute alles gestanden.«
Konstantin war wie betäubt. »Heute?« fragte er tonlos. »Heute hat sie es dir erzählt? Sie hätte es dir schon viel früher sagen müssen.«
»Natürlich. Das werde ich ihr auch nie verzeihen. Nie!« Pamina preßte die Hände zusammen und wandte sich ab.
Es entstand ein langes Schweigen. Konstantin hatte sich in einen Sessel sinken lassen und starrte vor sich hin. Danach war es also doch sein Kind, und er hatte seiner Frau Unrecht getan. Der Schock war für sie genau so groß gewesen wie für ihn. Und er hatte sie schmählich im Stich gelassen.
Scham und Reue stiegen in ihm auf. Er dachte jetzt nicht an das Kind. Er dachte nur an sich und Pamina. »Verzeih mir«, flüsterte er. »Bitte, verzeih mir, mein Herz.«
»Wie konntest du nur so schrecklich an mir zweifeln, Liebster? Unwillkürlich war ihr das Kosewort entschlüpft. Als sie es ausgesprochen hatte, kam es ihr vor, als würde eine Brücke über den Abgrund gespannt, der sich zwischen ihnen aufgetan hatte.
»Ich habe doch nicht im Traum an eine andere Möglichkeit gedacht«, versetzte er kleinlaut, zog sie sanft zu sich heran und betrachtete ihr Gesicht. »Unfaßbar«, murmelte er und strich mit den Fingerspitzen über ihre zarte weiße Haut.
»Ich kann doch nichts dafür, Konny. Deshalb bin ich kein anderer Mensch als vorher.«
»Nein, du bist meine Pamina.« Seine Arme schlossen sich fest um sie. Ihre Lippen fanden sich zu einem heißen Kuß. Ihre Hände umklammerten seinen Nacken.
»Du wirst mich nicht verlassen?« stammelte sie.
»Wir bleiben zusammen, meine Geliebte«, versicherte Konstantin mit fester Stimme und umarmte sie erneut.
»Und unser Kind?« Sie beugte sich ein wenig zurück, um ihm in die Augen zu sehen. »Schau, es ist doch völlig unschuldig, daß es nicht weiß ist. Die Ärzte hatten meiner Mutter versichert, die Möglichkeit, daß es so kommen könnte, sei äußerst gering. Und nun ist dieser Fall doch eingetreten. Aber wir werden es trotzdem liebhaben, nicht wahr, Schatz?«
Jetzt, da Konstantins Arme sie umfangen hielten und sie seine vertraute Nähe spürte, schien es ihr ganz einfach, was sie eben noch für unmöglich gehalten hatte.
Seine Arme lockerten sich, sanken hinab. Sein Blick ging an ihr vorbei. Er schwieg.
»Was hältst du davon, wenn wir sie Isabella nennen? Es ist der Vorname meiner berühmten Mutter, die kurz nach meiner Geburt gestorben ist.« Sein Schweigen ignorierend, erzählte sie ihm die Geschichte ihrer Herkunft, wie sie sie heute aus dem Munde ihrer Ersatzmutter erfahren hatte. Und als er immer noch schwieg, fragte sie leise: »Findest du nicht, daß es ein schöner Name für ein Mädchen ist?«
»Doch, doch«, murmelte er schwach und schien mit seinen Gedanken woanders zu sein.
Da schlug Pamina vor: »Komm, sieh sie dir an. Aber sei leise, damit sie nicht aufwacht!«
Widerstrebend folgte Konstantin seiner Frau ins Kinderzimmer. Das Baby schlief fest in seinem Bettchen. Die kleinen braunen Fäustchen lagen rechts und links neben dem Köpfchen. Die langen schwarzen Wimpern bildeten zarte Halbmonde auf den Wangen.
»Sie gedeiht gut«, flüsterte Pamina. »Jeden Tag nimmt sie ein paar Gramm zu.«
Konstantin rührte sich nicht. Reglos starrte er auf das winzige Wesen und dachte: ich kann es nicht – Gott verzeihe mir, aber ich kann dieses Kind nicht lieben, und wenn es tausendmal mein Kind ist. Es ist mir fremd und wird es ewig bleiben.
Eine tiefe Traurigkeit überkam ihn. Er ging leise hinaus. Pamina spürte, was in ihm vorging. Ihr Gesicht verzerrte sich. Eine lähmende Angst ergriff von ihr Besitz. Sie ahnte, daß etwas Bedrohliches auf sie zukam. Etwas, wogegen sie machtlos war.
Ins Wohnzimmer zurückgekehrt, sah sie ihn am Tisch sitzen. Den Kopf auf die Arme gestützt, blickte er grübelnd ins Leere. Unsicheren Fußes trat sie näher.
»Und wenn wir es zu Pflegeeltern geben würden?« hörte sie ihn sagen.
Wie zur Salzsäule erstarrt, blieb sie stehen. »Du willst unser Kind in fremde Hände geben?« flüsterte sie nach Sekunden atemlosen Schweigens.
Konstantin hob die Augenlider und sah sie mit einem gequälten Blick an. Dann stand er auf und begann wie ein gefangener Löwe durchs Zimmer zu laufen.
»Weißt du eine bessere Möglichkeit? Stell dir doch nur vor, was es für ein Gerede geben wird. Mein Vater ist ein bekannter Mann in dieser Stadt. Unsere Familie ist hier seit Generationen ansässig. Es wird doch kein Mensch glauben, daß ich der Vater eines Mischlings bin!« Seine Stimme war laut und bitter geworden.
»Und wenn wir irgendwo hinzögen, wo uns niemand kennt?« warf Pamina schüchtern ein.
»Das kann ich meinem Vater nicht antun«, erwiderte Konstantin schroff. »Schließlich bin ich gerade erst als Sozius in seine Anwaltskanzlei eingetreten. Hab erfolgreich meinen ersten Fall abgeschlossen. Stehe am Anfang einer echten Karriere. Denkst du, das läßt man so einfach im Stich? Ich habe auch keine Lust, irgendwo als kleiner Angestellter anzufangen.«
Schuldbewußt senkte Pamina den Kopf. Mit ihren Blicken zog sie das Muster des Teppichs nach. »Ich will dich nicht verlieren!« stieß sie in jäher Angst heraus. »Diese Tage, in denen du mich allein gelassen hast, waren die schlimmsten Tage meines Lebens.«
»Denkst du etwa, ich hätte nicht gelitten? Ich war genauso unglücklich wie du.« Er blieb vor ihr stehen und berührte mit der Hand ihre Schulter. »Weil ich dich nicht verlieren will, Pamina, laß uns die Kleine fortgeben, Liebste. Wir werden schon eine gute Pflegestelle für sie finden. Es soll ihr an nichts fehlen. Und später kommt sie in das beste Schweizer Internat. Wäre das nicht eine gute Lösung?«
Pamina sah an ihm vorbei. Sie fühlte eine seltsame Leere in sich. Das Kind fortgeben? Ihr Kind in fremde Hände geben?
Konstantin umfaßte behutsam ihr Kinn und drehte ihren Kopf zu sich. Er sah sie liebevoll an. Aus seinen Zügen war jede Härte gewichen. »Meine Pamina!« sprach er mit ganz tiefer, dunkler Stimme, die wie ein Streicheln war. »Bitte, sag ja! Dann können wir wieder glücklich sein. Wir zwei allein. Und das wollen wir doch, oder?«
Wie gebannt sah sie ihn an. Oh, daß er sie wieder so anschaute wie früher, wenn er von seiner Liebe zu ihr sprach. Das Herz wurde ihr ganz weit vor Sehnsucht.