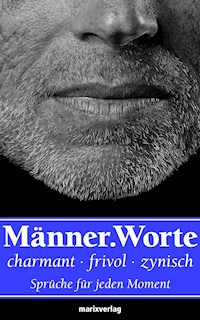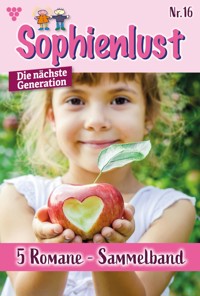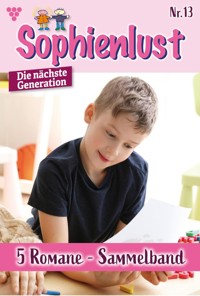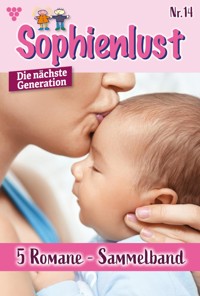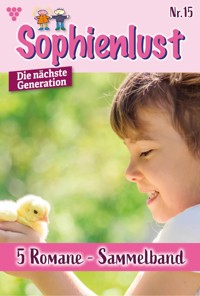25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Familie ist ein Hort der Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit. Wir alle sehnen uns nach diesem Flucht- und Orientierungspunkt, der unsere persönliche Welt zusammenhält und schön macht. Das wichtigste Bindeglied der Familie ist Mami. In diesen herzenswarmen Romanen wird davon mit meisterhafter Einfühlung erzählt. Die Romanreihe Mami setzt einen unerschütterlichen Wert der Liebe, begeistert die Menschen und lässt sie in unruhigen Zeiten Mut und Hoffnung schöpfen. Kinderglück und Elternfreuden sind durch nichts auf der Welt zu ersetzen. Genau davon kündet Mami. E-Book 1: Michelle und Daniel - doppeltes Glück E-Book 2: Kleine Jenny – großes Abenteuer E-Book 3: Warum streiten Mami und Papi? E-Book 4: Ich weiß es, du bist meine Tochter E-Book 5: Trauriges kleines Kerlchen E-Book 6: Ein Abenteuer - glücklich bestanden E-Book 7: So tapfer wie sein Vater E-Book 8: Einzelkinder - ein schweres Los? E-Book 9: Kleiner Sohn - mein ganzer Stolz E-Book 10: Zwei, die alle lieben
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1192
Ähnliche
Inhalt
Michelle und Daniel - doppeltes Glück
Kleine Jenny – großes Abenteuer
Warum streiten Mami und Papi?
Ich weiß es, du bist meine Tochter
Trauriges kleines Kerlchen
Ein Abenteuer - glücklich bestanden
So tapfer wie sein Vater
Einzelkinder - ein schweres Los?
Kleiner Sohn - mein ganzer Stolz
Zwei, die alle lieben
Mami – Staffel 30 –
E-Book 2018-2027
Diverse Autoren
Michelle und Daniel - doppeltes Glück
Zwei Schelme halten fest zusammen
Roman von Myrenburg, Myra
Es war Liebe auf den ersten Blick, und sie beruhte auf Gegenseitigkeit. Regine zweifelte keine Sekunde daran, weder an jenem verzauberten Tag, als die Buchenwälder der Ardennen im goldenen Schein der Spätsommersonne erglühten, noch später, als ein strenger Winter die Landschaft in Kälte und Dunkelheit hüllte.
Sie stand im Burghof der trutzigen Festung hoch über dem Grenzfluß Our und sah ihm entgegen, dem Ritter ohne Fehl und Tadel, der ihr bestimmt war von Gott und dem Schicksal. Er zügelte sein schimmerndes Roß, stieg aus dem Sattel und verneigte sich vor ihr. Sein Haar war voll und silberblond, seine Augen ozeanblau, seine Züge wie gemeißelt.
Sie wußte, wer er war. Clemens August, Edler von Aremberg, jüngster Sproß einer gräflichen Familie am fernen Rhein. Man hatte ihn auf Brautschau geschickt ins Luxemburgische, nach Vianden, wo im Schutze dichter Wälder, steiler Felsen und drohender Wehrtürme ein Burgfräulein namens Regine lebte und ihn erwartete... an einem Tag wie diesem, um die Mittagsstunde... in einem früheren Jahrhundert... vor langer Zeit.
Im Laufe der nächsten Minuten verwandelte sich das schimmernde Roß in ein Mountainbike, stahlgrau mit weißen Satteltaschen und einem Schlehdornzweig am Lenker. Das war eine Anpassung an die Gegenwart. Alles andere blieb, wie es war und wie es sein sollte: märchenhaft.
»Ich hab’ gehört, hier kann man übernachten«, sagte der junge Ritter und warf einen erwartungsvollen Blick auf das eindrucksvolle Gemäuer, »das ist doch die Burg Vianden, nicht wahr?«
Regine verlor sich vorübergehend in seinen ozeanblauen Augen und lächelte verträumt. »Ja, stimmt, und du bist Clemens.«
Er lächelte unsicher zurück. »Wirklich?«
»Klar! Clemens August von Aremberg. Jüngster Sohn eines Grafen am Rhein, ohne große Erbschaft, und daher vorgesehen für das Amt des Kämmerers im Dienst des Herzogs von Vianden und seiner drei Töchter – Irene, Justine und Regine.«
Er staunte sie wortlos an.
»Du hast nichts dagegen, wenn ich dich Clemens nenne?« fragte sie freundlich.
»O nein, im Gegenteil. Und du? Wer bist du?«
»Regine.«
Sie senkte graziös den Kopf, griff in die Falten ihres knöchellangen lichtblauen Kleides, dessen weite Ärmel mit bunter Borte abgesetzt waren, und deutete einen Knicks an.
Ihre Augen lachten.
Er lehnte das Rad an den Torbogen, reichte ihr die Hand und ließ sich in den Burghof führen. Sie traten an die meterbreite Mauerbrüstung. Ein überwältigender Blick tat sich auf: schroffe Felsen, ein tiefes dunkelgrünes Tal, ein glitzerndes Flüßchen, gesäumt von Spielzeughäuschen, ein Raubvogel, der in den Lüften kreiste, und über allem der Himmel – leuchtend blau, zum Greifen nah und doch hoch und unerreichbar.
In einem Blumenrondell blühten die letzten Rosen. In der Ferne läutete eine Mittagsglocke.
»Du kannst hier nicht übernachten«, sagte Regine, ohne seine Hand loszulassen.
»Nicht?«
»Nein, die Burg wird ständig restauriert, außen und innen, sie ist ein Museum.«
»Keine Jugendherberge?«
Sie schüttelte den Kopf. Ihre erdbraune Haarmähne wippte. Ihre steingrauen Augen lachten. Ihre Farben waren die des Landes.
»Aber ich dachte«, begann er sichtlich verwirrt, »jemand hätte mir gesagt...«
»Das hast du verwechselt, Clemens. Hier finden im Sommer oft internationale Jungendtreffen statt, Musikfeste, Dichterlesungen, Theaterspiele. Manchmal kommen auch Politiker, um Geheimverhandlungen abzuhalten. Aber meistens sind es nur Besucher, die sich die Burg ansehen wollen. Wenn du möchtest, führe ich dich ein bißchen herum.«
»Gern«, sagte er und folgte ihr willig durch einen Wandelgang mit bogenförmigen Öffnungen. Das Licht fiel schräg herein und malte Kringel auf die grobkörnigen Wände. In einem langen Saal kletterten sie auf die Sitzbänke in den tiefen Fensternischen. Hier mochten die Burgfräulein gesessen und hinunter geblickt haben auf die Spitzen der Tannen, den Turm des Kirchleins und vor allem auf den Saumpfad, der sich bergab schlängelte, genau da, wo heute die Straße entlang führte.
»Im Sommer ist es zauberhaft«, murmelte Clemens versonnen.
»Nicht wahr?« Regine versank in seinem Blick, riß sich zusammen und fügte mit einem kleinen Seufzer hinzu: »Im Winter hält man es nicht aus vor Kälte. Die Menschen in früheren Zeiten müssen enorm abgehärtet gewesen sein.«
Sie standen auf. Er reichte ihr galant die Hand, als sie den Fenstersitz verließen und hinabstiegen auf den Sandsteinboden des Saales.
»Hoffentlich ist mein Rad noch da«, sagte er, während sie über Treppen und gewundene Gänge zurück schlenderten und den Burghof durchquerten, vorbei an dem Rosenrondell.
»Bestimmt«, versicherte Regine, »vor dem Torbogen auf der rechten Seite steht ein Pförtnerhäuschen – du hast es wahrscheinlich nicht gesehen.«
»Nein – ehrlich gesagt – ich sah nur dich.«
»Jetzt übertreibst du aber!«
»Mit keinem Wort. Es ist die Wahrheit – Hand aufs Herz.«
Er blieb stehen, strahlte sie aus seinen ozeanblauen Augen an, löste behutsam die Verpflechtung ihrer beider Finger und kreuzte die Hände vor der Brust.
Regine schwankte ein wenig, denn ihr war ganz schwach vor Glück. Sie deutete auf sein stahlgraues Montainbike, das unversehrt am Torbogen lehnte, und erklärte ihm die Gegebenheiten: Im Pförtnerhäuschen befand sich der Eintrittskartenverkauf und ein kleiner Andenkenladen, heute besetzt von ihrer Cousine Dorette, die ein wachsames Auge auf alle abgestellten Fahrzeuge hielt.
»Komm, ich mache euch miteinander bekannt«, sagte Regine und zog ihn an das weit geöffnete Glasschiebefenster, wo eine dunkelhaarige junge Frau eine große Schachtel öffnete.
»Dorette – das ist Clemens.«
»Bonjour, Monsieur.«
»Clemens, das ist Dorette, meine Cousine.«
»Hallo!«
»Hast du neue Ware bekommen?« fragte Regine.
»Ja, sieh nur – schön, nicht wahr?«
Clemens beugte sich vor.
»Darf ich mal?«
»Natürlich. Hier –« Dorette reichte ihm eine Glaskugel, in der es heftig schneite. Als sich die Flocken gelegt hatten, erschien Vianden, die Burg mit vier Türmen, der bewaldete Hang von der Talseite her gesehen, die Kirche, die Häuser am Fluß, und darüber der Sommerhimmel wie eine blaue Kuppe.
»Toll«, murmelte Clemens und drehte die Kugel hin und her, »die kaufe ich.«
»Jetzt? Gleich?«
»Klar. Wer weiß, ob ich noch mal hierher komme.«
Die Worte, lässig gesprochen, versetzten Regine einen Stich. Aber er ging nicht tief. Der Schmerz verflog, kaum, daß sie ihn wahrgenommen hatte. Noch stand die Sonne am Himmel. Noch hielt der Zauber an. Noch war der Tag nicht zu Ende. Noch lockte das Glück, noch winkte die große Verheißung: Glaube, Hoffnung, Liebe.
Regine überließ sich den Regungen ihres Herzens, und sie sollte recht behalten. Sie waren ihrem Schicksal begegnet in dieser magischen Mittagsstunde. Sie wußten es beide. Ein unsichtbares Band verknüpfte sie miteinander, so fest, daß sie sich nicht trennen konnten, weder an diesem noch am nächsten Tag. Hand in Hand streiften sie durch die Gassen des alten Städtchens, das ihm bald so vertraut wurde wie kein anderer Ort auf der Welt. Irgendwann würde er fortgehen müssen. Wann? Noch nicht. Bald? Nur nicht dran denken.
*
Regine Marchand entstammte einer alteingesessenen Familie. Ihr Elternhaus stand in der Hauptstraße, die von der Burg zum Fluß führte, eng wie eine mittelalterliche Gasse, durchzogen von Touristenströmen, umgeben von Andenkenläden, Restaurants, Cafés, Hotels. In den vielen, dicht nebeneinander liegenden Geschäften wurde alles angeboten, was den kleinen Grenzverkehr zwischen Deutschland, Luxemburg und Belgien so attraktiv machte und dem schmalen, steilen Gäßchen mit seinem Kopfsteinpflaster ein internationales Flair gab.
In jenen schicksalhaften Tagen Ende September war Regine zweiundzwanzig Jahre alt, staatlich geprüfte Dolmetscherin für Deutsch und Französisch und selbstverständlich perfekt in der Landessprache Luxemburgisch, die als Dialekt auch auf der deutschen Seite des Grenzflüßchens Our gesprochen wurde.
Ihr Vater hatte für die Landeszeitung geschrieben und das kulturelle Erbe seines Heimatortes nach Kräften gefördert. Er hatte alte Schriften studiert, neue Chroniken angelegt, das Interesse seiner einzigen Tochter für die geschichtliche Vergangenheit geweckt und bis zu seinem Tode vor vier Jahren dem Kuratorium für die Burg Vianden angehört.
Von Regine hieß es, sie habe zuviel Phantasie und zuwenig Disziplin, um die Arbeit ihres Vaters fortzusetzen. Aber allen Unkenrufen zum Trotz war sie nach Abschluß ihrer Ausbildung zurückgekehrt, um in seine Fußstapfen zu treten.
Sie wollte es wenigstens versuchen.
Eine wichtige Rolle bei diesem Entschluß hatte ihr Elternhaus gespielt, das ihr allein gehörte. Alle anderen Vermögenswerte hatte ihre Mutter geerbt, Veronique Marchand, die inzwischen Madame Jordans hieß und mit ihrem zweiten Mann Emile in Brüssel lebte.
»Du kannst bei mir wohnen«, hatte Regine zu Clemens gesagt, als sie den Burgbereich verließen. Das Angebot hatte ihn überrascht, sie merkte es deutlich, aber er sagte nichts und fragte nichts. Nur der Druck seiner Hand verstärkte sich. Je länger er blieb, um so intensiver wurden seine Umarmungen, um so fester schlossen sich seine Finger um ihre Handgelenke. Daran und an die vielen kleinen Gesten der Höflichkeit sollte sie sich später immer erinnern.
Er hielt ihr jede Tür auf, ließ ihr stets den Vortritt, half ihr in den Mantel und nahm ihr jeden Einkaufskorb ab. Er war ein Ritter. Sie hatte es von Anfang an gewußt. Was sie miteinander verband war die Kraft einer großen Liebe. In den alten Zeiten, so stand es in der Chronik, liebte man nur einmal im Leben.
»Das ist auch unser Schicksal«, sagte Regine zu Clemens, »denn wir sind ja nicht von dieser Welt.«
»Nicht?«
»Natürlich nicht.«
Er staunte sie an mit seinen leuchtend blauen Augen, und auch das blieb ihr im Gedächtnis, das immer wiederkehrende glückliche Staunen.
Sie hatten unentwegt miteinander geredet. Worüber?
Regine fragte sich das später oft, aber außer Bruchstücken fiel ihr nichts ein, nichts Wesentliches, nichts von Substanz, nichts von Belang.
An seinem letzten Tag trafen sie vor der Burg eine bolivianische Gruppe in malerischen Trachten, die einen kleinen Stand aufgebaut hatten. Zwei von ihnen sangen und musizierten, zwei andere verkauften das übliche Sammelsurium, darunter Musik-Kassetten, Silberschmuck und bunte, aus feinen Fäden geknüpfte Glücksarmbänder.
Regine und Clemens kauften jeder eines und banden es sich gegenseitig ums linke Handgelenk. Dann fischte er eine winzige Mundharmonika aus einem Kästchen mit Krimskram, blies probehalber ein paar Töne und begann selbstvergessen zu spielen.
Die vier Bolivianer klatschten Beifall. Passanten und Burgbesucher blieben stehen und nickten ihm lächelnd zu.
Clemens brach ab, schüttelte den Kopf und murmelte verlegen: »Ach was, das ist nichts, gar nichts.«
Regine hörte nicht auf ihn. Sie zog ihren Geldbeutel aus der Tasche und kaufte ihm die Mundharmonika.
Die letzte Nacht war erfüllt von Abschiedsweh, aber nicht von Trostlosigkeit oder gar Hoffnungslosigkeit. Sie weinten beide, als sie sich trennten, unten am Grenzfluß, morgens um acht Uhr. Von hier aus wollte Clemens mit dem Mountainbike nach Trier fahren, und von dort aus mit dem Intercity nach Hause, nach Norden, Hamburg, Kiel oder noch weiter.
Er sprach sich nicht aus darüber. Das Thema schien unerfreulich zu sein. Er fuhr nicht gern, soviel hatte Regine erraten können. Aber er brauchte Zeit, um seine Probleme in Worte zu fassen, mehr Zeit, als ihnen diesmal blieb.
Nächstes Mal, dachte sie in unerschütterlicher Zuversicht, obwohl kein Termin genannt worden war und auch sonst nichts, woran sie sich halten konnte. Sie vertraute ihrem Gefühl, der Geheimsprache des Herzens, die nur drei Begriffe kannte: Glaube, Liebe, Hoffnung.
Sie zweifelte keinen Augenblick daran, daß er alle Hebel in Bewegung setzen würde, wiederzukommen. Sie wußte, was sie ihm bedeutete, und daß es keine andere Frau in seinem Leben gab. Soviel, immerhin, hatte er herausgebracht, und sie glaubte ihm vorbehaltlos. Denn obwohl sie nicht viele Vergleiche anstellen konnte, hatte sie doch bemerkt, daß er an Zärtlichkeit nicht gewöhnt und in der Liebe eher unerfahren war.
Um so mehr hatte er jede Stunde ihres Zusammenseins genossen, jede Berührung, jede kleine Geste, jedes liebe Wort.
»Laß mich nicht fort«, hatte er geflüstert und sich an sie geklammert beim Abschied, unten am Fluß, und sein Gesicht war naß gewesen von Tränen.
Gegen Abend rief er an, von
Trier aus, wo er wohlbehalten angekommen war, Gott sei Dank, und früh genug, um eine Fahrkarte zu lösen, das Rad aufzugeben und sich zu versichern, daß sie ihn noch liebe.
»Was dachtest du denn!« rief sie vorwurfsvoll, und er war beruhigt, immer noch traurig, aber nicht mehr so verzweifelt wie am Morgen.
Danach dauerte es eine Woche, bis sie wieder von ihm hörte.
Er klang munter, wenn auch etwas gehetzt, brach mitten im Satz ab und versprach, sich später noch einmal zu melden.
Regine wartete den ganzen Tag, den ganzen Abend und sorgte sich um ihn, als der Oktober verging, ohne Anruf, ohne Brief, ohne ein Lebenszeichen.
Sie wünschte sich sehnlichst, daß er anriefe, und sie wurde immer ungeduldiger, denn sie hätte ihm viel zu erzählen gehabt. Aber er ließ nichts von sich hören, und sie besaß weder seine Adresse noch seine Telefonnummer. Genau genommen wußte sie nicht einmal, wie er hieß.
Sie hatte ihn Clemens genannt, aus einem Impuls heraus, aus der Stimmung eines Augenblicks. Dabei war es geblieben. Einen anderen Namen – seinen richtigen – hatte er nie genannt.
*
In der Villa Fenwick im Ostseebad Haffling hatte die Stimmung einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Den ganzen Sommer über, während der Sohn des Hauses sich ohne Angabe von Zielen und Zwischenaufenthalten in der Weltgeschichte herumtrieb, war die Atmosphäre gespannt gewesen.
Jetzt jedoch, nachdem er endlich wieder vor Anker gegangen war, hatte sich die Situation eher verschärft als entspannt.
Folke Fenwick, zwanzig Jahre alt, zeigte sich weder reumütig noch einsichtig, obwohl er allen Grund dazu gehabt hätte. Nicht nur war er zwei Monate lang sozusagen von der Bildfläche verschwunden gewesen, mit seinem Mountainbike, seinem Jugendherbergsausweis und einem Minimum an Geld in der Tasche. Nicht nur hatte er das Abitur auch beim zweiten Anlauf nicht geschafft, nein, sein ganzes bisheriges Leben war eine Kette von Enttäuschungen, die er seinen Eltern zugefügt hatte, im Gegensatz zu seiner Zwillingsschwester Wibke, der alles gelang, was sie sich vornahm.
Überhaupt waren die Fenwicks seit Generationen eher Gewinner als Verlierer. Einen wie Folke, der nichts zuwege brachte, hatte es nie vorher gegeben.
Seine Mutter Dagmar, die aus einer ebenso erfolgreichen Familie stammte, bemühte sich wie immer um Schadenbegrenzung, obwohl auch ihr allmählich die Argumente ausgingen.
»Der Junge ist ein Spätzünder! Er braucht länger als andere. Laß ihm Zeit!«
»Das erzählst du mir jetzt seit fünfzehn Jahren«, erwiderte Arnulf Fenwick in abschätzigem Ton, ohne die Stimme zu heben. Je wütender er war, um so leiser sprach er.
Es war Sonntagmorgen.
Sie saßen im Eßzimmer mit Blick auf die Straßenpromenade am Frühstückstisch. Zwischen ehrwürdigen alten Möbelstücken hingen in schweren goldenen Rahmen die Portraits derer, die den Ruhm des Hauses begründet und fortgeführt hatten: Männer mit kühnen, herausfordernden Blicken aus ozeanblauen Augen, Frauen mit strengen Mienen unter schwarzen Spitzenhauben. Kein Lächeln, kein Schmunzeln, kein schmükkendes Beiwerk, kaum etwas Buntes, kaum eine Freundlichkeit.
Sie alle waren bekannt gewesen für ihre Wohlanständigkeit, ihren Weitblick, ihre Tüchtigkeit. Die Männer hatten früher Boote gebaut, später Schiffe. Sie waren Geschäftsleute gewesen und Ingenieure. Einer von ihnen, Arnulfs Großvater, war Admiral gewesen, ein anderer hatte die Fenwick-Werft gegründet, von der sie heute noch lebten – alle – die ganze Familie – auch Folke, der ungeratene Sohn.
Es gab kaum eine Gelegenheit, bei der er nicht daran erinnert wurde.
»Solange du deinen Lebensunterhalt nicht selbst verdienst«, sagte Arnulf Fenwick an diesem Sonntagmorgen, »wirst du tun, was ich für richtig halte. Hast du mich verstanden?«
»Ja«, murmelte Folke fast unhörbar.
Seine Schwester stieß ihn verstohlen in die Seite. Sie war nicht ganz so blond wie er, nicht ganz so geschmeidig, und ihre Züge waren nicht ganz so fein geschnitten wie seine. Sie sahen einander ähnlich, aber nicht so auffallend, daß man sie sofort für Zwillinge gehalten hätte.
Folke saß regungslos und starrte auf das Zwiebelmuster des Frühstücksgeschirrs.
Wibke warf den Kopf in den Nacken und sah ihren Vater furchtlos an.
»Und was hältst du für richtig?« fragte sie laut mit ihrer klaren hellen Stimme.
Arnulf Fenwick stellte klirrend seine Tasse ab und räusperte sich.
»Er wird in die Claus-Clausen-Schule gehen, das ist eine private Bildungsanstalt, die sogar für hoffnungslose Fälle wie deinen Bruder eine gewisse Garantie übernimmt.«
»Mit welchem Ziel?«
»Das Abitur natürlich. Da er schließlich den gesamten Lernstoff bereits zehn Jahre lang durchgekaut hat, dürfte es ihm nicht allzu schwerfallen. Zumindest erfüllt er damit die notwendigen Vorbedingungen. Ich verspreche mir einen durchschlagenden Erfolg von der Methode, die dort angewandt wird: Ordnung, Konzentration, strenges Reglement.«
»Internatsbetrieb?«
»Selbstverständlich.«
»Wie oft kann er nach Hause kommen?«
»Gar nicht. Er bleibt zwölf Monate. Während der Ferien, die es natürlich gibt, werden Schwächen ausgebügelt, alles noch einmal wiederholt und Sport getrieben. Sonst nichts, denn jede Ablenkung würde den Erfolg zunichte machen.«
»Findest du das nicht sehr hart, Vater?«
»Doch, Wibke. Aber nach den niederschmetternden Erfahrungen mit der schulischen Fehlentwicklung deines Bruders sehe ich keine andere Möglichkeit, ihm zu einem vernünftigen Start ins Leben zu verhelfen.«
Minutenlang herrschte bedrükkende Stille am Frühstückstisch.
»Wann?« fragte Folke tonlos, ohne seinen Vater anzusehen.
»Sofort. Das Schuljahr hat bereits am ersten September angefangen. Du kommst zu spät, wie immer.«
*
Wochenlang bemühte sich Wibke um eine Besuchserlaubnis in der privaten Lehranstalt, die nach ihrem Gründer Dr. Claus Clausen benannt und in einem umgebauten Herrenhaus am Rande der holsteinischen Kleinstadt Wredenstedt untergebracht war. Aber erst Ende November, an einem wolkenverhangenen Sonntagnachmittag durfte sie Folke besuchen. Wie es hieß, hatte er selbst einen früheren Termin abgelehnt, denn jeder Schüler unterwarf sich freiwillig einer ungewöhnlich strengen Hausordnung und einem umfangreichen Lernprogramm. Sie saßen auf Korbstühlen in einem Raum, der neben dem Eingang lag und mit Zimmerpflanzen, Vogelkäfigen und weiß gerahmten Aquarellbildern in hellen Farben ausgestattet war.
»Und? Wie geht es dir? Kommst du zurecht?« fragte Wibke halblaut.
»Ja, ich gebe mir alle Mühe.«
»Über Weihnachten darfst du nach Hause, weißt du das schon?«
»Ich hab’s gehört. Aber länger als drei Tage bleibe ich nicht. Sonst versäume ich zuviel. Du lernst hier nämlich immer, auch wenn du es gar nicht merkst.«
»Auch in der Freizeit?«
»Immer. Es gibt jede Menge Lernspiele die du ausleihen kannst, Zettelkästen mit Konzentrationsübungen stehen überall herum, und wenn du wirklich abschalten willst, kannst du einen Schach-Computer benutzen mit eingebauter Lernfunktion.«
»Klingt ja wahnsinnig interessant!«
»Ist es auch.«
»Folke! Das habe ich nicht ernst gemeint! Es sollte nur ein Witz sein!«
»Ach so.« Er lächelte schwach und streifte seine Pulloverärmel zurück bis zu den Ellenbogen.
»He, was ist das denn?« fragte Wibke und deutete auf das bunte Bändchen an seinem Handgelenk.
Er zuckte zusammen.
»Nichts, gar nichts...«
»Hast du das von deiner Tour mitgebracht?«
Er nickte stumm.
»Ein Glücksarmband, nicht wahr?«
»Ja.«
»Sag mal, warum erzählst du denn nichts? Du warst fast zwei Monate unterwegs. Du mußt doch einiges erlebt haben.«
»Meinst du?«
»Und ob ich das meine! Folke, du bist mein Bruder! Wir haben zusammengehalten unser ganzes Leben lang! Ich weiß, daß du in einer Zwangslage bist, anders kann man da ja nicht nennen«, sie wedelte mit den Händen und rollte mit den Augen, »mir kommt das hier vor wie ein Knast für gehobene Ansprüche! Okay, okay, ich sag’s ja nicht laut, obwohl es mir schwerfällt – aber du bist auch selbst schuld, Folke! Jahrelang hast du dich durchgemogelt! Sobald es anstrengend wurde, hast du einen Rückzieher gemacht! Wenn ich noch an unsere Arbeitsgemeinschaft für Mathe denke. Die war wirklich ein Knüller. Wochenlang habe ich dich bearbeitet, und kaum warst du drin, bist du schon wieder ausgeschieden.«
»Mathe war eben nicht mein Fach.«
»Woher willst du das wissen? Du hast es nie ernstlich versucht. Du warst daran gewöhnt, schon vor den ersten Schwierigkeiten zu kapitulieren, und das galt nicht nur für Mathe. Ich will unsere Eltern jetzt nicht in den Himmel heben, aber um deine angeblichen Problemfächer zu umgehen, haben sie dich nach der Mittelstufe auf ein musisches Gymnasium geschickt. Mit dem Erfolg, daß deine Noten sofort ins Bodenlose fielen, sogar in deinem Hauptfach Musik, und zwar nur deshalb, weil du dort mit deinem Schlendrian nicht durchkamst.«
»Es war zu spät. Ich hätte von Anfang an in diese Schule gehen sollen.«
»Du hättest dich auch etwas mehr anstrengen können, statt die Nachhilfestunden zu schwänzen und den Klavierunterricht ganz aufzugeben.«
»Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Mir war alles so verleidet.«
»Genau das ist dein Problem, Folke. Sobald du Druck kriegst, verlierst du die Lust, und dann tust du nichts mehr.«
»Ach, Wibke, du hast gut reden.«
»Das ist nicht wahr! Kapier das doch endlich mal! Ich kriege nichts geschenkt. Ich habe mich immer bemühen müssen. Mir ist das Abi nicht in den Schoß gefallen und auch nicht die Zulassung zum Studium an der Uni in New York!«
»Du gehst nach Amerika?« stieß Folke entgeistert hervor.
»Ein paar Auslandssemester machen sich immer gut, und für Wirtschaftswissenschaften bin ich drüben genau an der richtigen Adresse. Aber ich habe dafür einen Crash-Kurs in Wirtschafts-Englisch machen müssen und etliche Zusatzseminare.«
»Du bist eben Spitze«, murmelte er tonlos, »du schaffst, was du dir vornimmst.«
»Das wirst du auch«, raunte Wibke mit warmer Stimme und drückte seine Hand, »bisher warst du auf dem falschen Dampfer, aber jetzt bist du auf dem richtigen Weg, bestimmt.«
»Schön wär’s«, er hob die Schultern und seufzte tief, »aber ich glaube nicht daran, Schwesterherz. Ich bin eine Niete.«
Sie griff nach seinem Arm und schüttelte ihn heftig.
»Mensch, Folke, reiß dich zusammen! Rede dir keinen Schwachsinn ein! In einem Jahr hast du dein Abi in der Tasche und meldest dich auf der Musikhochschule an. Oder ganz woanders. Mutter hat recht. Du bist ein Spätzünder. Deine wahren Stärken werden sich erst noch herausstellen. So, und jetzt muß ich los. Weihnachten sehen wir uns, dann schlägt die Abschiedsstunde. Ab Januar bin ich in New York. Wolltest du noch etwas sagen?«
»Hast du zufällig dein Handy bei dir?«
»Klar. Warum? Willst du telefonieren? Darfst du das etwa nicht?«
»Doch, aber das Telefon steht im Flur, man ist nie allein, und jeder kann mithören.«
»Komm, gehen wir ein Stück. Du bringst mich zum Auto, das steht draußen im Hof. Meine Güte, was für ein albernes Versteckspiel, nur wegen eines Anrufs! Lassen sich die anderen das denn gefallen?«
»Die meisten sind jünger als ich«, murmelte Folke beschämt und folgte seiner Schwester zur Tür hinaus.
Sie war ihm um Längen voraus. Sie studierte im dritten Semester, hatte ein Apartement im Kiel und einen schicken kleinen Wagen. Die Eltern, wenn man sie nicht fortwährend enttäuschte, konnten sehr spendabel sein. Wibke öffnete die Wagentür, reichte ihm das Handy und sagte: »Nimm dir Zeit, ich gehe inzwischen eine rauchen.«
Er sank auf den Sitz, zog ein gelbes Papierfetzchen aus der Tasche und wählte die Nummer in Vianden.
»Bitte, bitte, sei zu Hause«, flehte er leise, während das Freizeichen ertönte, zweimal, dreimal. Dann endlich meldete sich jemand atemlos.
»Hallo Reginchen, ich bin’s. Clemens!« Es klang wie ein Aufschrei.
Sekundenlang sprachen sie beide gleichzeitig, hektisch und wild durcheinander. Dann waren sie still, warteten, fingen wieder an.
»Ich wollte die ganze Zeit...«
»Aber warum hast du nicht?«
»Wie geht es dir denn?«
»Wenn ich doch nur wüßte...«
»Gut? Oder nicht gut?«
»Clemens! Wie kann ich dich erreichen?«
»Im Moment gar nicht. Ich bin unterwegs.«
»Wo? Wo denn?«
»Im Norden mit dem Auto. Sag mir, wie es dir geht! Bitte! Nicht gut?«
»Doch, wieso? Du klingst so komisch – anders als sonst.«
»Clemens, ich bin schwanger!«
»Du bist – was? Ehrlich?«
»Ganz sicher. Ich war vorige Woche beim Arzt. Wenn du mich noch liebst...«
»Ja! Ja! Ja!«
»Dann gib mir deine Adresse – deine Telefonnummer – Clemens? Bist du noch da?«
»Ich muß aufhören – die Batterie ist alle – bis später – Reginchen, mein Liebes...«
Er sank in sich zusammen und stöhnte: »O mein Gott!«
Aber das hörte sie nicht mehr, denn er hatte das Handy abgestellt.
*
Wenn Regine später an ihre Schwangerschaft zurückdachte, kamen ihr die Monate wie eine einzige lange Irrfahrt vor.
Um dem Geschwätz zu entgehen – vorerst jedenfalls – war sie zur ärztlichen Untersuchung nach Deutschland gefahren, in ein Eifelstädtchen nahe der Grenze. Der Doktor hatte ihr nicht unbedingt ein Geheimnis verraten, als er die Schwangerschaft feststellte, er hatte sie nur in ihrer Ahnung bestätigt.
Anders war der zweite Besuch bei ihm verlaufen, Anfang Januar, als er die Möglichkeit nicht ausschloß, daß sie Zwillinge bekommen würde. Diese Auskunft hatte sie betäubt, gelähmt und schließlich in Panik versetzt.
Damit hatte sie nicht gerechnet. Damit kam sie nicht allein zurecht. Bis dahin war sie überzeugt gewesen, die Situation in jedem Falle meistern zu können, so oder so, ob mit, ob ohne Hilfe. Sie hatte sich stark gefühlt, innerlich ruhig und immer noch in ihrem Sommernachtstraum befangen.
Damit war es nun vorbei. Die Aussicht auf zwei Kinder, die gleichzeitig geboren, versorgt und großgezogen werden wollten, erschreckte sie.
Auf der Suche nach einem Rettungsanker fuhr sie im Februar nach Brüssel zu ihrer Mutter. Madame Veronique, seit einem Jahr endlich wieder verheiratet, diesmal mit einem pensionierten Beamten der Europa-Behörde, hatte sich ihr Leben gerade erst bequem eingerichtet. Als sie die bestürzende Neuigkeit erfuhr, bekam sie einen hysterischen Anfall.
Regine wußte im Nachhinein gar nicht mehr, warum sie ausgerechnet nach Brüssel gefahren war. Ihre Mutter war eher bekannt für Nervenkrisen als für Standfestigkeit. Außerdem, wie nicht anders zu erwarten war, hagelte es Vorwürfe.
»Wie konntest du nur so naiv sein! Um Gottes willen, Regine! Wo lebst du denn? Im Wolkenkuckucksheim? Der Mann hat sich spurlos aus der Affäre gezogen, wundert dich das? Du hast es ihm ja so leicht gemacht! Und jetzt kommst du zu mir, jetzt, wo das Unglück passiert ist.«
»So möchte ich es nicht nennen«, unterbrach Regine, deren Widerstand sich allmählich zu regen begann.
Madame Veronique ließ ein bitteres Gelächter hören.
»Ach nein? Wie denn? Ein doppeltes Unglück? Eine zweifache Katastrophe?«
Sie warf sich über die Sessellehne und bekam einen Weinkrampf.
Monsieur Emile stürzte herein, maß Regine mit einem bitterbösen Blick und schnarrte auf Französich: »Laß deine Mutter in Ruhe! Sie hat genug für dich getan! Was willst du denn noch? Bist du immer noch nicht alt genug, um auf eigenen Füßen zu stehen? Wenn du nur gekommen bist, um unseren Frieden zu stören...«
»Pardon, ich gehe ja schon.«
»Nein, nein«, wimmerte Madame Veronique in echter, ungespielter Verzweiflung, »so können wir sie nicht gehen lassen, Emile! Sonst tut sie sich noch etwas an!«
So komisch es war: der Besuch in Brüssel lief letzten Endes darauf hinaus, daß Regine ihre Mutter beruhigte, nicht umgekehrt. Aber immerhin hatte sie dabei gelernt, ihren Entschluß zu verteidigen, die Kinder zu bekommen und zu behalten.
Nein, sie wollte keinen Schwangerschaftsabbruch.
Nein, sie wollte keine anonyme Geburt.
Nein, sie wollte kein Adoptionsgespräch mit der Familienbeauftragten führen. Weder in Brüssel noch sonstwo auf der Welt.
»Regine war immer schon so weltfremd«, jammerte Madame Veronique, und Monsieur Emile fügte grimmig hinzu: »Starrsinnig ist sie! Unzugänglich! Taub für die Stimme der Vernunft!«
Nach Vianden zurückgekehrt, wo inzwischen bereits hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde, stelle sich Regine tapfer den meist indirekt gestellten Fragen, räumte auf mit den Gerüchten, bekannte sich deutlich zu ihrer unehelichen Schwangerschaft und regelte, so gut sie konnte ihre Angelegenheiten.
Am achtzehnten Juni, zehn Tage vor dem errechneten Geburtstermin, fuhr sie in Begleitung ihrer Cousine Dorette nach Bedburg
in der Eifel, wo sie im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus entbinden wollte. Den Chefarzt der Geburtshilfestation kannte sie von ihrer ersten Untersuchung her. Bei ihm war sie in Behandlung geblieben, ihm vertraute sie, er gehörte zu den wenigen Menschen, die sich jeder negativen Äußerung enthalten und ihr immer Mut gemacht hatten. In Anbetracht der langen Anfahrt hatte er ihr geraten, nicht auf die ersten Wehen zu warten, sondern mindestens eine Woche früher zu kommen. Zwillinge, wenn sie es überhaupt so lange aushielten, drängten meistens überpünktlich auf die Welt.
»Soll ich hierbleiben?« fragte Dorette flüsternd, nachdem sie
die schwere Reisetasche im Zimmer Nummer zwölf abgestellt hatte.
Nein, das wollte Regine nicht. Jetzt, wo sie den sicheren Hafen erreicht hatte, fühlte sie sich ganz beruhigt. Dorette mußte schleunigst wieder zurück nach Vianden fahren, ihren Kiosk öffnen und das Haus in der Hauptstraße hüten: Regines Haus.
»Ruf mich an, wenn du etwas brauchst«, bat Dorette, während sie gemeinsam zum Parkplatz schlenderten, »und vor allem dann, wenn etwas passiert – ich meine, wenn die Wehen einsetzen. Du weißt, ich werfe alles hin und bin in einer Stunde hier!«
Regine hängte sich bei ihr ein und lächelte gerührt.
Dorette hatte mit ihr gemeinsam den Mütterkurs absolviert, weil alle anderen Teilnehmerinnen mit ihren Ehemännern oder Lebensgefährten dort erschienen waren. Es schien inzwischen üblich zu sein, daß man zur Entbindung jemanden mitbrachte, der einem persönlich beistand.
Dorette fand, daß sie besser geeignet war, diesen Beistand zu leisten als die meisten Männer, mit denen sie im Kurs zusammengetroffen waren.
»Ich glaube, wir haben noch Zeit«, murmelte Regine, »es sei denn, der Doktor schlägt vor, die Geburt einzuleiten.«
»Warum sollte er das tun?«
»Keine Ahnung. Sie kontrollieren ja ständig die Herztöne, wenn sich da Unregelmäßigkeiten zeigen, werden sie so kurz vor dem errechneten Termin nicht mehr lange abwarten, sondern gleich etwas unternehmen.«
»Also gut – wie auch immer – ruf mich an, ja? Nachdem ich mich so perfekt vorbereitet habe, wäre es doch jammerschade, wenn ich nicht zum Zuge käme!«
Sie lachten beide, als Dorette ins Auto stieg. Die Sonne stand hoch am Himmel, ein leichter Wind vertrieb die Schäfchenwolken von West nach Ost.
*
Sechs Tage später, am vierundzwanzigsten Juni, dem Johannistag, morgens zwischen vier und halb fünf wurden Michelle und Daniel geboren.
Da die ersten Wehen schwach gewesen und kurz vor Mitternacht aufgetreten waren, hatte Regine gar nicht daran gedacht, in Vianden anzurufen und Dorette aus dem Bett zu holen.
Danach allerdings war alles so atemberaubend schnell gegangen, daß ihr Hören und Sehen verging und sie vorübergehend keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte.
Michelle, zehn Minuten vor ihrem Brüderchen geboren, wog hundert Gramm mehr als er, aber auch Daniel brachte genug auf die Waage, um dem Brutkasten zu entgehen.
Beide Kinder maßen neunundvierzig Zentimeter, waren gesund und sahen wie zwei halb erblühte Rosenknospen aus.
Regine saß aufrecht im Bett, schwach vor Freude und Erleichterung, hielt ihre Babys in den Armen und ließ sich feiern.
An diesem Morgen war sie der Star der Station, denn Zwillinge kamen nicht alle Tage zur Welt. Sämtliche Schwestern gratulierten, der Chefarzt und die Oberärztin wechselten sich ab mit guten Wünschen und Ratschlägen, die Hebamme erschien immer wieder in kurzen Abständen, und schließlich, gegen zehn Uhr vormittags, schob sich Dorette ins Zimmer, völlig aufgelöst vor Aufregung.
Einerseits war sie enttäuscht, die Geburt verpaßt zu haben, andererseits war sie überwältigt vom Anblick der beiden Winzlinge, die träumerisch ihre Fingerchen ausrollten, ihre Näschen krausten und die Mündchen öffneten wie kleine Fische, die nach Luft schnappten.
»Mein Gott, da sind sie ja«, flüsterte Dorette, »und so perfekt! Ein Wunder der Natur! In all den Monaten – hast du sie dir jemals vorstellen können?«
»Nicht wirklich«, erwiderte Regine nachdenklich, »das war ja das Spannende daran. Immer zu fühlen, wie sie sich bewegen, und nicht zu wissen, wie sie aussehen. Sie sind süß, nicht wahr?«
»Sehr«, sagte Dorette mit schwankender Stimme, »sie brechen mir das Herz! Hoffentlich bleiben sie nicht so, sonst werde ich ihnen nie etwas abschlagen können.«
Regine lachte leise, zärtlich und gerührt.
»Genau das muß ich auch erst lernen – später.«
»Viel später«, bekräftigte Dorette.
Sie sahen sich an und seufzten ein bißchen, aber es klang nicht sonderlich bekümmert. Diese Sorgen lagen noch in weiter Ferne. Jetzt ging es ausschließlich um die Frage der Ernährung, um die richtige Menge und die Kontrolle des Gewichtes. Wichtig war nur das Gedeihen der Kinder, die Pflege, die sie brauchten, und die Entwicklung in den nächsten Wochen.
Regine nahm sich vor, alles aufzuschreiben, jede Beobachtung, jede Veränderung, jeden kleinen Fortschritt, und natürlich auch jeden Impftermin, jede ärztliche Untersuchung und das entsprechende Ergebnis.
Zwar ahnte sie bereits, daß sie über weite Strecken keine Zeit für schriftliche Betrachtungen finden und froh sein würde, abends das Nötigste geschafft zu haben. Denn um zwei Säuglingen gerecht zu werden, brauchte man viel Zeit und Kraft, und auch dann, wenn man keine Mühe und keinen persönlichen Einsatz scheute, kam man nicht ohne Hilfe aus. Das hatte der Doktor ihr bereits mehrfach versichert, das glaubte auch Dorette zu wissen, die keine einschlägige Erfahrung besaß.
Darüber lamentierte Madame Veronique von Brüssel aus bei jedem Telefonanruf. Das nützte zwar herzlich wenig, aber es war ihr nicht abzugewöhnen.
Indessen, Regine lernte schnell. Als man ihr kurz nach der Entbindung vorschlug, die Zwillinge im Krankenhaus taufen zu lassen, stimmte sie sofort zu. Das ersparte ihr eine aufwendige Feier in Vianden, zu der sie mindestens ein Dutzend Gäste hätte einladen müssen.
So aber brauchte sie sich um nichts zu kümmern. Die beiden Paten standen schon seit Monaten fest und wußten Bescheid. Dorette hatte sich selbst angeboten. Sie wollte das kleine Mädchen übers Taufbecken halten.
Für ihren Sohn hatte Regine nach langer Überlegung einen Freund der Familie vorgesehen, den Justitiar und Notar Leon Haldermann.
Am neunundzwanzigsten Juni, einem herrlichen blauen Sommertag, wurden in der Kapelle des Sankt-Elisabeth-Krankenhauses von einem Franziskanerpater vier Säuglinge getauft, darunter das Zwillingspärchen Daniel und Michelle Marchand. Beide trugen lange weiße Taufkleidchen mit Spitzenbesatz und hellblauen Schleifen, deren Bänder über die Steckkissen fielen, auf denen sie gebettet waren.
Dorette hatte es sich nicht nehmen lassen, für diese echt luxemburgische Ausstattung zu sorgen, zu der auch zwei hauchzarte Häubchen aus weißem Mousselin gehörten, weil es in Kirchen und Kapellen auch im Sommer kühl sein konnte und die Köpfchen der Täuflinge noch keinen nennenswerten Haarwuchs aufwiesen.
Dorette war in knisternde dunkelrote Seide gekleidet, und Leon Haldermann im schwarzen Nadelstreifenanzug stand ihr in nichts nach. Im Vergleich zu den beiden Taufpaten nahm sich die junge Mutter sehr bescheiden aus. Sie trug eines der Umstandskleider, die sie sich zu Beginn der Schwangerschaft gekauft hatte, dunkelblau, schmucklos, mit tiefen Falten, in denen sie fast versank. Ihr Gesicht unter dem schweren erdbraunen Haar wirkte klein und schmal, ihre kieselgrauen Augen waren feucht.
Sie kniete in der ersten Bank neben dem Taufbecken und faltete die Hände, während der Pater mit raschen Schritten die Altartreppen hinunter kam und die Meßdiener um sich versammelte.
Sie hatte ihr Bestes getan. Sie hatte für ihre vaterlosen Kinder zwei Menschen ausgesucht, denen jede Leichtfertigkeit fern lag. Die diese Patenschaft ernst nehmen würden, immer, auch im Falle der Not.
Darauf kam es an. Das war ihr erst klargeworden, als man ihr die beiden hilflosen kleinen Wesen in die Arme gelegt hatte. Die Erkenntnis hatte sie getroffen wie ein Blitzschlag. Es war etwas anderes, übers Kinderkriegen zu reden, als sich plötzlich der Realität gegenüber zu sehen und unter der Last der Verantwortung fast zusammenzubrechen.
Wenn mir etwas passiert, was dann? mußte man sich fragen, und ganz besonders dann, wenn man keinen Partner hatte, der sich mitverantwortlich fühlte. Regine hatte diese Frage lange verdrängt, weil sie sich nicht in dieser Extrem-Situation sah. Ihr Glaube an Clemens, an seine Liebe und seinen guten Willen, war stärker gewesen als das Mißtrauen und der Zweifel.
Erst als sie die Kinder vor sich sah, war der Gedanke an ihn in den Hintergrund getreten. Er verlor mit jedem Tag an Bedeutung. Er war nur noch ein Schemen, ein Phantom, das irgendwo in ihrer Erinnerung herumgeisterte. Es lohnte nicht die Mühe, sich noch länger mit ihm zu befassen. Es gab Dringenderes, Wichtigeres. Die Kinder kamen zuerst, und danach kam vorläufig gar nichts.
Regine sah ihre Cousine Dorette mit der kleinen Michelle auf dem Arm vortreten, so sicher, als wäre es ihr Kind.
Anders Leon Haldermann, der vermutlich in seinem knapp vierzigjährigen Leben noch keinen fünf Tage alten Säugling gesehen, geschweige denn getragen hatte. Er bewegte sich steif und unsicher, blickte immer wieder besorgt auf das kleine Bündel im Steckkissen und sprach mit leiser Stimme die Taufformeln nach, die der Pater ihm vorgab.
Der alten Sitte gemäß erhielten beide Kinder als zweiten Namen den Vornamen der Paten, und so wurden die Taufscheine ausgestellt auf Michelle Dorette Marchand und Daniel Leon Marchand.
Nach der Feier kehrten die Täuflinge in ihre Bettchen auf der Station zurück. Regine lud die beiden Paten zu Kaffee und Kuchen in die Cafeteria des Krankenhauses ein und spazierte noch ein Stück mit ihnen durch die angrenzenden Straßen des Städtchens Bedburg, das der Geburtsort ihrer Kinder war.
Dann schlenderten sie zum Parkplatz, wo sich Dorette und Leon verabschiedeten. Sie waren in seinem großen Citroen gekommen, der unvergleichlich viel geräumiger und komfortabler war als die froschgrüne alte Ente, die sich Dorette und Regine teilten.
»Wann wirst du entlassen?« fragte Leon.
»Nächste Woche, aber nicht vor Mittwoch.«
»Soll ich euch vielleicht abholen?«
»Das wäre super«, antwortete Dorette rasch, bevor Regine sich äußern konnte, »wir müssen schließlich nicht nur uns verstauen, sondern auch die Kinder und das Gepäck.«
»Also gut, abgemacht. Gebt mir Bescheid, wann ich kommen soll.«
Sie stiegen ein, winkten Regine zu und fuhren davon. In Vianden trennten sie sich. Leon ging zum Meeting einer gemeinnützigen Stiftung, das für den späten Nachmittag im Burghof angesetzt war. Dorette schlängelte sich durch die Schar der Wochenendbesucher die Hauptstraße hinunter zu Regines Haus.
Sie hatte schon einen Teil der Sachen wieder mitgebracht, die in Bedburg nicht mehr gebraucht wurden. Außerdem wollte sie die Blumen gießen und die Zimmer im ersten Stock lüften. Als sie die Haustür aufschloß, hörte sie das Telefon im Wohnraum klingeln. Sie rannte hinein, hob den Hörer ab und rief: »Hallo?«
»Regine?« hörte sie eine unsichere Männerstimme fragen.
»Nein, hier ist Dorette! Clemens, bist du das?«
»Ja – ja.«
»Regine ist im Hospital – sie
hat Zwillinge bekommen – ein Mädchen und einen Jungen –
heute war die Taufe – hallo,
hallo – Clemens! Bist du noch da?«
In der Leitung herrschte lautlose Stille. Erst nach einer beklemmenden Pause, die Dorette endlos erschien, ertönte das Besetztzeichen.
»Du Feigling!« zischte sie, schüttelte den Hörer und warf ihn auf die Gabel. »Du verdienst diese wunderbaren Kinder nicht, und eine Frau wie Regine – so tapfer, so tüchtig – die verdienst du auch nicht!«
Sie wartete noch eine halbe Stunde, für den Fall, daß er sich aufraffen und noch einmal anrufen würde – vergeblich. Das Telefon klingelte nicht mehr, aber damit hatte sie eigentlich auch gar nicht gerechnet.
*
In der öffentlichen Telefonzelle neben dem kleinen Kaufhaus in Wredenstedt lehnte Folke Fenwick an der Glaswand und schnappte nach Luft. Sein Puls raste, seine Stirn bedeckte sich mit kaltem Schweiß.
Hätte er doch nur nicht angerufen!
Dank eines geheimnisvollen Mechanismus’, der ihn vor so manchem Sturz in die deprimierende Realität bewahrte, hatte er Regines Schwangerschaft erfolgreich verdrängen können. Anfangs hatte er das ganze Kapitel Vianden aus seinem Gedächtnis streichen müssen, um sich nicht von unerfüllbaren Forderungen bedrängt zu fühlen. Aber im Lauf der Monate war es ihm tatsächlich gelungen, den bedrohlichen Inhalt des letzten Telefongesprächs mit Regine abzutrennen von der zauberhaften Erinnerung an die besten Tage seines Lebens. Er konnte die Schneekugel wieder in die Hand nehmen, konnte sich zurückversetzen in die Welt der Sagen und Legenden, konnte sich verwandeln in den Ritter Clemens August von Aremberg und im Geiste Zwiesprache halten mit seiner Liebsten, dem Burgfräulein Regine von Vianden.
Folke Fenwick hatte viele
Träume, aber dies war sein Lieblingstraum. Eine besondere Infamie des Schicksals glaubte Folke darin zu erkennen, daß es nicht sein Vater war, sein großer, unbesiegbarer Gegenspieler, der diesen Traum zerstörte, sondern eine weibliche Stimme in einem Telefonhörer.
Gut, den konnte man fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, von sich schleudern wie eine Giftschlange. Aber das, was diese Stimme angerichtet hatte – das Chaos im Kopf und im Herzen – ließ sich nicht so leicht beseitigen.
Nachdem Folke mit schwankenden Schritten die Telefonzelle verlassen hatte, beschlich ihn die Angst vor einem totalen Blackout. Sobald er etwas verdrängen mußte, wurde sein Gedächtnis vorübergehend so leer wie eine Schiefertafel, auf der mit einem nassen Schwamm alles gelöscht worden war. Er kannte seine Reaktion. Er hätte sie voraussehen können. Aber auch diese Schwäche gehörte zu den Dingen, die er am liebsten vergaß, anderenfalls hätte er nicht gerade jetzt in Vianden angerufen, nicht am letzten Sonntag vor den schriftlichen Abiturarbeiten!
Die ganze Nacht wälzte er sich im Halbschlaf in seinem Bett, unfähig, den Tatsachen ins Auge zu sehen.
Zwillinge? Unmöglich! Das konnte gar nicht sein!
Warum nicht? Weil es nicht sein durfte!
Ein Mädchen und ein Junge. ›Wie Wibke und ich‹, dachte Folke, um diesen Gedanken sofort in den Hintergrund abzuschieben, was gar nicht so einfach war. Er mußte sich aufrichten, die Handflächen an die Schläfen pressen, die Zähne fest zusammenbeißen und an etwas anderes denken.
Die Mathematikarbeit am nächsten Vormittag gab ihm drei unlösbare Rätsel auf. Den deutschen Aufsatz am Dienstag hätte er nicht unbedingt verhauen müssen. Das Thema lag ihm, sogar die Gliederung gelang. Aber er fing zu spät an, brauchte zu lange und wurde nicht fertig.
Am Abend dieses Tages hatte er bereits das vertrackte, leider allzu vertraute Gefühl, das Ziel nicht zu erreichen. Obwohl er so dicht davor war wie noch nie. Er hatte gelernt wie ein Weltmeister. Er war wissenschaftlich gegen sein Konzentrationsproblem vorgegangen, er hatte sich geistig fit getrimmt, den gesamten Stoff gespeichert und keine Ablenkung zugelassen. Bis zum letzten Tag, an dem ihn dieser unsinnige, völlig überflüssige Anruf aus der Bahn geworfen hatte.
Im Nachhinein wußte Folke nicht mehr, was über ihn gekommen war, was ihn veranlaßt hatte, eine Telefonzelle zu betreten und eine Nummer zu wählen, die auf einem zerfetzten Zettelchen stand. Nein, er konnte sich das nicht erklären. Er konnte es nicht gutheißen, er konnte nicht darüber reden, nicht einmal mit Wibke, die kurz nach dem Fiasko für einen Monat nach Deutschland kam. Sie trafen sich in der elterlichen Villa im Ostseebad Haffling, kurz bevor die ganze Familie für drei Wochen nach Finnland in Urlaub fuhr. Schon die Tatsache, daß Folke daran teilnehmen durfte, statt in eine Sommerschule verbannt zu werden, zeigte, daß Arnulf Fenwick die Bemühungen seines Sohnes zu schätzen wußte, auch wenn das Ergebnis gleich null war.
»Man hat mir versichert, deine Leistungen während des Schuljahrs hätten durchaus zu gewissen Hoffnungen berechtigt«, sagte er am Frühstückstisch, »und ich will nicht verhehlen, daß meine Enttäuschung über dein letztlich doch sehr schlechtes Abschneiden dadurch eher größer als geringer ist. Dennoch sollst du die Erfahrung machen, daß Fleiß und Mühe nicht unbelohnt bleiben. Deshalb fährst du mit uns nach Turku. Ich habe dort geschäftlich zu tun. Ihr könnt Ausflüge machen in die Umgebung, und schließlich, so hoffe ich jedenfalls, wird auch für mich eine Woche Urlaub drin sein.«
Folke schwieg. Er senkte den Kopf, dankbar und beschämt. Er blieb nun einmal ein Problem für seine Eltern, und die Folge war, daß er sich ihnen zunehmend verpflichtet fühlte. Seine Abhängigkeit verstärkte sich mit jedem Jahr, das er älter wurde, und immer noch brauchte er seine Schwester als Sprachrohr.
»Was wird nach den Ferien?« fragte Wibke, die von den Eltern argwöhnisch beäugt wurde, da sie mit grell bunten Strähnchen im raspelkurzen Blondhaar aus Amerika zurückgekommen war.
»Wieso? Was soll schon werden?« knurrte ihr Vater unwillig.
»Mit Folke. Ihr habt doch nicht ernstlich vor, ihn noch einmal nach Wredenstedt zu schicken?«
»Was sonst? Hast du einen besseren Vorschlag?«
»Vater! Folke ist einundzwanzig! Im Januar wird er zweiundzwanzig!«
»Na und?«
»Das Durchschnittsalter der Abiturklasse liegt bei achtzehn. Weißt du, was es bedeutet, drei Jahre älter zu sein als die meisten anderen?«
»Nein, und es interessiert mich auch nicht.«
Wibke stemmte die Ellenbogen auf und rupfte energisch ein Brötchen auseinander.
»Na klar, du hast deine eigene Sicht. Wenn man über fünfzig ist, kommt es auf ein paar Jahre mehr oder weniger nicht an. Aber wenn du mich fragst...«
»Ich frage dich nicht, Wibke.«
»Egal, ich sag’s dir trotzdem.«
»Das wirst du nicht!« erregte sich Dagmar Fenwick. Ihre hohe Stirn unter dem straff zurückgekämmten nesselbleichen Haar färbte sich dunkelrot.
Arnulf warf ihr einen ärgerlichen Blick zu.
»Danke für die Schützenhilfe, aber ich kann mich sehr gut allein verteidigen. Was wolltest du mir sagen, Wibke? Daß ich deinen Bruder von der Leine lassen soll?«
»Ja. Er ist schließlich kein Hund.«
Folke verschluckte sich vor Nervosität.
»Schluß jetzt!« rief seine Mutter schrill, aber niemand kümmerte sich darum.
»Hast du gehört, was deine Schwester sagt?« fragte Arnulf Fenwick.
Folke wich dem väterlichen Blick aus und starrte gepeinigt auf die Bilder an der Wand. »Wenn du nicht nach Wredenstedt zurückgehen willst, was in drei Teufels Namen willst du statt dessen
tun?«
Lähmende Stille senkte isch über die Tischrunde.
Folke bewegte krampfhaft die Schultern und massierte sich die Unterarme.
»Du weißt es nicht?« bohrte die scharfe, leise Stimme seines Vaters.
»Nein, es ist so, daß ich die ganze Zeit nur auf das Abitur konzentriert war – ein anderes Ziel konnte ich gar nicht ins Auge fassen.«
»Eine ehrliche Antwort, immerhin. Und was soll er deiner Ansicht nach anfangen, Wibke?«
»Na, irgend etwas! Eine Ausbildung! Er könnte zur Berufsberatung gehen, sich einen Überblick verschaffen und irgendwo ein Praktikum machen, so wie tausend andere auch!«
»Sehr richtig. Aber dazu gehört mehr eigene Initiative, mehr Energie, mehr Elan, als dein Bruder jemals aufgebracht hat.«
Wibke schnaubte wütend und trat ihn unterm Tisch ans Schienbein, aber Folke schwieg ausdruckslos.
»Solange er nicht weiß, was er will, wird er tun, was ich für richtig halte«, erklärte Arnulf Fenwick in einem Ton, der eine Widerrede nicht duldete, »er wird zurück nach Wredenstedt gehen, pünktlich zum Schulbeginn, und nächstes Jahr sein Abitur ablegen. Möchtest du noch etwas dazu sagen, Dagmar?«
»Nur einen Satz«, stieß seine Frau mit bebender Stimme hervor, »ich bestehe darauf, daß dieses Thema nicht mehr erörtert wird! Ich will während unserer Ferien in Finnland nichts mehr davon hören! Kein Wort! Habt ihr mich verstanden?«
Niemand antwortete.
»Sollen wir denn immer alle Probleme unter den Teppich kehren?« fragt Wibke spitz.
Ihre Mutter tupfte sich mit dem Zeigefinger eine Träne aus den Augen.
»Du quälst mich«, murmelte sie matt, »aber das ist ja nichts Neues. Daran bin ich gewöhnt. Das hast du schon getan, als du klein warst.«
Folke, der an etwas ganz anderes dachte, hob plötzlich den Kopf und sah eine Familie mit weit geöffneten Augen an, das scharf geschnittene Profil seines Vaters, die Martyrermiene seiner Mutter, den aufsässigen Ausdruck im Gesicht seiner Schwester.
Wie, wenn er jetzt die Bombe platzen ließ? Wäre es nicht interessant, die jähe Veränderung zu beobachten, die seine Neuigkeit hervorrufen würde?
Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet, könnte er ihnen entgegenschmettern, ich bin nicht der ewige Nesthocker, der sich willig von euch herumschubsen läßt! Ich bin längst hinausgewachsen über euer Genörgel, eure Besserwisserei!
Ich habe eine wunderbare Frau, die zu mir gehört! Ich bin der Vater von zwei Kindern! Das ist die Wahrheit, ob sie euch gefällt oder nicht!
»He, was ist los?« fragte Wibke und starrte ihn aufmerksam an.
Folke holte tief Luft und atmete langsam wieder aus. Der magische Augenblick verflog. Die Versuchung war vorübergegangen. Der Mut hatte ihn verlassen.
»Nichts«, murmelte er und senkte den Blick auf seinen Teller.
*
Wenn ihr die Monate der Schwangerschaft rückblickend wie eine einzige lange Irrfahrt
vorkamen, so sollte Regine die Zeit danach als ein Marathonlauf in Erinnerung bleiben, der unaufhörlich treppauf, treppab führte.
»Ich wußte nicht, daß mein Haus so unbequem ist«, sagte sie verzweifelt zu Madame Claudine, der Hebamme, die im Nachbarort wohnte und noch wochenlang täglich zweimal kam, um die Zwillinge versorgen zu helfen.
»Ja, ja«, seufzte Madame Claudine, »so hat man früher gebaut. Nur ein paar Meter Straßenfront, dafür zwei Stockwerke hoch. Da rennt man sich die Seele aus dem Leib. Nur gut, daß Sie oben und unten warmes Wasser haben, sonst müßten wir das auch noch rauf und runter schleppen.«
Daran durfte Regine gar nicht denken. Schon die geringsten zusätzlichen Erschwernisse warfen sie um. Als Madame Claudine nach Ablauf des ersten Monats feststellte, daß die Muttermilch nicht mehr ausreichte, kam das einer mittleren Katastrophe gleich. Denn nun mußte Säuglingsnahrung angerührt, in sterilisierte Flaschen gefüllt und auf die richtige Temperatur gebracht werden, und nicht nur das. Mehrere Sorten wurden ausprobiert, und bis man eine gefunden hatte, die beiden Kindern gut bekam, vergingen bange Tage und Nächte.
Wenn Regine später an diesen Sommer zurückdachte, fiel ihr nichts anderes ein als die Sorge um das Lebensnotwendigste. In ihren Aufzeichnungen aus dieser Zeit fanden sich fast nur Eintragungen über Gewichtszunahmen, Erstlings-Kleidungsgrößen, wechselnde Grammzahlen der Baby-Nahrung, gefolgt von den ersten Angaben über feste Kost, bestehend aus Obst- und Milchbrei, und immer wieder der Hinweis auf Fencheltee und Thymipintropfen.
Aber auch körperliche Fortschritte wurden vermerkt, zum Beispiel der Tag, an dem sich jedes Kind zum erstenmal allein umdrehen konnte, und natürlich die Nacht, in der beide zum erstenmal durchschliefen.
Auf den Fotos, die dazwischen geklebt waren, blickten die Babys hellwach und munter in die Welt, während Regine abgezehrt und müde aussah. Ihr Gesicht war schmal und angespannt, und auf den meisten Bildern trug sie dasselbe blau-weiß gestreifte Sommerkleid oder den in jenem Jahr modernen Trägerrock mit einer karierten Bluse.
Das geknüpfte Glücksarmband hatte sie längst abgelegt, weil es erstens zu unpraktisch und zweitens auch zu unhygienisch war. Sie wußte nicht einmal mehr, wo sie es hingetan hatte, denn in ihrem Schlafzimmer stapelten sich Berge von Babysachen, die täglich gewaschen, getrocknet, glatt gezogen und alle paar Wochen aussortiert wurden, weil sie zu klein geworden waren.
In dieser Zeit lernte Regine praktisch alles über Säuglingspflege, und sie lernte, sich selbst zurückzustellen ohne sich allzu sehr zu vernachlässigen. Das war bereits ein Kunststück, aber noch schwerer fiel es ihr, sich und anderen gewisse Grenzen zu setzen. Als Madame Veronique im August mit Monsieur Emile nach Vianden kommen wollte, um die Enkelkinder zu sehen, wurde sie klar und deutlich abgewiesen.
»Also, ich weiß nicht, ob das richtig ist, sie so vor den Kopf zu stoßen«, gab Dorette zu bedenken, »schließlich ist sie deine Mutter.«
»Eben deshalb kenne ich sie nur zu gut«, erwiderte Regine knapp, »selbst wenn sie im Hotel wohnen würde, käme sie jeden Tag herein, um mir vorzuwerfen, daß ich mich zuviel mit den Kindern abgebe und zuwenig mit der Putzerei, oder daß die Platten auf dem Weg hinterm Haus neu verlegt werden müßten, oder daß ich zuwenig für mich tue, kleidungsmäßig und auch sonst, oder daß ich meine Zeit nicht gut genug einteile und keinen Überblick über meine Finanzen habe.«
Dorette hob lachend beide Hände. »Alles klar. Du hast ja recht. Ich höre sie schon meckern und lamentieren. Aber so ist sie nun einmal, sie kann nicht anders, und irgendwie ist es doch trotzdem ganz normal, daß sie ihre Enkelkinder sehen will.«
»Das sehe ich anders«, erwiderte Regine, und ihr Gesicht verschloß sich, »wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre, hätte ich keine Kinder und sie keine Enkel.«
»Ach Gott, das hatte ich ganz vergessen«, murmelte Dorette.
»Ich nicht«, sagte Regine, »und ich kann mir nicht vorstellen, daß ich es jemals vergessen werde.«
»Komm«, raunte Dorette und legte ihr den Arm um die Schulter, »du darfst dich nicht verhärten. Du hast es schwer gehabt, und du hast es auch jetzt noch nicht leicht. Aber du hältst dich gut, Regine, und ich bin immer auf deiner Seite, das weißt du!«
»Ja, du und Leon, ihr seid meine einzigen Stützen. Wenn ich euch nicht hätte, wäre ich schon untergegangen.«
»Sag so was nicht! Du bist viel stärker, als wir beide gedacht haben. Stimmt’s?«
»Ich muß es sein, Dorette! Und nicht nur gelegentlich mal, sondern immerzu, vierundzwanzig Stunden am Tag. Das hat der Schöpfer so eingerichtet, daß man es schafft, und dafür bin ich dankbar. Aber es geht nicht spurlos an mir vorüber, das kannst du mir glauben. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch, der ich vor einem Jahr noch war.«
»Natürlich nicht«, erwiderte Dorette lebhaft, »dafür hat sich dein Leben ja viel zu sehr verändert. Ich versuche übrigens manchmal, mir Clemens vorzustellen, ziemlich umsonst, ehrlich gesagt. Aber ich habe ihn ja auch nur flüchtig gekannt. Hast du schon mal daran gedacht, ihn suchen zu lassen?«
Regine griff nach einem Babyjäckchen, strich es mechanisch glatt und legte es wieder auf den kleinen Stapel, den sie für das tägliche Bad der Kinder vorbereitete.
»Gedacht ja, aber – sag mal, Dorette, wie kommst du denn jetzt darauf?«
»Weil das der Dreh- und Angelpunkt ist. Sein komisches Verhalten muß dich doch schwer belasten.«
»Ja, es ist mir absolut unerklärlich«, sagte Regine langsam, »aber ich habe einfach nicht den Nerv, eine komplizierte Suchaktion zu starten. Dafür fehlt mir denn doch die Kraft und auch das Geld. Vielleicht später mal.«
Dorette ließ das Thema fallen und kam nicht mehr darauf zu sprechen. Madame Veronique hielt sich beleidigt zurück, nachdem ihr die Besichtigung ihrer Enkelkinder fürs erste verwehrt worden war.
Der Sommer verging, der Herbst zog ins Land. Im Oktober hatte Michelle zwei Zähnchen und dichte, strubbelige erdbraune Härchen. Sie saß gern aufrecht und wippte vergnügt, wenn man sie auf dem Schoß hielt.
Daniel hatte noch keinen Zahn, aber er konnte sich, auf einer dicken Decke liegend, allein von rechts nach links rollen, und sein Händchen umschloß den ausgestreckten Zeigefinger seiner Mutter wie ein kleiner Schraubstock. Sein Köpfchen war von seidenweichem silberhellem Flaum bedeckt.
Beide Kinder hatten wunderschöne klarblaue Augen, und wenn sie lächelten, ging für Regine die Sonne auf.
*
Am ersten Weihnachtsfeiertag übernahm Dorette die Betreuung der Zwillinge, und Leon lud Regine zu einem Orgelkonzert in der Waldkirche Rod-sur-Syr ein. Anschließend fuhren sie zum Abendessen nach Echternach, einem ehrwürdigen alten Städtchen südlich von Vianden, wo Leon zu Hause war.
Das Hotel-Restaurant »Bon-heure« gehörte seiner Verwandtschaft, und im »Ländchen«, wie die Luxemburger ihre Heimat liebevoll zu nennen pflegten, kannten sich die meisten Einheimischen sowieso.
Regine genoß diesen Tag in vollen Zügen. Es war das erste Mal seit sechs Monaten, daß sie sich losgerissen und ihr Kinder länger als ein Stündchen in Dorottes Obhut zurückgelassen hatte. Zuerst war es ihr nicht ganz geheuer gewesen oder zumindest sehr ungewohnt, sich auf einen halben Tag und eine räumliche Distanz von mehr als dreißig Kilometern einzulassen. Aber schon in der Waldkirche beim Orgelkonzert hatte sie sich entspannt.
Im Restaurant »Bonheure«, in dem sie am frühen Abend eintrafen, empfand sie den herzlichen Empfang als außerordentlich wohltuend. Dazu kam die lang entbehrte, fast vergessene Atmosphäre gepflegter Gastlichkeit. Alles war so perfekt! Und so üppig! Makellose Tischtücher, gestärkte Stoffservietten aus zartgrünem Leinen, feinstes Geschirr mit Rosenmuster aus französischer Manufaktur. Die bauchige Suppenterrine auf einem Rechaud mitten auf dem Tisch, so daß man sich bedienen konnte, so lange man wollte. Hier nahm man sich Zeit für jeden Gang, hier wurde nicht hastig gegessen und getrunken, bezahlt und gegangen. Nein, hier ließ man sich gemächlich nieder, kostete den Wein, widmete sich mehrmals der Speisekarte und dachte mit keinem Gedanken an seine schlanke Linie. Am ersten Weihnachtsfeiertag war die Auswahl noch größer und die Stimmung noch gelöster als sonst, und alle Gäste waren festlich gekleidet.
Die meisten von ihnen, wie Regine feststellte, waren beträchtlich älter als sie, aber das störte sie nicht, im Gegenteil. Es war eine angenehme Abwechslung, sich einmal nicht als Hauptverantwortliche zu fühlen, sondern als das unbefangene, neugierige junge Ding, das sie vor einer Ewigkeit gewesen war.
Auf Dorettes Drängen hin hatte sie sich ein neues Kleid gekauft aus weichem rosenfarbenem Wollstoff und einen kamelhaarfarbenen Blazermantel, der jetzt an der Garderobe des »Bonheure« in Echternach hing.
Leon Haldermann sah genauso aus, wie man sich einen angesehenen Justitiar vorstellte, der in einem Geflecht von privaten und öffentlichen Interessenverbänden die Fäden in der Hand hielt. Er trug einen Anzug aus grauem Tuch, ein makelloses weißes, gefälteltes Hemd und über dem Kragen einen schwarzen Seidenbinder, der vorn zu einer schmalen Schleife gebunden war. Am Aufschlag seines Jacketts steckte eine goldene Nadel mit einem winzigen Fähnchen, dem Abzeichen der ›Freunde der Burg Vianden‹.
Er war vierzig Jahre alt und Junggeselle, weniger aus Überzeugung, als aus Mangel an Gelegenheit, denn seine vielschichtige Tätigkeit brachte ihm zwar reichlich Kontakte ein, die er aus Zeitmangel jedoch nicht pflegen konnte.
Er war von mittlerer Statur, hatte nußbraunes, dichtes, seitlich gescheiteltes Haar, ruhig blickende dunkle Augen und eine angenehme Stimme. Regine, die ihn zum ersten Mal aufmerksamer betrachtete, stellte bei sich fest, daß er mit den reiferen Jahrgängen ebenso wenig gemeinsam hatte wie mit den jungen Leuten ihres Alters. Er wirkte einfach zeitlos.
Nachdem sie eine herrliche heiße Bouillon gelöffelt und Wildschweinbraten mit Preiselbeeren gegessen hatten, legten sie eine Pause ein.
Leo bestellte sich Vichy-Wasser zu seinem Rosé, griff in die schmale schwarze Ledertasche, die über seiner Stuhllehne hing, und zog ein Buch hervor. Es war der alljährlich erscheinende Almanach, herausgegeben von den ›Freunden der Burg Vianden‹. Auf einer der letzten Seiten, die Leon aufschlug und Regine über den Tisch reichte, fand sich ein interessanter Schnappschuß. Er zeigte einen sehr schlanken jungen Mann mit klassischem Profil und hellblondem verwehtem Haar, in schwarzen Jeans und weißem Kapuzen-T-Shirt, der sich über den Verkaufsstand der bolivianischen Musiker beugte. Neben ihm, nur halb zu sehen, aber unschwer zu erkennen, stand Regine.
»Clemens«, flüsterte sie ungläubig.
»Ich dachte mir, daß er es ist«, bemerkte Leon mit gedämpfter Stimme, »du kannst den Almanach behalten. Wenn du willst, besorge ich dir noch ein Exemplar.«
»Ach ja – bitte! Oder sag mir, wo ich es kaufen kann!«
»Nirgends. Die erste Auflage ist schon vergriffen, und eine zweite wird gewöhnlich nicht gedruckt. Du weißt ja, der Almanach ist nur für einen kleinen Kreis von Interessenten bestimmt. Inzwischen ist schon die nächste Ausgabe in Arbeit. Aber ich lege mir immer ein paar Stück beiseite für mein privates Archiv.«
Regine versank in den Anblick der Schwarzweiß-Aufnahme, die ihr ruckartig einen der glücklichsten Momente ihres Lebens wieder ins Bewußtsein brachte. Sekundenlang fühlte sie genau so, wie sie damals gefühlt hatte, sogar die Spätsommersonne auf der Haut, den himmlischen Glanz und den wundersamen Zauber. Aber der Traum währte nur kurz, denn all dies war völlig unwirklich, sternenfern, ohne jeden Bezug zur Gegenwart.
»Leon, wann hast du das gefunden?« fragte Regine und tippte mit dem Zeigefinger auf den Almanach.
»Vor etwa einem halben Jahr, als ich das erste Exemplar zur Durchsicht bekam.«
»Aber du hast mir nichts davon gesagt.«
»Nein, ich dachte, du brauchst noch Zeit – die Kinder waren zur Welt gekommen – du hattest viel Streß. Also sagte ich mir, wenn du nicht selbst darauf stößt oder von irgend jemand sonst einen Hinweis bekommst, dann warte ich noch bis Weihnachten. Im neuen Jahr kannst du dann eine Entscheidung treffen.«
»Was für eine Entscheidung, Leon?«
»Ob du ihn suchen lassen willst. Er ist der Vater deiner Kinder.«
»Ach so«, murmelte Regine und schlug das Buch wieder zu. Sie fuhr sich mit beiden Händen an die Schläfen, strich sich das Haar zurecht und starrte angestrengt vor sich hin.
»Zweierlei«, fuhr Leon Haldermann ruhig fort, »solltest du bedenken. Jeder Mensch möchte wissen, wo seine Wurzeln liegen, von wem er abstammt, wer Vater und Mutter sind, das ist doch ein legitimes Anliegen, nicht wahr?«
Regine nickte widerstrebend.
»Damit du deinen Kindern diese Frage offen und ehrlich beantworten kannst, mußt du dir völlig klar sein über die Identität ihres Vaters. Das bist du ihnen schuldig. Daran führt kein Weg vorbei, wenn du Daniel und Michelle die mühsame Suche nach ihrer Herkunft ersparen willst. Früher oder später werden sie keine Ruhe mehr geben, bis sie wissen, wer ihr Vater war.«
»Nun ja, das sehe ich ein.«
»Ein weiterer Grund, sich kundig zu machen, ist der finanzielle«, erklärte Leon in sachlichem Ton, »zwei Kinder großzuziehen, kostet Geld. Deshalb hat der Gesetzgeber ganz klar entschieden, daß jeder Elternteil an den Kosten beteiligt wird.«
Regine legte die Hände flach auf den Tisch, beugte sich vor und sprach mit eindringlicher, leiser Stimme. »Leon, dieses Foto sagt doch alles! Du siehst, wie jung Clemens aussieht! Noch gar nicht richtig erwachsen! Das hatte ich schon fast vergessen. Was soll er denn beitragen zu unserem Lebensunterhalt! Wie willst du ihn an den Kosten beteiligen! Er wird kaum imstande sein, sich selbst zu ernähren.«
»Schon möglich. Oder auch nicht. Aber auf Spekulationen sollten wir uns nicht einlassen. Dafür ist die Sache zu ernst und auch zu folgenschwer. Entweder er kann etwas beisteuern, dann bitte schön, muß er das tun, um der Kinder willen. Oder er kann es nicht, dann werden wir ihm natürlich nicht das letzte Hemd ausziehen, sondern unseren Anspruch vorübergehend ruhen lassen.«
»Ach, ich weiß nicht«, seufzte Regine verzagt.
»Gut, für den Fall, daß du dich nicht dazu überwinden kannst, ihm irgend etwas abzuverlangen – überlegen wir uns doch mal, was du statt dessen tun kannst, denn das Leben geht weiter, Tag für Tag, es läßt dir keine Pause.«
»Nein, ich weiß. Es ist wie ein Wirbelsturm, mit dem man immer rechnen muß.«
Leon lächelte, griff nach der Weinflasche und füllte ihr Glas noch einmal.
»Ein passender Vergleich. Also, in zwei, drei Jahren, wenn sie in den Kindergarten gehen, könntest du vielleicht wieder halbtags arbeiten.«
»Oder auch vorher schon, abends, zu Hause – Übersetzungen oder Korrekturen – was meinst du? So was müßte doch schon bald möglich sein, wenigstens von Zeit zu Zeit, ohne allzu starken Termindruck.«