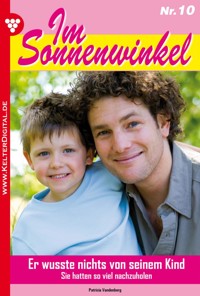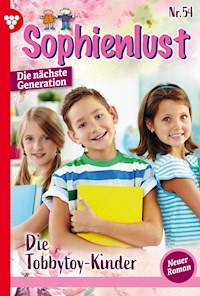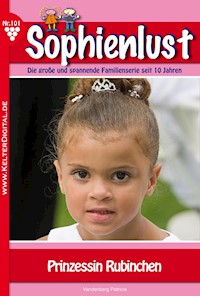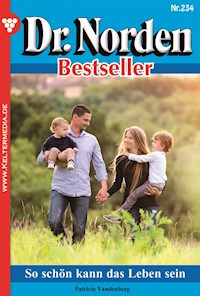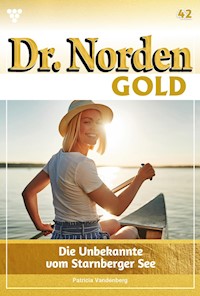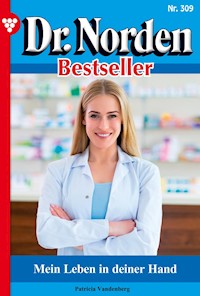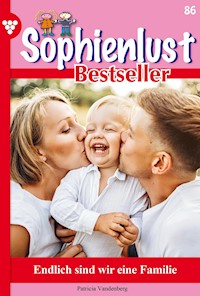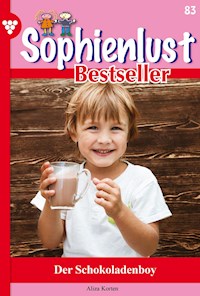14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dr. Laurin Box
- Sprache: Deutsch
Dr. Laurin ist ein beliebter Allgemeinmediziner und Gynäkologe. Bereits in jungen Jahren besitzt er eine umfassende chirurgische Erfahrung. Darüber hinaus ist er auf ganz natürliche Weise ein Seelenarzt für seine Patienten. Die großartige Schriftstellerin Patricia Vandenberg, die schon den berühmten Dr. Norden verfasste, hat mit den 200 Romanen Dr. Laurin ihr Meisterstück geschaffen. Patricia Vandenberg ist die Begründerin von "Dr. Norden", der erfolgreichsten Arztromanserie deutscher Sprache, von "Dr. Laurin", "Sophienlust" und "Im Sonnenwinkel". Sie hat allein im Martin Kelter Verlag fast 1.300 Romane veröffentlicht, Hunderte Millionen Exemplare wurden bereits verkauft. In allen Romangenres ist sie zu Hause, ob es um Arzt, Adel, Familie oder auch Romantic Thriller geht. Ihre breitgefächerten, virtuosen Einfälle begeistern ihre Leser. Geniales Einfühlungsvermögen, der Blick in die Herzen der Menschen zeichnet Patricia Vandenberg aus. Sie kennt die Sorgen und Sehnsüchte ihrer Leser und beeindruckt immer wieder mit ihrer unnachahmlichen Erzählweise. Ohne ihre Pionierarbeit wäre der Roman nicht das geworden, was er heute ist. E-Book 29: Ist der Vater meines Kindes krank? E-Book 30: Eine Ehe voller Zweifel E-Book 31: Alarmstufe eins in der Prof.-Kayser-Klinik E-Book 32: Werde ich ihm verzeihen können? E-Book 33: Ein Arzt spielt mit dem Feuer E-Book 34: Die Patientin mit den tizianroten Haaren E-Book 1: Ist der Vater meines Kindes krank? E-Book 2: Eine Ehe voller Zweifel E-Book 3: Alarmstufe eins in der Prof.-Kayser-Klinik E-Book 4: Werde ich ihm verzeihen können? E-Book 5: Ein Arzt spielt mit dem Feuer E-Book 6: Die Patientin mit den tizianroten Haaren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Ist der Vater meines Kindes krank?
Eine Ehe voller Zweifel
Alarmstufe eins in der Prof.-Kayser-Klinik
Werde ich ihm verzeihen können?
Ein Arzt spielt mit dem Feuer
Die Patientin mit den tizianroten Haaren
Dr. Laurin – Jubiläumsbox 6 –E-Book: 29 - 34
Patricia Vandenberg
Ist der Vater meines Kindes krank?
Petra hat Angst um ihr Baby
Roman von Patricia Vandenberg
»Guten Tag, Frau Walden«, begrüßte Dr. Laurin seine Patientin, doch das heitere Lächeln, das er sonst immer für diese hübsche, junge Frau gehabt hatte, erstarb ihm auf den Lippen, als er in ein maskenhaft starres Gesicht blickte.
Er hatte Petra Walden vor acht Monaten, als er ihr bestätigen konnte, daß sie ein Kind erwartet, als eine fröhliche junge Frau kennengelernt, und so war es bis vor vier Wochen, zur letzten Kontrolluntersuchung, geblieben.
Als Ehefrau des Chemikers Dr. Gerd Walden konnte sie ein völlig sorgloses Leben führen. Sie wurde von ihrem Mann verwöhnt. Nicht oft erlebte es Dr. Laurin, daß ein werdender Vater sich so regelmäßig nach dem Befinden seiner Frau erkundigte.
Heute war alles anders. Petra Waldens Aussehen und Benehmen stimmten den Arzt besorgt.
»Wir werden es doch nicht mit der Angst bekommen?« fragte er in scherzhaftem Ton. »Es ist alles bestens in Ordnung. Es besteht keinerlei Grund zur Besorgnis. Ein lebhaftes Kind tragen Sie da spazieren, Frau Walden.«
Petra starrte vor sich hin. Kein Grund zur Besorgnis, dachte sie, und ein Frösteln kroch über ihren Rücken.
Sie spürte, wie Dr. Laurin sie forschend betrachtete und nahm sich zusammen.
*
»Was sagen Sie, Hanna?« fragte Dr. Laurin seine tüchtige Helferin Hanna Bluhme.
»Wozu?«
»Zu Frau Walden«, erklärte er geistesabwesend.
»Ich bin überrascht, wie deprimiert sie plötzlich ist. Und noch mehr, daß ihr Mann heute nicht mitgekommen ist. Sie hat ein Taxi für die Heimfahrt kommen lassen. Vielleicht hat sie Sorgen innerhalb der Familie.«
Dr. Laurin mußte an diesem Tag immer wieder an sie denken, obgleich er sich nicht über Arbeit zu beklagen hatte, und dann ließ sich am Nachmittag Dr. Walden bei ihm melden.
»Vielleicht erfahren Sie jetzt, wovor Frau Walden sich fürchtet«, sagte Hanna zu Dr. Laurin.
»Fürchtet?« fragte er erstaunt zurück.
»Ja, ich habe das Gefühl, daß sie vor irgend etwas Furcht hat.«
Dr. Walden schien es allerdings auch nicht zu wissen, denn er wollte von Dr. Laurin erfahren, was seiner Frau denn fehle.
»Sie hat mir nicht gesagt, daß sie heute zur Untersuchung kommen wollte«, sagte Gerd Walden bestürzt, als Dr. Laurin auf das veränderte Wesen der jungen Frau zu sprechen kam. »Ich bin gleich vom Büro hergekommen, weil ich mir auch Sorgen um Petra mache. Sie ist ja nicht wiederzuerkennen.«
Dem konnte Dr. Laurin nicht widersprechen, allerdings mußte er bemerken, daß auch Dr. Walden viel von seiner früheren Frische verloren hatte. Sein schmales Gesicht war blaß und abgespannt. Aber er wich allen Fragen, die ihn selber betrafen geschickt aus und kam immer wieder auf seine Frau zurück.
»Sie hat keinen Appetit und schläft schlecht«, erklärte er.
»Hat sie Kummer?« fragte Dr. Laurin.
»Ich wüßte nicht warum«, erwiderte Dr. Walden. »Ich halte alles von ihr fern, was sie bedrücken könnte.«
Gibt es da doch etwas? fragte sich Dr. Laurin. Finanzielle Sorgen waren wohl ausgeschlossen. Gustav Walden, Gerds Vater, hatte eine gutfundierte Arzneimittelfabrik, in der Dr. Walden Chef war.
»Es wird alles wieder in Ordnung kommen, wenn das Kind erst da ist«, sagte Dr. Laurin aufmunternd. »Eine Schwangerschaft bringt oft wirklich die merkwürdigsten Nebenerscheinungen mit sich.«
*
Petra Walden legte schnell ein Make-up auf, als sie den Wagen ihres Mannes kommen hörte. Ihre Augenlider waren gerötet und verrieten, daß sie geweint hatte.
Sie betrachtete ihren Mann mit einem langen Blick. »Wie geht es dir, Gerd?« fragte sie leise.
»Das muß ich dich fragen, Liebling«, sagte er weich. »Willst du mir nicht sagen, was dich bedrückt?«
»Ach, das sind so Stimmungen. Werdende Mütter haben solche Anfälle, je näher der Tag rückt. Ein bißchen beschwerlicher ist es ja mittlerweile auch geworden.«
Sie zwang sich zu einem leichten Ton, aber ihre Stimme zitterte.
Er liebte seine Frau und wollte alles mit ihr teilen, auch den Kummer, für den er keine Erklärung hatte. Er hoffte, daß sie sich ihm anvertrauen würde, aber er ahnte nicht, daß er der letzte wäre, mit dem sie darüber sprechen würde, denn in Petra Walden wühlte seit Tagen eine quälende Angst um ihren Mann. Seit einer Woche wurde sie die grauenhafte Angst nicht mehr los, daß sie ihn verlieren würde.
»Wollen wir Vater nicht mal wieder besuchen?« fragte sie ablenkend.
»Nein«, erwiderte er so schnell, daß sie ihn verwirrt betrachtete. »Es wird zu beschwerlich für dich, Liebling. Du mußt dich jetzt schonen.«
Sie redeten nun nur noch aneinander vorbei, und eine eigentümliche Spannung war zwischen ihnen.
*
Petra Waldens unbeschwertes, sonniges Dasein hatte an dem Tag ein Ende gehabt, als sie im Schreibtisch ihres Mannes nach dem Scheckheft suchte. Sie hatte ihres verlegt.
Sie hatte das Scheckheft gefunden, aber auch einen Brief, der den Absender eines Arztes trug.
Sie hatte diesen Umschlag immer wieder angestarrt. Er war offen, und sie hatte das Schreiben herausgenommen.
Gerd hatte ihr nicht erzählt, daß er zu einer ärztlichen Untersuchung gewesen war, und das befremdete sie. Sie war sonst weder mißtrauisch noch eifersüchtig. Sie hatte plötzlich nur Angst, daß ihm etwas fehlen könnte, und das schien ihr dieses Schreiben erschreckend zu bestätigen.
»Der Patient Walden leidet an einem inoperablen Hypernephron«, hatte da gestanden. Dann hatte sie sich erkundigt und in Erfahrung gebracht, daß dies eine unheilbare, ja, tödliche Krankheit war, die man auch mit Krebs bezeichnete.
Ihre Welt stürzte zusammen.
Das kann nicht, das darf nicht sein, dachte sie immer wieder. Der Vater meines Kindes darf nicht krank sein!
Sie sagte ihm, daß sie das Scheckheft aus dem Schreibtisch genommen hätte, und wartete darauf, daß er an den Brief denken und erschrecken würde.
Nichts war ihm anzumerken.
»Hast du deins inzwischen wiedergefunden?« hatte er nur gefragt. Damit war für ihn der Fall erledigt.
Es war ihr klar, daß er es ihr verheimlichen wollte. Er dachte an sie und das Kind. Welche übermenschliche Beherrschung mußte es ihn kosten, mit diesem Gedanken zu leben, doch dann sagte sie sich auch, daß er auf Rettung hoffte, und nur sie jetzt nicht damit erschrecken wollte, daß er in eine Klinik ging.
Zwei Tage später hatte sie davon angefangen, daß er sich eigentlich auch einmal gründlich untersuchen lassen müsse.
Sie hatte es sogar mit aller Überwindung fertiggebracht, dabei ganz gelassen zu bleiben.
»Bei Gelegenheit«, sagte er. »Damit du beruhigt bist. Aber jetzt bist nur du wichtig.«
Nein, sprechen konnte sie nicht mit ihm darüber. Sie trug es mit sich herum. Sie spürte zuerst selbst nicht, wie die Angstzustände in ihr immer stärker wurden, wie sie nachts schon auf jeden Atemzug von ihm lauschte.
Ein trockenes Schluchzen schüttelte sie jetzt wieder. Klägliche Laute kamen über ihre Lippen.
»Petra, mein Kleines, was hast du denn nur?« fragte Gerd heiser. Dann schob er seinen Arm unter ihren Nacken und preßte seine Lippen an ihre Stirn.
Sie konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Sich vorzustellen, daß es eines Tages nicht mehr so sein könnte, daß sie auf ihn, seine Liebe, seine Nähe verzichten müßte, war das Schlimmste, was ihr geschehen konnte.
»Bleib bei mir, Liebster«, flüsterte sie. »Laß mich nicht allein.«
»Was hast du nur für Ängste, Kleines? Ich bin bei dir und bleibe bei dir.«
Seine Stimme klang ruhig und tröstend.
Vielleicht gibt es doch eine Rettung, dachte Petra. Gerd glaubt daran, und ich will auch daran glauben.
»Nicht böse sein«, sagte sie dicht an seinem Ohr. »Ich habe manchmal Angstzustände.«
»Sollten wir dich nicht lieber bald in die Klinik bringen?« fragte Gerd.
»Nein, ich will nicht von dir getrennt sein, ich will zu Hause bleiben, solange es geht. Ich werde mich zusammennehmen, Liebster.«
Sie nahm es sich fest vor, und sie war dann auch während der nächsten Tage nicht mehr so deprimiert. Wenigstens ließ sie es sich nicht anmerken.
Doch dann traf sie auf einem Spaziergang, den sie täglich machte, ihre Schulfreundin Steffi, die mit einem Arzt verheiratet war.
Ihr erzählte sie, daß in ihrem Bekanntenkreis ein tragischer Krankheitsfall vorliege und schilderte in Wirklichkeit ihren eigenen Fall. Steffi meinte ganz unbedarft, daß Petra sich nicht mit den Nöten anderer belasten solle und sagte beim Abschied, daß sie hoffe, das Kind der Bekannten käme gesund zur Welt.
Petra fühlte den Boden unter sich schwanken und verabschiedete sich schnell.
Gerd Walden hatte noch zweimal bei Dr. Laurin angerufen. Er sagte, daß der Zustand seiner Frau äußerst merkwürdig sei, aber sie ließe sich nicht bewegen, schon früher in die Klinik zu gehen.
*
Dr. Laurin machte sich ernste Sorgen um seine Patientin. So sehr beschäftigte ihn Petra Walden, daß er eines Abends beim Essen innehielt und vor sich hin starrte.
»Was fehlt dir, Leon?« fragte seine Frau Antonia. »Fühlst du dich nicht wohl?«
Er schrak zusammen.
»Verzeih, mein Schatz«, sagte er. »Ich mache mir Sorgen um eine Patientin.«
»Kommt wieder die Polizei?« fragte der kleine Konstantin, mit dem sein Vater mal wieder nicht gerechnet hatte.
»Nein, Konstantin«, erwiderte Leon. »Laß uns ein bißchen Ruhe.«
Konstantin zeigte sich verständnisvoll und verschwand wieder. Seine Zwillingsschwester Kaja empfing ihn mit der Bemerkung: »Siehste, ich habe dir ja gleich gesagt, du sollst nicht neugierig sein.«
»Papi hat Sorgen«, berichtete Konstantin seufzend. »Wegen ’ner Patientin.«
»Hab’ ich schon gehört«, gab Kaja zu. »Ist aber nichts mit der Polizei. Gott sei Dank.«
»Was is’ mit Polipei?« mischte sich Kevin ein.
»Po-li-zei«, sagte Konstantin ihm vor. »Es ist nichts damit. Iß deine Banane.«
Der kleine Kevin zog einen Schmollmund. Kaja streichelte ihm gleich die Wange.
»Konstantin meint’s nicht so«, sagte sie.
»Er kommandiert gern.«
»Ich kommandier’ gar nicht«, protestierte Konstantin. »Kevin soll nicht reden, wenn er ißt, sonst verschluckt er sich wieder, und wenn er keine Luft mehr kriegt, regen Mami und Papi sich auf.«
»Papi hat oft Sorgen mit Patientinnen«, sagte Kaja tiefsinnig.
»Arzt sein ist nicht einfach«, bemerkte Konstantin altklug. »Muß man gute Nerven haben.«
»Wo hat Papi die?« wollte Kevin wissen.
Konstantin wußte nicht gleich, was er meinte. »Fragen stellst du«, sagte er.
Kevin wollte jetzt alles wissen. Das Fragealter war bei ihm angebrochen.
Antonia hatte von Leons Sorgen erfahren, aber sie wußte dazu auch nichts zu sagen.
Schwangerschaftspsychose? Bei einer so optimistisch und positiv eingestellten Frau wie Petra Walden es gewesen war, hielt Leon das für abwegig, aber es gab immer wieder Überraschungen.
»So lange ist es gutgegangen bei ihr. Eine Schwangerschaft ohne jegliche Komplikation, und nun kommt vielleicht doch noch etwas daher. Ich fürchte, daß ihr seelischer Zustand doch irgendwie mit ihrem Mann zusammenhängt.«
»Frag’ sie doch einfach, Leon.«
»Kann ich nicht. Wenn sie reden wollte, hätte sie es mir gesagt. Sie ist frei heraus. Sie war es jedenfalls«, fügte er bedrückt hinzu.
»Nehmen wir es mal so, daß der neunte Monat nicht das reinste Vergnügen ist«, meinte Antonia. »Du, unsere Kinder diskutieren.«
Da kam Kevin auch schon angestürmt. Er hatte sich nicht mehr zurückhalten lassen, er wollte zu seinem heißgeliebten Papi, von dem er Aufklärung über das menschliche Nervensystem erwartete.
»Andere Dreijährige interessieren sich mehr für Autos«, seufzte Leon.
»Er ist halt dein Sohn«, lächelte Antonia.
»Ich bin auch Papis Sohn!« schrie Konstantin.
»Und ich bin Papis Tochter«, echote Kaja.
»Und mich braucht ihr wohl nicht«, scherzte Antonia. »Dann werde ich mich mit unserer Püppi befassen.«
Das Baby der Laurins, die kleine Kyra, meldete sich auf Kommando.
*
Am nächsten Tag bekam Dr. Laurin eine neue Patientin, die ihn in ihrem munteren, frischen Wesen an die Petra Walden vergangener Tage erinnerte.
Ihr Name war Jenni Burk, sie war einundzwanzig und gebürtige Amerikanerin. Während ihr deutscher Mann als Journalist in Ostasien weilte, war sie jetzt bei ihren Schwiegereltern, weil sie ihr Kind in München zur Welt bringen wollte. Nun lag die Prof.-Kayser-Klinik zwar nicht direkt in München, aber sie hatte sich für diese entschlossen, weil sie dem Haus ihrer Schwiegereltern am nächsten lag und weil sie ihr gefiel.
Sie fand alles wonderful, von ihren Schwiegereltern angefangen bis zu Hanna Bluhme, mit der sie sich gleich lange und anregend unterhielt.
»Aller Wahrscheinlichkeit nach müßte sie gleichzeitig mit Frau Walden niederkommen«, sagte Dr. Laurin nachdenklich. »Dann könnten wir die beiden in ein Zimmer legen. Dieses quicklebendige Persönchen macht ja die müdesten Geister munter.«
»Warten wir es ab«, meinte Hanna skeptisch. »Wenn ihr Mann nicht zur rechten Zeit heimkommt, wird sie vielleicht auch den Kopf hängen lassen.«
*
Gerd Walden lebte in ständiger Sorge um seine Frau. Das Ergebnis war, daß er immer blasser und schmaler wurde, und das wiederum schob Petra auf seinen Gesundheitszustand. Appetit hatten sie beide nicht, und so sorgte sich einer nur um den anderen, und als Gerd Walden dann ein Machtwort sprach und seine Frau in die Prof.-Kayser-Klinik brachte, erschrak Dr. Laurin über das Aussehen von beiden.
Seinen Vermutungen waren keine Grenzen gesetzt. Sie war schweigsam… und ihr Mann auch. Jedenfalls war es zweckmäßig, sie jetzt unter ständiger ärztlicher Aufsicht zu haben.
Gerd fühlt sich schlecht, dachte sie. Er will nicht, daß ich ihn so elend sehe. Ein paarmal hatte sie sich versucht gefühlt, mit ihm offen zu sprechen, doch dann hatte sie der Mut wieder verlassen. Was sollte man da denn sagen? Weinen und ihm das Herz noch schwerer machen? Wenn sie wenigstens jemanden hätte, mit dem sie sich aussprechen könnte, aber Dr. Laurin würde dann womöglich mit Gerd sprechen, und damit war auch niemandem geholfen.
Also schwieg Petra weiter.
*
Jenni Burk war unverändert heiter und guter Dinge, obgleich ihr Mann noch immer nicht daheim angekommen war.
»Es wäre besser, wenn Mick erst kommt, wenn das Kind schon da ist«, sagte Jenni. »Er regt sich sonst bloß auf.«
Sie wollte es auch nicht hören, daß Mummy und Dad, wie sie ihre Schwiegereltern nannte, nicht einverstanden waren mit ihrem Sohn.
»Mick ist in Ordnung«, sagte Jenni. »Er verdient Geld für seinen Sohn.«
Daß es ein Sohn werden würde, ließ sie außer Zweifel. Sie sprach nur von Micky, wenn sie von ihrem Kind redete, und sie redete sogar schon mit ihm, was lustig und rührend zugleich war.
»Du bist schön verfressen, Micky«, sagte sie, wenn sie Hunger hatte. Mummy kochte ihr natürlich, worauf sie gerade Appetit hatte, und das ließ Jenni sich gern gefallen.
»Micky hätte heute Appetit auf Apfelstrudel«, sagte sie zu Renate Burk.
Es klang bezaubernd, wie sie es aussprach. Frau Burk mußte lachen.
»Dann bekommt Micky eben Apfelstrudel, Jenni«, sagte sie zärtlich.
»Allerliebste Mummy«, sagte Jenni ebenso zärtlich. »Ich habe euch sehr lieb, aber ihr dürft nicht auf Mick schimpfen. Ich habe doch gewußt, daß ich einen Wandervogel heirate.«
Nun, eine verständnisvollere Frau hätten sie ihrem einzigen Sohn nicht wünschen können, und sich selbst auch keine liebenswertere Schwiegertochter. Jenni war ein wahrer Sonnenschein, und so war es verständlich, daß sie ihr jeden Wunsch von den Augen ablasen.
Für Jenni war das herrlich. Sie hatte ihre Eltern früh verloren und war bei Verwandten aufgewachsen. Sie hatte sogar ein bißchen Bedenken vor Michaels Eltern gehabt, vor allem, weil das Baby schon unterwegs war, als sie heirateten. Schon ziemlich lange war das schon unterwegs, und deshalb hatte sie ihre Schwiegereltern auch erst so spät kennengelernt. Aber alle Befürchtungen waren unnütz gewesen.
Sie wurde mit offenen Armen empfangen. Zuerst nur, weil sie eben Michaels Frau war und ein Baby erwartete, dann aber gleich um ihrer selbst willen, denn wer in ihre strahlenden Augen blickte, mußte sie liebhaben.
Jenni war ein entzückendes Geschöpf. Sie blieb es auch, als die ersten Wehen einsetzten.
Das war drei Stunden, nachdem sie den köstlichen Apfelstrudel genossen hatte.
Frau Burk hielt es für ratsam, vorsichtshalber doch in die Klinik zu fahren, und dort erfuhr Jenni dann, daß sie gleich dableiben müsse.
»Nicht aufregen, Mummy«, sagte sie tröstend. »Du hast doch auch mal ein Baby bekommen, und das ist mein Mick.«
Ich werde ihm die Ohren langziehen, wenn er heimkommt, dachte Frau Burk, und da kam schon ihr Mann angestürmt, der das Haus leer gefunden hatte.
»Ist das Kind schon da?« fragte er atemlos.
»So schnell geht es nun auch wieder nicht, Dad. Mir wäre es jetzt doch lieber, Michael würde endlich kommen.«
Nun warteten sie, und indessen machte Jenni sich mit Petra Walden bekannt, die man vorsichtshalber bereits vor Stunden ins Geburtszimmer gebracht hatte.
Petra vergaß für einige Zeit ihre Sorgen, denn Jenni verstand es wirklich meisterhaft, fröhliche Stimmung um sich zu verbreiten. Ihr lustiges Kauderwelsch erforderte zudem einige Aufmerksamkeit, wollte man verstehen, was sie sagte.
»Mein Micky ist ein sehr lebhaftes Kind«, plauderte Jenni.
»Sie haben schon ein Kind?« fragte Petra verwundert, denn Jenni wirkte selbst noch wie ein halbes Kind.
Hellauf lachte Jenni. »Ich meine den da«, sagte sie und deutete auf ihren Bauch.
»Er wird Michael heißen wie sein Daddy. Er wird schwarze Haare haben und blaue Augen wie Mick. Er kann es gar nicht erwarten, bis er seine Mutter anschauen darf. Hoffentlich werde ich ihm gefallen.«
Die eigentümlichsten Gedanken gingen Petra durch den Sinn, als Jenni ein paar Minuten schwieg, weil wieder eine Wehe kam. Sie lief dann hin und her, atmete ein und aus und setzte sich dann wieder.
Petra begann zu stöhnen.
»Haben Sie Schmerzen?« fragte Jenni sofort. »Das tut mir leid. Laufen Sie doch auch ein bißchen herum, dann geht es besser.«
Aber dazu war Petra viel zu schwach. Sie wünschte plötzlich, daß Jenni reden sollte, unaufhaltsam reden, denn das wirkte beruhigend auf sie. Jenni redete, bis ihr dann der Schweiß auf der Stirn stand.
»So, Micky«, sagte sie, »jetzt hast du es bald geschafft.«
Als Dr. Laurin das Geburtszimmer betrat, redete Jenni gerade wieder tröstend auf Petra ein.
»Das Kinderkriegen ist anscheinend bei allen verschieden, Herr Doktor«, sagte sie. Dann war sie erschrocken, als Petra in den Operationssaal gebracht wurde. Sie wollte mit, aber Schwester Marie und Dr. Thiele erklärten ihr, daß sie hierbleiben könnte.
Jenni dachte nun nicht mehr an Petra Walden, denn eine halbe Stunde später konnte sie ihren Sohn schon im Arm halten.
*
Petra Walden dachte an Jenni, als sie die Narkose bekam. Sie wird ein gesundes Kind bekommen, kreiste es in ihrem Kopf, ein gesundes Kind, ein gesundes Kind!
Nur dieser Gedanke war dann noch da, und sie nahm ihn mit sich in die Bewußtlosigkeit.
Als sie wieder erwachte, hatte sie auch einen Sohn, doch selbst diese Nachricht konnte ihr kein Lächeln entlocken.
»Wie soll er denn heißen?« fragte Dr. Laurin.
»Michael«, erwiderte sie. Es war nur ein Hauch, dann schloß sie wieder die Augen.
»Zweimal Michael innerhalb einer Stunde«, sagte die Hebammenschwester Irma. »Zwei Prachtbuben.«
»Bitte nicht durcheinanderbringen«, sagte Dr. Laurin.
»Michael Burk, 3220 Gramm«, sagte die junge Schwester Liesa. »Michael Walden, 3159 Gramm, Länge bei beiden zweiundfünfzig Zentimeter. Schwarze Haare, blaue Augen.«
»Alle Kinder haben blaue Augen«, sagte Schwester Marie.
»Frau Walden hat sich nicht gefreut«, sagte Dr. Laurin später zu ihr. »Ich blicke nicht mehr durch. Haben Sie Herrn Walden schon angerufen?«
»Versucht habe ich es. Er ist nicht da.«
»Er ist nicht da?« fragte Dr. Laurin staunend. »Das gibt es doch gar nicht!«
»Es tut mir leid, Chef, aber das gibt es. Vielleicht liegt da doch der Kummer. Weiß man es? Manche Männer spielen nur nach außen hin den besorgten Ehemann.«
Schwester Marie blieb skeptisch, aber man brauchte es Frau Walden nicht zu sagen, daß man ihren Mann noch nicht erreicht hatte. Sie schlief den Schlaf tiefster Erschöpfung. Man hatte sie noch nicht in das vorbereitete Bett gelegt, denn bei Jenni Burk saßen die Schwiegereltern.
Später wurde dann Petra Walden in das Zimmer gefahren. Sie selbst merkte es gar nicht.
»Sie nennt ihren Sohn auch Michael«, sagte Schwester Marie.
»Ich werde es ihr doch nicht etwa suggeriert haben?« lächelte Jenni, die nun auch langsam müde wurde. »Vielleicht wollten sie ein Mädchen und hatten nur dafür Namen ausgesucht.«
Jenni schlief ein, mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen. Wie ein kleiner Kobold sah sie aus, und das war sie auch, denn sie hatte ihrem Mann einen Termin für die Geburt ihres Kindes mitgeteilt, der erst zehn Tage später sein sollte. Sie hatte sich nämlich ausgerechnet, daß sie dann schon mit dem Sohn daheim sein würde und es Mick erspart bliebe, in eine Klinik zu gehen, was ihm ohnehin nicht behagte. Doch davon hatte sie ihren Schwiegereltern nichts verraten. Mochten sie jetzt auch ungehalten sein, wenn Michael erst da war, war doch alles wieder gut.
Jenni machte sich keine Sorgen. Sie glaubte so fest an ihren Mann und an ihr Glück, daß nichts ihren Schlaf beunruhigen konnte.
*
Gerd Walden kam am Abend. Er war erregt, dann aber doch ein wenig erleichtert, als er vernahm, daß die Komplikationen nicht zu groß gewesen seien. Er entschuldigte sich bei Dr. Laurin damit, daß sein Vater plötzlich schwer erkrankt sei und er zu ihm habe fahren müssen.
Stimmte das? Dr. Laurin hegte plötzlich Zweifel. Es schien ihm auch so, als würde Gerd Walden sich über die Geburt seines Sohnes auch nicht freuen können.
Petra wachte auch nicht auf, als ihr Mann sie besuchte. Er hielt sich nicht lange auf, da es schon spät war, und sagte, daß er morgen früh wiederkommen wolle.
Er hatte nicht verlangt, seinen Sohn zu sehen. Dr. Laurin wußte nicht, daß zu dieser Stunde Gustav Walden bereits gestorben war und daß Gerd Walden noch ganz unter diesem Eindruck stand.
Das einzig Erfreuliche an diesem Tag war für Dr. Laurin nur Jenni Burk gewesen, doch er ahnte nicht, wie bald auch sie in Sorgen gestürzt werden würde.
»Irgendwie finde ich es schon sehr komisch, daß Frau Walden ihren Sohn auch Michael genannt hat«, sagte Antonia dann auch noch.
»Komisch finde ich das gar nicht«, sagte Leon. »Sie muß sich in einer ganz entsetzlichen Verwirrung befinden.«
Der nächste Tag sollte es bestätigen.
*
Schwester Liesa sah an diesem Morgen verheult aus, wie Schwester Marie mit leisem Unwillen feststellte, denn Liesa sah in letzter Zeit ziemlich oft so aus.
Sie hatte Liebeskummer.
»Nehmen Sie sich endlich zusammen«, sagte Schwester Marie zu der jungen Kollegin.
Da flossen die Tränen schon wieder.
»Es ist gleich zehn Uhr. Bringen Sie die Neugeborenen zum Zimmer 8«, sagte Schwester Marie. »Himmel, wenn Sie so zerstreut sind, kriegen wir noch Scherereien.«
Die Scherereien kamen prompt.
Petra hatte noch kein Wort mit Jenni gewechselt, die eben von ihren Schwiegereltern angerufen wurde. Sie beendete das Gespräch dann rasch. »Jetzt kommt Micky«, sagte sie. »Bis nachher, Mummy.«
Sie setzte sich auf, und nun hatte sie nur noch Augen für das Baby, das man ihr in den Arm legte. Zärtlich betrachtete sie es und hielt das winzige Händchen fest.
»Das ist nicht mein Kind«, sagte da Petra Walden plötzlich mit schriller Stimme. »Sie haben mein Kind vertauscht. Sie haben es Frau Burk gegeben.«
Jenni war fassungslos.
»Micky ist mein Sohn! Ich kenne ihn genau. Das hier ist mein Kind.«
Schwester Liesa verlor die Nerven. Weinend lief sie aus dem Zimmer, und wenig später erschienen Dr. Laurin und Schwester Marie.
»In unserer Klinik werden keine Kinder vertauscht, Frau Walden«, sagte Dr. Laurin. »Sie brauchen sich darum wirklich keine Gedanken zu machen. Die Kinder bekommen sofort ein Klebebändchen mit dem Namen und der Blutgruppe.«
»Das ist nicht mein Kind«, beharrte Petra wieder.
Auch Jenni lächelte nicht mehr.
Jetzt stand Entsetzen in ihren Augen.
»Ich lasse mir mein Baby nicht wegnehmen. Es ist mein Micky! Er hat die kleine Schramme an der Stirn. Da, sehen Sie, Herr Doktor.«
Dr. Laurin war jetzt überzeugt, daß Petra Walden unter einer schweren Psychose litt und machte sich Vorwürfe, daß er ihren Zustand doch nicht ernst genug eingeschätzt hatte.
»Frau Walden wird nach Zimmer 6 c verlegt«, sagte er, um wenigstens für Jenni Ruhe zu schaffen.
»Ich will mein Kind haben«, schluchzte Petra hysterisch. »Mein Kind, nicht ein anderes.«
»Ich komme nachher gleich zu Ihnen, Frau Burk«, sagte Dr. Laurin leise.
Dann sorgte er dafür, daß seine Anordnungen befolgt wurden.
»Warum sagen Sie das, Frau Walden?« fragte er ruhig.
»Weil es stimmt«, stieß sie hervor. »Ich weiß es ganz sicher.«
Sie war in einem bedenklichen Erregungszustand. Er gab ihr ein Beruhigungsmittel.
Mit gefurchter Stirn beriet er sich dann mit den Ärzten.
»Es kann kein Versehen sein«, sagte Dr. Rasmus. »Michael Burk hat Blutgruppe Null, Michael Walden Blutgruppe AB. Es ist alles vermerkt.«
»Ich muß dahinterkommen, was mit Frau Walden los ist«, sagte Dr. Laurin.
»Dr. Walden wartet auf Sie«, schallte Hannas Stimme aus dem Sprechapparat.
Gerd Walden war zu seiner Frau gegangen und hatte ihr Rosen gebracht.
»Sie haben unser Kind vertauscht«, sagte sie auch zu ihm.
Gerd Walden war unter der Last aller Sorgen, die ihn bedrückten, dem Zusammenbruch nahe.
Dr. Laurin sah es. Er bemerkte die Verzweiflung in den Augen des anderen.
»Meine Frau behauptet…« Gerd Walden kam nicht weiter.
»Ich weiß, was Ihre Frau sagt«, fiel ihm Dr. Laurin ins Wort, »aber es ist unmöglich, daß die Kinder vertauscht worden sind.«
»Ich glaube es ja auch nicht, aber ich kann mir einfach nicht mehr erklären, was mit Petra los ist«, sagte Gerd Walden. »Es ist erschreckend und bedrückend, welche Wandlung mit ihr vor sich gegangen ist.«
»Haben Sie Eheschwierigkeiten?« fragte Dr. Laurin sehr direkt.
»Du lieber Gott, ich habe andere Sorgen. Mein Vater ist gestorben. Ich wollte es gestern nicht sagen. Es ist schrecklich, wenn ein Kind am gleichen Tag geboren wird, wenn sein Großvater stirbt. Mein Vater hat sich sehr auf den Enkel gefreut.«
»War Ihr Vater länger krank?« fragte Dr. Laurin.
»Sicher schon länger. Er hat es nicht gezeigt. Natürlich hat es mich sehr bedrückt, als ich erfuhr, daß er nicht mehr zu retten ist, aber am meisten sorgte ich mich doch um meine Frau. Sie mochte meinen Vater sehr gern.«
»Wußte sie von seiner Krankheit? Sind ihre Depressionen etwa darauf zurückzuführen?«
»Nein, ich habe ihr nichts gesagt. Ich habe doch alles von ihr ferngehalten, was sie betrüben könnte. Es ist mir unerklärlich, wodurch sie so verändert ist. Sie darf keinesfalls erfahren, daß mein Vater gestorben ist.«
»Hatten Sie den Namen Michael für Ihren Sohn ausgesucht?« fragte Dr. Laurin geistesabwesend.
»Nein, sie wollte einen Dominik.«
Er schüttelte nur immer wieder den Kopf.
»Aber sie hat den Namen Michael genannt. So heißt auch Frau Burks Sohn. Die beiden waren zusammen im Entbindungszimmer. Ich dachte, daß es aufmunternd für Ihre Frau wäre, denn Frau Burk ist reizend und völlig unkompliziert. Herr Walden, wir müssen Ihnen Blut abnehmen, um jeden Irrtum auszuschließen. Ich muß mich rückversichern, obgleich es unmöglich scheint, daß die Kinder vertauscht wurden. Frau Burk hat eine halbe Stunde vor Ihrer Frau entbunden. Da war das Kind schon versorgt. Es trug sein Bändchen schon am Arm.«
»Glauben Sie, daß meine Frau an Geistesverwirrung leidet?« fragte Gerd Walden leise.
»Unter einer Psychose auf jeden Fall. Das kann für eine Wöchnerin bedenklich sein. Aus diesem Grund bitte ich Sie, mir alles zu sagen, auch wenn es Ihnen unangenehm sein sollte.«
»Aber was soll ich sagen? Ich liebe meine Frau, ich sorge mich um sie. Es wäre schrecklich, wenn…«
Er unterbrach sich. Man sah, daß er am Ende seiner Kräfte war.
*
Gerd Walden saß wieder am Bett seiner Frau und hielt ihre Hände. Der Blick, mit dem sie ihn angesehen hatte, erzeugte ein beklemmendes Angstgefühl in ihm, denn er war so abwesend und trostlos, daß man das Schlimmste fürchten konnte.
»Petra, mein Liebling«, sagte er bebend, »bedeutet es dir denn nichts, daß ich bei dir bin?«
»Es bedeutet mir so viel, Gerd, so unendlich viel«, flüsterte sie. »Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.«
Solche rätselhaften Worte machten ihn mutlos. Er gelangte zu der Überzeugung, daß sie schwerkrank sein müsse. Wenn er nur die geringste Ahnung gehabt hätte, womit sie sich quälte, wie leicht hätte er sie von all diesen Qualen befreien können! So war er nur darauf bedacht, ihr noch mehr Aufregung zu ersparen.
»Unser Michael ist ein gesundes, kräftiges Kind«, sagte er tröstend, da er meinte, daß sie sich deshalb Sorgen machen könnte.
Petra schloß die Augen.
»Ein gesundes, kräftiges Kind«, wiederholte sie monoton. »Hat sich jetzt alles geklärt?«
»Ja, es hat sich alles geklärt«, sagte Gerd Walden.
Als Petra eingeschlafen war, ging er zur Säuglingsstation. Dort war Schwester Irma, die ihn auch mit einem Blick betrachtete, in dem er Furcht zu lesen glaubte.
»Kann ich meinen Sohn sehen?« fragte er mit belegter Stimme.
»Gewiß, Herr Doktor«, erwiderte sie. »Ein hübsches, munteres Kerlchen.«
Er betrachtete sie nachdenklich. »Eine Verwechslung ist wirklich ausgeschlossen?« fragte er.
»Bestimmt. Ich war bei der Geburt des kleinen Burk dabei.«
Sie brachte das Baby, seinen Sohn, der friedlich schlief, die
Fäustchen an die Wangen gepreßt. Er sah ihn lange an.
»Kann ich das andere Baby auch sehen?« fragte er dann. Auch das wurde ihm gewährt.
Gerd Walden fand keine großen Unterschiede zwischen diesen beiden Säuglingen. Sie hatten beide schwarze Haare und runde Köpfchen.
»Danke«, sagte er mit rauher Stimme. Das war alles, was er hervorbringen konnte.
Als Renate und Willy Burk kamen, fanden sie Jenni in Tränen aufgelöst vor.
Natürlich meinten sie, daß sie nun doch traurig sei, weil ihr Mann immer noch nicht gekommen war, aber sie erfuhren schnell den wirklichen Grund.
»Dr. Laurin kann nichts dafür. Es ist unser Micky, ich weiß es ganz genau. Ich kenne mein Kind. Ich würde es unter Dutzenden herausfinden. Daran ist nur diese hysterische Frau schuld.«
Da es um ihr Kind ging, kannte selbst die tolerante Jenni keine Nachsicht.
Dr. Laurin mußte sich mit einer zornerfüllten Großmama auseinandersetzen. Renate Burk fragte, wie so etwas in einer so renommierten Klinik überhaupt passieren könne.
Er erklärte es so, daß Petra Walden in der letzten Zeit der Schwangerschaft unter einer Psychose gelitten hätte und daß man noch nach der Ursache forsche.
»Diese Frau Walden ist krank, gemütskrank, wie es scheint«, sagte sie zu Jenni, und damit wurde sofort wieder deren Mitgefühl erregt.
»Ist so etwas vererbbar?« fragte sie.
Dr. Laurin, der Frau Burk in Jennis Zimmer begleitet hatte, sah die junge Frau nachdenklich an. Eine Idee kam ihm bei dieser Frage. Eine seltsame Idee, aber er mußte darüber nachdenken.
Für Jenni Burk war die Welt wieder in Ordnung und für ihre Schwiegereltern auch, als sie wieder in strahlende Augen blicken konnten.
»Mick dürft ihr nicht böse sein«, sagte Jenni. »Er denkt doch, daß das Baby erst später kommt. So habe ich es ihm nämlich geschrieben.«
Das wollte sie nun lieber doch zugeben.
*
Dr. Laurin führte indessen ein ernstes Gespräch mit Schwester Marie, die ihm nun doch nicht vorenthalten wollte, daß Schwester Liesa manchmal gar nicht bei der Sache war.
»Ich mache mir ehrlich Gedanken, ob durch ihre Unachtsamkeit nicht doch eine Verwechslung vorgekommen sein könnte«, sagte Schwester Marie.
»Machen Sie mich nicht schwach«, ächzte Dr. Laurin. »Nein, es hat alles seine Richtigkeit. Frau Burk kennt ihr Kind ganz genau, und die Untersuchung hat ergeben, daß Dr. Walden mit größter Wahrscheinlichkeit der Vater des anderen Michael ist.«
»Mit größter Wahrscheinlichkeit?«
»Sie wissen doch, Marie, mit Sicherheit kann man nur sagen, wenn einer nicht der Vater sein kann.«
»Eine Mutter soll das Kind nicht erkennen, das sie selbst zur Welt gebracht hat? Oder nicht anerkennen wollen?«
»Da liegt der Haken«, erwiderte Dr. Laurin gedankenvoll. »Dieses Geheimnis gilt es zu lüften. Nun werden wir Frau Walden mal ihr richtiges Baby bringen. Mal sehen, was sie jetzt sagt.«
Aber das war nicht möglich.
Petra Walden hatte hohes Fieber, und dadurch wurde für Dr. Laurin eine beunruhigende Situation geschaffen. Alles übrige mußte in den Hintergrund treten.
*
Gegen Abend wurde die Lage kritisch. Petra Walden lag in wilden Fieberphantasien. Schwester Marie hielt Wache an ihrem Bett.
»Nicht sterben, er soll nicht sterben«, stöhnte Petra. Zuerst hatte es Schwester Marie nicht verstanden, doch dann schien es ihr wichtig genug, es sofort Dr. Laurin zu berichten.
»Ob sie das Kind meint?« fragte sie.
»Vielleicht wußte sie doch etwas von der Krankheit ihres Schwiegervaters. Er ist übrigens gestorben«, sagte Dr. Laurin geistesabwesend. »Ich muß noch einmal mit Herrn Walden sprechen.«
Was er sich sonst noch dachte, sprach er nicht aus. Es war nur eine Kombination, die ihm absurd erschien, aber es war so vieles absurd im Zusammenhang mit Petra Walden, daß er auch dies durchdenken wollte.
Vererbbar!
Das Wort hatte Jenni Burk ausgesprochen und dabei an eine mögliche Gemütskrankheit gedacht. Aber vielleicht hatte Petra Walden sich über die Vererbbarkeit anderer Krankheiten Gedanken gemacht. Vielleicht war sie durch solche Gedanken in eine panische Angst versetzt worden, die sie dazu bewegt hatte, ihr Kind zu verleugnen.
Dieses Problem galt es zu lösen, wenn Petra Walden wieder ganz gesund werden sollte.
*
Dr. Walden kam sofort, nachdem er angerufen worden war. Die Verzweiflung stand auf seinem Gesicht geschrieben, denn auch er befürchtete das Schlimmste für seine Frau.
Morgen wurde sein Vater beerdigt. Da mußte er zugegen sein. Nun mußte er auch die Fragen Dr. Laurins ertragen. Es war unumgänglich, so leid dem Arzt der Mann auch tat.
»Sie sagten, daß Ihre Frau sehr an Ihrem Vater hing«, begann Dr. Laurin stockend.
Gerd Walden nickte. »Petra hat ihre Eltern früh verloren. Nicht durch den Tod. Sie ließen sich scheiden. Das Kind wurde dem Vater zugesprochen, aber da er sich nicht um Petra kümmern konnte, kam sie in ein Internat. Aber Sie wollten ja nur wissen, warum Petra so sehr an meinem Vater hing.« Er sah Dr. Laurin verwirrt an.
»Nein, erzählen Sie nur. Es interessiert mich sehr, Herr Walden. Es muß einen sehr triftigen Grund geben, der zu der augenblicklichen Gemütsverfassung Ihrer Frau führte. Wie lernten Sie Ihre Frau kennen?«
Gerd Waldens Gesicht entspannte sich etwas. »Rein zufällig, auf der Straße, wundert Sie das sehr?«
»Nein, gar nicht«, erwiderte Dr. Laurin mit einem flüchtigen Lächeln. »Genaugenommen habe ich meine Frau auch auf der Straße kennengelernt, obgleich wir im gleichen Haus unsere Praxisräume hatten. Meine Frau war früher Ärztin. Jetzt ist sie mit unseren vier Trabanten vollauf beschäftigt.«
Er sagte es, um Gerd Walden das Gefühl zu nehmen, daß er ihn nur aushorchen wollte. Der Mann war nicht eine Spur arrogant. Er sagte nicht ein einziges Wort gegen seine Frau. Dr. Laurin spürte, daß echte Liebe ihn an Petra band.
»Ich hatte es wahnsinnig eilig an diesem Tag«, fuhr Dr. Walden fort. »Eine sehr wichtige und dringende Verabredung mit einem Geschäftspartner. Petra wohnte im selben Hotel. Weder ihr Vater noch ihre Mutter, obgleich sie beide nahe bei München wohnen, hatten sie bei sich aufgenommen, als sie aus dem Internat kam. Ihr Vater hatte sich mit ihr im Hotel getroffen. Petra war sehr niedergeschlagen an diesem Tag, weil er ihr eröffnet hatte, daß er für ihr geplantes Studium nicht aufkommen würde. Sie hatte Tränen in den Augen, als ich mit ihr zusammenstieß. Ich kann es nicht anders sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Sie war so jung und so bezaubernd. Ich sagte, sie solle in dem Café auf mich warten, das sich im Erdgeschoß des Hotels befand. Meine geschäftliche Unterredung dauerte ziemlich lange, aber Petra wartete. Sie brauchte einen Menschen, mit dem sie reden konnte. Wir tranken Kaffee und verbrachten den Abend auch noch miteinander. Petra erzählte mir alles, was sie bedrückte. Vielleicht hat sie sich am Ende der Schwangerschaft Gedanken gemacht, wie wenig Eltern und Kinder verbinden kann. Darüber habe ich auch nachgedacht. Ihr seltsames Benehmen läßt den Rückschluß zu, daß sie auch die Befürchtung hegte, ich könne sie verlassen und ihr Kind, unser Kind, müsse so aufwachsen, wie sie selbst aufgewachsen ist. Ich habe ihr bestimmt keinen Anlaß gegeben, diese Befürchtungen zu hegen, aber man weiß nie, was in einem Menschen vor sich geht.«
»Nein, man weiß nicht, was sich im Innern eines Menschen abspielt, welche Veränderungen mit der Zeit in ihm vor sich gehen. Erzählen Sie bitte weiter. Es interessiert mich sehr, wie Petra dann Ihren Vater kennenlernte«, sagte Dr. Laurin.
»Das geschah sehr bald«, sagte Gerd Walden. »Ich bin sonst eigentlich nicht impulsiv, aber ich nahm Petra schon zwei Tage später mit zu meinem Vater, der am Chiemsee lebte. Ich muß sagen, daß ich fast eifersüchtig war, wie gut sich beide gleich verstanden. Sie betrachtete meinen Vater als vollwertigen Ersatz für ihre Eltern. Wir lebten im ersten Jahr unserer Ehe auch mit ihm zusammen, dann jedoch meinte er, daß die Hin- und Herfahrerei zu beschwerlich für mich werden würde, und wir ließen das Haus bauen. Aber wir waren oft am Chiemsee. Mehr und mehr überließ mir Vater die Leitung der Fabrik. Er muß schon ziemlich lange gewußt haben, daß er eine tödliche Krankheit in sich trug. Er war dann vor einem Vierteljahr, auch drei Wochen in einer Klinik. Wir hatten verabredet, Petra zu sagen, daß er sich zur Kur befände, damit ihr die Aufregungen erspart blieben. Ich bekam dann die Gewißheit, daß Vater unheilbar krank sei durch ein ärztliches Gutachten.«
Er versank in Schweigen. Seine Wangenmuskeln zuckten, seine Hände verschlangen sich fest ineinander, daß die Knöchel weiß hervortraten.
»Aber Sie sagten Ihrer Frau nichts?« fragte er.
»Nein.«
»Kann sie es von jemand anderem erfahren haben?«
»Von wem schon? Vater sagte es doch selbst mir nicht. Er bat mich nur darum, nicht mehr mit Petra zu kommen. Er meinte, daß sie geschont werden müsse. Es hat ihn so glücklich gemacht, daß sie ein Kind erwartete. Es war ihm versagt, die Geburt noch zu erleben.«
»Ihre Frau hat im Fieber gesprochen, Herr Walden«, sagte Dr. Laurin nach langem Überlegen. »›Nicht sterben, er soll nicht sterben‹, sagte sie. Schwester Marie hat es mir berichtet. Ihre Frau muß etwas gewußt haben.«
Gerd Walden schüttelte den Kopf.
»Darf ich erfahren, was es für eine Krankheit war?« fragte Dr. Laurin.
»Krebs. Ein Tumor an der Niere, der inoperabel war, als man es erkannte. Mein Vater war siebzig. Er war mit sich und mit Gott im Reinen, Herr Laurin. Er war ein großartiger Mann, und ganz gewiß wäre es für ihn entsetzlich, wenn Angst um ihn zu Petras Zustand beigetragen hätte. Herr Laurin, Sie müssen alles tun, damit meine Frau wieder gesund wird, damit sie so wird, wie sie früher war. Unsere Ehe war unbeschreiblich glücklich. Petra hat so viel Freude in unser Leben gebracht. Sie müssen doch wissen, wie selig sie war, als sie die Gewißheit hatte, Mutter zu werden.«
»Ja, ich weiß es. Sie war hinreißend«, erwiderte Dr. Laurin. »Sie dürfen versichert sein, daß ich alles tun werde, um ihr zu helfen.«
Aber wie sollte er ihr helfen? In ihr Inneres konnte er nicht hineinschauen.
*
Dr. Gerd Walden fand keine Ruhe in seinem Haus. Er ging von einem Raum in den anderen, und dann faßte er plötzlich den Entschluß, sein Testament zu machen. Wenn Petra nicht wieder gesund würde, wollte er auch nicht mehr leben.
Er setzte sich an seinen Schreibtisch, zog die Schublade auf und wollte sein Briefpapier herausnehmen, als sein Blick plötzlich auf das Scheckheft fiel. Es lag immer am gleichen Platz. Wie hypnotisiert starrte er es an.
Jener Tag stand wieder vor seinen Augen, an dem sie ihr Scheckheft verlegt und seines gesucht hatte.
In dieser Schreibtischschublade, und in dieser hatte er auch den ärztlichen Befund seines Vaters aufbewahrt. Nur für einen Tag, weil Petra ihn am Vorabend fast beim Lesen überrascht hatte.
Er erinnerte sich jetzt ganz genau. Er überlegte, ob Petra den Befund gelesen hatte. War das des Rätsels Lösung?
Aber warum hatte sie ihn nicht gefragt, warum hatte sie nicht mit ihm gesprochen? Hatte sie darauf gewartet, daß er etwas sagen würde?
Seine Erkenntnisse schienen ihm jedoch wichtig genug, um Dr. Laurin zu benachrichtigen. Er hatte ihm gesagt, daß jede Kleinigkeit wichtig für ihn sei.
Er rief in der Klinik an. Es war einundzwanzig Uhr vorbei, und man sagte ihm, daß Dr. Laurin zu Hause sei. Man nannte ihm auch die Privatnummer, unter der er zu erreichen wäre.
*
Es war Mittwoch, und bei den Laurins war Familientreffen. Professor Joachim Kayser mit seiner Frau Teresa, sein Bruder Bert und dessen Frau Monika, Leons Schwester mit ihrem Mann, dem Kriminalkommissar Andreas Brink, waren im Hause Laurin versammelt.
Joachim Kayser hatte seinen Schwiegersohn beiseite genommen. »Du hast doch Sorgen, Leon«, sagte er. »Worum handelt es sich diesmal?«
Leon überlegte, ob er mit seinem Schwiegervater darüber sprechen sollte. Von ihm hatte er die Klinik schließlich übernommen, aber da sie früher bedeutend kleiner gewesen war und die Zeiten noch viel geruhsamer, hatte Professor Joachim Kayser während seiner langen Praxis bei weitem nicht so viele Aufregungen gehabt wie Leon.
»Leon, Telefon!« rief Antonia durch die Tür. »Herr Walden möchte dich sprechen.«
»Entschuldige«, sagte Leon zu seinem Schwiegervater.
Der Professor gesellte sich wieder zu der Runde. »Einen ganz ruhigen Abend gibt es bei euch wohl auch nie?« sagte er zu seiner Tochter Antonia.
»Manchmal doch, Paps«, meinte Antonia lächelnd, »aber sonst gewöhnt man sich an alles.«
»Es ist gut, daß wenigstens du nicht mehr dauernd aufgescheucht wirst«, sagte Joachim.
»Das wäre noch schöner«, mischte sich Teresa ein. »Antonia wird den ganzen Tag über auf Trab gehalten. Kyra wird auch schon recht lebhaft.«
»Bei uns fangen nun die Probleme an mit der Schule«, warf Sandra Brink ein. »Stellt euch nur vor, im Gymnasium haben sie eingebrochen. Und wer war es? So ein paar vierzehnjährige Rangen, die sich an ihren Lehrern rächen wollten. Es ist einfach nicht zu glauben. Söhne aus besten Familien. Man legt die Ohren an.«
Ihr Sohn Leon sollte im Herbst auf das Gymnasium kommen, und es war verständlich, daß Sandra sich Sorgen machte, in welche Gesellschaft er dann geraten würde.
»Leon hat ja einen Kommissar zum Vater«, meinte Teresa mit ihrem unverwüstlichen Humor.
»Gott bewahre uns, daß wir so was ausstehen müssen«, meinte Andreas Brink.
»Ich werde mir Leon mal vornehmen«, sagte der Professor.
»Mich hast du überhaupt nicht aufgeklärt, Paps«, sagte Antonia neckend. »Was hättest du eigentlich gesagt, wenn ich Antibabypillen von dir verlangt hätte?«
»Da war das noch gar nicht spruchreif«, sagte ihr Vater, »und außerdem bin ich noch heute skeptisch, ob sie nicht doch schädlich sind.«
Da kam Leon zurück. Seine Stirn war umwölkt.
»Schlechte Nachrichten?« fragte Antonia sofort.
»Ich weiß nicht. Vielleicht helfen sie weiter. Ihr habt gerade über Antibabypillen geredet. Wer braucht welche? Du etwa, Teresa?« Er flüchtete sich in die Ironie.
»Ach was, ich hätte liebend gern noch Kinder bekommen«, sagte Teresa.
»Ich habe bloß den Zeitpunkt verpaßt.«
Sie hatte ihren Jugendfreund Joachim Kayser erst im reifen Alter geheiratet, nachdem Antonias Mutter schon lange Zeit tot war, und nur die Eingeweihten wußten noch, daß sie Leon und Sandra mütterliche Freundin war und wegen der beiden, die sie aufgezogen hatte, auf Joachim verzichtet hatte, als sie noch sehr jung war. Teresa war dennoch die ideale Frau für Joachim, und eigentlich war sie der Mittelpunkt der ganzen Familie geworden.
Monika Kayser hatte zu ihrem Unglück Antibabypillen nie gebraucht. Sie hätte auch liebend gern eigene Kinder gehabt, aber glücklicherweise mit den beiden liebenswerten Adoptivkindern Florian und Pamela ihre Probleme lösen können.
Jetzt sprachen sie erst einmal über den Nachwuchs, und Leon brauchte nichts von Gerd Waldens Anruf zu erzählen.
»Kennst du zufällig Gerd Walden, Bert?« fragte Leon.
»Nicht, daß ich wüßte, außer, daß wir beinahe den gleichen Vornamen haben«, sagte der Ältere, »aber warte mal, meinst du den Junior von der Arzneimittelfirma?«
»Genau den.«
»Gustav Walden ist vor ein paar Tagen gestorben, das war der Senior«, sagte Bert.
»Ich habe es gelesen. Große Nachrufe. Es war ein sozialer Arbeitgeber.«
Das war wichtig für ihn, denn er war auch einer von jenen, die nicht nur an eigenen Profit dachten.
»Jetzt ist Gerd Walden der Senior«, sagte Leon. »Der Junior ist vor ein paar Tagen zur Welt gekommen.«
»In der Prof.-Kayser-Klinik«, schaltete sich Antonia ein.
»Dann ist die Nachfolge ja gesichert«, sagte Bert.
Professor Kayser war dicht an seinen Schwiegersohn herangetreten. »Sind das deine Probleme, Leon?« fragte er leise.
»Vielleicht können wir später darüber sprechen, Paps«, sagte Leon.
Teresa schaltete auch schnell.
»Du wolltest von Pamela erzählen, Bert«, sagte sie.
Florian und Pamela gehörten genauso zur Familie wie die Kinder von den Brinks, Leon und Lena, und die vier kleinen Laurins.
»Ach, Pamela macht es bloß Sorgen, daß alle in ihrer Klasse schon einen Busen bekommen und sie noch nicht«, sagte Monika.
»Na, die Buben bekommen doch nicht hoffentlich auch einen?« scherzte Andreas, worauf er einen strafenden Blick von seiner Frau erntete.
»In meiner Jugendzeit waren das alles noch Tabus«, mischte sich Teresa ein. »Aber heutzutage kann man ja über alles sprechen.«
»Gott sei Dank«, sagte Andreas. »Es ist ziemlich ulkig, wenn man von seinen Kindern aufgeklärt wird.«
»Immerhin ist es auch ziemlich ulkig, wenn man plötzlich Fragen gestellt bekommt, wie es Sandra liebte«, lächelte Teresa.
»Ich hatte ja einen Bruder, der schon bestens Bescheid wußte«, sagte Sandra anzüglich. Worauf Antonia ihrem Mann einen spöttischen Blick zuwarf, aber Leon war mit seinen Gedanken weit entfernt und reagierte nicht.
Kurz darauf zogen sich Leon und Professor Kayser in das Bauernzimmer zurück, um sich zu unterhalten. Wenn der Professor sich sonst auch nicht mehr in den Tätigkeitsbereich seines Schwiegersohnes einmischte, denn er hatte als Großpapa seine neue Lebensaufgabe gefunden, so war er doch immer beratend zur Stelle, wenn Leon mit Problemen zu kämpfen hatte.
Leon schilderte seinem Schwiegervater den Fall Petra Walden.
Nach einiger Zeit steckte Antonia den Kopf zur Tür herein. »Zwei, die sich anscheinend wieder einmal bestens verstehen«, bemerkte sie lächelnd. »Aber ihr sitzt ganz trocken. Soll ich euch nicht etwas bringen?«
»Meinetwegen«, murmelte er. »Was hättest du für Gedanken gehabt, wenn du… Ach, das ist doch Blödsinn, du als Ärztin hättest natürlich gewußt, daß Krebs nicht vererbbar ist.«
Antonia sah ihn aufmerksam an. »Die Anlagen schon. Ja, ich bin überzeugt, daß sie erblich sind«, sagte sie. »Es geht um Petra Walden? Ist ihr Schwiegervater an Krebs gestorben?«
Leon nickte. »Ich weiß nicht mehr weiter, Antonia«, sagte er leise.
Während er sich bemühte, seiner Frau alles klarzumachen, läutete das Telefon wieder.
Diesmal war es die Klinik. Man rief ihn, weil Petra Waldens Zustand sich noch verschlimmert hatte.
*
An diesem Abend kehrte auch Michael Burk heim. Sein Flugzeug kam mit zweistündiger Verspätung an.
»Junge, endlich«, wurde er von seiner Mutter begrüßt.
»Wo ist Jenni?« war seine erste Frage.
»Wo soll sie sein?« dröhnte die Stimme seines Vaters durch die Diele. »In der Klinik natürlich.«
»Drei Tage ist unser Micky schon auf der Welt«, sagte seine Mutter.
»Ein Kampf war auch schon um ihn entbrannt«, fügte sein Vater hinzu.
»Wieso Kampf? Guter Gott, Jenni schrieb doch… Ach, da hat sie sich wieder etwas ausgedacht. Ich kenne sie ja. Nun redet doch schon! Wie geht es ihr?«
»Gut, und wir würden auch ganz gut ohne dich auskommen, du Rabenvater«, sagte Willy Burk, aber die innige Umarmung für seinen Sohn strafte seine Worte Lügen.
»Ich muß gleich zu ihr«, stieß Michael hervor.
»Heute nicht mehr. Weißt du nicht, wie spät es ist?« fragte seine Mutter. »Jenni schläft schon, und Aufregung hatten sie mit uns wahrhaftig genug.«
»Wieso? Erzählt doch! Was war mit Jenni?«
»Setz dich erstmal hin, Michael«, drängte Willy Burk. »Du bist Vater eines prächtigen Buben.«
»Wonnig ist er«, mischte sich Renate Burk ein. »Eine Frau hast du, die mußt du dir noch verdienen, du Lauser.«
»Ich habe sie doch geheiratet«, sagte Michael.
»Damit ist es nicht getan. Wir geben sie jedenfalls nicht mehr her«, bekam er von seiner Mutter zu hören.
»Nun mal hübsch langsam, Mama«, stöhnte Michael.
»Mummy klingt viel hübscher«, sagte sie. »Und wenn einer langsam ist, dann bist du es.«
»Das sag nicht noch mal. Schließlich muß ich die Brötchen für eine Familie verdienen.«
»Aber nicht gerade im fernsten Teil der Welt«, protestierte sie.
»Von Geographie hattest du ja immer wenig Ahnung, Mummy«, sagte Michael scherzend. »Jetzt reden wir aber von Jenni und meinem Sohn.«
»Jennis Sohn«, widersprach sein Vater.
»Na schön, dann bin ich auch nur Mummys Sohn«, sagte Michael anzüglich. »Ich kann doch nichts dafür, wenn Jenni mir schreibt, er käme erst Anfang nächster Woche zur Welt. Ich habe ganz nebenbei noch ein paar tolle Reportagen machen können. Schließlich wollte ich meiner Frau doch auch etwas Schönes mitbringen.«
»Was denn?« erkundigte sich seine Mutter neugierig.
»Du wirst es schon noch sehen. Vielleicht erlaubt ihr mir auch, daß ich mir den Staub abwasche. Ich habe wahrhaftig nicht gedacht, daß meine Frau mich völlig aus euren Herzen verdrängen würde.«
Das war nun doch nicht der Fall. Er wurde umsorgt und verwöhnt, und dann wurde erzählt.
Man kann sich vorstellen, daß Michael Burk, nach allem, was er erfahren hatte, keine freundlichen Gedanken für Petra Walden hegte, und doch hätte er wohl auch Mitleid mit ihr gehabt, wenn er sie so gesehen hätte, wie sie jetzt da lag.
Dr. Rasmus stand der Angstschweiß auf der Stirn, als Dr. Laurin kam. Das Fieber hatten sie zwar drücken können, aber dann hatte Petra einen Kreislaufkollaps bekommen. Es war häufig der Fall bei geschwächten Wöchnerinnen, aber nicht in so bedrohlichem Maße wie bei Petra Walden.
Fast die ganze Nacht ging darüber hin, bis die Gefahr halbwegs gebannt war. Dann kam Petra kurz zu sich und rief nach ihrem Mann. Plötzlich richtete sie sich auf und sah Dr. Laurin mit schreckensweiten Augen an.
»Gerd muß sterben, er muß sterben«, stöhnte sie.
»Nein, Frau Walden, beruhigen Sie sich doch«, sagte Dr. Laurin. »Ihrem Mann geht es gut. Soll ich ihn rufen?«
Es war jetzt fünf Uhr morgens, und Dr. Laurin dachte daran, daß Gerd Walden heute zu der Beerdigung seines Vaters fahren mußte.
Wieso kam sie eigentlich dazu zu denken, daß ihr Mann sterben müsse? Wenn er doch nur endlich wüßte, was hinter dieser Stirn vor sich ging!
Petra war in die Kissen zurückgefallen. Ihr Atem ging schnell und unregelmäßig. Dr. Laurin gab Dr. Rasmus einen Wink, daß er gehen könne. Nun war er allein mit ihr.
»Hören Sie mich, Frau Walden?« fragte er eindringlich, denn Petra hatte die Augen wieder geschlossen.
Sie nickte. Sie war sehr matt, aber Dr. Laurin spürte, daß sie nachdachte.
»Wissen Sie noch, wie wir uns miteinander gefreut haben?« fragte er behutsam.
»Ich kann mich nicht mehr freuen«, erwiderte sie tonlos.
»Warum nicht, Frau Walden? Sprechen Sie!«
»Gerd ist krank. Er ist nicht zu retten. Ich habe es gelesen.«
Dr. Laurins Gedanken arbeiteten fieberhaft. »Einen ärztlichen Befund?« fragte er dann, weil er an Gerd Waldens Anruf dachte.
»Ja.« Sie schluchzte trocken auf, dann strömten Tränen über ihre Wangen.
Er tupfte sie ab.
»Der Befund betraf Ihren Schwiegervater«, sagte er dann nach einem kurzen Zögern.
Drangen seine Worte noch in ihr Bewußtsein? Blaß und bewegungslos lag sie da.
»Papa?« rang es sich dann fragend von ihren Lippen.
»Sie müssen mir alles sagen, was Sie bewegt, Frau Walden«, sagte Dr. Laurin wieder eindringlich. »Sie müssen gesund werden, für Ihren Mann und für Ihr Kind. Für einen gesunden Mann und ein gesundes Kind«, betonte er.
Sekunden des Schweigens verstrichen, und Dr. Laurin beobachtete die Kranke unentwegt.
»Papa… Was ist mit Papa?« fragte sie dann.
Dr. Laurin fühlte den Puls der Kranken, der zu jagen begann.
Neue Angst erfüllte ihn.
Noch einmal schlug Petra die Augen auf. »Papa, nicht Gerd?« fragte sie mit leiser, aber klarer Stimme.
»Ja«, erwiderte Dr. Laurin, sich an die Hoffnung klammernd, daß dies die schlimmste Last von ihr nehmen würde.
Es kam kein Wort mehr über Petras blasse Lippen. Eine tiefe Ohnmacht verlöschte alle Gedanken.
Dr. Laurin hoffte auf den neuen Tag. Er hatte völlig vergessen, daß der längst begonnen hatte.
*
Michael Burk erschien an diesem Morgen als erster Besucher in der Prof.-Kayser-Klinik. Den Arm voller Blumen, kam er anspaziert, groß, dunkel, bronzebraun. Schwester Otti blieb die Luft weg, als er plötzlich vor ihr stand. Sie war jung und glücklich verheiratet, aber dieser Mann irritierte selbst sie.
»Burk«, stellte er sich vor. »Ich will zu meiner Frau.«
Ein dynamischer Mann war das. Na, hoffentlich würde es nun nicht nachträglich noch einen Wirbel mit ihm geben.
»Und nachher möchte ich Dr. Laurin sprechen«, sagte er da auch schon.
»Das wird heute vormittag leider nicht möglich sein. Er hat Sprechstunde«, erklärte Schwester Otti.
»Er wird für mich zu sprechen sein«, sagte Michael energisch.
»Melden Sie sich dann bitte in seinem Vorzimmer an«, sagte Schwester Otti eingeschüchtert. Leise öffnete sie dann auch die Tür zu Jenni Burks Zimmer.
Jenni hielt ihren Morgenschlaf. Micky hatte seine zweite Mahlzeit bereits zu sich genommen. Natürlich hatte Jenni darauf bestanden, ihr Kind zu stillen. Das gehörte sich so, war ihre Meinung. Sie hatte sich auf die Mutterschaft vorbereitet. Eine ganz enge Verbindung zwischen Mutter und Kind während der ersten Lebensmonate war durch nichts zu ersetzen. Das war auch heute, in diesem überaus modernen Zeitalter, nicht anders.
Allerdings war sie sehr angetan, wenn sich der Fortschritt so zeigte wie hier in der Prof.-Kayser-Klinik, daß man sein Kind tagsüber im Zimmer behalten konnte. Sie wollte ihren Micky auch nachts nicht hergeben, aber Dr. Laurin hatte doch gemeint, daß sie Nachtruhe brauche.
»Jenni, mein Baby«, sagte Michael leise.
»Mick«, juchzte Jenni auf, »du bist da.«
Sie hielten sich umschlungen, sie küßten sich erst einmal ausgiebig, aber dann begann Micky zu maunzen, als ahne er, daß sein Vater nun endlich gekommen sei.
Michael sah seinen Sohn ein wenig benommen an. »Gott, ist der winzig«, sagte er staunend.
Jenni lachte glucksend. »Leider ist es nicht möglich, ein Kind auf die Welt zu bringen, das schon laufen kann. Micky ist ganz schön kräftig. Ich wollte ja eigentlich schon daheim sein, wenn du kommst.«
»Du hast Nerven«, sagte Michael. »Die Eltern haben mir schon den Kopf gewaschen. Wie geht es dir, Liebes? Ist alles in Ordnung?«
»Das siehst du doch. Ist er nicht süß, unser Micky?«
»Du bist süß«, sagte Michael, der seinen Sohn lieber erst aus der Distanz betrachtete. Er, der Vater dieses Kindes, begriff jetzt erst dieses Wunder. »Wie ich hörte, hat es schon eine Menge Aufregung gegeben«, sagte er, nachdem er zaghaft die kleinen Finger gestreichelt hatte.
»Ist schon wieder vorbei«, meinte Jenni. »Ich würde mir doch kein anderes Kind unterschieben lassen. Ich kenne unseren Micky jetzt seit neun Monaten. Wir wissen ganz genau, daß wir zusammengehören. Micky weiß das auch.«
Michael wollte Jenni nicht widersprechen, obgleich er solche Behauptungen doch sehr vage fand. Ein wenig ungläubig mußte er aber wohl doch aussehen, denn Jenni fuhr mit ihren Erklärungen fort.
»Wir haben uns nämlich schon richtig unterhalten, bevor er da in seinem Bettchen lag. Er war manchmal sehr ungeduldig, und dann mußte ich ihm immer gut zureden. Ich glaube, er ist ganz zufrieden mit seiner Mami.«
»Das kann er auch sein«, sagte Michael zärtlich. »Ich bin gespannt, ob er mit seinem Vater auch zufrieden ist.«
»Bestimmt. Ich habe ihm viel von dir erzählt. Es ist erwiesen, daß die ungeborenen Kinder aufnehmen, was man sagt.«
»Geht da deine Phantasie nicht doch ein bißchen mit dir durch, Jenni?« fragte Michael zweifelnd.
»Du hast ja keine Ahnung«, meinte sie, »und vielleicht machen sich auch viel zu wenige Mütter darüber Gedanken, wie sehr ein ungeborenes Kind reagiert. Wußtest du schon, daß es auch im Mutterleib schon am Daumen lutscht, daß es sogar schon weint?«
»Übertreibe nicht, Jennimädchen.«
»Doch, das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Ich kann es dir schwarz auf weiß zeigen. Du bist so gescheit, aber von Babys hast du keine Ahnung.«
»Ich werde es schon noch lernen.« Er wandte sich dem Baby zu. »Hallo, Micky, nimmst du zur Kenntnis, daß du nicht nur eine Mutter sondern auch einen Vater hast?«
Micky blinzelte. Er steckte den Daumen in den Mund und schmatzte laut.
»Fingernägel hat er auch schon«, sagte Michael staunend.
»Und was für welche«, lachte Jenni. »Er kann schon kratzen. Alle sagen, daß er ein besonders hübsches Kind ist.«
»Wollte diese Frau ihn uns deswegen wegnehmen?« fragte Michael.
»Ach, reden wir nicht mehr davon«, meinte Jenni. »Sie tut mir leid. Sie ist krank. Sie wußte wahrscheinlich gar nicht, was sie sagte.«
*
Aber das hatte Petra Walden doch ganz bewußt getan. So unbegreiflich es ihr an diesem Morgen auch erschien, da sie wieder klar denken konnte, so genau wußte sie doch, warum sie dieses andere Kind hatte haben wollen.
Sie rief sich die Stunde im Kreißsaal in die Erinnerung zurück. Sie sah Jenni Burk vor sich, fröhlich und unbeschwert von und mit ihrem noch ungeborenen Kind sprechend. Sie selbst war von Angst geplagt, ein krankes Kind zu gebären.
Sie, Petra Walden, die in ihrem Leben niemandem was zuleide getan hatte, die immer den geraden Weg gegangen war, die sich niemals unterkriegen ließ, obwohl sie doch schon in jungen Jahren soviel Kummer erlebt hatte, konnte etwas tun, was einem Verbrechen gleichkam.
Würde sie dafür nicht bestraft werden?
Ich habe mein Kind verleugnet, Gerds Kind! Kälte durchströmte ihren Körper, der gestern noch fieberheiß gewesen war.
Dann kam der andere Gedanke. Papa ist todkrank. Es war sein Befund, nicht einer von Gerd.
Ihre Augen begannen zu brennen, aber es kamen keine Tränen mehr.
Sie starrte zur Decke, dann zur Tür. Sie hoffte, daß sie sich auftun und Gerd eintreten würde, damit sie ihm endlich alles sagen könnte.
Dann tat sich die Tür auch auf, aber es war Dr. Thiele, der mit Schwester Otti kam. Wenn es wenigstens Dr. Laurin gewesen wäre.
Sie fragte nach ihm. »Er hat Sprechstunde. Später kommt er gleich zu Ihnen, Frau Walden«, sagte Dr. Thiele.
»Brauchen Sie etwas?« fragte Schwester Otti.
Petra bewegte verneinend den Kopf. Vielleicht würde Gerd nie mehr kommen, weil sie ihr Kind verleugnet hatte. Sie verkrampfte ihre Hände in der Bettdecke. Am liebsten hätte sie geschrien, alles herausgeschrien, was sie quälte, wofür sie sich verachtete, die Schuld, die sie auf sich geladen hatte.
Papa hätte sie alles sagen können. Er hätte sie verstanden. Sie sah sein gütiges Gesicht vor sich, seine Augen, sie hörte seine Stimme, die so liebevoll war und so vieles gutgemacht hatte, was ihr Vater zerstörte.
»Papa soll kommen«, flüsterte Petra dann matt, und ein unterdrücktes Schluchzen klang in ihrer Stimme. »Ich möchte ihn so gern sehen.«
In der gleichen Minute wurde der Sarg mit Gustav Walden in das Grab gesenkt, das von einem Blumenmeer umgeben war und vor dem Gerd mit gesenktem Haupt stand, während seine Gedanken bei Petra weilten.
*
Dr. Laurin brachte diesen Vormittag nur mit äußerster Willenskraft hinter sich. Er hatte kurz mit seiner Frau telefoniert, und Antonia hatte besorgt gefragt, ob er überhaupt geschlafen hätte.
Er brauchte sein Bett, um richtig schlafen zu können, die Nähe seiner Frau, die Atmosphäre seiner Häuslichkeit.
Dieser kurze Schlaf war keine Erquickung gewesen.
Es war ein trostloser Vormittag. Nicht eine einzige Patientin war dabei, die ihn optimistischer stimmen konnte.
»Herr Burk möchte Sie sprechen, Chef«, sagte dann Hanna Bluhme.
»Auch das noch!« stöhnte Dr. Laurin. »Heute kommt alles zusammen.«
Michael Burk wollte von ihm genauestens unterrichtet werden, ob diese fatale Angelegenheit restlos geklärt wäre.
»Was die Klinik anbetrifft, schon«, erwiderte Dr. Laurin. »Eine Verwechslung ist ausgeschlossen.«
»Und wenn es die Frau weiterhin behauptet?«
»Frau Walden befindet sich noch immer in einem depressiven Zustand. Wir werden jede Aufregung von Ihrer Frau fernhalten, Herr Burk.«
»Das will ich auch hoffen«, sagte Michael unwillig. »Eine tolle Geschichte ist das. Man sollte es nicht für möglich halten.«
»Sie sind Journalist, Herr Burk. Wollen Sie das ausschlachten?« fragte Dr. Laurin zögernd.
»Ich? Meine Frau und mein Kind durch die Zeitungen zerren? Wofür halten Sie mich?«
Dr. Laurin zwang sich zu einem Lächeln.
Es fiel ihm heute schwer. »Für den Ehemann einer ganz bezaubernden Frau«, erwiderte er.
»Hoffentlich sagen Sie das nur als Arzt und nicht als Mann«, sagte Michael kritisch.
»Ich bin glücklich verheiratet. Entschuldigen Sie, wenn ich heute nicht ganz okay bin. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen.«
Michael betrachtete ihn forschend. »Ich habe was gegen Kliniken und auch gegen Ärzte«, sagte er.
»Glauben Sie mir, ich wäre manchmal auch ganz froh, wenn die Menschheit ohne beides auskommen würde«, sagte Dr. Laurin. »Heute ganz besonders.«
Da lächelte Michael jungenhaft. »Was würden Sie dann tun?« fragte er.
»Vielleicht würde ich Journalist werden und in der Welt herumreisen und immer nur dann nach Hause kommen, wenn meine Frau mal wieder ein Kind bekommen hat«, erwiderte Dr. Laurin anzüglich.
»So, das war eine Retourkutsche. Schlagfertig sind Sie schon. Vertragen wir uns, Doktor.«
Sie taten es mit einem festen Händedruck, und Leons Stimmung besserte sich.
»Jenni ist eine komische Frau«, sagte Michael Burk. »Sie wollte mich gar nicht dabei haben.«
»Wahrscheinlich kennt sie Ihre Abneigung gegen Kliniken und gegen Ärzte?«
»Das auch, aber wie finden Sie das denn, daß sie mit dem Kind redet, als könne es sie richtig verstehen? Sie behauptet, daß sie mit Micky schon reden konnte, als er noch gar nicht auf der Welt war.«
»Dann hat sie genau die richtige Einstellung. Wir können uns darüber bei anderer Gelegenheit ja noch einmal unterhalten, Herr Burk, wenn es Sie interessiert. Ich bin heute in Zeitnot.«