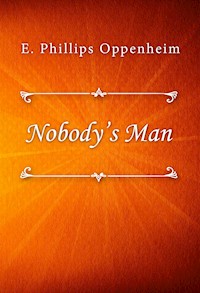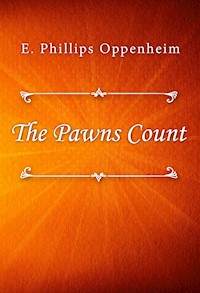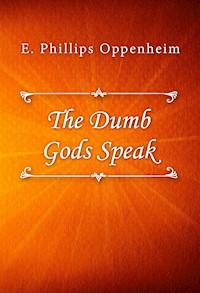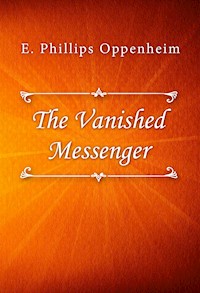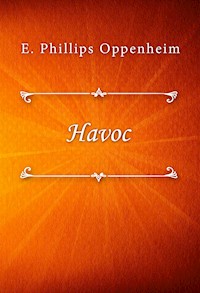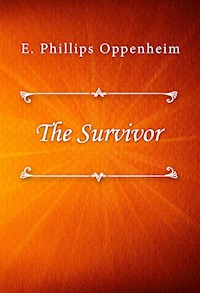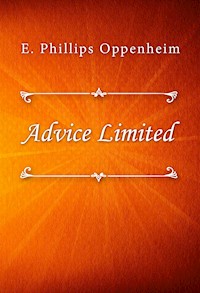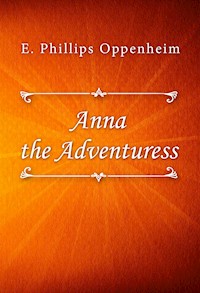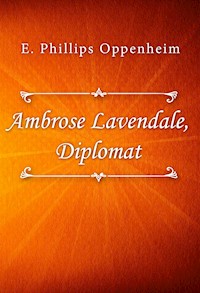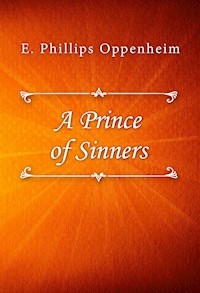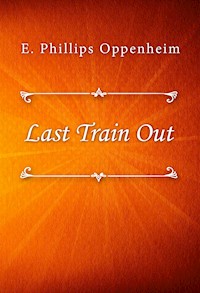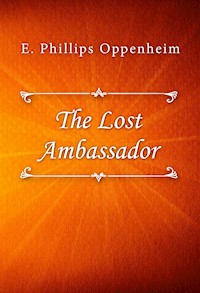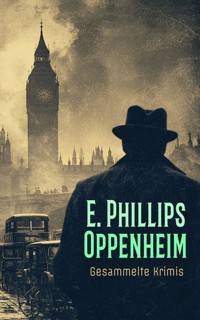
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Edward Phillips Oppenheim war ein englischer Schriftsteller, der als einer der Pioniere des modernen Spionage- und Abenteuerromans gilt. Geboren in London, begann er seine literarische Laufbahn zunächst neben seiner Tätigkeit im väterlichen Geschäft. Mit seiner ersten Veröffentlichung Ende des 19. Jahrhunderts gewann er rasch Anerkennung und wurde zu einem der meistgelesenen Autoren seiner Zeit. Oppenheim schrieb über hundert Romane, in denen er Elemente aus Politik, Spionage, Intrige und Romantik miteinander verband. Seine Werke zeichnen sich durch geschliffene Dialoge, elegante Milieuschilderungen und eine subtile Spannung aus. Viele seiner Geschichten spiegeln die Atmosphäre Europas zwischen den Weltkriegen wider. Oppenheim wurde oft als "Prince of Storytellers" bezeichnet, da er das Genre des Kriminal- und Spionageromans entscheidend geprägt hat. Sein Einfluss ist bis heute in der Spannungsliteratur spürbar, insbesondere in der Verbindung von gesellschaftlichem Glanz und düsterer Geheimniswelt. Oppenheims Werke sind bis heute von Bedeutung, weil sie die Ängste, Hoffnungen und politischen Spannungen ihrer Zeit spiegeln, die auch in unserer Gegenwart aktuell bleiben. Ihre Mischung aus Nervenkitzel, Eleganz und psychologischer Tiefe macht sie nach wie vor spannend und beliebt. Die Sammlung "Gesammelte Krimis" umfasst einige seiner bekanntesten Romane, die exemplarisch für sein Werk stehen. In "Der Meisterspion" begegnet der Leser einem geheimnisvollen Agenten, der zwischen Loyalität und Verrat, Pflicht und persönlicher Moral schwankt. Oppenheim zeichnet das Bild eines Mannes, der im Netz internationaler Intrigen gefangen ist, während sich der Erste Weltkrieg ankündigt. Spannung entsteht aus der Unsicherheit, wer Freund und wer Feind ist – eine Thematik, die Oppenheim meisterhaft beherrscht. "Die große Täuschung" erzählt von einem Doppelleben voller Masken, Täuschungen und moralischer Ambivalenz. Ein scheinbar unbescholtener Gentleman verbirgt eine gefährliche Vergangenheit, die ihn in ein Netz aus Erpressung und Lüge verstrickt. Oppenheim schafft es, die feine Linie zwischen gesellschaftlicher Fassade und innerer Wahrheit herauszuarbeiten, was das Werk zu einem psychologisch raffinierten Kriminalroman macht. In "Das Geheimnis von Cruta" führt Oppenheim seine Leser auf eine abgelegene Mittelmeerinsel, wo Liebe, Macht und religiöser Fanatismus aufeinandertreffen. Die exotische Kulisse, gepaart mit düsteren Geheimnissen, erzeugt eine beklemmende Atmosphäre – ein Beispiel für Oppenheims Fähigkeit, Spannung mit Symbolik und Romantik zu verweben. "Schatten der Vergangenheit" handelt von einem Mann, der versucht, den Fehlern seiner Jugend zu entkommen, doch seine dunkle Vergangenheit holt ihn ein. Intrige und psychologische Spannung verschmelzen hier zu einem moralischen Drama über Schuld und Vergebung. "Der Mord an Bernard Brown" ist ein klassischer Kriminalfall, der mit raffinierter Konstruktion und überraschender Auflösung überzeugt. Der Mord an einem angesehenen Bürger wirft ein grelles Licht auf die verborgenen Leidenschaften einer englischen Kleinstadtgesellschaft. In "Finanzkönige" wendet sich Oppenheim dem Intrigenspiel der Hochfinanz zu. Macht, Korruption und politische Machenschaften bilden den Hintergrund, vor dem moralische Integrität auf die Probe gestellt wird. Diese Sammlung zeigt Oppenheim auf dem Höhepunkt seiner Kunst: als Erzähler, der Spannung mit Stil, Intelligenz und Menschlichkeit verbindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
E. Phillips Oppenheim - Gesammelte Krimis
Inhaltsverzeichnis
Das Geheimnis von Cruta
1. Der letzte Wunsch
»Pater Adrian!«
»Ja, hier bin ich!«
»Ich sah, wie Sie eben heimlich mit dem Arzt sprachen. Wie lange habe ich noch zu leben? Er hat Ihnen die Wahrheit gesagt. Ich muß wissen, wie es mit mir steht!«
Der schlanke, junge Priester trat näher an das Bett, schüttelte langsam den Kopf und sah den Kranken mitleidig an.
»Es ist nicht mehr lange – Sie haben nur noch kurze Zeit. Aber warum fürchten Sie sich? Sie haben gebeichtet. Ich selbst habe Ihnen die Absolution erteilt, und die Kirche hat Ihnen die Sterbesakramente nicht verweigert.«
»Ich fürchte mich nicht. Es ist nur so eine Sache der Überlegung. Werde ich den Morgen noch erleben?«
»Das ist möglich. Aber nicht mehr den Mittag.«
Der Sterbende richtete sich mühsam auf und zeigte nach dem Fenster.
»Öffnen Sie es!«
Sein Diener, der schweigend im Schatten gesessen und das Gesicht in den Händen verborgen hatte, erhob sich und führte den Auftrag aus.
»Wieviel Uhr ist es?«
»Drei.«
»Gomez, strenge deine Augen an und sieh auf das Meer hinaus. Kannst du kein Licht am Horizont erkennen?«
»Nein. Der Sturm hat alles in Dunkel gehüllt. Hören Sie nur!«
Ein Regenschauer schlug gegen die Fensterscheiben, und der heulende Sturm rüttelte an dem Hause. Gomez wandte sich verzweifelt wieder vom Fenster ab. Kein menschliches Auge konnte diese Finsternis durchdringen. Wieder sank er in seinen Sitz und sah sich schaudernd um. Der hochgewölbte Raum, in dem sie sich befanden, wurde nur durch ein paar Kerzen notdürftig beleuchtet, und der größere Teil des Zimmers lag in Halbdunkel. Graue, phantastische Schatten schienen in den Ecken zu lauern. Selbst die große Gestalt des Priesters, der vor einem rohgeschnitzten Kruzifix kniete, machte einen geisterhaften, unwirklichen Eindruck. Die schweren, doppelten Bettvorhänge bewegten sich unruhig in dem Zug, der durch das halbgeöffnete Fenster hereindrang. Die Kerzen flackerten und brannten unruhig in den Leuchtern. Gomez betrachtete sie ängstlich. Auch das Leben seines Herrn brannte langsam zu Ende. Er machte sich jedoch darüber keine besonders großen Sorgen. Fünfundzwanzig Jahre diente er ihm schon. Er dachte an eine kleine, gemütliche Wohnung in Piccadilly, wo sie nichts von den Unannehmlichkeiten ihres jetzigen Aufenthaltes gekannt hatten. Wenn sein Herr seine Tage dort beschlossen hätte, wäre es ein Luxus gewesen zu dem, was sich hier abspielte. Es tat ihm persönlich leid, daß sein Herr hier in diesem weltvergessenen Winkel sterben mußte. Seine Gedanken wanderten. Er kannte die Zusammenhänge und wußte, warum es zu Ende ging. Hatte er doch alles mit ihm erlebt und durchgekämpft!
Der Sterbende lag jetzt ganz ruhig, als ob die letzten Augenblicke gekommen seien. Einmal richtete er den Kopf auf, und ein schwacher Schein flackerte über sein graues, eingefallenes Gesicht, in dem dunkle, fieberglänzende Augen brannten. Aber er sank gleich wieder in die Kissen zurück, schloß die Augen und atmete ruhig und gleichmäßig. Er ging mit seinen letzten Kräften sparsam um.
Eins – zwei – drei – vier – fünf! Hart und gespenstisch klangen die Schläge einer alten Uhr in dem Gebäude. Kurz darauf ertönte eine tiefe Glocke. Der Mann auf dem Bett hob müde den Kopf.
»Was macht der Sturm?« fragte er leise.
Gomez stand auf und ging wieder zum Fenster.
»Er verzieht sich. Der starke Wind flaut ab.«
»Wann wird es Tag?«
»In einer Stunde.«
»Bleiben Sie beim Fenster und warten Sie, bis es dämmert.«
Der Priester runzelte die Stirne.
»Es ist aber jetzt an der Zeit, daß Sie Ihre Gedanken von irdischen Dingen abwenden«, sagte er ruhig. »Was kümmert Sie das Morgengrauen? Bald werden Sie in ewigem Schlaf ruhen. Nehmen Sie das Kruzifix in die Hand und beten Sie mit mir.«
Der Sterbende schob aber das Kreuz mit einer ungeduldigen Handbewegung beiseite, die fast verächtlich wirkte.
»Gomez, sehen Sie kein Licht auf dem Meer?« fragte er wieder.
Der Diener lehnte sich weit vor und strengte seine Augen an, daß sie schmerzten. Plötzlich hielt er den Atem an, als er einen schwachen, gelblichen Schein entdeckte. Rasch wandte er sich um.
»Ganz weit hinten sehe ich ein Licht. Ich kann noch nicht sagen, was es ist, aber ich sehe es.«
Eine Welle von Erregung ging über das harte, verfallene Gesicht des Mannes auf dem Lager. Er richtete sich wieder etwas auf und seine Stimme klang fester.
»Schieben Sie mein Bett zum Fenster.«
Der Priester und Gomez kamen seinem Wunsch nach, aber es gelang ihnen nur mit Mühe, das schwere, ächzende Möbel vorwärtszubewegen. Inzwischen war das Licht auf dem Meer näher herangekommen und deutlicher geworden. Die drei sahen gemeinsam hinaus und beobachteten, wie es immer größer und größer wurde. Gomez und sein Herr zeigten fieberhafte Erwartung, während das Gesicht des Priesters deutlich Widerwillen verriet.
»Es dämmert!« rief Gomez plötzlich und deutete nach Osten.
»Richten Sie mich auf. Geben Sie mir Kissen in den Rücken, daß ich sitzen kann!«
Gomez tat, wie ihm geheißen wurde. In dem kalten Morgenlicht war das Gesicht des Sterbenden deutlich zu sehen.
Ein langer Bart von schwarzen und grauen Haaren lag auf seiner Brust. Seine dunklen, ungebrochenen Augen schauten auf das Meer hinaus.
»Also kommt er doch!«
Gomez und der Priester schraken bei diesem fast triumphierenden Ausruf zusammen und ihr Blick folgte dem lang ausgestreckten Arm. Über dem fernen gelben Licht sahen sie eine feine, dünne Rauchlinie am Horizont.
»Ja, es ist wirklich ein Dampfer«, sagte der Priester, der jetzt mehr Interesse zeigte. »Er hält auf die Insel zu.«
»Wann kommt der Postdampfer?« fragte Gomez.
»Erst in zwölf Tagen«, entgegnete der Priester. »Das ist ein fremdes Schiff.«
»Kann das Schiff in die Bucht einlaufen?« fragte Gomez plötzlich. »Es ist ziemlich hoher Seegang an der Barre.«
Alle drei sahen jetzt auf den Hafeneingang. Nun wurden in kurzer Reihenfolge drei Raketen von der Spitze des Felsenhügels abgeschossen. Der Sterbende biß die Zähne zusammen.
»Was bedeutet dieses Signal, Pater Adrian?« fragte er.
Der Priester sah mitleidig auf den Sterbenden. »Es ist eine Warnung für das Schiff, daß der Eingang zum Hafen unpassierbar ist. Beruhigen Sie sich. Es ist eine Mahnung des Himmels. Sie sollen Ihre Gedanken nicht von dem Heile ablenken. Beten Sie jetzt mit mir.«
Aber die Worte des Mönches verhallten ungehört, und der Sterbende schien nicht entmutigt zu sein. Sein Blick durchdrang die Ferne, und es war, als ob er den Kapitän auf der Brücke sähe und die scharfen Befehle hörte, die er seinen Untergebenen zurief.
Das Schiff setzte seinen Weg unbekümmert um alle Gefahren mutig fort und kam immer näher. Pater Adrian und Gomez sahen dem tollkühnen Wagnis in fieberhafter Erregung zu. Gespannt und interessiert beobachteten sie den Kampf der großen Dampfjacht mit der mächtigen und gefährlichen Brandung.
Der Priester war ein wenig zur Seite getreten, als das graue Morgenlicht sein Gesicht beleuchtete, damit man seine zuckenden Lippen und seine unnatürliche Blässe nicht sehen sollte. Es war ein Zufall, daß gerade dieser Mann in dem Inselkloster unter seiner Pflege sterben mußte. Das Bedrückende der letzten Stunden und die düsteren Worte des Paters hatten den Sterbenden so erschüttert, daß er sein Geheimnis preisgab. Wort für Wort hatte der Priester es ihm entrungen. In den traurigen und ruhigen Stunden, in denen der Tod zur Gewißheit wurde, hatte der starke, weltlich gesinnte Mann sich schwach gefühlt und war für kurze Zeit in den Händen dieses kühlen und willensstarken Mönches wie ein hilfloses Kind gewesen. Die Gebete und die erteilte Absolution hatten ihn nicht getröstet und gestärkt. Die Worte, die der Pater dem Sterbenden leise zuflüsterte, waren wie eiskalte Wassertropfen auf ihn niedergefallen, und sein sehnlicher Wunsch, Gott näherzukommen, war im Keim erstickt worden. Wie er gelebt hatte, so mußte er auch sterben. Die Gebete des Priesters konnten ihm nicht helfen. So suchte er wieder Ruhe und Frieden bei den Lehren der Philosophie, die ihm während seines Lebens über so manche Gefahr und schwere Stunde hinweggeholfen hatten.
Das Schicksal schien ihm nun doch noch seinen letzten, leidenschaftlichen Wunsch erfüllen zu wollen. Der Mann, den er noch einmal hatte sehen wollen, bevor sich seine Augen für immer schlossen, wurde fast wie durch ein Wunder wieder an seine Seite geführt. Er wußte intuitiv, daß er für dieses letzte Wiedersehen noch genügend Kraft besitzen würde. Und er würde diese letzte Nachricht hören, die ihm entweder den Tod erleichterte oder ihn mit schweren Sorgen die Grenze des unbekannten Jenseits überschreiten ließ. Unverwandt ruhte sein Blick auf dem Schiff. Sein Atem ging kurz, aber er wachte und wartete.
Jetzt kam der gefährliche Augenblick. Der Dampfer hatte die Brandung am Eingang des Hafens erreicht. Die Wellen waren dort haushoch und schossen über das Deck. Mehr als einmal war der Rumpf des Schiffes vollständig verschwunden, aber im nächsten Moment hob er sich wieder aus den Wellen. Schließlich hatte die Jacht die Brandung durchquert und fuhr nun in den verhältnismäßig ruhigen Hafen ein. Unter den gigantischen Felsenriesen sah sie zwerghaft klein aus. Eine Viertelmeile von der Küste entfernt ließ der Kapitän Anker werfen, und gleich darauf wurde ein Boot heruntergelassen.
Der Mann auf dem Lager schien plötzlich von neuem Leben beseelt. Die Morgensonne war unter grauem Gewölk hervorgebrochen, und im Osten hatten sich die Ränder der Wolken brandrot gefärbt. Die ersten Lichtstrahlen fielen auf die weiße Bettdecke und das bleiche Gesicht des Sterbenden.
»Geben Sie mir den schwarzen Ebenholzkasten, der dort auf dem Tisch steht, Gomez«, befahl er.
Der Diener verließ seinen Platz am Fenster und brachte den gewünschten Gegenstand ans Bett. Der Kranke legte die Hand darauf und verbarg ihn dann unter der Bettdecke.
»Ich bin bereit«, sagte er halblaut zu sich selbst. »Pater Adrian, wie lange habe ich nach der Meinung des Arztes noch zu leben?«
»Noch eine knappe Stunde«, sagte der Priester, ohne von dem Boot fortzusehen, das sich dem Lande rasch näherte. »Bedeutet Ihnen Ihre ewige Seligkeit so wenig,« fragte er mit harter, ernster Stimme, »daß Sie Ihre letzten Gedanken und Augenblicke den Dingen dieser Welt widmen? Das ist ein unheiliger, sündiger Tod! Nehmen Sie das Kreuz und hören Sie nicht auf die Leute, die dort kommen und deren Worte Sie dem Himmel entfremden. Achten Sie nicht auf die Welt und was darin vorgeht. Erheben Sie Ihre Augen und Ihr Herz zu dem Herrn. Ewige Seligkeit oder ewige Verdammnis warten auf Sie, bevor die Sonne zum Firmament emporgestiegen ist!«
»Ich fürchte mich nicht. Was könnten mir die wenigen Gebete helfen? Meine Aufgabe auf dieser Welt ist noch nicht gelöst. Sprechen Sie mir, bitte, nicht von Beten. Nichts, was ich oder Sie jetzt tun, kann mich dem Himmel auch nur einen Schritt näherbringen. Gomez, du hast scharfe, klare Augen. Kannst du jemand im Boot erkennen?«
»Ich sehe Mr. Paul – er sitzt am Steuer.«
»Gott sei Dank!«
»Es sind aber auch noch andere Leute in dem Boot!«
»Sie sind mir fremd. Ich sehe einen Herrn, der seiner Kleidung und Erscheinung nach ein Gentleman sein muß, dann ein Mädchen und zwei Matrosen, die rudern.«
Der Sterbende runzelte die Stirne und seine Finger verkrampften sich unter der Bettdecke. Er hatte etwas von seiner Ruhe und Überlegenheit verloren, seitdem er genau wußte, daß das Schiff sicher landen würde.
»Das Boot ist jetzt ganz in der Nähe, Gomez. Kannst du mir den Fremden nicht beschreiben?«
»Ich kann nur sehen, daß er groß und hager ist. Er muß auch schon älter sein. Außerdem ist er stark in Mäntel und Decken gehüllt, als ob er krank wäre.«
»Gib mir zwei Löffel von dem Kognak!«
Gomez erfüllte seinen Wunsch, dann schloß sein Herr die Augen und lehnte sich in die Kissen zurück. Ein unheimliches Schweigen herrschte im Zimmer, das tiefe Schweigen der Erwartung.
Das kleine, ärmliche Kloster, in dem sie sich befanden, wurde nur von wenigen Mönchen bewohnt, die einem niederen Orden der römischen Kirche angehörten. Das Gebäude lag in düsterem Schatten, und von der halbverfallenen Kapelle drang kein Laut durch die langen, leeren Gänge. Der Sturm hatte sich gelegt.
Schließlich wurde das Schweigen unterbrochen. Man hörte zuerst schwach, dann immer deutlicher Schritte, die sich näherten, und dann unterhielten sich die Fremden draußen leise miteinander. Ein kurzes Klopfen ertönte. Der Priester, der den Besuchern bis zur Schwelle entgegengegangen war, ließ sie ein. Zwei Männer traten herein. Der eine näherte sich dem Bett mit ausgestreckten Händen, während der andere nach zwei Schritten stehenblieb und scharf zu dem Sterbenden hinübersah, ohne zu grüßen oder zu zeigen, daß er ihn kannte. Der erste sank neben dem Bett auf die Knie, nahm die eine Hand des Sterbenden und drückte sie.
»Vater«, rief er erregt. »Ich hätte alles darum gegeben, dich gesund wiederzusehen. Sage mir, daß alles nicht wahr ist, was man mir am Eingang sagte. Jetzt, da ich wiedergekommen bin, wirst du die Krankheit überstehen!«
Er erhielt keine Antwort. Der Sterbende sah nicht einmal in das Gesicht des jungen Mannes, das dem seinen so nahe war. Sein Blick lag auf dem Mann, der in einiger Entfernung von dem Bett stand. Er atmete schnell und ein Zittern ging durch seinen Körper. Dann seufzte er auf.
»Vater, du bist erregt. Das ist ja auch kein Wunder, wenn du ihn hier an deinem Lager siehst. Hast du meinen Brief erhalten, der dich auf unser Kommen vorbereitete? Ich habe alles versucht, aber ich konnte ihn nicht abhalten, hierherzukommen.«
Gomez trat einen Schritt aus dem Schatten hervor.
»Es ist kein Brief angekommen«, sagte er kurz.
Der junge Mann erhob sich mit bleichem Gesicht.
»Es war auch töricht von mir, mich auf die Post in dieser entlegenen Gegend zu verlassen. Ich werde es mir nie verzeihen, daß ich ihn unvorbereitet hierherbrachte.«
Wieder herrschte Totenstille im Raum. Verzweifelt sah der Sohn von seinem Vater zu dem Fremden, dessen Züge undurchdringlich waren. Aber plötzlich spielte ein grausames, ironisches Lächeln um die Mundwinkel dieses Mannes. Trotz der düsteren Szene vor ihm schien er gleichgültig und fast heiter gestimmt. Schließlich begann er zu sprechen, aber seine Stimme klang fremd und störend in diesem Sterbezimmer.
»Ich treffe Sie also auf dem Totenbett, Martin. Das ist merkwürdig. Wenn mir noch vor einem Monat jemand gesagt hätte, daß ich hierherkommen würde, um Zeuge Ihres Todes zu sein, hätte ich ihn für wahnsinnig gehalten. Auf eine solche Genugtuung hätte ich niemals gehofft!«
Diese Worte schienen plötzlich die Energie des Sterbenden wieder zu wecken. Er wandte sich an seinen Sohn, der an der Seite des Bettes stand.
»Wie ist er hierhergekommen?«
»Zuerst suchte ich ihn in Monaco, aber man hatte dort seit zwei Jahren nichts mehr von ihm gehört. Dann fand ich seine Spur in Algier, folgte ihm nach Kairo, Athen und Syrakus. Endlich fand ich ihn in Konstantinopel, wo er als Offizier der türkischen Armee diente.« Der junge Mann sprach in zorniger Erregung. »Ich überreichte ihm deinen Brief und deine Botschaft und erwartete seine Antwort. Nach drei Tagen sagte er mir, daß er mich hierherbegleiten wollte, um dir die Antwort persönlich zu geben. Drei Tage vor unserer Abfahrt schrieb ich dir einen Eilbrief. Aber, wie ich höre, ist er nicht angekommen. Verzeihe mir, daß ich ihn unvorbereitet zu dir bringe.« Er wandte sich an den Fremden. »Ich habe mein Wort gehalten und Sie sicher hierher gebracht, obwohl es mir schwer genug fiel. Am liebsten hätte ich Sie bei den Dardanellen ins Meer geworfen. Die Versuchung war groß, das kann ich Ihnen sagen. Geben Sie jetzt meinem Vater Ihre Antwort und gehen Sie dann. Sie haben kein Recht, an seinem Totenbette zu weilen.«
»Höflich sind Sie gerade nicht«, entgegnete sein Begleiter. »Aber mein lieber Martin, wenn dies unser Abschied für immer sein soll, so will ich Sie doch deutlicher sehen.«
Er kam einige Schritte näher und sah erst jetzt den Priester, der mit geschlossenen Augen und erhobenen Händen vor dem Kruzifix kniete.
»Ach, wir sind nicht allein. Der Mönch kann uns hören.«
»Das ist ganz gleich«, erwiderte der Mann auf dem Bett langsam. »Seine Ohren und sein Mund sind verschlossen. Er ist ein Mönch!«
Er richtete sich ein wenig in seinem Bett auf. Seine rechte Hand lag unter der Decke auf dem schwarzen Eichholzkasten. Sein Sohn war wieder neben dem Bett niedergekniet und hielt die andere Hand.
Der Fremde lächelte jetzt nicht mehr, seine Gesichtszüge waren hart und entschlossen.
»Hören Sie, was ich zu sagen habe, Martin de Vaux. Sie haben mir ein Vermögen angeboten, wenn ich meinen Einfluß und meine Macht über die aufgebe, die Ihnen teuer sind, und die Sie lieben. Geld ist mir natürlich viel wert und ich schätze es. Aber ich will keinen Schilling von Ihnen anrühren. Ich fluche Ihnen, Ihrem Gelde und Ihrer ganzen Familie. Ich gebe meine Macht nicht auf – das ist meine Rache!«
Der Sterbende war merkwürdig ruhig, und man hörte nur ein leises Geräusch unter der Bettdecke.
»Ich kenne Ihren schlechten Charakter«, sagte er. Sie wollen mich mit dem quälenden Gedanken sterben lassen, daß ich die Leute, die ich liebe, unter Ihrer Gewalt zurücklassen muß, und daß Sie sie bis aufs Blut peinigen und meinen Namen in den Schmutz treten können. Aber Sie haben sich verrechnet, Viktor. Sie werden mich auf dieser letzten Reise ins Ungewisse begleiten!«
Seine Stimme war hart und drohend geworden, und Pater Adrian sprang plötzlich in namenlosem Schrecken auf. Der Kranke hatte sich aufgerichtet. Seine Augen blitzten, er streckte den Arm aus, und in der nächsten Sekunde fiel ein Schuß.
Ein furchtbarer Schrei gellte auf. Der Fremde, der eben noch am Fußende des Bettes gelehnt hatte, lag tot am Boden. Ein dunkles Mädchen, das auf das Geräusch hin ins Zimmer getreten war, umklammerte ihn leidenschaftlich und schluchzte wild auf.
Auch Martin de Vaux war zurückgesunken. Seine Hand spannte sich noch um den Revolver, aber seine Arme hingen schlaff herunter. Diese letzte Anstrengung hatte ihn das Leben gekostet.
Pater Adrian war der erste, der die Lage überschaute. Er neigte sich erst über den einen, dann über den anderen Toten und drückte beiden die Augen zu.
»Ist er tot?« fragte Paul de Vaux mit erstickter Stimme.
»Ja. Sie sind beide nicht mehr am Leben.«
Das Schluchzen des Mädchens klang unheimlich durch den stillen Raum, während das Sonnenlicht auf den bleichen, ruhigen Gesichtern der Toten spielte.
2. Tanzkunst
Paul de Vaux stand in einem kleinen Erker des Empfangsalons der Lady Swindon. Er war groß, schlank und sorgfältig gekleidet, wie es die Mode in London vorschrieb.
»Paul, du siehst gerade nicht sehr glücklich aus«, sagte jemand dicht neben ihm.
Er drehte sich um und sah den anderen scharf an.
»Das kannst du auch nicht von mir erwarten, Arthur. Du weißt doch, wie ich diese Veranstaltungen liebe. Soweit ich sehen kann, ist es ein Empfang wie jeder andere. Die jungen Leute kommen hier zusammen, um sich gegenseitig etwas vorzurenommieren. Die Frauen klatschen, und dazu trinkt man schwarzen Tee. Du hast mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierhergebracht. Wo ist denn das glänzende Schauspiel, das du mir versprochen hast?«
»Alles zu seiner Zeit. Du wirst mir noch dankbar sein. Die Vorstellung beginnt in einer Minute.«
Paul de Vaux sah seinen Bruder ungläubig an. »Das bildest du dir wahrscheinlich nur ein. Hier scheint niemand etwas Ungewöhnliches zu erwarten.«
Arthur lächelte nur und trommelte mit den Fingern ungeduldig auf dem Fensterbrett. Er war etwas kleiner als sein Bruder und war ihm auch sonst wenig ähnlich. Aber auch er sah auf seine Weise gut aus und hatte sympathische Züge.
»Das ist ja gerade das Schöne. Lady Swindon überrascht ihre Gäste. Ich habe es nur zufällig von Denison im Klub erfahren. Sonst hätte ich dich überhaupt nicht hergebracht.«
»Ach, ich halte nichts von solchen Überraschungen«, entgegnete Paul gelangweilt. »Die Hälfte des Vergnügens liegt doch immer in der Erwartung. Wollen wir nicht lieber gehen? Lassen wir den anderen das Vergnügen. Komm mit in meine Wohnung, dort können wir in Ruhe eine Zigarre rauchen und dabei überlegen, was wir heute abends anfangen.«
Arthur schüttelte den Kopf und legte die Hand auf Pauls Arm.
»Du weißt eben nicht, was uns bevorsteht. Ich möchte auf keinen Fall fortgehen. Um Gotteswillen, da kommt der Bischof von Canterbury. Wer weiß, was der für ein Gesicht machen wird! Und drüben sehe ich Lady May. Wenn die dich sieht, wird sie gleich zu uns kommen.«
»Ich dachte, die Westovers wären gestern nach Norden gereist. Lady May sagte es mir«, erwiderte Paul etwas interessierter.
»Nun, sie können ihre Pläne ja etwas geändert haben – aber die Vorstellung beginnt. Du siehst jetzt die schönste Frau, die es meiner Meinung nach gibt.«
Die Unterhaltung verstummte plötzlich. Alle Anwesenden nahmen auf Stühlen Platz und blickten zu dem einen Ende des Zimmers. Schwere, schwarze Vorhänge wurden von unsichtbaren Händen zurückgezogen und enthüllten ein kleines Podium, auf dem ein dunkelroter orientalischer Teppich lag. Erwartungsvolles Geflüster ging durch die Versammelten. Gleich darauf ertönte die melancholische Melodie einer Flöte, in die sich die dumpfen Töne eine Handpauke mischten. Fasziniert lauschten die Zuhörer den traumhaften, klagenden Klängen und schauten in höchster Spannung auf die kleine Bühne, deren Hintergrund durch einen dunkelroten Vorhang geschlossen war.
Plötzlich erschien die schlanke Gestalt eines Mädchens auf dem Podium. Sekundenlang blieb sie in regloser Haltung stehen. Von oben warfen zwei Scheinwerfer helles Licht auf sie herab. Sie trug ein prachtvolles orientalisches Gewand und reichen Schmuck. Langsam schien die Melodie ihren Körper zu beleben. Sie wiegte sich leicht und begann dann zu tanzen. Leise bewegte sie den Oberkörper nach dem Rhythmus der Musik. Schlagzeug fiel ein, die Bronzestimme der Zimbeln klang auf, die Melodie wurde allmählich leidenschaftlicher, und in demselben Maße steigerten sich die Bewegungen ihres wundervollen Körpers. Der Ausdruck ihres Gesichtes war von betäubender Süße, aber sie schien keinen der Zuschauer zu sehen. Sie war in sich selbst versunken und nur ihrem Tanz hingegeben.
Für Paul war dieses Erlebnis eine nie geahnte Vision der Schönheit an Farben und Linien, an Bewegungen und Rhythmus. Es lag wie ein Bann über ihm, und viel zu schnell war der Tanz für ihn beendet. Die Tänzerin verschwand unerwartet wieder, und die Zuschauer blieben noch sekundenlang reglos sitzen. Dann erloschen die Scheinwerfer, der Kronleuchter flammte auf, und die Unterhaltung setzte wieder ein.
3. Nur eine Tänzerin
»Nun, was sagst du jetzt?«
Paul schrak zusammen, als er aus seinen Träumen gerissen wurde. Er hatte noch mit verschränkten Armen zu der Nische hinübergesehen, in der sie verschwinden war. Die plötzliche Frage seines Bruders brachte ihn in Verwirrung, und er errötete leicht. Arthur sah, daß Paul nervös war und sprach weiter.
»Das Mädchen war einfach großartig und entzückend. Ich muß herausfinden, wer sie ist!«
Mit diesen Worten verschwand er in der Menge. Paul wollte ihn zurückhalten, aber dann unterließ er es doch. Vielleicht konnte Arthur etwas erfahren.
Er selbst hatte keinen Grund mehr, noch zu bleiben, und verließ bei der nächsten Gelegenheit das Haus. Dieses Erlebnis war eine Offenbarung für ihn. Etwas Neues, Süßes, unaussprechlich Schönes war in sein Leben getreten, worüber er sich noch nicht klar werden konnte. Er drückte den Hut in die Stirn und eilte die breite Freitreppe hinunter auf die Straße.
Die Luft brachte ihn wieder zu sich, und er stand einen Augenblick still, um seine Gedanken zu sammeln. Dann rief er das nächste Auto an, ohne sich umzusehen. Der Chauffeur hielt in seiner Nähe, sah sich aber zögernd um, und Paul bemerkte plötzlich, daß wenige Schritte von ihm entfernt eine junge Dame stand, die zu gleicher Zeit wie er dem Chauffeur ein Zeichen gegeben hatte.
Er erkannte dieses Gesicht mit den dunklen Augen sofort wieder. Gewöhnlich wußte er sich in allen Lagen zu helfen, aber nun stand er wie erstarrt am Rand des Fußgängersteiges. Ihre plötzliche Gegenwart schien ihn hypnotisiert zu haben. Der Chauffeur mischte sich nicht ein, sondern überließ den beiden die Entscheidung.
Endlich faßte sich Paul de Vaux. Die Falten, die sich in sein Gesicht eingegraben hatten, zeigten, daß er schon manchen Kampf durchlebt und das Leben von vielen Seiten kennengelernt hatte. Im Dschungel Indiens hatte er einst einen Tiger erlegt, und die Eingeborenen eines entlegenen Walddorfes sprachen noch jetzt achtungsvoll von dem englischen Sahib, der ihren furchtbaren Feind so mutig zur Strecke gebracht hatte. Aber im Augenblick schien alle Kühnheit von ihm gewichen zu sein, und es war ihm, als ob er sein Herz schlagen hörte, als er einen Schritt vorwärts trat. Er wollte sich bei ihr entschuldigen und ihr beim Einsteigen helfen. Aber die Worte kamen nicht über seine Lippen. Er reichte ihr nur die Hand, um ihr behilflich zu sein, und schwieg.
Sie reichte ihm die ihre, stieg aber nicht gleich in den Wagen. Sie sah seine Verlegenheit, und um der merkwürdigen Situation ein Ende zu machen, sprach sie zuerst.
»Es ist eigentlich nicht recht von mir, daß ich Ihnen den Wagen nehme und Sie im Regen stehen lasse.«
Ihre Stimme klang ihm wie zauberhafte Musik, wie Töne aus einer fernen Welt. Und doch wurde dadurch der Bann gebrochen, der ihn gefangen hielt. Er sah sie an. Ein reicher Pelzmantel schmiegte sich um ihre herrliche Gestalt. Einige vorwitzige braune Locken hatten sich unter dem kleinen Hut hervorgeschoben. Als sie den Fuß auf das Trittbrett stellte, öffnete sich ihr Mantel ein wenig, und Paul sah, daß sie ihr Tanzkostüm noch trug.
»Das macht nichts, ich kann gehen.«
»Aber Sie werden ganz naß. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? In diesem Wagen ist Platz für uns beide. Steigen Sie auch ein. Meine Wohnung ist nicht weit entfernt, und Sie können dann weiterfahren.«
Sie stieg ein und setzte sich, denn sie hielt es für selbstverständlich, daß er ihr Anerbieten annahm. Er folgte ihr auch, ohne im geringsten erstaunt zu sein. Es war ihm plötzlich, als ob er von jeher zu ihr gehört hätte und sie nicht verlassen dürfte. Sie gab dem Chauffeur ihre Adresse, und der Wagen fuhr an.
An der Ecke des großen Platzes standen zwei Herren, die sich miteinander unterhielten. Als das Auto langsam an ihnen vorüberfuhr, sahen beide ins Innere, und einer von ihnen schrak zusammen. Paul, der bis dahin geradeaus gesehen hatte, bemerkte die beiden und war etwas beunruhigt, als er seinen Bruder Arthur erkannte.
»Wer war dieser elegant gekleidete Herr?« fragte sie.
»Mein Bruder.«
»Ach so.«
Er wandte sich ab und fühlte sich etwas unangenehm berührt.
Sie schwiegen, bis der Wagen vor einem schönen, aber etwas düsteren Haus in einer Nebenstraße hielt.
»Ich wohne hier«, erklärte sie dann ruhig.
Er half ihr beim Aussteigen. Der Gedanke, daß er sie nun verlassen sollte, war ihm schmerzlich, und doch fürchtete er, daß sie ihn einladen könnte.
»Wenn Sie es nicht sehr eilig haben, kommen Sie vielleicht noch zu einer Tasse Tee herauf?« fragte sie und sah ihm voll ins Gesicht.
»Darf ich Sie wirklich begleiten?« erwiderte er leise.
»Aber natürlich, sonst hätte ich Sie doch nicht eingeladen. Paßt es Ihnen nicht?« fügte sie mit einem spöttischen, aber bezaubernden Blick hinzu.
»Es wird mir eine große Freude sein«, entgegnete er ernst. Nachdem er den Chauffeur bezahlt hatte, folgte er ihr ins Haus.
Auf dem ersten Treppenpodest hielt sie an, schloß auf und forderte ihn durch eine Handbewegung auf, näherzutreten. Er war erstaunt und befangen, als er die reich und prachtvoll ausgestatteten Zimmer sah. Die Tür zum Speisezimmer stand auf, wo der Tisch zum Abendessen gedeckt war. Sie zog ihre Handschuhe aus und bot ihm einen Sessel an.
Er verneigte sich, blieb aber stehen, während sie Hut und Mantel ablegte. Dann trat sie zu ihm.
Die Farbe ihres Kostüms paßte wundervoll zu ihrer bräunlichen Hautfarbe, ihren schwarzen Haaren und ihren dunklen Augen. Sie trat so nahe an ihn heran, daß er den Duft ihres Körpers atmen konnte. Er spielte halb unbewußt mit einem venezianischen Glase, das auf dem Kaminsims stand, aber plötzlich öffneten sich seine Augen weit, und er neigte sich vor. Das Glas zerbrach in seiner Hand, aber er achtete nicht darauf.
»Bist du deshalb aus dem Kloster St. Lucile weggelaufen, Adrea Kiros?!«
4. Adreas Tagebuch
Heute hat mein eigentliches Leben begonnen, und deshalb beginnen auch heute meine Memoiren. Alles, was ich vorher erlebte, hat keine Bedeutung mehr.
Nachdem ich mich aus freiem Entschluß von jeder Gesellschaft getrennt habe, stehe ich nun einsam und ohne Freund in der Welt. Die Männer könnte ich wohl leicht für mich gewinnen, aber den Frauen liegt sicher wenig an mir. Und ich bin froh darüber, denn ich hasse die Frauen, vielleicht auch die Männer. Jedenfalls wird niemand mein Vertrauter sein, und deshalb führe ich Tagebuch.
Heute war für mich ein ereignisvoller Tag. Ich habe zum erstenmal vor einem Publikum getanzt. Und Paul de Vaux war bei mir in diesem Hause. Wir waren beide ganz allein. Zu seltsam, daß ich ihn in dieser großen Stadt gleich das erstemal treffen mußte. Er hat sich verändert, seitdem ich ihn zum letztenmal im Konvent gesehen habe, und auch ich bin eine andere geworden. Und doch hat er mich wiedererkannt! Wie bleich und ernst sah er aus, als er vor dem Kamin stand und meinen Namen nannte! Er ist sehr schön – schöner noch als damals, als mein Vater ermordet wurde, und er seinem Mörder nicht in den Arm fiel. Ach, Paul de Vaux, das war ein böser Tag für dich. Kam dir niemals der Gedanke, daß das kleine, braune Mädchen, wie du es damals nanntest, eines Tages erwachsen sein würde? Glaubtest du jemals, daß sie hätte vergessen können? Ach, die Männer sind doch zu einfältig!
Er hat sich noch an mich erinnert. Sein Gesicht war ernst, aber seine Stimme klang zart! Er hat nicht vergessen, daß er mein Vormund, und ich sein Mündel war. Wie entsetzt und ängstlich sah er mich an. Was wollte er alles wissen! Ob ich allein lebte, ob ich Freunde hätte.
Als ich im Stuhl saß, kam er ganz dicht zu mir und neigte sich so nahe zu mir, daß sein Kopf beinahe den meinen berührte. Als ich zu ihm aufschaute, glaubte ich zuerst, daß er mich umarmen wollte. Ich lächelte ihn an.
Er hat nichts weiter gesagt. Ich lud ihn ein, mit mir zu speisen und versprach ihm, nachher allein für ihn zu tanzen. Ich legte meine Hand einen Augenblick auf seine Schulter, aber er nahm seinen Hut und ging aus dem Zimmer. Es war unhöflich, aber charaktervoll. Er hat sich nicht im mindesten geändert. Ach, Paul de Vaux, du magst kämpfen, soviel du willst, am Ende wirst du doch mein sein!
5. Sturmzeichen
»Paul!«
Der junge Mann war unangemeldet in das kleine Wohnzimmer seiner Mutter getreten. Er sah müde und abgespannt von der Reise aus und sie sah ihn besorgt an als sie sich erhob.
»Bitte, ängstige dich nicht«, sagte er, neigte sich zu ihr und küßte sie. »Es geht mir gut.«
»Und was macht Artur?«
»Ich war gestern nachmittag mit ihm zusammen. Es geht ihm auch gut. London fällt mir auf die Nerven. Das ist alles. Deshalb bin ich hierher gekommen, um mich auszuruhen, und vielleicht ein paar Tage auf die Jagd zu gehen.«
Sie war froh, daß sie ihren ältesten Sohn wieder einige Zeit bei, sich hatte. Die sympathische ältere Dame hatte weiße Haare, schöne Züge und eine aufrechte Haltung, aber wenn man sie näher betrachtete, zeigten sich viele Sorgenfalten in ihrem sonst so bescheidenen Gesicht.
»Morgen wird eine Schnitzeljagd geritten. Treffpunkt im Wald von Dytchley. Hoffentlich wirst du dich erholen. Lege deinen Mantel ab. Ich werde Tee für dich kommen lassen.«
»Danke. Ich bin von der Station aus zu Fuß gekommen und es war sehr kalt. Das warme Kaminfeuer hier tut gut.«
»Ich wünschte nur, ich wäre auf dein Kommen vorbereitet gewesen. Dann hätte ich natürlich den Wagen an den Bahnhof geschickt.«
»Ich habe mich erst im letzten Augenblick zu dieser Reise entschlossen und bin gerade noch zum Zuge zurechtgekommen. Dick Carruthers wollte mich für ein paar Tage nach Paris mitnehmen, aber das paßte mir nicht. Es soll naß, kalt und regnerisch dort sein. Und in dem alten Schloß Vaux Court ist es so behaglich.«
»Ja, es gehört zu den schönsten englischen Sitzen«, erwiderte seine Mutter und schenkte ihm eine Tasse Tee ein. »Obgleich es abseits von den großen Verkehrsstraßen liegt, waren doch in der letzten Woche über ein Dutzend Leute hier, um die Arbeit zu besichtigen. Ich gebe immer meine Einwilligung dazu, wenn du nicht zu Hause bist.«
Paul trank seinen Tee und machte es sich in einem weichen Sessel bequem.
»Was für Leute kommen denn gewöhnlich? Wohl meistens Geistliche und Architekten, vielleicht auch einige Kunsthistoriker?«
»Ja, aber auch viele Amerikaner. Vorgestern war sogar ein römisch-katholischer Priester hier. Er ist den ganzen Tag in den alten Klosterruinen umhergegangen, soviel ich weiß.«
Paul rückte etwas näher zu seiner Mutter heran, und sie erkannte, wie bleich und angegriffen er aussah.
»Bist du krank?« fragte sie ängstlich. »Was fehlt dir?«
»Nichts, ich bin nur müde. Es ist eine lange Reise von London, wie du weißt, und außerdem bin ich doch den weiten Weg vom Bahnhof hierher zu Fuß gegangen. Es ist wirklich nichts, ich fühle mich sonst sehr wohl.«
»Du sahst eben so aus wie dein Vater«, sagte sie leise. »Ich fürchtete mich immer, wenn er diesen Gesichtsausdruck hatte.«
Er rückte seinen Stuhl wieder in den Schatten, so daß man sein Gesicht nicht genau sehen konnte. Aber Mrs. de Vaux war nur halb befriedigt.
»Ich fürchte, du bleibst nachts zu lange auf. Lord Westover erwähnte neulich, daß du viel mit Journalisten, Schriftstellern und Malern verkehrtest, und diese Leute machen ja die Nacht zum Tage.«
»Lord Westover kann sich darüber kein Urteil erlauben. Ich empfinde es als eine persönliche Auszeichnung, daß ich in diesen Kreisen verkehren kann. Sie sind ebenso exklusiv wie unsere offizielle Gesellschaft, und man findet viel Kultur bei ihnen.«
»In gewisser Weise stimmt das. Aber vielleicht nimmst du jetzt lieber ein Bad und kleidest dich um, du siehst noch blaß und angestrengt aus. Eine Erfrischung tut dir sicher gut. Ich werde Reynolds klingeln. Du hast doch wahrscheinlich deinen Kammerdiener nicht mitgebracht.«
Er streckte seine Hand aus und hinderte sie daran.
»Warte bitte noch einen Augenblick, Mutter. Ich sitze hier so gemütlich und möchte noch etwas bleiben. Dieses Zimmer habe ich immer besonders gern gehabt.«
Er sah sich in dem merkwürdigen sechseckigen Raum um, dessen Wände mit alten Eichentäfelungen bedeckt waren. Die Decke war in Form eines kuppelartigen Gewölbes konstruiert. Die Möbel waren echte Stücke in Louis-XV.-Stil, und die Verzierungen der Wände stimmten mit dem Ornament der Möbel überein.
»Ich halte mich auch gern hier auf«, sagte sie ruhig. »Heute abend ist der blaue Salon geöffnet. Wir werden dort speisen, aber nur weil Lord und Lady Westover zum Essen kommen. Ich fürchte, May kann nicht erscheinen. Sie soll sich erkältet haben, ihre Gesundheit scheint nicht sehr stark zu sein.«
Paul schien sich für diese Mitteilung wenig zu interessieren. Er blieb aus einem ganz bestimmten Grund, der nichts mit May Westover und ihrer Gesundheit zu tun hatte. Dagegen wollte er etwas erfahren, ohne jedoch die Aufmerksamkeit seiner Mutter zu erregen.
»Amerikaner müssen sich ja für Ruinen sehr interessieren«, warf er hin.
»Ja, das sollte man meinen, wenn man sie sieht. Aber Reynolds liebt sie nicht. Sie sind ihm zu vertraulich und stellen zu viele indiskrete Fragen. Der katholische Priester, der neulich hier war, ist schon viel interessanter. Er ging in den Klosterruinen umher, als ob er sie schon sein Leben lang gekannt hätte. Reynolds erzählte mir auch, daß der Mann das Kloster sehr liebte, und daß er zwei Stunden lang in der Kapelle gebetet hätte.«
»Hast du ihn auch selbst gesehen?«
»Ja, aus der Entfernung. Ich habe damals nicht besonders auf ihn geachtet. Das tat mir nachher leid, als ich Reynolds Bericht hörte. Es muß sehr traurig für ihn gewesen sein, in der alten, kahlen Kapelle zu weilen. Die Katholiken achten und ehren ihre Kirchen und Kapellen weit mehr als wir, ihr Gottesdienst hat etwas so Berauschendes und Erhebendes, und ihr Verhältnis zur Religion ist mehr von persönlicher Zuneigung und Liebe getragen.«
Paul bewegte sich unruhig in seinem Stuhl. »Er ist dir also nicht besonders aufgefallen?«
»Wen meinst du? Wer soll mir aufgefallen sein?«
»Natürlich der katholische Priester, von dem wir eben sprachen.«
»Seine Gesichtszüge habe ich nicht gesehen. Ich kann mich nur darauf besinnen, daß er sehr groß war. Wenn du dich für ihn interessierst, kann dir Reynolds sicher noch viele Einzelheiten erzählen. Da kommt er gerade.«
Ein grauhaariger Diener war eingetreten und Mrs. de Vaux wandte sich an ihn.
»Reynolds, Mr. Paul möchte gerne von dem katholischen Priester hören, der gestern so lange hier war und die Abtei besichtigt hat. Können Sie ihn genauer beschreiben?«
»Ich fürchte, das kann ich kaum«, antwortete der alte Mann respektvoll. Diese Priester sehen sich alle so ähnlich, wenn sie die langen, dunklen Gewänder tragen. Er war groß und hager und hatte ein vollkommen glattes Gesicht. Sonst ist mir nichts aufgefallen. Nur sprach er mit ausländischer Betonung.«
»Wissen Sie auch genau, daß es wirklich ein Priester war?« fragte Paul gleichgültig. »Man hört in der letzten Zeit so viel von Betrügern, die nur eine Gelegenheit wahrnehmen, um die Häuser kennenzulernen, in die sie später einbrechen wollen. Ich bin solchen Leuten gegenüber immer etwas mißtrauisch.«
»Ich bin ganz sicher, daß es kein Betrüger war«, entgegnete Reynolds zuversichtlich. »Dazu interessierte er sich viel zu sehr für die Abtei selbst. Er kannte die Geschichte des Klosters besser als sonst jemand, den ich hier getroffen habe. Wenn es ein Dieb oder Einbrecher gewesen wäre, der hier nur spionieren wollte, dann hätte er mir Geld angeboten und hätte sicher versucht, mich fortzuschicken.«
»Das stimmt«, erwiderte Paul. »Waren Sie die ganze Zeit bei ihm?«
»Fast dauernd. Er plauderte gern mit mir und hielt mich zurück, als ich gehen wollte. Er hat sich auch alles Sehenswerte genau betrachtet. Außerdem hat er nicht das Schloß selbst sehen wollen wie die anderen Besucher, die doch hauptsächlich die berühmten Gemälde in der Galerie betrachten wollen. Er ist nur in den Ruinen gewesen.«
»Das ist natürlich entscheidend«, sagte Paul kurz. »Ein Dieb oder Einbrecher interessiert sich nicht für Ruinen. Mein Verdacht war vollkommen unbegründet.«
»Der Priester fragte auch noch, ob Sie viel hier wären, und wann Sie wiederkommen würden«, bemerkte Reynolds, bevor er den Raum verließ.
Paul sah auf. Eine merkwürdige Furcht überfiel ihn plötzlich. Das Totenzimmer seines Vaters stand wieder vor ihm, und er erlebte im Geist noch einmal die tolle, gefährliche Fahrt mit der Jacht. Er sah die Wellen am Hafeneingang vor sich, die über dem Deck zusammenschlugen und ihn vollständig durchnäßten, und er dachte an die endlos bangen Stunden, in denen sie in der Nacht vorher auf das kleine flackernde Licht los? steuerten, das in dem fernen Klostergemach leuchtete. Wieder war es ihm, als ob er das Heulen des Sturmes und das Donnern der Meereswogen hörte, das als dumpfe, düstere Melodie die traurigen Vorgänge begleitete. Er glaubte das monotone, singende Beten des düsteren Mönches zu vernehmen, und er sah im Geiste, wie das zynische Lächeln auf den Zügen des großen Mannes am Bettende plötzlich er? starb, als dieser tot zusammenbrach. Und dann tauchte das kleine, braune Mädchen mit den wirren, dunklen Locken und dem tränenbenetzten Gesicht vor ihm auf, die den Toten so krampfhaft umklammert hielt und die Fremden so ängstlich betrachtete.
Diese letzte Erinnerung brachte Paul plötzlich wieder zur Wirklichkeit zurück, und er dichte an Adrea, die einen so tiefen Eindruck auf ihn gemacht hatte. Seine Wangen glühten, und er wußte nun wieder, warum er London verlassen hatte.
Seine Mutter beobachtete ihn scharf, und er konnte ihrem fragenden Blick nicht begegnen.
»Paul, hast du Sorgen oder Kummer?« fragte sie langsam.
»Ach, nein, es ist nichts, Mutter. Verzeih, daß ich meine Gedanken ein wenig wandern ließ.«
Sie war zu stolz, um sein Vertrauen zu bitten, und als gleich darauf der Gong aus der Halle ertönte, erhob sie sich.
»Wir haben heute abend einige Gäste, Paul. Denke daran, und komme nicht zu spät.«
»Ich werde pünktlich sein, Mutter.«
Sie verließen den Salon zusammen und trennten sich in der Halle. Mrs. de Vaux blieb noch, um den Hausmeister zu sprechen, und Paul stieg die breite Treppe allein hinauf. Auf dem Gang im ersten Stockwerk blieb er stehen und starrte aus einem hohen Bogenfenster auf die Klosterruinen hinunter, die unten im Park lagen. Das Wetter war frostig und klar, er konnte das verfallene Mauerwerk genau erkennen, obwohl der Mond nur schwach schien. Es lag wie ein geheimnisvoller Zauber über diesen schönen, malerischen Ruinen, und als Paul länger hinschaute, änderte sich sein Gesichtsausdruck. Aber plötzlich trat eine dunkle Gestalt langsam aus dem Schatten der Pfeiler hervor und blieb hochaufgerichtet und bewegungslos stehen.
6. Freudlose Begegnung
»Mr. de Vaux!«
Paul wandte sich im Sattel schnell zu der jungen Dame um, die ihn angesprochen hatte. Über ihren schönen, anmutigen Zügen lag ein Schatten, und sie runzelte die Stirn.
»Ach, verzeihen Sie, Lady May. Haben Sie eben etwas zu mir gesagt?«
»Sie fragen, ob ich etwas gesagt habe?« erwiderte sie mit verhaltenem Zorn. »Es scheint mir, als ob Sie Ihr frohes und heiteres Wesen in London gelassen hätten. Was ist denn nur mit Ihnen?«
»Ach nichts. Es tut mir leid –«
»Bitte, entschuldigen Sie sich nicht«, unterbrach sie ihn schnell. »Es ist wohl besser, daß ich vorausreite.«
»Tun Sie das nicht, Lady May. Ich weiß, daß ich unaufmerksam war, und ich will versuchen, es wieder gutzumachen.«
»Schön«, entgegnete sie etwas ruhiger. »Aber Sie müssen nicht denken, daß ich mich ohne Grund beschwere. Ich habe Sie dreimal etwas gefragt, bevor ich nur eine Antwort erhielt. Sie sind den ganzen Tag rücksichtslos geritten und haben häufig Ihr Leben und Ihr Pferd in Gefahr gebracht. Einige Ihrer tollkühnen Sprünge mit dem Tier grenzten direkt an Wahnsinn. Ich liebe kühnes, flottes Reiten, aber doch mit Maß und Ziel. Das ist nicht allein meine Meinung, andere Leute urteilen ebenso. Ich habe an vielen Schnitzeljagden teilgenommen, seitdem mein Vater mir das erste Ponny schenkte, aber ich habe noch niemals gesehen, daß jemand versucht hat, den Annisforth unterhalb der Brücke zu nehmen. Und ich möchte das auch nicht wieder sehen«, sagte sie schaudernd. »Ich weiß, daß Sie gute und wilde Pferde reiten, aber im allgemeinen sind Sie doch nicht so unvernünftig wie heute. Sie haben Ihre schwarze Stute so zugerichtet, daß es lange dauern wird, bevor sie wieder geritten werden kann. Der alte Harrison hatte Tränen in den Augen, als er das Tier in dem Zustand sah.«
»Ach, Harrison ist ein altes Weib, wenn es sich um Pferde handelt. Ich habe Mag nicht ein einzigesmal die Sporen gegeben. Sie war selbst so frisch und munter, daß ich sie kaum halten konnte.«
»Sie können sich und mich nicht täuschen«, erwiderte Lady May ruhig. »Den ganzen Tag haben Sie die tollkühnsten Sprünge gemacht, um zu stürzen, und es ist ein großes Glück, daß Sie mit dem Leben davonkamen und sich nicht das Genick brachen, was tatsächlich Ihre Absicht zu sein schien. Und nachdem Sie diese Absicht nicht erreicht haben, sind Sie fast zehn Meilen neben mir geritten, ohne sich zu unterhalten.«
Er wollte gerade sagen, daß er ihre Gesellschaft ja nicht gesucht hätte, aber dann schwieg er doch. Lady May hatte tatsächlich Grund, auf ihn böse zu sein. Sie waren seit den Tagen ihrer frühesten Kindheit befreundet, und selbstverständlich erwarteten alle Bekannten Pauls, daß er Lady May eines Tages heiraten würde. Er wußte, daß Lady May auf seinen Antrag wartete, denn sie hatte seinetwegen schon zwei achtbare Herren der Gesellschaft abgewiesen. Ihre Eltern und ihre Familie wünschten ebenfalls die Heirat, und Lady May selbst achtete und liebte Paul mehr als einen anderen Mann. Es war daher nur erklärlich, daß sie über das lange Schweigen während des Heimrittes erregt und erzürnt war. Sie hatte es natürlich so eingerichtet, daß er nur in ihrer Gesellschaft den Heimweg antreten konnte.
»Bitte, seien Sie mir nicht böse«, begütigte er sie. »Ich habe Sorgen.«
Sofort war sie freundlich und mitfühlend.
»Ach, es tut mir so leid. Verzeihen Sie, was ich gesagt habe. Aber früher haben Sie mir all Ihren Kummer erzählt.«
Er schüttelte den Kopf.
»Ich kann Ihnen nicht alle Einzelheiten erzählen. Ich habe heute morgen einen Brief von einem Bekannten aus der Stadt erhalten, dem ich unbedingt trauen kann. Das Schreiben handelte von Artur. Sie wissen, wie leicht er sich beeinflussen läßt. Wenn jemand ihn näher kennengelernt hat, kann er alles mit ihm machen, was er will. Nun hat er die Bekanntschaft einer Tänzerin Adrea Kiros gemacht, die ihn vollständig fasziniert hat. Er ist ihr vollständig verfallen.«
»Ich habe von ihr gehört«, erwiderte Lady May leise. »Sie tritt aber nur in Privathäusern bei gesellschaftlichen Gelegenheiten auf. Aber alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, daß sie eine große Künstlerin sei.«
»Ja, das stimmt«, Paul wolle noch mehr sagen, aber dann schwieg er. Lady May hatte ihn beobachtet und erkannt, daß er von Adrea Kiros nicht in ruhigem Ton sprechen konnte.
»Ich will mich über Artur nicht beklagen«, fuhr er fort. »Er ist der Lieblingssohn meiner Mutter. Sie wissen, wie sehr sie noch an alten Anschauungen hängt, und Sie werden deshalb verstehen, welchen Kummer ihr derartige Gerüchte bereiten würden. Aber abgesehen davon, hat Artur keine starke Gesundheit, und mein Freund Cis schreibt, daß er krank und elend aussieht. Adrea spielt scheinbar nur mit ihm, obgleich sie ihn sehr ermutigt.«
Lady May hatte Mitleid mit Paul, aber sie konnte sich seine Stimmung doch nicht ganz erklären.
»Wäre es nicht besser, daß Sie nach London führen und Ihren Einfluß auf Artur geltend machten? meinte sie. »Sie müssen zugeben, daß das ein selbstloser Rat ist«, fügte sie mit einem Lächeln hinzu. »Ich wünsche doch, daß Sie nicht so schnell wieder von hier fortgehen. Aber ich weiß auch, wie sehr Artur an Ihnen hängt. Sicher gelingt es Ihnen, ihn von London und seinem Einfluß zu lösen. Glauben Sie nicht, daß Sie ihn hierherbringen könnten? Hier lassen sich allerhand Zerstreuungen für ihn arrangieren, und wir könnten eine schöne Zeit miteinander Verleben.« Sie sprach eifrig und lebhaft. »Was halten Sie von meinem Vorschlag?«
Er war dankbar, daß sie so lange gesprochen hatte, denn er hatte sich beruhigen können. Die Pflicht schien ihm diese Reise nach London zu diktieren. Er hatte den Brief seines Freundes schon vor zwei Tagen erhalten und zweimal an Artur telegraphiert, aber keine Antwort erhalten. Er fürchtete, wieder in Adreas Nähe zu kommen, und doch sehnte er sich nach ihrer Gegenwart. Selbst in der Ferne übte sie einen starken Einfluß aus, dem er sich nicht entziehen konnte. Und doch durfte es nicht sein.
»Ich halte Ihren Plan für sehr gut. Morgen fahre ich nach London. Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen, daß Sie sich so sehr für mich interessieren.«
Er sah ihr ins Gesicht und schaute dann über die kahle Heide, die sich zu beiden Seiten ausdehnte. Es war ein später Novembernachmittag, und der Himmel hatte sich im Westen schwarzgelblich gefärbt als Nachklang des Abendrotes. Eine frische, kräftige Brise wehte von der See herüber, und aus der Ferne konnte man hören, wie sich die Wogen unaufhörlich an den harten Klippen brachen. Weiter landeinwärts war das Gelände mehr bebaut, aber hügelig, und hier und dort von efeuumrankten Felspartien unterbrochen. Ab und zu zeigte sich eine kleine Fichtengruppe. Paul kannte dieses sturmdurchwehte, kahle Land mit den weiten Heide- und Moorländern, den stillen einsamen Wasserflächen und dem nimmer endenden Rauschen des Meeres sehr gut. Das war seine Heimat, und er liebte sie. Das war ihm noch niemals so deutlich zum Bewußtsein gekommen. Die Reise nach London wurde ihm plötzlich unangenehm. Die Schönheit Nordenglands hatte ihn wieder vollständig in Bann geschlagen und die andere Neigung in den Hintergrund gedrängt. Und als er nun Lady Mays Gesicht mit den blonden Locken und den blauen Augen betrachtete, fühlte er, daß sie ganz hierhergehörte, und daß die Zuneigung zu ihr das starke Band war, das ihn an diese Gegend kettete. Von ihr ging ein guter Einfluß aus. Er neigte sich zu ihr und legte die Hand auf ihren Sattel.
»Sie sind so gut zu mir«, sagte er sanft. »Sie waren schon immer so lieb.«
Sie sah erfreut zu ihm auf, und ihre Augen sagten ihm mehr als Worte.
»Ich wünschte, ich könnte öfter mit Ihnen zusammensein«, erwiderte sie ruhig, »damit Sie mir wie früher alle Ihre Sorgen und Ihren Kummer anvertrauen könnten. Erinnern Sie sich noch?«
»Ja, ich weiß es. Und manchmal habe ich gehofft, daß diese Tage wiederkommen möchten.«
Sie ritten eine grasbewachsene Seitenstraße entlang, die zur Abtei führte. Man hörte die Hufe der Pferde nicht auf dem weichen Rasen.
Sie schwieg und wandte den Kopf ab, damit er nicht sehen sollte, daß sich eine Träne in ihr Auge stahl. Seine Hand ruhte noch auf ihrem Sattel, während er die Zügel lose in der anderen Hand hielt.
»Sollten diese Zeiten wiederkehren, sollte ich jemals wieder so glücklich sein«, sagte er kaum hörbar, »dann werden Sie es nicht so leicht mit mir haben. Ich habe schwere Sorgen – vielmehr eine einzige Sorge, aber die ist um so größer und drückender.«
Sie sah ihn einen Augenblick an und dachte unwillkürlich an die Zeit, als merkwürdige Gerüchte über Martin de Vaux hier erzählt wurden. Aber das war nun schon viele Jahre her, und sie wollte ihn jetzt nicht danach fragen. Sie glaubte Paul und nahm für ihn Partei, denn sie war überzeugt, daß ihm unrecht geschah. Eine Frau ist immer leicht geneigt, andere zu verurteilen, die Gegner ihres Geliebten sind.
Er brachte sein Pferd noch etwas näher an das ihre und drückte plötzlich ihre schmale Hand, die die Reitpeitsche hielt.
»May –«
In diesem Augenblick scheute ihr Pferd, sprang zur Seite und schlug heftig aus. Eine große, düstere Gestalt trat plötzlich mitten auf den Weg und ergriff die Zügel von Lady Mays Pferd. Der Mann war so plötzlich aus dem Halbdunkel aufgetaucht, und seine Erscheinung war so ungewöhnlich, daß Paul und May ebenso erschraken wie die Tiere. Paul war zuerst aufgebracht und wütend.
»Was zum T– –«
Aber er fluchte nicht. Der Mann beruhigte Lady Mays Pferd mit ein paar leisen Worten und trat dann aus dem Schatten der überhängenden Äste auf die Mitte der Straße. Auch jetzt waren seine Züge kaum sichtbar, aber man konnte ein Gewand und die Umrisse seiner Gestalt erkennen. Er trug lange dunkle Mönchsgewänder und den breitkrempigen, flachen Hut der römisch-katholischen Priester.
Paul brach mitten im Wort ab und der Arm mit der Peitsche, der sich schon erhoben hatte, sank kraftlos nieder. Er war dankbar, daß man im Zwielicht sein Gesicht nicht sehen konnte. Aber, da er nun Gewißheit hatte, faßte er sich. Er hatte Pater Adrian wiedererkannt, obgleich auch dieser sich mit den Jahren verändert hatte. Er ritt auf ihn zu und wandte sich an ihn.
»Haben Sie den Weg verloren?« fragte er ruhig. »Hier ist eine Privatstraße, und das Tor an der anderen Seite führt zum Schloß.«
Der Priester sah ihn einen Augenblick ernst an, dann trat er zur Seite, als ob er die beiden vorbeireiten lassen wollte.
»Es tut mir leid, daß ich Sie und Ihre Pferde erschreckt habe«, sagte er mit sanfter, wohllautender Stimme, die einen starken fremden Akzent aufwies. »Ich wandte Ihnen gerade den Rücken zu und wartete, daß der Mond hinter den Ruinen aufgehen sollte. Der Boden ist so weich, daß ich die Hufschläge nicht gehört habe. Der Diener im Schloß hat mir die Erlaubnis gegeben, überall in den Ruinen umherzugehen. Vielleicht habe ich mich etwas zu weit entfernt.«
»Das macht nichts«, erwiderte Paul. »Sie interessieren sich für die Ruinen?«
»Ja.«
»Im Schloß befinden sich auch mehrere kostbare Gemälde, die Sie vielleicht ebenso interessieren. Meistens stammen sie aus neuerer Zeit. Aber wir haben auch verschiedene kostbare klassische Gemälde, eine Madonna von Rubens, und mehrere Italiener.«
»Ich danke Ihnen, aber ich interessiere mich nur für mittelalterliche Kunst. Diese Ruinen sind mir mehr wert als irgendein Gemälde weltlichen Inhalts. Ich gehe jeden Abend hierher, und ich hoffe, daß Sie mir während meines kurzen Aufenthaltes in dieser Gegend die Erlaubnis dazu geben.«
»Gerne. Sie können kommen und gehen, wie es Ihnen beliebt. Ich bin Mr. de Vaux.« Paul berührte sein Pferd leicht mit der Peitsche. »Guten Abend.«
»Guten Abend, und vielen Dank!«
Die Beiden ritten die Allee weiter entlang. Paul schwieg, in Gedanken versunken, und machte keine weitere Bemühung, die vorige Unterhaltung wieder aufzunehmen. Bei einer Biegung des Weges drehte er sich im Sattel um. Der Priester stand noch auf dem Weg. Er hatte ihnen den Rücken zugekehrt, aber er stand regungslos wie eine steinerne Statue.
7. Eine Frage
Der Mond schien voll auf die Ruinen der Abtei Vaux. Zauberhafte Schönheit war über die Landschaft gebreitet. In der Ferne glänzte das Silberband eines Stromes, in der Nähe der Abtei leuchtete ein schilfbewachsenes Gewässer auf, und die dunklen Tannen auf den sandigen Abhängen verloren in dem Mondschein ihr düsteres Aussehen.
Zwischen den hochragenden Pfeilern der Ruinen stand der katholische Priester. Er hatte das Gesicht dem Monde zugewandt, und auch aus seinen Zügen war die Härte gewichen. Aber es quälten ihn noch Unruhe und Zweifel.
»Sechs Nächte habe ich nun in den Ruinen gebetet«, sagte er halblaut zu sich selbst, »aber diese mondhellen, stillen Nächte sind für mich wie ein Spott. Wenn es einen Gott und eine heilige Jungfrau gibt, warum haben sie dann ihre Gnade von mir abgewandt? Es ist ein trauriges, hoffnungsloses Unternehmen, daß ich hierherkam. Ich wäre besser in dem öden Kloster in Cruta geblieben und hätte dort meine Tage verbracht, ohne die Aufregungen und Versuchungen der großen Welt zu erfahren, ohne Seele, ohne Leben. Der Kampf hier draußen wird für mich ein ewiges, schreckliches Rätsel bleiben. Ich kann mit dieser Welt nicht rechten, mit ihr weinen oder lachen. Ich lebe in ihr und bin doch nicht in ihr. Warum wurde ich hierhergeschickt?«
Das Geräusch eines brechenden Zweiges störte ihn auf. Paul de Vaux kam auf ihn zu. Er hatte einen großen, weiten Mantel über seinen Frackanzug gelegt.
Pater Adrian ging ihm einige Schritte entgegen, und die beiden standen sich einen Augenblick lang schweigend gegenüber. Sie wußten, daß dies keine gewöhnliche Begegnung war. Jeder schien die Stärke des anderen zu prüfen und abzuwägen.
»Pater Adrian, wir haben uns schon früher getroffen«, begann Paul.
»Ja.
»Sie werden verstehen, daß ich überrascht bin, Sie hier in England zu sehen. Haben Sie das Kloster in Cruta verlassen?«
»Ich bin einen Monat nach Ihrer Abreise von dort fortgegangen.«
»Aber Sie haben doch ein Gelübde abgelegt. Sind Sie dadurch nicht für das ganze Leben gebunden?«
Der Pater lächelte bitter. »Meine Gelübde haben mit meinem Aufenthalt nichts zu tun. Es waren Klagen über das Kloster gekommen, und ich war damals hingesandt worden, um sie zu prüfen. Das Kloster war nur arm, und die Mönche lebten nicht nach der Regel. Jetzt ist es geschlossen worden.«
»Dann sind Sie also kein Mönch?«
Pater Adrian schüttelte den Kopf.
»Ich habe in meiner Jugend zwar die Jahre meines Noviziats durchgemacht und in einem Kloster gelebt, aber ich habe nicht das Gelübde abgelegt. Das Leben im Kloster taugt nur für heiligere und strengere Männer als mich.«
»Aber wer sind Sie dann?«
»Ich bin – Pater Adrian, Priester der römisch-katholischen Kirche. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen.«
Das Mondlicht schien jetzt voll auf seine dunklen, ausdrucksvollen Züge. Paul sah ihn durchdringend an, aber der Pater begegnete seinem Blick ruhig und sicher.
»Was bringt Sie zur Abtei Vaux?« fragte Paul schließlich.
»Ich wollte Ihren Landsitz sehen.«
»Aber es muß Sie doch etwas mehr als gewöhnliche Neugier hierher getrieben haben?«
»Ich wollte das Heim des Engländers Martin de Vaux sehen, der in meinen Armen im Kloster Cruta starb. Sechs Nächte habe ich hier für seine Seele im Fegefeuer gebetet, denn er starb in schwerer Sünde.«
»Sind Sie nur hergekommen, um mich daran zu erinnern?« fragte Paul bitter. »Vielleicht haben Sie bereut, daß Sie bisher geschwiegen haben? Sie wollen doch nicht etwa das Herz seiner Witwe brechen, indem Sie ihr die Geschichte seiner letzten Stunde erzählen? Hat er Ihnen in diesen letzten düsteren Augenblicken das Geheimnis seines Lebens gebeichtet? Hat er Ihnen gesagt, warum er nach Cruta kam?«
»Das hat er getan«, entgegnete der Priester ernst.
»Mein Gott!« rief Paul entsetzt. Er hatte bisher nur gefürchtet, daß der tragische Tod seines Vaters bekannt und seine Mutter dadurch unglücklich werden würde. Aber nun betrachtete er Pater Adrian plötzlich mit ganz anderen Augen. Frieden und Ruhe seiner Familie hingen also von dem guten Willen dieses Mannes ab.
»Die Geheimnisse eines Sterbenden sind Ihnen anvertraut worden«, sagte er heiser. »Die Geheimnisse der Beichte sind für Sie so unverbrüchlich wie der Glaube!«
Der Pater schüttelte leicht den Kopf.
»Nein, er weigerte sich, zu beichten. Er hat mir ausdrücklich gesagt, daß er nur als Mann zum Mann zu mir spräche.«
Paul verdammte die Schwäche seines Vaters. Wenn nun dieser Priester aus gewissen Gründen zu dem Entschluß käme, dieses Geheimnis nicht zu wahren! Warum war er eigentlich hierhergekommen? Warum betrachtete er die letzten Mitteilungen eines Sterbenden nicht als Beichte? Es gab nur noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht wollte er Geld für sein Geheimnis haben. Aber Geld bedeutete doch für einen Priester der römisch-katholischen Kirche nichts. Was könnte er dadurch gewinnen?«
»Ich verstehe Sie nicht«, erwiderte Paul schließlich. Warum sind Sie hierhergekommen?«
Pater Adrian schaute nachdenklich zur Seite.
»Sie fragen mehr, als ich Ihnen sagen kann. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Wir werden uns wiedersehen. Leben Sie wohl!«
Er wandte sich zum Gehen, aber Paul legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Wenn Sie glauben, daß Sie mir etwas zu sagen haben, dann sagen Sie es jetzt. Ich kann alles tragen. Ich weiß nur, daß mein Vater ein Geheimnis hatte. Das Geheimnis selbst kannte ich nicht. Also sprechen Sie! Sagen Sie mir mehr!«
Der Pater machte sich frei.
»Noch nicht. Ich bin bis jetzt noch zu keinem klaren Entschluß gekommen. Ich sagte Ihnen schon, daß wir uns wiedersehen würden!«
»Aber –«
»Leben Sie wohl!«
Der Pater entfernte sich mit schnellen Schritten und verschwand in den Schatten der Nacht.
»Kommen Sie doch zurück! Ich muß mit Ihnen sprechen!« rief Paul fast verzweifelt.
Aber der Priester wandte sich nicht mehr um. Paul starrte ihm nach. Die Gefahr, die er immer gefürchtet hatte, war nun eingetreten.
8. Hoffnungslose Liebe
Paul und Artur teilten eine Junggesellenwohnung in Mayfair. Teilen ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, denn Paul hatte das Haus gekauft und war der alleinige Besitzer. Artur wohnte dort, so oft er Urlaub nach London erhielt, und dort traf Paul seinen Bruder am Morgen seiner Ankunft in London.
Die beiden Brüder reichten sich schweigend die Hand. Paul hatte nicht den Wunsch, im Augenblick zu sprechen, denn das Aussehen seines Bruders beunruhigte ihn. Es war ein Uhr mittags, aber Artur trug noch seinen Pyjama. Er hatte eingesunkene, blasse Wangen mit rot abgezirkelten Flecken, und schwache, dunkle Schatten lagen unter seinen Augen. Ein Stoß blauer Papiere und einige amtliche Kuverte lagen auf dem Tisch.
»Ich wünschte nur, du würdest einem mitteilen, wann du nach London kommst«, sagte Artur, etwas benommen durch die Überraschung, und machte den Versuch zu lächeln. »Ich habe dich doch erst heute abends erwartet. Deshalb habe ich gefrühstückt, bevor ich mich angekleidet habe. Ich war gestern abends spät auf.«
Paul wollte so unbefangen wie möglich er? scheinen und lehnte sich an den Kamin. Die Rolle, die er jetzt zu spielen hatte, lag ihm durchaus nicht. Aber er mußte seinen jüngeren Bruder ermahnen und ihn auf den rechten Weg bringen. Die Umstände zwangen ihn dazu.