
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magellan Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Albert sammelt Abschiede. Tag für Tag fotografiert er am Bahnhof Umarmungen, Trennungen und Tränen. Denn Abschiede, das sind für ihn Momente, in denen der Mensch wahrhaftiger ist als jemals sonst. Eines Tages lernt er Kati kennen. Sie sieht aus wie ein Engel, ist gleichzeitig abgezockt und verletzlich. Und sie ist wie gebannt von seinen Bildern, vor allem von seinem Lieblingsbild, auf dem Schmerz und Glück völlig selbstvergessen miteinander verschmelzen. Doch Kati behauptet, das Foto sei eine einzige Lüge. In den Tiefen des Bahnhofs machen sich die beiden daran, die Wahrheit hinter dem Foto zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Christoph Scheuring, geboren 1957, hat in seinem Leben schon viel gesehen. Als Journalist für DER SPIEGEL, stern und DIE ZEIT hat er mit den Mächtigsten am Tisch gesessen und mit den Machtlosen auf der Straße gelebt. Seine Leidenschaft gehört besonders den Jugendlichen in den Randgebieten unserer Gesellschaft. Als Autor schreibt er über das Leben dort, wo es brüchig ist, wo es ausfranst, wo es wehtut. Dort, wo es interessant wird. ECHT war für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2015 nominiert.
Lehrerinnen und Lehrer finden hier
eine kostenfreie Lehrerhandreichung zum Download:
www.magellanverlag.de/lehrerhandreichungen
CHRISTOPH SCHEURING
ECHT
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
1
Das erste Mal, dass ich mit der Polizei was zu tun bekam, ist jetzt ziemlich genau vier Monate her. Bis dahin hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht einmal einen Lutscher geklaut. Keine Schlägerei, keine Klingelstreiche, und wenn ich doch mal bestraft wurde, war es höchstens ein Missverständnis. »Ich« und »was anstellen« waren absolut inkompatible Begriffe. Ich glaube, ich war so ziemlich der anständigste Junge, den man am Hamburger Hauptbahnhof finden konnte, und deshalb bekam ich wahrscheinlich auch so einen Schreck, als ich dann zum ersten Mal verhaftet wurde. Es war an einem Freitagnachmittag, auf Gleis 12, neben der Treppe.
Wie immer um diese Zeit war der Bahnsteig vollgepackt mit Studenten und Soldaten der Bundeswehr, und dann hatten auch noch ein paar Züge Verspätung, sodass zwischen den Gleisen ein echtes Geschiebe war. Von allen Seiten drückten die Leute und pausenlos hatte man irgendwelche Ellenbogen zwischen den Rippen, und deshalb merkte ich anfangs gar nicht, als mich jemand von hinten berührte. Es war eine kräftige Hand, die meinen Arm festhielt und die dann immer härter zudrückte, bis ich vor Schmerz fast in die Knie ging. »Mitkommen, Freundchen«, sagte eine Stimme, und dann wurde ich die Bahnsteigkante entlanggezerrt, dass ich überhaupt keine Chance hatte, mich zu wehren.
Mein erster Gedanke war, dass das jetzt eine Entführung war, und deshalb brüllte ich ziemlich laut und schlug um mich und trat dem Entführer gegen das Schienbein, aber der Typ ließ überhaupt nicht locker. Stattdessen fasste er mit der freien Hand in seine Jacke und hielt irgendein Papier in die Höhe.
»Bitte machen Sie Platz, das ist ein polizeilicher Einsatz«, rief er, und dann schleifte er mich die Rolltreppe hoch und durch die Wandelhalle. Ungefähr wie Moses durch das Rote Meer. Vor uns teilte sich die Menge und hinter uns floss sie wieder zusammen, und alle schauten mich an, als wäre ich ein biblisches Wunder. Kein einziger Mensch rührte einen Finger für mich.
Und ich alleine hatte ehrlich überhaupt keine Chance gegen den Typen. Er war mindestens einen Kopf größer als ich und hatte doppelt so viele Muskeln und zehnmal so viel Fett. Richtig so ein Mensch-Massiv, das ich im Leben nicht umschmeißen könnte. Also stolperte ich hinter ihm her, am Reisezentrum vorbei, raus auf den Vorplatz, Richtung U-Bahn und dann die erste Rolltreppe wieder runter. Dort war dann ein ewig langer Gang mit weißen und blauen Kacheln. Wir kamen an den Fahrkartenautomaten vorbei, und gegenüber war auf der rechten Seite eine Glastür und ein riesiges verspiegeltes Fenster, hinter dem wahrscheinlich irgendwelche Ermittler saßen und den Platz kontrollierten. Über dem Fenster stand »HVV-Wache«. Daneben war noch eine silberne Stahltür ohne Klinke. Für die hatte der Menschen-Berg einen Schlüssel.
Hinter der Tür war ein fensterloses Büro mit lauter Bildschirmen, auf denen man offenbar alles sehen konnte, was im Bahnhof passierte. Im Moment waren vielleicht eine Handvoll Typen hier, die auf die Bildschirme starrten. Alles Männer, glaube ich, eine Frau konnte ich nicht entdecken.
Der Menschen-Berg drückte mich auf einen Stuhl, der vor einem zugewucherten Schreibtisch stand, und setzte sich selbst auf die gegenüberliegende Seite. Er faltete die Hände hinter dem Kopf und lehnte sich zufrieden zurück. Sein Gesicht hatte so eine rotviolette Farbe wegen der geplatzten Äderchen überall, und darüber hatte er ganz dichtes schwarzes Haar, das bestimmt eine Perücke war, weil man überhaupt keinen Haaransatz sehen konnte. Und die Augenbrauen waren auch nicht so tiefschwarz, sondern eher graubraun, würde ich sagen. Er schaute mich an, ohne den Mund aufzumachen. Das ging bestimmt eine Viertelstunde so. Wahrscheinlich war das irgendeine Masche von ihm, damit ich mich durchschaut fühlte und Angst bekam.
Hat leider auch ziemlich gut funktioniert, weil ich mir nämlich die ganze Zeit das Hirn zermarterte, was er eigentlich von mir wollte. Ich hatte absolut überhaupt nichts angestellt. Also jedenfalls nicht bewusst. Und wenn ich trotzdem verhaftet wurde, konnte das Ganze ja nichts Gutes bedeuten.
»Ich will einen Anwalt«, sagte ich irgendwann, weil ich das Schweigen nicht mehr aushielt und weil das im Fernsehen ja immer alle sagen, aber der Rotgesichtige lachte nur, als hätte ich gerade einen ganz tollen Witz gemacht. Dann wurde er – ganz plötzlich, von einem Moment auf den anderen – so richtig übellaunig.
»Wo ist dein Handy?«, bellte er.
»Hab ich … also … vor zwei Tagen … hab ich es in der Schule verloren«, stotterte ich, was jetzt nicht ganz der Wahrheit entsprach, weil es nämlich so war, dass die beiden größten Hohlköpfe in meiner Klasse das Teil so lange auf der Toilette hin- und hergeworfen hatten, bis es in einer Kloschüssel gelandet war. Seitdem trocknete es zu Hause auf unserer Heizung und funktionierte nicht mehr.
»Ja klar«, sagte der Typ, »verloren … ganz zufällig«, und dann musste ich alle Taschen ausleeren und der Typ tastete meine Hose und die Jacke ab, ohne etwas zu finden. Logischerweise.
»Name?«, fragte er schließlich. »Alter? Adresse? Eltern?«
»Albert …«, murmelte ich.
»Junge, verarsch mich nicht. Kein Mensch heißt heute noch Albert.«
»Ich würde auch lieber anders heißen.«
»Und weiter?«
»Cramer«, sagte ich.
»Mit C oder mit K?«
»Wie man’s nimmt«, sagte ich, weil es nämlich so ist, dass mein Vater eigentlich Kramer mit K heißt, wie sein Vater und dessen Vater und überhaupt die ganze Verwandtschaft. Meine Mutter aber fand, dass Kramer irgendwie nach Krämerladen und Provinz aussieht und dass Cramer besser zu ihrem künstlerischen Profil passen würde, und deshalb hatte sie den Namen sofort nach der Hochzeit ändern lassen. Seitdem stehen bei uns zwei Namen am Klingelschild. Kramer für meinen Vater. Und Cramer für mich. Die ersten Jahre stand das C natürlich auch noch für meine Mutter. Aber irgendwann hatte sie wohl realisiert, dass nicht nur das K provinziell war an meinem Vater. Schätze ich mal. Jetzt ist sie mit irgendeinem wichtigen Theatermenschen zusammen. Auch wenn ich persönlich finde, dass es praktisch nichts gibt, was noch unwichtiger ist als das Theater.
»Na prima … auch noch ’ne Intellektuellenfamilie«, meinte das Rotgesicht dazu und blickte zur Decke. Dann stand er auf und walzte durch den Raum zu einem Monitor, der den Eingang eines Andenkenladens in der nördlichen Halle zeigte. Davor schienen sich zwei Frauen zu streiten.
Ich schaute mich um. Keiner von den Männern beachtete mich. Genau genommen hätte ich einfach so verschwinden können aus diesem Raum. Aber leider war es wie immer bei mir: nicht genug Mut, um auch mal was zu riskieren.
Irgendwann kam der Typ dann wieder zurück an den Schreibtisch. »Du bist in ernsthaften Schwierigkeiten, mein Freund«, sagte er und deutete auf die vielen Bildschirme im Raum. »Wir beobachten dich schon eine ganze Weile. Wir wissen, was du hier treibst. Wir wissen auch, wie du es treibst. Wir wissen nur noch nicht, wer alles zu dir gehört. Deine Hintermänner. Bosse. Komplizen.«
»Was denn für Komplizen?«, fragte ich.
Dann war es erst mal wieder eine Weile still. Irgendwann kam er hinter seinem Schreibtisch hervor, schob einen Stuhl neben mich und legte seinen Arm buddymäßig auf meine Schulter. »Jetzt pass mal auf, mein Freund«, sagte er, »ich versteh dich ja, ich meine, dass man seine Kollegen nicht verrät, und als ich so alt war wie du, hab ich auch noch an Ehre und Treue und den ganzen Quatsch geglaubt. Aber soll ich dir was verraten? Deinen Kollegen sind Ehre und Treue ziemlich egal. Was schätzt du, wie viele Menschen hier schon gesessen sind? Auf diesem Stuhl? Fünfzig? Hundert? Ich will es dir sagen. Es waren mehr als tausend! Und keiner war dabei, der am Ende nicht für den eigenen Vorteil seinen Kumpel verpfiffen hätte. Sie kaufen sich alle frei. Alle, wie sie da sitzen. Die Großen wie die Kleinen. Diebe, Dealer, Fixer. Gibt keine Ausnahme. Also überleg dir genau, ob du wirklich nicht weißt, von was ich hier rede. Du steckst noch nicht so tief drin, soweit ich das sehe. Und deshalb bekommst du hier noch einmal die Chance, dass du relativ unbeschadet rauskommst aus dieser Nummer.«
»Aus welcher Nummer denn, ich weiß es echt nicht«, sagte ich, und die Wahrheit ist, dass ich ihm alles erzählt hätte, wenn ich nur gewusst hätte, was. Ich schaute ihn an und er schaute mich an und irgendwann latschte er wieder zurück zu seinem Stuhl hinter seinem Schreibtisch.
»Wie du meinst«, sagte er und rückte seinen Stuhl an den Schreibtisch und knipste die Lampe an, und ich dachte, jetzt kommt bestimmt diese Blendnummer mit der Lampe, die einem direkt in die Augen leuchtet, sodass man sich gar nicht mehr konzentrieren kann und alles verrät, aber der Typ machte dann doch nur eine Schublade auf und holte einen Block und einen Stift heraus.
»Alter?«, fragte er, und ich sagte: »Sechzehn«, was die Wahrheit war, auch wenn ich im letzten Jahr meinen Schülerausweis vorzeigen musste, als ich mir den Film »Hangover« anschauen wollte. Und der ist freigegeben ab zwölf.
»Sechzehn … das’s ja schön«, meinte der Typ und verzog sein Gesicht zu einem breiten, triumphierenden Grinsen, dass sein bretthartes Toupet wie ein Helm nach vorne rutschte. »Du weißt schon, warum mich das freut? Mit sechzehn bist du fällig, mein Freund. Mit sechzehn darfst du bezahlen für den Blödsinn, den du gemacht hast.«
»Aber ich hab doch gar nichts gemacht«, antwortete ich, und er sagte: »Klar«, und dann wollte er wissen, wo ich mit meinen Eltern wohne. Ich nannte ihm die Adresse von meinem Vater, und dann knipste er seine Lampe aus und zerrte mich wieder raus auf den gekachelten Gang, zurück bis zur Rolltreppe und hoch auf den Bahnhofsvorplatz. Dort parkten vielleicht zehn Polizeiautos hinter einer Schranke und ein paar zivile Wagen standen auch noch herum. Er schob mich auf die Rückbank von einem dieser blau-silbernen Astras und dann zuckelten wir durch Hamburg. An jeder Ampel glotzten die Menschen rein und manche tuschelten sogar miteinander, sodass ich mich in dem Auto echt wie ein ertappter Schwerverbrecher fühlte. Auf direktem Weg ins Gefängnis.
Besser wurde es erst, als wir langsam in unser Viertel kamen. Da gibt es nämlich praktisch keine Ampeln, weil wir in so einer total gediegenen Gegend wohnen, in der die Häuser Klappläden und Erker haben und die Bäume in den Gärten mindestens zweihundert Jahre alt sind. Von außen sieht das total idyllisch aus, und deshalb gibt es auch jede Menge Leute, die sonntags in ihren wattierten Mänteln durch unsere Straße laufen und davon schwärmen, wie romantisch das alles ist.
Meine Mutter sah das früher natürlich anders. Mit Chance konnte man sie im Herbst immer hören, wenn sie kniehoch im Laubhaufen stand und unseren Baum beschimpfte. Der war eine riesige Buche.
»Du gehst mir so auf die Eier«, pöbelte sie dann, »du inkontinenter Holzkopf, jedes Jahr wieder die gleiche Scheiße mit deinen Mistblättern, ich mach dich fertig, ich schwör’s. Nächstes Jahr ist hier Rübe ab, kannste dich drauf verlassen, du Wichser.«
Meine Mutter konnte echt derbe sein bei diesem Thema. Das war jedes Jahr wieder ein beeindruckendes Schauspiel. Meistens blieben dann draußen auf der Straße die wattierten Spaziergänger stehen und versuchten, in unseren Garten zu schauen. War aber nicht so einfach, weil unsere Hecke aus irgendeinem Nadelholz ist und keine Blätter verliert.
Ich schätze, dieser Baum war auch einer der Gründe, warum meine Mutter irgendwann genug hatte von meinem Vater, weil der nämlich keinen Handschlag rührte für diesen Baum. »Ist doch Natur, mein Herz«, murmelte er in solchen Momenten, und dabei merkte er gar nicht, wie meine Mutter innerlich überkochte, und dann war sie vor sechs Jahren plötzlich verschwunden. Ende September, bevor die ersten Blätter gefallen waren.
Mein Vater hockte danach ungefähr einen Monat lang am Fenster und starrte hinauf in die Krone, und dann wandte er sich wieder seinen mathematischen Gleichungen zu, mit denen er von morgens bis abends sein Geld verdient. Er arbeitet nämlich von zu Hause aus als Mathematiker für irgendein statistisches Institut. Davor war er Professor an der Uni und dort hat er irgendeine Behauptung von Carl Friedrich Gauß erweitert, und deshalb wollte mein Vater wahrscheinlich auch, dass ich Carl Friedrich heiße, aber da hat meine Mutter nicht mitgemacht. Am Ende haben sie sich auf Albert geeinigt, weil Albert Einstein für meinen Vater auch ein Held ist und weil meine Mutter so ziemlich alles liebt, was Albert Camus jemals gedacht und geschrieben hat. Leider hat sie mich dann auch immer so französisch beknackt »Albeeeer« gerufen. Selbst im Schwimmbad, als meine Mutter mal ein paar Jahre lang glaubte, ich würde als Schwimmer Karriere machen.
Mein Vater hat das übrigens nie geglaubt, weil er meinte, dass meine Hände zu klein wären dafür und es deshalb rein physikalisch nicht möglich wäre. Aber damit konnte er bei meiner Mutter natürlich nicht landen. Die Welt immer nur naturwissenschaftlich zu analysieren, dafür hatte sie kein Verständnis.
Der Polizist hatte das Verständnis auch nicht. Noch bevor mein Vater überhaupt protestieren konnte, hatte er mich aus dem Auto, durch den Garten, die Treppe hoch in die Wohnung geschleift.
»Ich muss Sie leider davon in Kenntnis setzen, dass Ihr Sohn in eine ganze Reihe von Straftaten verwickelt ist«, sagte er.
»Das halte ich in Kenntnis seines Charakters für unwahrscheinlich«, antwortete mein Vater ziemlich abwesend und wollte sich wieder umdrehen und zurück an die Arbeit gehen, aber der Fleischberg hatte sich schon erstaunlich geschmeidig an ihm vorbei in den Flur geschlängelt.
»Selbstverständlich kann ich Ihnen das auch beweisen«, sagte er, und mein Vater meinte: »Wenn es unbedingt sein muss, eigentlich bin ich beschäftigt«, und dann saßen sie zusammen um den Küchentisch und der Polizist pulte aus seiner Aktentasche einen ganzen Stapel Fotos heraus. Es waren lauter Standbilder von den Überwachungskameras auf dem Bahnhof.
»Ihr Sohn«, sagte der Dicke und legte ein Foto nach dem anderen auf den Tisch, »hier, sehen Sie, um 15.12 Uhr macht er ein Foto mit seiner Kamera. Und hier, eine Minute später, verschickt er die Nachricht mit seinem Handy. Und dann noch mal vier Minuten später. Schauen Sie sich das Foto ganz genau an. Ist nicht so deutlich zu sehen. Dort zieht jemand derselben Person die Geldbörse aus der Tasche. Oder hier, drei Tage später. Dieselbe Masche. Wir können Ihnen zig solcher Sequenzen zeigen. Immer ist Ihr Sohn daran beteiligt. Er kundschaftet die Opfer aus und benachrichtigt seine Komplizen.«
»Was machst du denn auf dem Bahnhof?«, fragte mein Vater, »davon weiß ich ja gar nichts … dass du dich da herumtreibst.«
»Ich fotografiere«, antwortete ich.
»Das sehe ich. Und was fotografierst du?«
»Abschiede«, sagte ich.
»Abschiede? Das verstehe ich nicht. Was willst du denn mit Fotos von Leuten, die du nicht kennst?«
»Weiß nicht, interessieren mich halt«, antwortete ich, weil ich sowieso nicht glaubte, dass das irgendjemand verstehen konnte. Nicht einmal ich verstand mich so richtig. Wie sollte es dann erst Erwachsenen gehen? Oder noch schlimmer, Polizisten? Da hatte ich keine Hoffnung. Es ist nämlich so, dass ich finde, dass es keinen intensiveren Augenblick gibt als einen Abschied. Also, ich meine, so einen Abschied von einem Menschen, der einem alles bedeutet, und wo sich das Herz schon verklemmt, wenn man nur daran denkt, dass er vielleicht irgendwann nicht mehr da ist. So stelle ich mir das jedenfalls vor, weil ich selbst ehrlich gesagt noch nie Abschied nehmen musste von jemandem, der mir etwas bedeutet hat. Außer von meiner Mutter vielleicht, als sie auszog, aber das war auch kein richtiger Abschied, weil sie schon nach zwei Stunden wieder am Telefon hockte und mich zuschwallte mit ihren Muttergefühlen.
Trotzdem ist absolut klar, dass es stimmt, was ich sage. Da muss man sich nur mal eine halbe Stunde auf einen Bahnhof stellen, um das zu verstehen. Abschiede sind eigentlich immer tiefe, ehrliche Augenblicke. Natürlich gibt es auch Menschen, die bei einer Ankunft umgeblasen werden von ihrer eigenen Freude. Aber die meisten sind dann nur hölzerne Marionetten und wissen nicht, wohin sie mit ihren Armen und Augen sollen. Und überhaupt am peinlichsten ist, wenn sie sich auch noch so richtig viel Mühe geben mit Transparenten und Girlanden und Willkommen-zu-Hause-Shirts. Ist alles gelogen. Jetzt nicht im Sinne, dass die T-Shirts gelogen sind und sie sich gar nicht freuen. Sondern weil sie ihre Gefühle in dem Moment gar nicht zeigen können und sich deshalb nur so verhalten, wie sie glauben, dass man sich verhalten muss, wenn man sich freut. Da ist nichts Echtes in den Gesichtern. Und das ist bei den Abschieden eben anders. Abschiede sind ganz oft perfekte Momente. Und darum geht es ja beim Fotografieren und deshalb bin ich auch so oft am Bahnhof.
»Blödsinn«, sagte der Dicke, »totaler Bullshit. Warum schickst du dann nach jedem Foto eine SMS an deine Komplizen?«
»Ich verschicke keine SMS«, antwortete ich. »Ich schreibe mir Notizen zu den Motiven und sortiere die Bilder.«
»Natürlich«, sagte der Polizist, »würde ich jetzt auch behaupten …«
»Darf ich Sie kurz unterbrechen«, meinte mein Vater. »Wir wollen doch hier keine vorschnellen Urteile fällen. Ich gebe zu, dass dies ein wenig exzentrisch klingt, was mein Sohn erzählt. Aber unmöglich ist es nicht, und es lässt sich ja nun auch kurzfristig klären, ob er die Wahrheit sagt. Wenn er tatsächlich Abschiede sammelt, muss es ja irgendwo eine Sammlung geben, die er uns zeigen kann. Vielleicht schauen wir uns die einfach mal an. Bevor wir über unbewiesene Vorwürfe diskutieren.«
Das war natürlich der Supergau. Meine Fotos hatte noch kein Mensch zu sehen bekommen. Die waren mein absolutes Geheimnis. Noch viel persönlicher als mein Facebook-Account. In ihnen war quasi alles von mir, und da musste schon ganz viel passieren, dass ich erlaubt hätte, dass jemand Fremdes sie anschauen durfte. Und ganz bestimmt wollte ich nicht, dass mein Vater darin herumschnüffelte und dieser Polizist schon mal gar nicht. Also tat ich am Küchentisch erst einmal so, als hätte ich nichts gehört, aber dann ging mein Vater ungefragt los und holte den Laptop aus meinem Zimmer.
Zusammen mit dem Polizisten klickte er sich durch den Computer, aber sie fanden darauf kein einziges Foto. Konnten sie auch nicht, weil ich Fotos auf meinen beiden externen Festplatten ablege, immer schön als Doublette, damit die Motive niemals verloren gehen. Da bin ich echt diszipliniert. Im Unterschied zu meinem übrigen Leben, würde ich sagen.
Die ganze Suche dauerte vielleicht zehn Minuten, in denen ich schweigend danebensaß und das Grinsen des Polizisten immer feister wurde und mein Vater immer mehr in sich zusammenfiel. Irgendwann tat er mir echt leid, weil er das nicht verdient hatte, dass dieser Arsch von Polizist so über ihn triumphierte. Ich muss nämlich sagen, dass ich meinen Vater schon irgendwie bewundere, auch wenn er sich manchmal so verhält, als wäre er nicht von dieser Welt.
Damit meine ich nicht das Klischee vom zerstreuten Professor, der nichts auf die Reihe kriegt, weil er so überhaupt nicht ist. Mein Vater ist nicht zerstreut. Er geht auch nicht zum Einkaufen und merkt dann auf halbem Weg, dass er noch seinen Schlafanzug trägt, oder so ein Zeug. Mein Vater kriegt das praktische Leben schon ganz gut geregelt. Aber er schaut die Welt auf so eine vernünftig-weltfremde Weise an, dass ich bei ihm manchmal echt meine Zweifel habe.
Zum Beispiel als ich das letzte Mal mit ihm zusammen U-Bahn gefahren bin. Da kamen wir nach der Fahrt am Rathausmarkt die Treppe hoch, und vor dem Eingang saßen zwei rasierte Typen auf der Straße, die vielleicht zwanzig oder so waren, und um sich herum hatten sie einen Wall von Bierdosen aufgeschichtet. Wie so eine Sandburg am Strand. Mindestens hundert Dosen, und vor den Wall hatten sie ein Pappschild gestellt, auf dem nichts weiter stand als »HUNGER«. In Großbuchstaben und mit ziemlich wackliger Schrift. Eigentlich konnte jeder Blinde sehen, dass die beiden total betrunken waren. Mein Vater hat ihnen trotzdem zwei Euro in die Schale gelegt und freundlich gelacht und gesagt: »Wohl eher Durst, Freunde«, und dabei ist er gegen den Wall gestoßen und der ist scheppernd zusammengefallen.
Einer von diesen Typen hat sich dann nach oben gestemmt und ist zu meinen Vater getorkelt und hat ihm ansatzlos auf die Nase gehauen. So, dass mein Vater Kopf voran die Treppe zur U-Bahn wieder runtergeschlittert ist.
Jeder andere Mensch hätte an dieser Stelle die Polizei gerufen. Oder sich wenigstens still und heimlich aus dem Staub gemacht. Aber mein Vater versteht irgendwie nicht, dass es Arschlöcher gibt, um die man lieber einen Bogen macht, und wollte »das Missverständnis« klären, weil er eben immer an die Vernunft im Menschen glaubt.
Der Besoffene hat dann nur »Fresse, Alter« gesagt und ihm ein zweites Mal auf die Nase gehauen.
So ist mein Vater, und das kann ich echt nicht mit ansehen, wenn jemand ihn schlecht behandelt. »Die Fotos sind auf meiner externen Festplatte«, erklärte ich, holte den kleinen silbernen Kasten aus dem Versteck hinter meiner Gardine und stöpselte ihn an den Laptop.
Der Polizist warf aber nur einen flüchtigen Blick darauf und sagte: »Beschlagnahmt«, und dann schnappte er sich auch noch das kaputte Telefon von der Heizung.
Zu mir meinte er: »Ich krieg dich, mein Freund, verlass dich drauf.«
»Ich bin nicht Ihr Freund«, antwortete ich. »Vorher kotz ich in meine Stiefel.«
Ich schätze, das war dann der Anfang unserer Freundschaft.
2
Dass sich durch die Verhaftung alles verändert hatte, wusste ich natürlich noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Am Anfang dachte ich wirklich, dass jetzt alles wieder wie vorher würde, weil die Polizei auf meiner Festplatte sehen würde, dass ich die Wahrheit erzählt hatte, und danach könnte ich weiter am Bahnhof fotografieren und niemand würde sich um mich kümmern. War aber nicht so, als ich nach ein paar Tagen zum ersten Mal wieder am Bahnhof war. Aber das lag nicht an diesem Fettkloß, sondern an mir. Und vielleicht an den anderen Leuten.
Früher war es nämlich so, dass ich irgendwie unsichtbar war, wenn ich am Bahnhof fotografierte. Das war wie ein Zauber. Ich stand mitten in dem Gewimmel und konnte alles beobachten, aber keiner beachtete mich. Ungefähr so wie in diesen superbescheuerten Filmen, in denen irgendwelche Engel unter uns sind, die wir nicht sehen können, aber sie sehen alles, und wenn sie über die Straße gehen, rauschen Lkws durch sie durch, ohne dass ihnen etwas passiert. So war mein Gefühl immer beim Fotografieren, und dieser Zauber war plötzlich verschwunden, als ich zum ersten Mal nach der Verhaftung wieder zum Bahnhof kam.
Die Leute sahen mich an. Oder ich bildete mir ein, dass sie mich ansahen, das kommt ja im Endeffekt auf dasselbe raus. Ich war nicht mehr bloß der Beobachter, sondern gehörte selber dazu. Und da merkte ich dann, wie bescheuert das ist: irgendwelchen fremden Menschen in einem innigen Moment mit der Kamera ins Gesicht zu kriechen. Konnte ich plötzlich nicht mehr tun, weil ich mir selbst dabei zuschaute, und dann erwischt man auch den perfekten Moment nicht mehr.
Das Problem ist nämlich, dass ein perfektes Foto irgendwie unperfekt sein muss, damit es perfekt ist. Sonst könnte man einfach zwei tolle Menschen mit einer perfekten Pose in eine perfekte Kulisse stellen und dann mit perfektem Licht abfotografieren und schon hätte man das perfekte Bild. Hat man aber nicht. Weil es nämlich so ist, dass dann der Augenblick fehlt. Also irgendwie das wirkliche Leben. So was sieht man nicht auf den ersten Blick. Ich meine, ob es gelogen ist oder wahr und ob es zu einem spricht und ob es von einem echten, intensiven Augenblick erzählt. Darum geht es. Und genau das taten meine Fotos jetzt nicht mehr. Ich meine, sie waren auch technisch nie wirklich perfekt, aber jetzt war es so, dass ich den Augenblick einfach nicht mehr erwischte. Keine Ahnung, entweder war ich zu früh oder ich war zu spät oder ich wartete auf etwas, was überhaupt nicht passierte. Da fehlte irgendeine Verbindung. Ich glotzte nur noch wie ein Idiot auf jede Szene.
Mein erster Gedanke war, dass mich die Leute nach der Aktion mit der Verhaftung plötzlich erkannten, aber das konnte natürlich nicht sein, weil am Bahnhof mindestens alle halbe Stunde komplett andere Menschen sind. Und ganz besonders ist das auf den Bahnsteigen 11 bis 14 so, wo die Fernzüge halten und keine Pendler stehen.
Danach dachte ich, dass ich selbst schuld daran war, weil ich bei jedem Foto plötzlich überlegte, was die anderen von mir dachten und ob sie vielleicht Angst hatten, dass ich sie danach ausrauben würde oder so. Deshalb versuchte ich es mit dem superlangen Tele, das mir meine Mutter geschenkt hatte. Damit merkten die Leute nicht, dass ich sie fotografierte, aber das funktionierte auch nicht, weil die Leute dann fünfzig Meter weg standen und auf diesen fünfzig Metern garantiert immer irgendein Idiot durch das Bild lief. Also stellte ich mich oben auf die Treppe, die runter zum Bahnsteig führt, und versuchte, von dort zu fotografieren, aber das ging auch nicht, weil Bilder von oben ja nicht die normale Perspektive sind und deshalb irgendwie distanziert aussehen. Außerdem holt das Tele immer den Hintergrund ran und verkürzt die Entfernungen, sodass man gar keinen vernünftigen Bildaufbau hat, weil es keinen richtigen Vordergrund und keinen Hintergrund gibt und alles irgendwie gleich wichtig wirkt.
Ich muss zugeben, dass ich nach den ersten Tagen ziemlich verzweifelt war und schon überlegte, ob ich lieber anfangen sollte zu schreiben, was meine Mutter immer von mir gewollt hat, aber dann gab es doch noch einen perfekten Moment. Ganz plötzlich, aus heiterem Himmel.
Es war, als ich mein Tele längst wieder weggepackt hatte und ratlos auf einer Bank auf dem Bahnsteig hockte. Vor mir stand der ICE aus München, die Leute waren schon alle ausgestiegen und auch der Bahnsteig hatte sich mittlerweile geleert. Irgendwann ruckte der Zug wieder an, und als der letzte Wagen vorüber war, saß quasi auf der gleichen Bank, nur einen Bahnsteig weiter, dieses Mädchen. Also direkt gegenüber. Sie war ungefähr siebzehn, schätze ich mal, und so brutal schön, dass ich mich gar nicht traute, sie überhaupt anzusehen. Jedenfalls nicht länger als eine Zehntelsekunde. Wobei ich sagen muss: So richtig brutal schön war sie doch nicht, aber sie hätte es sein können, wenn sie gewollt hätte. Wollte sie aber wahrscheinlich nicht. Das konnte man an dem völlig ausgeleierten T-Shirt sehen, das von einem Supermarkt war. »Real – alles drin« stand auf der Brust. Allerdings schon ziemlich verwaschen. Dazu trug sie eine graue, superweite Jogginghose und schwarze Stiefel mit Stahlkappen, auf die sie weiße Herzen gemalt hatte, wie ein Punk, nur dass Punks keine Herzen auf ihre Schuhe malen, sondern Kleckse oder Sterne oder das Wort »Anarchie«.
Das Mädchen war garantiert kein Punk, weil sie auch keine Piercings in den Lippen hatte oder tausend Sicherheitsnadeln im Ohr oder einen zur Hälfte rasierten Schädel. Stattdessen hatte sie ihre Haare mit einem Einmachgummi zu einem Zopf verknotet, aber so nachlässig, dass ihr jede Menge Fransen über die Augen hingen. Ich schätze, es war ihr einfach egal, wie sie aussah. Sie hatte auch keine gezupften Augenbrauen und kein Make-up und so ’n Zeug wie die Mädchen in meiner Klasse. Dafür war sie braun gebrannt, aber nicht diese Kack-Lebkuchen-Bräune von den Leuten, die immer ins Sonnenstudio gehen. Sondern wie jemand, der einfach den Tag über draußen ist. Sie saß ein bisschen nach vorne gebeugt auf der Bank und hatte ihre Handflächen unter die Oberschenkel geschoben. Ihre Pupillen waren fast schwarz und um die Augen hatte sie schwarze Farbe gemalt, sodass sie aussah wie eine Eule. Sie schaute mich die ganze Zeit an.
Dabei lag neben ihr irgendein Typ und schlief. Er war nicht so braun wie sie, eher sogar ziemlich bleich, und er hatte ein wurstenges T-Shirt an, dass man seinen Sixpack darunter sah, der sich in einem affenartigen Tempo hob und senkte. Als hätte der Typ gerade einen Vierhundertmetersprint hinter sich. Aber es waren ziemlich beeindruckende Muskeln, die er da hatte, muss ich mal sagen, auf jeden Fall viel athletischer als meine. Mit seinem Kopf berührte er ihren Schenkel. Aber nicht so, dass der Kopf auf ihrem Schoß lag, wie bei einem Paar, sondern eher so, als würde sie nur auf ihn aufpassen, während er schlief.
Das war schon ein seltsames Gefühl, so angestarrt zu werden von einem Mädchen. Besonders wenn man selbst dasitzt wie ein Idiot und nichts hat, mit dem man sich gerade beschäftigt. Also holte ich meine Kamera raus und machte ein paar Aufnahmen in ihre Richtung. Es schien sie überhaupt nicht zu stören. Sie schaute direkt in die Linse, ohne verlegen zu sein, ohne irgendeine Grimasse. Nur manchmal pustete sie die Strähnen vor ihren Augen weg, aber die fielen immer wieder zurück.
Irgendwann fuhr dann auf meinem Bahnsteig der nächste ICE ein und versperrte die Sicht. Er kam aus Frankfurt, und weil an diesem Tag der HSV gegen die Eintracht spielte, quetschten sich aus den Türen tausend Kuttenträger, die einen Adler auf ihrem Rücken hatten und pausenlos »Sieg« brüllten und zwischen jedem »Sieg« dreimal klatschten. Wie Nazideutschland, dachte ich, nur halt nicht so militärisch geordnet. Wobei ich gar nicht weiß, wie militärisch geordnet Deutschland früher so war. Auf jeden Fall war es unglaublich, wie viele Menschen in einen einzigen Zug passen. Der Bahnsteig war praktisch voll und trotzdem quollen immer noch mehr Leute heraus und dann stampften auch noch von den Seiten Polizisten heran und kesselten die Fans mit ihren Schilden und Schlagstöcken ein und schoben den ganzen Pulk irgendwann aus dem Bahnhof.
Das Ganze hatte vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Dann rollte der ICE wieder weiter und natürlich war die Bank dahinter jetzt leer. Keine Spur von den beiden. Ich schaute mich um. Die Rolltreppen zum Bahnsteig. Der gläserne Fahrstuhl. Oben die Galerie mit den Geschäften. Als hätten sich die beiden in Luft aufgelöst. Vielleicht waren sie vom Bahnsteig direkt runter zur U-Bahn gegangen.
»Suchst du jemand?«, fragte plötzlich eine Stimme in meinem Nacken. Dann kletterte das Mädchen von hinten über die Bank und setzte sich neben mich. So nah, dass ihr Bein mein Knie berührte. Dabei war auf der Bank noch mindestens zwei Meter Platz.
»Ich kenn dich«, sagte das Mädchen nach einer Weile. »Dich hat der dicke Polizist vor ein paar Tagen verhaftet.«
»War aber nur ein Missverständnis«, antwortete ich.
»Wieso, was wollte er denn?«
»Er hat gedacht, dass ich zu einer Bande gehöre, die Leute ausraubt.«
»Hat er dir geglaubt?«
»Ich weiß nicht … Er hat gemeint, er behält mich im Auge.«
»Dann würd ich aber aufpassen, dass du nicht zusammen mit mir gesehen wirst«, sagte sie und lachte, und dann rückte sie ein Stückchen weg und für einen kurzen Moment legte sie ihre Hände neben sich, bevor sie sie wieder unter die Beine schob. Sie hatte echt grobe Finger. Mit Narben und dicken Knöcheln, wie man sie kriegt, wenn man sich öfter prügelt. Hooliganhände, würde ich sagen, die hatten im Leben noch keine Maniküre gesehen.
Eine Weile schauten wir beide geradeaus. Dorthin, wo sie vorhin gesessen hatte, auch wenn da jetzt gar nichts zu sehen war.
»Du fotografierst«, sagte sie schließlich.
Ich nickte.
»Und was?«
»Weiß nicht … also … ehrlich gesagt … ich fotografier Abschiede … irgendwie Menschen, die sich trennen … von denen einer wegfährt.«
»Das’s ja krass«, meinte sie. »Echt jetzt, Abschiede? Verdienst du damit Geld oder so was?«
»Nein. Wieso? Wie kommst du denn da drauf?«
»Dann ist es nur Zeitvertreib?«
»Ich weiß nicht … ich vertreib nicht die Zeit … Eigentlich ist es das, was ich am allerliebsten mache.«
»Aber Abschiede sind doch das Traurigste von der Welt.«
»Schon … aber sie sind auch das Schönste … finde ich.«
Da drehte sie sich zur Seite und sah mich an, und ich schätze mal, das war dann der Moment, der bei mir alles geändert hat. Auch wenn ich gar nicht weiß, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ein bisschen so wie in dieser Waschmittelwerbung, die zurzeit im Fernsehen überall läuft. Da ist eine Frau in bunten Klamotten zu sehen, und man denkt, okay, Frau, bunte Klamotten, nix Besonderes, aber dann sagt jemand »Schluss mit verblassten Farben« oder so ’n Quatsch und die Frau greift quasi von innen in den Fernseher und zieht einen Grauschleier weg und da merkt man erst, dass die Farben und alles vorher ganz dumpf waren und dass das Leben eigentlich viel strahlender ist.
So war das auch bei ihr. Wobei »strahlender« jetzt das falsche Wort dafür ist. Eher intensiver. Dunkler. Eigentlich war ihr Gesicht wie ein See bei einem Sturm, der voller Wellen war, und dann wurde er plötzlich spiegelglatt, und das Wasser war ganz klar, sodass man bis runter zum Grund sehen konnte, und dort war dann alles algenmäßig überwachsen von Trauer. Also, sie weinte nicht oder so. Sie war einfach nur monstertraurig.
So schaute sie mich regungslos an und diesmal schaute ich auch nicht weg, und da waren ihre Augen doch nicht schwarz, sondern blau, aber nicht so strahlend wie bei Megan Fox zum Beispiel, sondern eher dunkel wie blaue Tinte.
»Weißt du, was das Allerschlimmste im Leben ist?«, fragte sie schließlich.
»Der Tod?«, sagte ich.
»Noch schlimmer als der Tod ist, wenn man sich nicht verabschieden kann.«
»Woher weißt du das?«
»Denk ich mir halt.«
»Echt? So was denkst du?«
»So was denke ich …«, sagte sie, und dann schwieg sie, und ich wusste auch nicht, was ich darauf noch antworten sollte. Irgendwann meinte sie: »Ich glaube, wenn man Abschied nehmen kann, ist das wie ein Chirurg, der die Wunde zunäht. Und ohne Abschied hört es eben nie auf zu bluten … Oder die Narbe wuchert ganz übel und man bleibt ein Leben lang verwachsen und hässlich.«
»Also, verwachsen ist bei dir aber nichts«, sagte ich und dachte, das wäre jetzt mal ein geschmeidiges Kompliment, aber da lag ich komplett daneben. Als hätte sie den Schleier wieder nach oben gezogen.
»Wie viele Abschiede hast du schon fotografiert?«, fragte sie nach einer ganzen Weile.
»Keine Ahnung«, antwortete ich. »Vielleicht dreihundert Gigabyte auf meinem Computer.«
»Und seit wann machst du das?«
»Bestimmt schon zwei Jahre.«
»Zeigst du mir deine Bilder mal?«
»Klar«, sagte ich, obwohl es ja eigentlich gar nicht klar war, dass sie jemand anschauen durfte.
»Jetzt gleich?«, fragte sie.
»Von mir aus auch gleich.«
Da griff sie nach meiner Hand und zog mich von der Bank, und wir gingen rüber zum Gleis, von dem meine S-Bahn fuhr.
3
Eigentlich hätte mein Vater komplett irritiert sein müssen von mir. Da hatte ich praktisch zehn Jahre lang so gut wie keinen Menschen mit nach Hause gebracht und das totale nerdmäßige Maulwurfsleben geführt und dann kam ich plötzlich zuerst mit einem Polizisten-Fleischberg an und ein paar Tage später auch noch mit der hübschesten Eule des Universums.
Ich hätte wetten können, dass es in seinem Hirn anfing zu rattern, aber dass er dann kein einziges Wort herausbringen würde, sondern höchstens »He … he« stammeln würde und danach wieder verschwinden würde zu seinen Formeln.
War dann aber ganz anders. Er schob seine Brille nach vorne zur Nasenspitze und betrachtete meinen Gast über die Ränder der Gläser von oben nach unten, einmal runter und wieder rauf.
»Ich bin der Vater dieses Genies«, sagte er und gab ihr die Hand.
»Kati«, sagte das Mädchen.
»Wie Katharina?«
»Wie Einfach-nur-von-Geburt-an-Kati.«
»Na, dann setz dich mal, Kati«, sagte mein Vater und deutete auf den Tisch, und das war natürlich das Letzte, was ich gebrauchen konnte, dass mein Vater Konversation machen wollte mit ihr, weil so was nur im Fremdschämen enden konnte.
Und genauso lief es dann auch, weil mein Vater natürlich das ganze blödsinnige Zeug wissen wollte, von dem Eltern immer glauben, dass es wichtig ist, das aber überhaupt nichts erzählt über den Menschen: woher man kommt und was die Eltern beruflich machen und auf welche Schule man geht und welche Noten man hat und so weiter.
Kati erzählte trotzdem wie ein Wasserfall, und mein Vater sah sie dabei an mit seinem einfühlenden Therapeutenblick, den ich schon an ihm kannte, weil er auch meine Mutter immer so angeschaut hatte. Mit zur Seite gelegtem Kopf und immer am Nicken, aber eigentlich hörte er dabei gar nicht zu, sondern das Gespräch war nur ein kosmisches Hintergrundrauschen, während er die ganze Zeit an andere Sachen dachte. Hab ich mir bei ihm jedenfalls immer so vorgestellt.
Allerdings muss ich zugeben, dass meine Mutter diesen Verdacht auch schon hatte und manchmal nach ihrem letzten Satz fragte, und den konnte er dann immer absolut exakt wiederholen. Aber auch nur diesen einen Satz. Als ob da so ein kleiner Zwischenspeicher bei ihm eingebaut war, in dem er einen Satz ablegte und der dann vom nächsten überschrieben wurde. Und der Hauptrechner beschäftigte sich währenddessen mit den wirklich wichtigen Dingen. Ich schätze mal, er hat da einfach zwei völlig getrennte Stromkreise in seinem Kopf. Für Kati hat er sich aber trotzdem echt interessiert.
Umgekehrt war ich mir nicht so sicher, weil das meiste von ihr garantiert gelogen war. Zum Beispiel, dass ihre Mutter ein Nagelstudio in Wandsbek hätte mit Pediküre und medizinischer Fußpflege und so was und dass sie selbst aber lieber Friseurin lernen würde, weil sie überhaupt kein Bock darauf hätte, alten Menschen die verpilzte Hornhaut vom Fuß zu raspeln. Deshalb hätte sie sich jetzt um einen Ausbildungsplatz beworben bei einem Friseur in der Innenstadt.
»Da kommen lauter berühmte Leute hin«, sagte Kati, »das ist voll interessant, weil die einem ja beim Haareschneiden immer alles erzählen.«
Ganz ehrlich, wenn man sich für Frisuren interessiert, läuft man nicht mit so einem Haarschnitt herum wie Kati. Und dass sie sich was aus dem Gerede von Prominenten macht, passte eigentlich auch nicht zu ihr. Fand ich.
Auf der anderen Seite sind Nagelstudio und Friseur jetzt nicht unbedingt Berufe, mit denen man eine Welle macht, und deshalb konnte es natürlich sein, dass es doch nicht gelogen war, weil es schon bescheuert wäre, wenn man ausgerechnet so was erfindet. Ich meine, wenn ich mir an ihrer Stelle etwas ausgedacht hätte, dann Meeresbiologin oder Model oder Olympiateilnehmerin oder irgendwas anderes Cooles.
Auf jeden Fall redeten die beiden eine halbe Ewigkeit miteinander und ich stand überflüssig wie ein Schirmständer in der Ecke, bis wir endlich raufgehen konnten zu mir ins Zimmer. Wobei ich zugeben muss, dass ich das mit dem Raufgehen auch nicht so eilig hatte, weil man mit meinem Zimmer auch keine Welle machte.
In meinem Zimmer sieht es nämlich immer noch so aus wie in einer Krabbelgruppe. Das liegt daran, dass Wohnen mir bisher eigentlich ziemlich egal war und ich quasi noch nie was verändert hatte in meinem Zimmer. Immer noch lag dieser Teppich mit den aufgemalten Straßen vor meinem Bett, auf dem ich früher mit meinen Hot-Wheels-Autos herumgekurvt war. Und auf dem Schreibtisch verstaubte seit Jahren eine halb fertige Lego-Rakete, und daneben standen die beiden Stoffhasen, die meine Mutter genäht hatte, als ich vier Jahre alt war. Dem einen hatte sie den Namen »Al« auf seine Latzhose gestickt. Der andere hieß »Bert«. Fand meine Mutter damals wahnsinnig originell. Mir selbst waren die beiden seit zwölf Jahren nicht mehr ins Auge gefallen. Aber wenn man das Zimmer mit fremdem Blick anschaut, bohrt sich so was natürlich sofort ins Bewusstsein. Genauso wie das Buchstaben-Tier-Plakat, das meine Eltern pädagogisch wertvoll zur Einschulung über das Bett geklebt hatten, weil man damit angeblich leichter lesen lernt: A wie Affe und G wie Giraffe und K wie Kakadu. Den hatte ich als Kind allerdings immer für einen Papageien gehalten, weshalb es bei mir echt »Kakke« aussah, wenn ich versuchte, »Pappe« zu schreiben. Aber das war nur im ersten Schuljahr so.
Am schlimmsten in meinem Zimmer waren aber die gerahmten Fotos, die meine Mutter neben die Tür genagelt hatte. Ich mit Blockflöte an Weihnachten wie so ein Frosch mit aufgeblasenen Backen. Oder beim Vorlesewettbewerb, was jetzt nicht so ein schlimmes Foto war, nur die Erinnerung daran war ziemlich übel, weil ich damals auf einer Bühne saß und bestimmt fünfmal an dem Wort »Prophylaxe« gescheitert bin, bis ungefähr hundert Eltern unten im Saal angefangen haben, rhythmisch zu klatschen. Wahrscheinlich sollte mich das aufmuntern. Ich wurde aber nicht aufgemuntert, sondern rot wie eine Tomate. Ist allerdings ein Schwarz-Weiß-Bild in meinem Zimmer. Und dann gibt es natürlich noch das Foto von den Hamburger Schwimmmeisterschaften, das überhaupt das schlimmste Bild ist, das von mir existiert: Ich auf dem Podium, gegen die Sonne, mit zusammengekniffenen Augen, in einer bescheuerten, viel zu großen Slipbadehose, die wie ein Beutel auf den Hüften saß und bis rauf zum Bauchnabel reichte. Und über dem Gummizug kam dann eine Brust, die so mickrig war, dass man mich quer durch einen Briefkastenschlitz hätte schieben können. Tolle Wurst.
Kati schaute von mir zum Foto und wieder zurück. Das mit der Brust hatte sich zum Glück mittlerweile ein bisschen gebessert.
»Ich hab jetzt ’ne coolere Badehose«, sagte ich. »Willst du sie sehen? … Vielleicht?«
»Lass mal«, antwortete sie. »Wo sind denn die Fotos vom Bahnhof?«
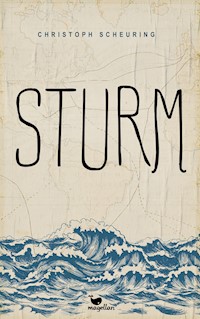
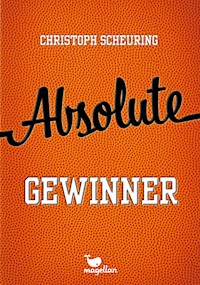













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













