
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Kinderbuch
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Königreich Eckstein
- Sprache: Deutsch
König Tibald und seiner Gemahlin Ema steht das Undenkbare bevor: Sie müssen ihre Tochter, Prinzessin Miriam, der Catastrophe, dem verfluchten Wald im Süden Ecksteins, als Maimädchen opfern. Danach ist ihr Leben wie auf den Kopf gestellt. Ema fühlt sich am Königshof zunehmend eingeengt, und auch Tibald wünscht sich nichts sehnlicher, als ab zudanken und fernab der Verpflichtungen eines Monarchen zu leben. Nur wer würde dann Eckstein und seine Bewohner beschützen? Zum ersten Mal in der Geschichte steht das einst so friedliche Königreich am Rande des Abgrunds: Nach dem Hungerwinter und der sommerlichen Dürre fehlt es den Menschen an allem. Und Tibalds Halbbruder Jesko, der seit jeher über Eckstein herrschen will, bedroht nach wie vor den Frieden des Landes - und des Königs Leben. Jesko kennt keine Skrupel und hat einflussreiche Komplizen, die ihm helfen, Tibald und Ema immer einen Schritt voraus zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pascale Quiviger
Eckstein
Band 3. Abschiede
Roman
Aus dem Französischen von Sophia Marzolff
atlantis
Für meine Patentochter Jeanne
1
Zweimal im Jahr teilen sich Licht und Dunkelheit die vierundzwanzig Stunden des Tages genau untereinander auf. Es sind Momente der vollkommenen Ausgewogenheit. Nach der Tagundnachtgleiche des Frühlings triumphiert das Licht über die Dunkelheit, nach der Tagundnachtgleiche des Herbstes das Dunkel über das Licht.
An diesem dreiundzwanzigsten September herrschte mittags eine drückende Hitze. Die Menschen zogen sich hinter ihre geschlossenen Fensterläden zurück, wie sie es schon den ganzen Sommer getan hatten. Als sie abends aus ihren Häusern kamen, sahen sie am Horizont endlich Wolken aufziehen. Einzelne dicke violette Gebilde – keine gewöhnlichen Wolken. Die Hafenbewohner wurden als Erste nachdenklich beim Anblick des klebrigen Schaumes, den die Wellen auf dem Kieselstrand hinterließen. Wieso waren da überhaupt Wellen? Es ging doch gar kein Wind, ja die Luft war völlig reglos. Die Dörfler fanden sich nicht zurecht zwischen der bewegten See und dem unbewegten Himmel. Sie warteten darauf, dass sich eine Wolke entlud, dass die Nacht hereinbrach.
Die Zeit schien stillzustehen. Auf dem Hügel warfen die Bäume immer längere Schatten, deren Umrisse verschwammen. Blätter fielen ganz von selbst herab, Sand stieg sonderbar von den Wegen auf, die Schafe drängten sich zusammen wie ein einziges Wollknäuel. Die unvermeidliche Zikade hörte auf zu singen.
Als hinter den verdorrten Wipfeln Westwaldens die Sonne untergegangen war, zog ein unangenehmer Windhauch über die Insel, strich über das trockene Gras, kroch überallhin, bis unter die Türschlitze. Um acht Uhr abends war aus dem Hauch eine Böe geworden. Um neun ein Sturm. Die Birken bogen sich in die Horizontale, und gegen den Hafenkai brandete eine riesige Welle. Drinnen im Schloss wirkten die Fenster pechschwarz, und die Wände schienen näher zu rücken. Eilige Schritte hallten über die Steinfliesen, Türen knallten im Windzug, und fortwährend erloschen Kerzen. Um zehn erhob sich die Stimme des Waldes. Ein bedrohliches Murmeln. Eine Mahnung, ein Ruf, ein unverständliches Geraune, das dennoch jeder verstand: Heute Abend musste eine Familie ihr kleines Kind dem Wald übergeben.
Karl trat aus der Schmiede, um seine Frau Mathilde abzuholen. Sie selbst hatten einst auf diese Weise ihre Tochter verloren, eines Herbstabends zur Tagundnachtgleiche. In Sidra hatten sie sie zwar wiedergefunden, doch kurz darauf war diese ebenfalls verschwunden. Hatte Sidra etwas mit dem Ruf des Waldes zu tun? Mathilde hielt sich die Ohren zu. In ihrem Kopf durchlebte sie von Neuem und in allen Einzelheiten jene Nacht, in der sie ihr Kind hatte hergeben müssen. Sie sah wieder Alberich vor sich, sein Mund eine schnurgerade Linie in dem gepflegten Bart, seine blassen Augen starr auf den Weg vor sich gerichtet, als er sie zur Hütte des Mittelsmannes führte. Sie spürte wieder die friedlichen Atemzüge des schlafenden kleinen Schatzes in ihrem Arm, den nervösen Schritt des Schimmels und direkt neben sich den unter Schock stehenden Karl.
Nun würde einem anderen Mädchen dasselbe Schicksal widerfahren. Willem Schöne war einer der wenigen, der begriff, um welches Kind es sich handelte, und er war darüber am Boden zerstört: seine Patentochter. Die heutige Tagundnachtgleiche würde nicht nur die Blutlinie des Königshauses unterbrechen, sie würde auch sein Herz brechen. Ein paar Türen weiter war Blasius von Frixeln in seinem Bett, das er nicht mehr verließ, zur selben Schlussfolgerung gelangt. Bei all seinen Grübeleien und geistigen Höhenflügen hatte er sich doch niemals etwas Derartiges vorstellen können. Eine Insel ist eine Insel, dachte er traurig. Trifft sie ein Unglück, trifft es sie ganz.
Lysander, der bei ihm saß, bestürmte seinen Lehrer mit Fragen. Noch hatte ihm niemand erklären wollen, weshalb ein Fluch über Eckstein lag, und selbst Blasius hielt seine Lider still und verweigerte ihm damit eine Antwort. Wütend machte sich der Junge zur Küche auf, die ein beliebter Treffpunkt im Schloss war. Dort stieß er auf Felix, der ihn schon überall suchte. Und der Hüne von Mann war es zu guter Letzt, der ihm mit tränenerstickter Stimme die Legende vom allerersten König, der wahnsinnig gewordenen Königin und ihrer verschollenen Tochter erzählte.
Unterdessen saß Tibald in einem dunklen Winkel seines Arbeitszimmers, wie gelähmt vor Entsetzen, von den Bildern und namenlosen Erinnerungen, die mit dem Ruf des Waldes auf ihn einstürmten. Er sah wieder das Medaillon vor sich an einem Zweig baumeln, sah bläuliches Granitgestein, ein grünes Licht. Fühlte Asche und Dornen. Er schüttelte den Kopf im vergeblichen Versuch, sich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren. Vor allem wollte er nicht verstehen, was an diesem Abend geschehen würde. Er bereitete sich darauf vor, das Kind einer anderen Familie dem Wald zu überbringen. Die Eltern des Babys würde er am Vier-Wege-Kreuz treffen, und wie es die Tradition verlangte, würde er ihnen allein entgegenreiten. Allein, ohne Ema. Wie sollte er es nur ohne Ema schaffen?
Wo war sie überhaupt? Er hatte sie seit dem Morgen nicht mehr gesehen. Tibald nahm sich vor, sie zu suchen, aber dann wandte er sich doch zerstreut etwas anderem zu. So verwirrt war er nicht mehr gewesen, seit er vor zehn Monaten der Catastrophe entronnen war. Mit fahrigen Fingern rückte er den Dolch an seinem Gürtel zurecht, holte zuerst seinen langen roten Mantel und vergaß ihn dann auf einem Stuhl. Zog einen Stiefel an und fand den anderen nicht. Eine unsichtbare Krone schien sich kalt und schwer auf sein Haupt zu senken: die Krone der Traurigkeit, die früher oder später auf allen Ecksteiner Herrschern lastete und ihre Regentschaft bestimmte.
Als sich um elf Uhr abends der Ruf des Waldes zum Schrei wandelte und entwurzelte Bäume den Hafenhügel hinabrollten, ging die Tür vom königlichen Arbeitszimmer auf. Im Halbdämmer konnte Tibald seine Frau nicht gleich erkennen. Erst als sie näher trat, registrierte er ihre Reisekleidung und in ihren Armen die warme Decke, aus der ein rosa Bäckchen, blonde Locken und eine mollige kleine Hand hervorlugten. Und da erst traf ihn die Wahrheit mit voller Wucht und in ihrer ganzen Grausamkeit.
Lieber wäre er gestorben. So unendlich viel lieber wäre er gestorben. Tibald wich zum Kamin zurück und schüttelte unmerklich den Kopf. Ema sah ihn mit sich ringen und konnte ihm nicht helfen. Sie selbst lebte ja nur noch halb. Wie viele Stunden blieben ihnen noch? Den ganzen Tag lang hatte sie Miriam betrachtet, wie sie vor sich hin brabbelte und an der Stelle, wo sie ein Zähnchen bekam, an ihrer Faust nuckelte. Wie konnte Ema ihm eine Hilfe sein? Mit welcher Kraft sollte sie das fertigbringen? Mit welchen Worten, in welcher Sprache?
Tibald lehnte sich schwer an den weißen Marmorsims und legte sich eine Hand über die Augen. Auf einmal tauchte mit erstaunlicher Klarheit jener Albtraum vor ihm auf, den er Nacht für Nacht geträumt und anschließend immer wieder vergessen hatte. All die Monate, in denen er sich qualvoll in seinem Bett gewälzt hatte, waren nur eine Vorbereitung gewesen auf das Unglück, das ihm nun bevorstand. Wie ein Schauspieler vor einer Theateraufführung hatte er nachts fortwährend geprobt. Und ganz wach träumte er jetzt, bis die Wirklichkeit in ihn eingesunken war. Er hatte das Medaillon nicht verloren. Er hatte es absichtlich im Wald zurückgelassen und an einen Zweig gehängt, damit Miriam das Gesicht ihrer Mutter nicht vergaß. Er hatte einen Pakt mit Sidra geschlossen. Einen unumgänglichen Pakt. Er konnte nichts dafür. Weder der König noch der Mensch konnte irgendetwas dafür.
Als er wieder aufsah, begegnete er Emas schwarzen Augen. Sie blickte ihn unverwandt an, schien aber seltsam abwesend, weit weg hinter ihren unnahbaren Zügen verschanzt. Würde er auch sie verlieren? Er ging zu ihr, um Mutter und Tochter in seine Arme zu schließen. Miriam war warm, Ema kalt. Er liebte die eine so sehr wie die andere. Sie beide bewohnten eine so tiefe Region seines Wesens, dass nichts sie ihm jemals entreißen konnte. Mit einer jähen Bewegung löste er sich von ihnen, fand den fehlenden Stiefel, schlüpfte hinein, knöpfte seine Weste zu, zog den Mantel an.
In tiefem Schweigen machten sie sich zum Pferdestall auf. Unterwegs traten die Leute vor ihnen auseinander und senkten die Köpfe. Ema bewegte sich würdevoll und reserviert, Tibald starrte auf einen fernen Punkt vor sich, sein Mund ein gerader Strich wie damals bei seinem Vater. Die Wäscherin und der Schmied waren die Einzigen, die ihnen ins Gesicht zu sehen vermochten. Während Mathilde zart über Miriams Stirn strich, sprach sie ganz leise zu der Königin wie zu einer jüngeren Schwester. Sie beschwor sie, stark zu sein, erklärte ihr, dass das Land sie brauche. Ema antwortete ihr in einer fremden Sprache.
Die Pferde im Marstall befanden sich in größter Unruhe. Epinal wieherte seit zwei Stunden, um seine Pupillen leuchtete der Ring aus grünem Licht. Gabriel hatte unter großen Mühen drei Schimmel gesattelt, wie es die Tradition verlangte. Doch als er die kleine Prinzessin erblickte, glitt ihm das Zaumzeug aus der Hand, das er gerade anlegen wollte. Er rechnete noch einmal neu: Wenn der König zugleich der Vater war, dann genügten zwei Pferde. Schweren Herzens brachte er das dritte in seine Nische zurück.
Als Tibald und Ema losritten, hatten sie noch kein Wort miteinander gesprochen. Dichter Nebel verschluckte Baumstämme und Schlossmauern. Der Rundbogen vor ihnen sah aus wie eine schwebende Brücke, und die wenigen versprengten Schaulustigen erinnerten an Bojen. Am Vier-Wege-Kreuz wurden sie von einem Mann und einer Frau mit ihrer kleinen Tochter erwartet, die am ersten Mai während des Mittagsläutens geboren war. Tibald schickte sie mit einer Handbewegung nach Hause. Sie verstanden nicht. Er dankte ihnen, versprach, sie nicht zu vergessen, und ritt weiter.
Kurz nach dem Vier-Wege-Kreuz war von der Landschaft nichts mehr zu sehen; der Nebel hatte alles ausgelöscht. Es war, als hätte die Welt noch nicht zu existieren begonnen oder als sei sie gerade zu Ende gegangen. Ema und Tibald befanden sich im Nirgendwo, nicht auf einer Insel, nicht in einem Jahrhundert – sie waren Gefangene von Ereignissen, die größer waren als sie. Wie ein Leuchtturm strahlte über ihnen die Ewigkeit, erleuchtete sie aber nicht. Sie nahmen das rhythmische Geklapper der Pferdehufe nicht wahr; für sie bestand das Universum nur noch aus Miriam. Miriam, die in ihrer Decke strampelte und mit neugierigen Augen in die Nacht blickte.
Die stundenlange Wegstrecke bis zum Rand der Catastrophe erschien ihnen viel zu kurz. In der Ferne wurde ein trüber Lichtschein sichtbar, das musste die Hütte des Mittelsmannes sein. Sie bogen auf einen schlammigen Pfad, auf dem es von dicken Würmern und unzähligen Schaben wimmelte. Dann tauchte die Hütte aus dem Nebel auf: ein steiles Dach, ein einziges Fenster, eine hölzerne Tür mit rostigen Beschlägen.
Tibald war nicht Herr seiner Bewegungen; es fiel ihm schwer, von seinem Pferd zu steigen. Als er schließlich aus dem Sattel glitt, schritt er wie eine Aufziehpuppe zur Tür und klopfte dreimal ganz leise. Die Scharniere quietschten. Der Mittelsmann erschien auf der Schwelle, in einem groben Gewand mit einer zu großen Kapuze, und streckte grußlos zwei magere Hände mit schmutzigen Nägeln aus. Ema blieb ein Stück zurück. Sie wiegte Miriam, die inzwischen eingeschlafen war. Erst als Tibald ihr einen flehenden Blick zuwarf, kam sie langsam näher.
Sie spürte ihre Beine nicht. Jeder Schritt hin zu den ausgestreckten Händen trieb sie weiter fort von sich selbst. Würde sie je wieder in ihre Haut als Sklavin, Königin und Frau zurückfinden? Vielleicht nicht. Sie ordnete noch einmal, zweimal die Decke um das Bündel, bevor sie die Kleine ihrem Vater übergab. Dann schlang sie die Arme um sich, um noch ein bisschen von Miriams Wärme festzuhalten – es war alles, was ihr blieb.
Zitternd nahm Tibald seine Tochter entgegen. Er musste sich gedanklich mit allen Herrschern vor ihm verbinden, bevor er es über sich brachte, sie in die dunklen Klauen des Mittelsmannes zu legen. In diesem Moment wachte Miriam auf. Mit heiterem Gesichtchen sah sie sich nach ihren Eltern um. Und vor diesem Gesicht einer wahren Prinzessin schloss sich die Tür.
Im nächsten Moment verstummte der Schrei der Catastrophe. Der Wind flaute ab, der Nebel lichtete sich. Ein Blitz erhellte die knorrigen Zweige des Waldes. Tibald blickte Ema an, die ihm fremder erschien denn je; Ema blickte Tibald an, als wäre er unsichtbar. Er half ihr auf Horaz hinauf und beschloss, selbst zu Fuß zurückzugehen.
Er weinte.
In der Ferne grollte Donner, Blitze zerrissen den Himmel, und sturzartiger Regen setzte ein, prasselte auf die trockene Erde. Ema legte im Reiten den Kopf zurück und ließ das Wasser ihren Hals hinablaufen. Tibald zog seinen Mantel aus, knöpfte seine Weste auf und öffnete sein Hemd. Die vom Unwetter zerrüttete Landschaft ähnelte ihnen. Natürlich würde sie sich wieder berappeln, ein Grashalm nach dem anderen würde sich wieder aufrichten. Auch sie beide würden dieses Wunder vollbringen müssen. Nur wie?
Ema und Tibald glaubten sich allein auf der Welt, doch im Aufleuchten eines Blitzes erkannten sie, dass ihnen ganz fern auf der Straße jemand entgegenkam. Es war Lysander, bis auf die Knochen durchnässt, weiß wie ein Mond in schwarzer Nacht, das strähnige Haar an den Schläfen klebend. Lysander mit seinem typischen Blick eines Erwachsenen, der versehentlich in einen Kinderkörper geraten war. Tibald, der Zephir am Zügel führte, ließ den Jungen aufs Pferd steigen.
»Nimm du die Zügel«, sagte er, und Lysander hatte das unbehagliche Gefühl, dass er ihm das ganze Königreich in die Hände legte.
2
Esmee war vom Ruf des Waldes mitten im Galopp überrascht worden, auf halbem Wege zwischen Frixeln und dem Schloss. Zodiak hatte sich geweigert, auch nur einen Schritt weiterzugehen, und so hatten die Botin und ihre Stute einen Teil der Nacht fröstelnd unter einer Eiche verbracht, während der Sturm ringsum Bäume umriss. Nachdem der Schrei verstummt war, hatten sie ihren Weg im Gewitter, unter strömendem Regen fortgesetzt und waren nun am Marstall angelangt.
»Der König erwartet dich im Thronsaal«, empfing Gabriel sie ohne große Vorrede.
»Du bist schon auf?«
»Keiner hat geschlafen, wie du dir vorstellen kannst.«
»Der König demnach auch nicht?«
»Der König …«
Gabriel machte ein so verstörtes Gesicht, dass Esmee nicht weiterfragte.
Gewöhnlich bestellte Tibald die Botin nicht vor Tagesanbruch zu sich, und schon gar nicht empfing er sie im Thronsaal. Aber dieser Tag war offensichtlich nicht wie die anderen.
Von oben bis unten voller Schlammspritzer eilte Esmee mit großen Schritten über den langen roten Teppich, auf dem sie eine nasse Spur hinterließ. Doch als sie den König erblickte, blieb sie abrupt stehen. Sein Haar war weiß.
»Hoheit …«
Er ließ ihr keine Zeit zum Wundern. Mit einer langsamen, fast widerstrebenden Bewegung nahm er einen gefalteten Brief von seinem Schoß.
»Diese Botschaft hier sollst du bitte mündlich überbringen. Ich möchte, dass du sie auswendig lernst.«
Normalerweise schrieb Tibald eine mündlich zu übermittelnde Nachricht nicht eigens vorher auf. Doch diesmal fühlte er sich außerstande, die Worte auszusprechen, an denen er die ganze Nacht gefeilt hatte. Er war im Innersten zerbrochen, ein Haufen Brocken und Krümel, der nur noch von der Kleidung zusammengehalten wurde.
Mit großer Verlegenheit faltete Esmee das Blatt auseinander. Sie konnte nicht gut lesen. Sie konnte gar nicht gut lesen. Stets hüpften ihr die Buchstaben vor den Augen herum und spielten Bockspringen. Während ihrer ganzen Schulzeit hatte sie auf die einfachsten Fragen keine Antwort gewusst. Heute las sie stattdessen die Landschaft; ihr Buch, das waren jetzt Straßen, Felsschluchten und Hügel. Und noch nie hatte ihr jemand einen Text zum Auswendiglernen gegeben. Mit ein wenig Mühe und Geduld konnte sie sich vielleicht durch die Zeilen buchstabieren, doch da sie noch durcheinander war vom Schrei des vergangenen Abends und dem weiß gewordenen Haar des Königs, sah sie nun statt der Wörter nur lauter Insekten.
»Ich weiß, meine Handschrift ist nicht sehr gut«, sagte Tibald entschuldigend.
»Nein, es liegt an mir, Hoheit. Lesen … fällt mir schwer.«
Esmee ließ ihre Hand sinken und verwischte dabei etwas von der Tinte auf ihrer regennassen Hose.
»Gut«, sagte Tibald und seufzte. »Ich will versuchen, es dir zu sagen.«
Langsam stand er auf, stieg vom Podest herab und rezitierte mit belegter Stimme: »Am Abend der Tagundnachtgleiche wurde Prinzessin Miriam, erstgeborenes Mädchen dieses Mais, dem Mittelsmann übergeben, aus den Händen des Ecksteiner Herrschers, dessen größter Wunsch der Frieden im Reich ist.«
Esmee schien es, als würde sein Haar noch weiter erbleichen. Am liebsten hätte sie den König in die Arme genommen, aber einen Monarchen berührte man nicht. Stattdessen fing sie an zu weinen.
»Schaffst du es wohl, diese Nachricht bis morgen Abend in allen Regionen zu verbreiten? Ich möchte niemand anderen damit betrauen. Marthe hat dir schon eine Wegzehrung vorbereitet. Brich sofort auf.«
Esmee wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht, machte auf dem Absatz kehrt und ließ das Blatt mit dem fürchterlichen Satz auf dem Boden liegen.
Zur selben Zeit weckte Manfred viel früher als gewohnt alle Schlossbediensteten, indem er vor jedem Zimmer mit seinem großen Schlüsselbund rasselte. Er wollte das Personal in der Wäscherei versammeln. Seiner Ansicht nach verlangten die historischen Ereignisse der vergangenen Nacht nach einer angemessenen Reaktion. Lang und schlank stellte der Kammerherr sich in dem großen weißen Raum mit der niedrigen Decke auf, in dem kreuz und quer Wäscheleinen hingen, diverse Bügeltische standen und Lavendelduft in der Luft lag. Das fortschreitende Alter beugte bereits seinen Nacken, was er dadurch kompensierte, dass er stolz das Kinn anhob. Seine Reputation, seine Erfahrung, die Tressen seiner Livree – alles an ihm war respektgebietend. Zwischen den wabernden Dämpfen der bereits erhitzten Bügeleisen hatte er etwas von einem Adler im Gleitflug. Er sprach gut.
Von nun an, so sagte Manfred, solle für die königlichen Herrschaften nichts zu gut oder zu schön sein. Nachlässige Diener würden sich verbessern müssen; aufmerksame Diener sollten hervorragend werden; und auch die hervorragenden konnten noch mehr geben. Es genüge nicht mehr, auf Wünsche zu reagieren – man müsse den Wünschen zuvorkommen. Es genüge nicht mehr, Präsenz zu zeigen – man müsse auch verstehen, unsichtbar zu werden, zu schweigen oder mit dem Hintergrund zu verschmelzen.
Es folgten tausenderlei kleine Empfehlungen. Für den Tee der Königin seien exakt zwei Minuten vonnöten, damit sich das Aroma entfalte (»eine Übung in Geduld«). Zu schwere Stoffe, zu lange Röcke, Schleppen oder Unterröcke behinderten ihren raschen Gang (»Vermeiden wir Brokat, verzichten wir auf das Stärken der Wäsche«). Lebhafte Farben ließen ihren Teint leuchten, graue Nuancen ihn erblassen (»Nur keine Scheu vor bunten Tönen«). Den König wiederum gelte es vor seinen eigenen Schwächen zu bewahren. An sonnigen oder stürmischen Tagen könne er sich schlecht konzentrieren (»Lassen wir die Fenster dann geschlossen«). Er liebe seinen Kaffee stark und trinke versehentlich die gemahlenen Körnchen mit (»Wir sollten ihn besser filtern«). Er kleide sich ungern mit Pomp (»Bremsen wir seinen Schneider«) und könne nur gut nachdenken, wenn er durch den Raum wandere (»Sorgen wir für glatte Teppiche«).
Manfred fügte noch etliche allgemeinere Hinweise an. Die Knöpfe mit dem Fuchssymbol müssten auf jeglicher offiziellen Uniform glänzen. Die Tischdecken hätten zu jedem Anlass (sei er förmlich oder alltäglich) und in jedem Raum (ob prunkvoll oder bescheiden) fleckenlos zu sein, die Ziergegenstände ohne Staub, die Spitzendeckchen ohne Risse, die Lampen ohne Rußschlieren und das Silberzeug ohne Patina. Töpfe, Stiefel, Kommoden und so fort sollten so hochglanzpoliert sein, dass man sich darin spiegeln könnte.
Die zwischen heißen Wasserbecken und aufgehängten Laken stehenden Bediensteten hörten ihm aufmerksam zu. Hilaria, Manfreds älteste Tochter, empfand großen Stolz, Marthe empfand Wut auf den Wald, Madeleine tiefstes Mitleid für Ema. Nur ein einziger Diener fehlte: Benedikt, der tags zuvor nach Ys gefahren war, um seine »Mama zu besuchen«, wie er sagte. Das war bedauerlich, denn Manfred hätte gern die Gelegenheit genutzt, um ausführlich seine Beförderung zum Kammerdiener von Philipp Alsen zu begründen.
Kammerdiener genossen in der Dienerschaft einen höheren Rang: Benedikt würde nun keine Hühner mehr rupfen, keine Fische mehr abschuppen, keine Schweine mit Kartoffelschalen mehr füttern müssen. Er würde nicht mehr vor Sonnenaufgang aufstehen müssen, um Möbel zu polieren, den Fußboden zu schrubben oder Kaminfeuer zu schüren. Seine Beförderung hatte in der Dienerschaft eine größere Kontroverse ausgelöst – immerhin war Philipp Alsen der Cousin des Königs.
In Manfreds Augen hatte Benedikt seine Gaben ausreichend unter Beweis gestellt, indem er schon die verschiedensten Persönlichkeiten (den Duke of Oats, Doktor Zwillich, den Hofarchitekten Van Wolfswinkel, den Kanzler und einige ausländische Gäste) vorbildlich bedient hatte. Er hatte ihnen stets mit geziemendem Abstand zur Seite gestanden. Außerdem hatte er sogar den König persönlich unter schwierigen Umständen (nämlich ohne explizite Aufforderung des Königs) auf zwei Reisen begleitet. Manfred verhehlte nicht seine Absicht, ihn in zwei oder drei Jahren zum Haushofmeister zu machen. Damit wäre Benedikt für die gesamte männliche Dienerschaft im Schloss zuständig. Eine Verwalterin (idealerweise Hilaria) würde die Zuständigkeit für das weibliche Personal übernehmen, und Manfred selbst würde sich so ausschließlich den königlichen Gemächern widmen können.
Nur eines fehlte Benedikt noch: die Achtung seiner Kollegen. Manfred versuchte deshalb bei jeder sich bietenden Gelegenheit, seinen Ruf ein wenig aufzupolieren, und an diesem Morgen hatte er die Nachricht in Benedikts Zimmer hinterlassen, er möge an der Versammlung teilnehmen, falls er rechtzeitig zurück sei. Doch Benedikt kam zu spät: Die anderen zerstreuten sich bereits, als er endlich die Wäscherei betrat. Seine Ellbogen und Knie waren von der Reise verschmuddelt, sein rotes Haar flog wild um seine bleichen Schläfen. Manfred, noch ganz erhoben von seiner eigenen beflügelnden Ansprache, empfing ihn mit einem strengen Blick.
»Ich weiß«, sagte Benedikt zerknirscht.
Er glättete sich rasch das Haar und überreichte Manfred eine große Packung Marzipanplätzchen, als wollte er sich damit für seine Verspätung, seine abgerissene Erscheinung und überhaupt seine ganze Existenz entschuldigen.
»Die Postkutsche ist wirklich eine erbärmliche Angelegenheit«, versuchte er sich zu rechtfertigen. »Ah, wenn Ihr wüsstet, Manfred! Ein einziges Gerumpel und Geholper! Ich habe mir den Kopf an der Scheibe gestoßen, schaut Euch nur diese Beule an, mir brummt richtig der Schädel. Und ich saß eingezwängt zwischen lauter Paketen. Aber es war die einzige Möglichkeit, noch rechtzeitig zum Tagesanbruch wieder hier zu sein. Und wie Ihr seht, bringe ich die berühmten Plätzchen mit, wie ich es Marthe versprochen habe … Gut, dann werde ich mich mal in Ordnung bringen.«
»Ja.«
»Und was diese besondere Versammlung betrifft … Worum ging es da?«
»Um die sehr ernsten Geschehnisse der letzten Nacht, wie du dir wohl denken kannst.«
Benedikt schien kurz angestrengt nachzudenken.
»Ja sicher«, sagte er dann.
»Ja.«
»Gewiss.«
Manfred zeigte mit seiner weiß behandschuhten Fingerspitze zur Tür.
»Nun, dann bringe die Plätzchen doch selbst in die Küche.«
3
Nach dem heftigen Regen erhob sich der Tag über einer aufgelebten Natur. Das Gras färbte sich wieder grün, die Vögel pickten nach Larven und Würmern, Maulwürfe krochen aus ihren Erdhaufen. Auf der ganzen Insel stieß alles, was wuchs, einen erleichterten Seufzer aus. Doch je mehr Ecksteiner durch Esmee von der traurigen Nachricht des Königs erfuhren, desto mehr Ratlosigkeit breitete sich aus. Wie sollten sie das Glück des Regens mit der Tragödie der Tagundnachtgleiche zusammenbringen? Konnte man das eine ohne das andere denken? Hatte der Wald für den so sehnlich erwarteten Niederschlag im Gegenzug die Prinzessin eingefordert?
Von überallher trafen Beileidsbriefe ein. Weder Tibald noch Ema wollten sie lesen. Elisabeth bot sich an, sie in ihrer Eigenschaft als Patentante für sie zu beantworten. Willem machte die Familie ausfindig, die zum Vier-Wege-Kreuz gekommen war, denn Tibald wollte ihnen Miriams Wiege schenken. Allerdings war nicht mehr viel davon übrig – wegen der vergifteten Rassel, deren Herkunft ungeklärt blieb, hatte er fast das ganze Zubehör verbrannt.
Den Rest des Tages verbrachte Willem zusammen mit dem König im großen roten Arbeitszimmer. Er verhielt sich möglichst unauffällig, sprach mit leiser Stimme und beeilte sich, allem, was Tibald sagte, beizupflichten. Doch am späteren Nachmittag kam er nicht umhin, ihm zu widersprechen: Tibald hatte davon angefangen, eine Suchaktion für seine Tochter zu organisieren.
»Das ist verrückt.«
»Keineswegs.«
»Aber Tibald, eine Suchaktion! Erinnere dich. Hundertneunundachtzig Verletzte …«
»Lass uns die Glocken für den Inselnotruf läuten.«
»Tibald, ich weiß, dass es ein entsetzlicher Verlust ist, und …«
»Was weißt du schon davon, Willem? Und wo wir dabei sind, weißt du auch, warum es immer der König ist, der dem Mittelsmann das Kind überbringt?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Dann sage ich es dir: Weil es eine schier unmögliche Aufgabe ist. Weil ein Vater so etwas nicht fertigbringt. Ich habe mich zweiteilen müssen.«
Willem betrachtete stumm seinen Freund. Er hatte sich eindeutig verändert, er wusste nur noch nicht zu sagen, wie. Das weiße Haar und die lange Narbe jedenfalls schienen sich ganz stimmig in sein Gesicht zu fügen.
»Wir lassen die Glocken läuten, sofort.«
»Tibald, die Suchaktion damals war ein Albtraum. Außerdem … Kein Maimädchen ist je aus der Catastrophe zurückgekehrt …«
Tibald wusste insgeheim, dass das nicht stimmte: Sidra war zurückgekehrt. Wie sie es geschafft hatte, lag zwar jenseits seiner Vorstellung, aber es war eine Tatsache. Er verscheuchte den Gedanken und antwortete stattdessen:
»Es war auch noch nie eine Prinzessin dabei.«
»Doch. Die allererste.«
Willem hatte recht. Die Geschichte wiederholte sich. Eckart hatte seine Tochter verloren und dann um den Preis des völligen Vergessens und eines verfluchten Waldes sein Land regiert. Das Volk bezahlte dafür, von Generation zu Generation. Auch Tibald hatte soeben seine Tochter verloren. Sollte er womöglich den Fehler des ersten Königs wiedergutmachen? Würde er es schaffen, Eckstein zu regieren, ohne etwas zu vergessen oder zu verfluchen? Was hatte er seinem Vorfahren voraus?
Er hatte die ewige Liebe. Eine Blüte aus Licht war einige Tage nach seiner Geburt auf seiner Stirn erschienen; und zur selben Zeit jenseits der Meere auch auf Emas. Es war ein Zeichen des Schicksals, dessen Bedeutung sie beide nicht verstanden, dem sie mit ihrem Leben jedoch gerecht zu werden versuchten …
Tibald starrte den Kapitän an, ohne ihn wirklich zu sehen. Plötzlich ließ er seine Faust auf den Schreibtisch niederfahren, dessen Ecken mit Eckarts geflügeltem Schwertgriff verziert waren.
»Ich gehe hin«, verkündete er.
»Wohin?«
»Ich muss dorthin.«
Er stand auf, griff nach seinem roten Mantel und stürmte aus der Tür.
Wenige Minuten später ritt er durch die Hafenregion. Zephirs Galopp erfüllte ihn mit Mut, sein Kleeduft beruhigte ihn. Er nahm denselben Weg wie am Vortag, als könnte er ihn auf diese Weise ungeschehen machen, so wie man Unangenehmes mit einem Schwamm wegwischt. Die Landschaft zog an ihm vorüber, Felsen, Äcker, verkümmerte Büsche, kurze Ausblicke auf das Meer mit seinem silbrigen Horizont. Ein raues Gelände, das stellenweise gezähmt, anderswo wild, aber immer vertraut war und das er doch nicht wiedererkannte. Er trieb Zephir an, bis alles um ihn herum verschwamm.
Bald hatte er sein Ziel erreicht. Das helle Tageslicht gereichte der Hütte nicht zum Vorteil: eine kümmerliche Baracke in mondartiger Landschaft. Zephir sträubte sich weiterzugehen. Tibald drängte ihn beharrlich vorwärts bis zu etwas, was einmal ein Brunnen gewesen sein musste und nur noch ein Haufen Steine war. Er band den Hengst fest, stapfte zu der Hütte und schwang den Türklopfer gegen das morsche Holz. Als Antwort ertönte eine Art Grunzen.
»Mach auf! Hier ist der König.«
In der Tür erschien die von der Kapuze verhüllte Gestalt.
»Wo ist sie?«, fragte Tibald.
Der Mittelsmann schüttelte den Kopf. Alle Väter kamen zu ihm. Sie hämmerten verzweifelt an die Tür, knieten vor ihm nieder, waren mit Geschenken beladen oder mit Äxten bewaffnet. Doch keiner von ihnen hatte seine Tochter wiederbekommen.
»Wo ist sie?«
Als Tibald immer noch keine Antwort erhielt, stieß er den Mann zur Seite und betrat den einzigen Raum der Hütte, der schmutzig war und leer und dessen Boden aus festgestampftem Lehm bestand. Die Höhle eines Tieres, dachte Tibald abgestoßen. Der Mittelsmann wartete in der offenen Tür, überzeugt davon, dass der König wie alle anderen von selbst wieder gehen würde.
Doch Tibald ging nicht. Er bemerkte:
»Du sprichst nicht.« Er kam näher und fragte: »Kannst du sprechen? Wer bist du überhaupt?« Dann riss er ihm mit einem Ruck die Kapuze vom Kopf.
Der Mittelsmann vergrub sein Gesicht in seinen schwarzen Pranken. Tibald griff ihm in den struppigen Nacken, um seinen Kopf hochzuziehen. Was er sah, verstörte ihn so sehr, dass er abrupt losließ, ohne den erhobenen Arm zu senken: eine lange Nase, unter der der Mund fast verschwand; spitze Ohren und haarige Wangen; bernsteinfarbene Augen mit senkrechten Pupillen. Der Mittelsmann besaß das Gesicht eines Mannes, der einem Fuchs ähnelte, oder das Gesicht eines Fuchses, der einem Mann ähnelte.
»Unmöglich«, murmelte Tibald und spürte zu seiner eigenen Überraschung, wie sein Zorn verflog.
Was da vor ihm stand, war eine ungestalte, einsame Kreatur, verloren zwischen zwei Spezies, an der Grenze zwischen zwei Welten lebend, ein Wesen, das wegen seiner schrecklichen Aufgabe von allen gehasst und die restliche Zeit nicht wahrgenommen wurde. Tibald holte tief Luft und atmete den strengen Geruch der Hütte ein.
»Ist sie am Leben?«, fragte er nun etwas sanfter.
Der Mittelsmann nickte.
»Bekommt sie zu essen? Wird sie warm gehalten?«
Wieder ein Nicken.
»Danke.«
Tibald trat aus der Tür und ging zu seinem Pferd, unsicher über das, was er gesehen hatte. Die Grenzen der Wirklichkeit verschwammen bedenklich. Kannte er sein Königreich überhaupt? Was für geheime Mächte walteten darin, welche finsteren Bündnisse hatten sich da geschlossen? Und wer herrschte am Ende wirklich?
Er schwang sich auf Zephir, nahm sich vor, seine abgründige Entdeckung für sich zu behalten, und galoppierte los.
4
Der Regen kam jede Nacht wieder, üppig und anhaltend. Für einige Stunden verflüssigten sich die Wege und Straßen, Hafenkarren stürzten ins Meer, und die durchtränkte Erde quoll auf. Doch frühmorgens mit dem Hahnenschrei kehrte alles zur Normalität zurück. Ein sonnenheller Tag brach an, honiggoldenes Licht umhüllte die Welt, und die Fischer zogen die treibenden Karren aus dem Wasser.
Ema verbrachte die meiste Zeit in ihrem Gärtchen, wo sie sich über die letzte Kapuzinerkresse des Jahres beugte und das vom Herbststurm abgerissene Laub aufsammelte. Mit jedem Tag musste sie neu lernen, dass trotz ihres unendlichen Kummers der Wind weiter wehte und die Jahreszeiten wechselten. Sie sprach jetzt wieder die Sprache des Nordens, mit einer tieferen und weniger singenden Stimme, und immer nur ein paar Worte. In ihr herrschte ein steter Gefühlstumult, unaushaltbar und unkontrollierbar. Ihr schien, die Schlossmauern würden sich immer enger um sie schließen. Je kürzer die Tage wurden, desto drängender wurde ihr Wunsch, aus Eckstein zu fliehen, doch ohne Tibald, ohne Miriam würde sie es niemals tun. Ihre Liebe hielt sie zurück wie eine Eisenkugel, die an ihrem Fußknöchel hing. Sie grollte sich selbst wegen ihrer Fluchtgedanken. Wegen allem anderen grollte sie Sidra, und sie grollte auch Eckart, dem ersten König, der sein Land mit einem Fluch belegt hatte. Sie wollte niemanden sehen bis auf Elisabeth, die still kam, still dablieb und still wieder ging.
Tibald wiederum sehnte sich danach, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen – ein schwieriger Wunsch für einen König. Mehrmals verließ er ohne jede Erklärung das Schloss, begleitet nur von seinem treuen Leibwächter Ovid. Jedes Mal ritten sie in dieselbe Richtung: zum Waldsaum der Catastrophe. Wie seinerzeit Alberich wanderte Tibald die dichte Mauer aus Bäumen entlang und hoffte auf irgendein Lebenszeichen. Ovid folgte ihm zitternd, die Erinnerung an die fatale Suchaktion saß ihm noch in den Knochen, hinzu kam seine Angst vor Geistern. Und jedes Mal wirbelte ihnen der Wald totes Geäst und Dornen entgegen. Die Augen voller Staub kehrten sie schließlich entmutigt zum Schloss zurück.
Irgendwann fand Tibald eine sinnvollere Betätigung, um sich den Audienzen zu entziehen: Er beschloss, die unterirdischen Geheimgänge zu inspizieren. Immerhin waren diese Gänge ein ganzes Jahrhundert alt, und das Erdbeben hatte sie sicherlich beschädigt. Ema schien auf nichts anderes gewartet zu haben, als ihn zu begleiten, und so tauchten die beiden regelmäßig von der Oberfläche ab. Manfred konnte ihr ständiges Verschwinden nicht gutheißen, und auch die Leibwächter hatten ein mulmiges Gefühl. Doch keiner von ihnen wagte etwas einzuwenden. Tibald und Ema waren durch ihr selbstloses Opfer zu überlebensgroßen Monarchen geworden, und wenn ihre Trauer nach Zweisamkeit, Rückzug und Dunkelheit verlangte, dann sollte es eben so sein.
Die beiden suchten sich auf der Karte des Tunnelnetzes einen zufälligen Gang heraus. Wenn es einen versteckten Zugang gab, brachen sie bei Tag auf, andernfalls bei Nacht. König Floris, der Erbauer der Geheimgänge, hatte bekanntermaßen eine Leidenschaft für ausgeklügelte Mechanismen gehabt. Fast überall hatte er komplizierte Gewichts- und Räderwerksysteme untergebracht, die seit Langem vor sich hin rosteten. Doch die meisten seiner Gänge hatten dem Verschleiß der Zeit widerstanden, weil sie direkt in den Sandstein gehauen waren. Ema und Tibald machten in ihnen allerlei Entdeckungen: Weinkeller, gedeckte Tische, Spiegel, Bücher und Diwane sowie einige alte Münzen. Allerdings fanden sie nirgendwo das berühmte Schachbrett, mit dem Floris der Erzählung nach zwei Tage und zwei Nächte hindurch gespielt hatte, ohne etwas zu trinken oder zu essen. Sein Gegner hatte am Ende gewonnen, und zur Belohnung hatte der König ihm das Herrenhaus von Ys zur Verfügung gestellt. Es hieß, das Schachbrett sei ein Kunstwerk von unschätzbarem Wert. Womöglich gehörte es nur ins Reich der Legenden, trotzdem hatte Tibald insgeheim gehofft, den Import von Lebensmitteln damit zu finanzieren.
Doch auch ohne Schachspiel machten sie unter diesen Überbleibseln eines kapriziösen Jahrhunderts einen Überraschungsfund nach dem anderen. Und oft führten ihre unterirdischen Wanderungen sie an völlig unerwarteten Orten ans Tageslicht. Von einem hohlen Felsen im Schlossgarten aus landeten sie, von Spinnweben überzogen, in einem Hafengässchen; von einer Bodenluke im Rauchsalon gelangten sie in den Park der Damhirsche; von der königlichen Zisterne in eine Felsenschlucht zwischen Mittling und Frixeln; von der Vorratskammer der Schlossküche zu einem aparten runden Zimmer mit einem breiten, von Silberglöckchen gesäumten Bett. Als sie sich probeweise auf die faulige Matratze legten, brach das Gestell unter ihnen zusammen, und vom Boden stieg ebenso viel Staub auf, wie von der Decke herabrieselte. Nach Luft ringend rappelten sie sich hoch und lachten.
Sie lachten.
Der letzte Gang, den sie erforschten, startete bei einer verborgenen Tür im Festsaal und führte zum Aussichtspunkt am Kap des Leuchtturms. Die Tür war geschickt getarnt: die gleiche gerillte Sockelleiste wie der Rest der Wand, derselbe gelbe Damast, die gleiche geschnitzte Holztäfelung – die üppige Verzierung ließ einen flüchtigen Beobachter über den Spalt hinwegsehen. Dieser Geheimgang erklärte wahrscheinlich auch Sidras überraschendes Auftauchen an dem Abend, als die Mannschaft der Isabelle ins Schloss zurückgekehrt war. Alle Festgäste hatten noch auf Königin Sidra gewartet, um den Tanz eröffnen zu können, aber sie war nicht erschienen. Und plötzlich war sie wie aus dem Nichts aufgetaucht, unvermutet und unerklärlich, wodurch sie nicht wenigen einen Schrecken eingejagt hatte. Was sie jetzt wohl tat? Was machte sie in ihrem Wald? Wiegte sie die kleine Miriam? Redete sie mit ihr? Konnte sie singen?
Tibald und Ema, die beide einen Pakt mit der Catastrophe geschlossen hatten, wussten es voneinander, sprachen aber nicht darüber. Wie so viele Eltern vor ihnen hatten sie es dem Land zuliebe getan. Nun tauchten sie gemeinsam in die warmen Arme des Sandgesteins, tasteten sich durch unbekannte Gänge, gefährliche Tiefen, ganz wie die Trauer, die sie so gerne überwinden wollten.
Wenn Tibald nicht mit Ema durch den Untergrund wanderte, erledigte er sein Tagesgeschäft. Um die Stunden auszufüllen, stürzte er sich geradezu verbissen in die Arbeit. Da er nicht mehr von Albträumen heimgesucht wurde, schlief er besser – und schuftete nur umso mehr. Unter anderem beschäftigte er sich mit der Grundversorgung der Insel. Der große Frost hatte das Vieh eingehen lassen, die trockene Hitze die Ernten vernichtet und Feuersbrünste einen Teil der Wälder zerstört. Tibald hatte deshalb ein Rationierungssystem entwickelt, das für jeden gerade das Wichtigste zum Leben vorsah und etliche vor dem Verhungern bewahrte. Das System funktionierte recht gut, wenn sich auch einige Menschen nicht damit zufrieden zeigten. Sie versuchten, mehr für sich herauszuschlagen, indem sie wilderten, um Geld spielten, stahlen oder ihre Kinder betteln ließen. Die Beamten des Friedensrichters hatten alle Hände voll zu tun, um die entstehenden Konflikte zu schlichten und die Kleinen wieder in die Schule zu schicken.
Wieder einmal hatte Tibald das Mutterland Basilis um Unterstützung bitten müssen. Obwohl König Immanuel selbst bis zum Hals in einem blutigen Konflikt steckte, hatte er versprochen, Eckstein mit Vorräten zu beliefern, und sogar die Erlaubnis gegeben, die aus Basilis stammenden Wertgegenstände, die in der Ecksteiner Schatzkammer lagerten, weiterzuverkaufen. Alles, nur nicht das gläserne Uhrwerk, hatte er mit seiner zittrigen Hand dazugeschrieben.
Aber selbst Immanuels Großzügigkeit half ihnen nicht aus der Misere. Die Staatstresore waren leer und der Schatzkanzler zutiefst besorgt. In der Folge begannen die Bankdirektoren um den König zu streichen, um ihm ein Darlehen anzubieten, aber Tibald verscheuchte sie wie lästige Fliegen. Das Königshaus verschulden? Nie und nimmer! Außerdem hatten die Bankiers schon von dem Hungerwinter munter profitiert: Als die Menschen einander die Brotkrusten aus den Händen rissen, hatten sie zu unmöglichen Zinssätzen Geld verliehen. Der König hatte sie ausgebremst, indem er ihre Gewinne limitierte, und seither waren die gegenseitigen Beziehungen angespannt.
Aus diesem Grund gab Tibald auch nur widerwillig nach, als ihn ein Audienzgesuch des vermögendsten aller Bankdirektoren erreichte. Herr von Höll (so hieß er wirklich) war ein einflussreicher Mann, der es verstand, sich zu jedem Anlass eine Einladung zu verschaffen (er war bei Alberichs Beerdigung gewesen, beim Festempfang zu Ehren der zurückgekehrten Seefahrer, bei Tibalds Krönung sowie bei Miriams Taufe). Er besaß ein enormes Vermögen, das er auf legale Weise angehäuft hatte, sosehr die Gesetzgebung auch die Vermögensanhäufung zu verhindern suchte. Die Redewendung »reich wie von Höll« war längst in die Alltagssprache eingegangen. Da der Bankier seinen Reichtum lieber zeigte als benannte, war er von Kopf bis Fuß in Samt gekleidet, dem teuersten Stoff der Welt. Tibald, der ihn auf seinem Thron sitzend erwartete, seufzte auf, als er den Samtschimmernden lässig herannahen sah.
»Eure Majestät«, sagte der Bankier mit einer Verbeugung.
Er hatte eine schmale Stirn, ein perfekt gestutztes graues Spitzbärtchen und lebhafte kleine blaue Augen in tiefen Höhlen. Auf eine unverwechselbare Weise gelang es ihm stets, zu lächeln, ohne zu lächeln.
»Herr von Höll, ich weise Euch gleich darauf hin, dass Euer Besuch zwecklos ist.«
»In diesem Fall komme ich gerne direkt zur Sache, mein König.«
»Gut, denn ich habe nicht viel Zeit. Eure Kollegen waren bereits hier, um mir ihre Unterstützung anzubieten, und ich habe abgelehnt. Das Königshaus kommt sehr gut ohne sie aus.«
Während von Höll noch respektvoll mit dem Kopf nickte, wandte er auch schon ein:
»Mit Verlaub, Hoheit, möchte ich Euch darauf aufmerksam machen, dass man auf der Insel größtenteils anders darüber denkt.«
»Und was soll das heißen?«
»Die Staatstresore sind leer, Hoheit. Das ist der Öffentlichkeit bekannt.«
»Ja, die Tresore sind leer. Aber ich sage Euch, was der Öffentlichkeit ebenfalls bekannt ist: Wer etwas leiht, muss es zurückzahlen. Und wer etwas von einem Bankier leiht, muss es mit Zinsen zurückzahlen, was am Ende meist ein Loch ohne Boden bedeutet. Das Königshaus verschuldet sich nicht. Keiner meiner Vorfahren hat je ein Darlehen aufgenommen, und ich werde da keine Ausnahme sein.«
»Natürlich nicht, Eure Majestät.«
Von Höll zupfte an seinem Bärtchen und sagte nichts weiter. Ihm gegenüber strich Tibald mit der Fingerspitze über eine seiner Koteletten – bei ihm ein Anzeichen größter Langeweile.
»Nun?«, fragte er nach einer Weile. »Immer noch hier?«
»Aus gutem Grund, Eure Majestät. Ich bin gekommen, um Euch ein Angebot zu unterbreiten, das Ihr nicht ablehnen könnt.«
Tibald antwortete nur mit einer müden Handbewegung.
»Ein zinsloses Darlehen ohne Rückzahlungsfälligkeit, Eure Majestät.«
Einen Moment lang musterte Tibald ihn argwöhnisch. Zinslos? Ohne Rückzahlungsfrist? Nicht sehr glaubwürdig.
»Herr von Höll«, sagte er schließlich. »Ihr seid berühmt für Euren Reichtum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihr gewöhnlich auf solche Weise Geschäfte macht …«
»Es ist ja auch eine außergewöhnliche Situation, Hoheit.«
»Das stimmt. Und trotzdem. Ihr werdet doch nicht ohne Profit Geld verleihen. In Eurem Angebot verbirgt sich irgendein Gewinn für Euch. Welcher ist es?«
»Ein patriotischer Gewinn, Hoheit. Die moralische Genugtuung, aus Solidarität gehandelt zu haben.«
Von Höll betonte die Schlüsselwörter mit großem Nachdruck, und Tibald bekam fast einen Lachanfall. Ein Bankier, der ihm aus moralischen Gründen sein Vermögen zu Füßen legte? Aus Solidarität? Ein guter Witz. Von Höll sah beleidigt aus.
»Mein König«, protestierte er mit todernster Stimme, »Ihr habt doch selbst zum Wohl der Allgemeinheit geopfert, was Euch am kostbarsten war: Eure eigene Tochter … Warum sollten die Ecksteiner nicht Eurem Beispiel folgen?«
Von Höll verstand es wie ein Masseur, die empfindlichen Stellen seiner Kunden zu berühren. Sobald Miriam erwähnt wurde, wurde Tibald wachsweich. Unruhig trommelte er mit den Fingern auf die Armlehnen des Throns. Er hatte bereits sämtlichen Schmuck, sämtliche Teppiche und Kunstwerke des Königshauses verkauft, die er hatte finden können. Hätte er das berühmte Schachspiel gefunden, hätte es ihm einen gewissen finanziellen Aufschub verschafft, mehr aber auch nicht. Er hatte die Abbauquoten für Jade und Onyx verdoppelt, ferner die Ecksteiner Theaterleute und Musiker auf Tournee in die Nördlichen Gebiete geschickt. Manche Länder, die seine schwache Situation sahen, boten Tibald an, ihm großzügig unter die Arme zu greifen, wenn er dafür endlich Ecksteins politische Neutralität aufgab und sich (inklusive seiner Edelsteine) mit ihnen verbündete. Aber Tibald wollte alles tun, was in seiner Macht lag, um Ecksteins Unabhängigkeit zu wahren. Und nun lag es in seiner Macht, von Hölls Angebot anzunehmen.
»Zinslos?«, vergewisserte er sich.
»Zinslos, Hoheit.«
»Ohne Rückzahlungsfälligkeit?«
»Mein guter König Tibald, ich schwöre Euch beim Leben meiner Mutter, dass Ihr für die Dauer Eurer Regentschaft – die lang und glücklich sein möge – nichts mehr von mir hören werdet.«
Die letzten Worte sprach von Höll mit der Hand auf dem Herzen, was Tibald nur misstrauischer machte.
»Ohne Rückzahlungsgarantien?«
»Hoheit, mir ist glasklar, wie unangenehm Euch Schulden sind. Ich weiß also sowieso, dass Ihr mich baldmöglichst und eher als jeder andere auszahlen werdet.«
Tibald holte tief Luft.
»Wie viel?«
Von Höll zog ein zusammengerolltes Pergament aus seinem Ärmel und näherte sich dem Thron. Der Vertrag war bereits in allen Details ausgearbeitet. Tibald las ihn langsam durch, wobei er nach jeder Klausel einen prüfenden Blick auf den Bankier warf. Die gerissenen kleinen Augen folgten jeder seiner Bewegungen. Das Angebot war tatsächlich verlockend, ja es war ein Rettungsanker. Doch etwas ließ Tibald stutzig werden.
»Hier steht wortwörtlich, ich werde für die Dauer meiner Regentschaft nichts von Euch hören, alles schön und gut. Aber was ist danach? Zwar habe ich nicht die Absicht, jung zu sterben, aber als König muss man mit allem rechnen. Wie verhält es sich mit meinem Nachfolger?«
Tibald benutzte die männliche Form des Wortes, da Miriam nun nicht mehr infrage kam und Madeleines Pendel ihm drei Söhne prophezeit hatte.
»Ich werde zu gegebener Zeit mit Eurem Nachfolger über die Rückzahlung verhandeln, Hoheit.«
»Herr von Höll, Ihr werdet wohl verstehen, dass ich meine künftigen Kinder nicht in eine solche Lage bringen möchte. Ich brauche eine zusätzliche Garantie. Ich möchte die Rückzahlung auf die übernächste Generation verschieben. Nur als reine Vorsichtsmaßnahme, denn wie Ihr ja schon bemerkt habt, bin ich niemand, der gerne Schulden ansammelt.«
Von Höll dachte einen Moment lang nach und ließ seine scharfen kleinen Augen durch den Saal wandern. Wenn der König sein Wort nicht hielt, würde er sein Geld nie wiedersehen. Überraschenderweise ging er jedoch auf den Vorschlag ein.
»Einverstanden, Hoheit. Schreiben wir den Vertrag entsprechend um.«
Von Höll ging niemals irgendwohin, ohne das Zubehör für Vertragsänderungen griffbereit zu haben. Er musste nur mit den Fingern schnippen, und ein Lakai brachte ihm die Schreibgarnitur, die er am Eingang zurückgelassen hatte.
»Gut«, sagte Tibald, als er die endgültige Version in der Hand hatte. »Ich berate mich mit meinen Leuten und denke über Euer Angebot nach. Ihr erhaltet bald meine Antwort.«
Zufrieden zog sich der Bankier zurück. Noch am selben Abend rief Tibald Ema, Willem und den Schatzkanzler bei sich zusammen, um mit ihnen den Text genau zu prüfen. Nachdem eine Weile verstrichen war, rieb sich der Schatzkanzler die spitze Nase und rang sich ein seltenes Lächeln ab.
»Da ist alles in Ordnung, Hoheit. Alles in bester Ordnung. Weder Rückzahlung noch Zinsen werden gefordert, solange Ihr oder eines Eurer Kinder auf dem Thron sitzt, das steht hier schwarz auf weiß. Ihr seid jung und gesund, uns bleibt also genügend Zeit. Wenn ich es recht sehe, investiert Herr von Höll hier in die wirtschaftliche Stabilität des Landes, was durchaus in seinem Interesse liegt. Er streckt eine beträchtliche Summe vor, die ausreichen sollte, um Eckstein wieder flottzumachen. Mit ein wenig Haushaltsdisziplin habt Ihr die Schulden in fünfundzwanzig bis dreißig Jahren beglichen. Im Moment sind wir im Minus, Hoheit, wie ich Euch ja schon vorausgesagt hatte. Ihr müsst notgedrungen ein Darlehen annehmen. Wenn es aus dem Ausland kommt, bringt Ihr Ecksteins Neutralität in Gefahr. Kommt es von einem Eurer Untertanen, müssen wir erstens Zinsen zahlen, zweitens gelangt dadurch übermäßiger Reichtum in die Hände eines Einzelnen, was dem Gesetz widerspricht. Herrn von Hölls Angebot erlaubt Euch, diese beiden Klippen zu umschiffen: Ecksteins Neutralität ist gesichert, und er wird sich nicht persönlich bereichern. Ich würde sagen, er kommt gerade richtig, Hoheit. Der Himmel schickt ihn uns. Ihr müsst nur noch den Ältestenrat überzeugen.«
Willem Schöne fuhr sich nachdenklich mit den Fingern durch sein ungeordnetes Haar, was allerdings nicht viel daran änderte, dass seine ganze Erscheinung infolge seiner Nächte mit Elisabeth ziemlich zerknautscht war. Er war geneigt, dem Kanzler zuzustimmen. Ema hingegen hatte ihre Zweifel, dass jemand, der von Höll hieß, vom Himmel geschickt worden sein konnte. Aber da Tibald wusste, dass sie von Natur aus misstrauisch war, schenkte er ihren Zweifeln nicht allzu viel Gewicht. Stattdessen spitzte er seine Feder, um seinen Ratgeberinnen zu schreiben.
Sobald jedoch die anderen den Raum verlassen hatten, betrachtete er traurig die Decke. Das Fresko von der guten Regierung war immer noch da, auch wenn bei dem Erdbeben alle Figuren abgefallen waren. Tibald blickte oft zu der beschädigten Decke hinauf. Woraus bestand letztlich eine gute Regierung? Aus Kompromissen.
In den folgenden Tagen arbeitete er unermüdlich. Doch oft hielt er zwischendurch inne und blickte gedankenverloren auf die Reste der Trompe-l’Œil-Malerei. Wenn Manfred den König so reglos dasitzen sah, brachte er ihm in Erinnerung, dass es an der Zeit sei, seine Büste in Bronze gießen zu lassen.
»Ach nein, bloß nicht. Nicht jetzt.«
Der Kammerherr zog sich zurück, der König arbeitete, die Zeit verging.
Die Zeit vergeht immer.
5
Lysander hasste die Schule, unwiderruflich. Er konnte tun, was er wollte, immer fiel er auf. Entweder er kam zu früh oder zu spät, er antwortete zu schnell oder zu langsam, mit zu kurzen oder zu langen Sätzen, zu laut oder zu leise. Nachdem er im Juni dreizehn geworden war, wuchs er, der immer sehr klein gewesen war, auf einmal viel zu schnell. Das Ergebnis waren lange spillerige Arme und Stelzenbeine und hohle Wangen in einem zu langen Gesicht.
Baptist, der Metzgersohn, ließ ihn keine Sekunde in Frieden. Er dachte sich unzählige Arten aus, ihn zu piesacken. Mit der Zeit war, wie es oft zwischen Feinden geschieht, etwas wie eine Verbindung zwischen ihnen entstanden. Sie kamen sich ungewollt nahe, wie eines Tages eine erstaunliche Begebenheit bewies. Es passierte in der Pause, jenem Moment der Entspannung, in dem Lysander immer besonders unentspannt war. Weil es am Vortag geregnet hatte, war es auf dem Schulhof zu matschig, um Ball zu spielen. Baptist langweilte sich also, und für Lysander gab es nichts Schlimmeres, als wenn Baptist sich langweilte. Bevor er sich verdrücken konnte, hatte der Metzgersohn ihn auch schon Bauch voran in eine Wasserpfütze gedrückt. Lavendel, Manfreds Tochter, lief schnell los, um den Lehrer zu informieren, auch wenn sie sich keine großen Hoffnungen machte: Er würde ihr nur wieder sagen, dass ihn das Geschehen außerhalb des Klassenzimmers nichts angehe. Die anderen Schüler, die sich ebenfalls langweilten, versammelten sich bereits um die Pfütze, in vorderster Reihe Emilia. Aus solchen Situationen hielt sie sich inzwischen heraus – ihr Hauptzeitvertreib bestand darin, den Jungen zu gefallen, und Lysander gehörte nicht in diese Kategorie.
Mit der Nase im Schlamm dachte Lysander, dass dies nur ein unangenehmer Moment war, den er eben hinter sich bringen musste. Danach würde ein weiterer unangenehmer Moment kommen: Rohrstockschläge vom Lehrer wegen der besudelten Kleidung. Der einzige Trost war, dass auch Baptist schmutzig sein würde. Lysander begann, mit der flachen Hand auf die Pfütze zu schlagen, und da wurde dem schlammbespritzten Baptist bewusst, dass er ebenfalls Prügel riskierte. Erst vom Lehrer, und dann von seinem Vater. Doppelte Dresche. Besser, ich lasse Lyssi los, dachte er, sonst geht das übel aus …
»Sehr übel«, bestätigte Lysander mit halb erstickter Stimme.
Baptist presste sich mit seinem ganzen Gewicht auf ihn.
»Wovon redest du, Lyssi?«
»Von den zwei Abreibungen, die du kriegst.«
Baptist erschrak. Er stützte sich auf den ohnehin schon platten Lysander, richtete sich schnell auf und wischte seine Hände an der Hose ab (die schon Wurstflecken hatte). Lavendel, die eben dazugekommen war, glaubte ihren Ohren nicht zu trauen. Hatte Lysander gerade Baptists Gedanken gehört? Doch bevor sie dem genauer nachgehen konnte, richtete der Metzgersohn seine Sticheleien nun gegen sie.
»Na, Püppi, spielst du wieder die großmütige Helferin?«
Lavendel kniff die Lippen zusammen, um ihm nur ja keine Antwort zu geben. Baptist zu antworten war, wie in einem bodenlosen Sumpf zu versinken. Er hatte es sowieso schon geschafft, die anderen Mädchen gegen sie aufzuhetzen, und so verbrachte sie die meiste Zeit der Pause damit, die Katze zu streicheln, die auf dem Hof umherstrich. Zum Glück klingelte jetzt die Glocke zum Pausenschluss.
Statt ins Klassenzimmer zurückzukehren, ging Lysander zum Brunnen, um sich sauber zu machen. So würde er zwar zu spät kommen, aber da ihn sowieso eine Strafe erwartete, konnte er sie genauso gut in properer Erscheinung über sich ergehen lassen. Nachdem er sich das Gesicht frisch gemacht hatte, stellte er fest, dass auch Lavendel draußen geblieben war, um auf ihn zu warten.
»Lysander …«
Er ging geradewegs an ihr vorbei.
»Lysander, kannst du die Gedanken von Baptist hören?«
Lysander blieb stehen. Er wischte sich das nasse Gesicht mit dem noch nasseren Ärmel ab.
»Ich? Nein, warum?«
»Du hast ihm geantwortet, obwohl er nichts zu dir gesagt hat. Darauf hat er dich plötzlich losgelassen. Kannst du uns denken hören?«
Lysander sah selbst überrascht aus. Er hörte die Gedanken von Epinal und Jaspis, und er konnte leicht erraten, was Blasius ihm sagen wollte. Aber ansonsten fand er die Menschen eher undurchschaubar.
»Nein«, sagte er und ging weiter.
»Lysander, hör doch …«, drängte Lavendel und hielt seinen Arm fest. »Du hast eine Gabe. Die musst du nutzen.«
Nun sah er Lavendel aufmerksamer an. Ihre Augen waren wie Kornblumen, rund und von einem eigenartigen Blau, das ins Lila spielte. Es war seltsam, dass sich jemand für ihn interessierte, noch dazu ein Mädchen. Es machte ihn schrecklich verlegen. Lavendel senkte den Kopf, auch sie war jetzt verlegen. Sie fürchtete, er könnte ihre Gedanken lesen. Aber Lysander zuckte nur mit den Schultern, entwand ihr seinen Arm und ging stoisch zum Klassenzimmer, den Rohrstockschlägen entgegen.
Ein paar Tage lang ließ Baptist ihn in Ruhe, bevor er eines Nachmittags Mitte Oktober wieder rückfällig wurde. Lysander, der oft als Letzter das Schulhaus verließ, um Rempeleien zu entgehen, nahm sich Zeit, sein Tintenfass einzuräumen, seine Schreibfeder zu trocknen und seinen Ranzen zu füllen. Erst spät bemerkte er, dass das Wichtigste fehlte: ein illustrierter Atlas, den jeder Schüler abwechselnd für einen Abend mit nach Hause nehmen musste, um daheim nicht nur die Lage der Nördlichen Gebiete, sondern gleich aller bekannten Weltregionen auswendig zu lernen. Die Jungen oder Mädchen verbrachten meist die ganze Nacht damit, so viele Seiten wie möglich abzuzeichnen, und diesmal war Lysander an der Reihe. Der kostbare Band hatte während des ganzen Schultags vor ihm gelegen. Nun war er verschwunden. Lysander suchte in jedem Winkel des Klassenzimmers, öffnete alle Pulte und verschob alle Stühle, bis er es schließlich aufgab und bedrückt hinausging.
Draußen war die Luft mild. Lysander stieg über die Katze hinweg, die zu dieser Zeit gern auf dem Schulhof in der Sonne lag. Er hörte auch sie denken, schenkte ihr jedoch keine Beachtung, weil er soeben den Atlas auf der anderen Seite des Hofes entdeckt hatte. Baptist lehnte dort an einem Baumstamm und blätterte lässig darin, obwohl er durch die blonde Matte, die ihm in die Augen fiel, kaum etwas sehen konnte.
»He, Spargel! Suchst du irgendwas?«
Das Buch baumelte gefährlich tief zwischen seinen dicken roten Fingern. Wenn es beschädigt wurde, würde es eine besonders große Strafe geben. Lysander beschloss trotzdem seiner Wege zu gehen. Allerdings hatte er nicht mit Florian gerechnet, der ihn jetzt Richtung Baum schubste. Lysander stieß ihn mit seinem Ellbogen weg und betete, dass nur ja nicht Felix auftauchte und dazwischenging.
»Seit wann kannst du lesen?«, rief er Baptist zu.
»Seit wann kannst du lesen?«, äffte der ihn nach. »Ich lese besser als du, Lyssi.«
Die üblichen Verdächtigen versammelten sich um sie.
»Gib das Buch her.«
Baptist grinste breit.
»Hol’s dir.«
Er ließ den Atlas fallen. Beim Aufprall auf den Boden verknickten die Seiten unter dem Gewicht des Einbands. Selbst Florian riss staunend den Mund auf. Der illustrierte Atlas … Lysander bückte sich, um ihn aufzuheben, und bekam einen Tritt in den Bauch. Die Luft blieb ihm weg, und er sackte auf die Seite, wo er sich zusammenrollte und, das Buch vor seinen Kopf haltend, weitere Tritte abwartete. Durch die Pappe hindurch konnte er fühlen, dass aller Blicke auf ihn gerichtet waren. Wieder einmal war es die schlimmste Erniedrigung. Wieder einmal war er buchstäblich am Boden. Immerhin einen Vorteil hatte es: Er konnte nicht mehr tiefer sinken.
»Ich gehe und hole den Metzger!«, schrie Lavendel und lief los.
»Pah, verschwindel, Lawindel!«, erwiderte Florian automatisch.
Lysander wartete immer noch hinter dem Buch ab, doch die Tritte blieben aus. Baptist schien plötzlich Angst bekommen zu haben, und mit Grund: Wie viele kleine Menschen lief Lavendel besonders schnell, und die Schläge des Metzgers waren nicht von Pappe. Mit den Händen in den Hosentaschen verzog sich Baptist. Als Lysander sich endlich aufrappelte, lag der Hof verlassen da. Er wagte nicht, die Schäden des Atlas zu begutachten, und steckte ihn direkt in den Ranzen. Seine Rippen taten ihm weh, aber wenigstens war Felix nicht aufgekreuzt.
Um sich ein wenig aufzumuntern, dachte er an Jaspis. Im Grunde war sie alles, was ihm blieb.
Er ging nach Hause, in sein Zimmer, wo er alles vergessen konnte. Das Turmfalkenweibchen hatte nämlich trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit oben auf dem Schrank überraschend Eier ausgebrütet. Ihre vier Falkenjungen waren perfekte kleine Geschöpfe. In einigen Wochen würden sie flügge werden und davonfliegen, falls sie nicht lieber den Winter auf dem Schloss verbrachten. Lysander würde nicht versuchen sie aufzuhalten, hoffte aber, dass sie bleiben würden. So lange ließ er sein Fenster immer offen stehen, damit Jaspis ungehindert jagen und ihre Brut versorgen konnte.
Felix teilte seine Begeisterung nicht. Er beschwerte sich über das schrille Vogelgepiepse, den strengen Geruch und die vielen Halme auf dem Teppich. Er jammerte über die harten Schwielen, die Jaspis’ Krallen auf Lysanders Handgelenk hinterlassen hatten. Vor allem aber sah er nicht gern, wie schnell die kleinen Falken groß wurden. Ehe man sich’s versah, würden sie ausgewachsen sein – eine unerträgliche Parallele. Denn auch Lysander veränderte sich. Er wuchs so schnell, wurde ein richtiger Schlaks. Wenn es nach dem Jungen ginge, brauchte er keinen Kammerdiener und erst recht keinen Aufpasser mehr. Der schrankgroße Rudergänger versuchte sich also möglichst unauffällig und klein zu machen, wenn er ihm von fern folgte, aber in seinem tiefsten Innern wünschte er sich, ihn sein Leben lang zu beglucken.
In der Hoffnung, die Vogelbrut ein bisschen schneller loszuwerden, suchte Felix die Unterstützung von Jaspis’ Erzfeind: dem Taubenzüchter, der Raubvögel hasste und tagtäglich die Sorge hegte, sein Taubenturm könnte Schauplatz eines Blutbads werden. Felix bestärkte ihn darin, beim König vorzusprechen, um sich über die Turmfalkenbrut zu beschweren. Der Taubenzüchter bereitete sich so gewissenhaft auf die Audienz vor, dass er die ganze Nacht davor nicht schlafen konnte. Seine Bemühungen blieben jedoch vergebens: Er erntete bei Tibald lediglich ein Schulterzucken.
6
Das gleiche Schulterzucken erntete eines Morgens der Botschaf- ter von Siries, der vorsprach, um für ein exklusives Bündnis zwischen Eckstein und seinem Land zu werben. Tibald ließ sich müde dazu herab, ihm eine doppelte Portion Gemüsesuppe anzubieten. Er hatte genug von Politik und Protokoll, wollte lieber den Wind spüren als Konversation machen. Die Audienzen schlauchten ihn, er fühlte sich vom Zepter an den Thron genagelt, vom Hermelinpelz völlig weich gekocht. Und sobald er den Botschafter losgeworden war, eilte er zurück zu seinem Arbeitszimmer. Er wollte nur noch allein sein, höchstens Emas Hand halten.
Aber daraus wurde nichts, denn vor seiner Tür wartete ungeduldig eine unangemeldete Besucherin. Sie war ihres Zeichens Wirtin eines Gasthofs in der Nördlichen Hochebene, hatte einen grauen Haarknoten, eine Büste, auf der man ein Tablett hätte abstellen können, und war eigens angereist, um mit dem König zu sprechen, ohne erst ein Audienzgesuch einzugeben. Hinter ihr machte Willem Schöne ein paar verzweifelte Gesten. Es handelte sich nämlich um seine Tante Babsi, der noch keiner je etwas hatte abschlagen können. Hinter Willem stand der Kammerherr und machte angesichts der aufdringlichen Dame ein empörtes Gesicht. Aber Tibald hatte schon kapituliert.
»Kommt herein, gute Frau. Mit wem habe ich die Ehre?«, fragte er und bot ihr einen Platz an.
»Barbara Barber, Eure Majestät.«
Ganz gegen seinen Willen musste Tibald lachen.
»Entschuldigt bitte, aber heißt Ihr wirklich so?«
»Ihr könnt mich einfach Babsi nennen, Hoheit, Eure Herrlichkeit, danke schön.«
Tibald machte eine subtile Bewegung mit zwei Fingern, die Manfred sofort verstand, da die beiden sich inzwischen über bloße Zeichen verständigten. Es bedeutete: Tee, Plätzchen – und vor allem keinen weiteren Besuch. Der Kammerherr verneigte sich und verschwand geräuschlos.
»Holla, Eure Majestät, in dieses Zimmer hier würde ja mein ganzer Gasthof reinpassen …«
Babsi drehte sich eifrig um sich selbst, damit ihr nur ja kein Detail des Raumes entging. Sie hatte für ihren Besuch extra Kleider in den königlichen Farben gewählt, weshalb sie fast mit dem Hintergrund verschmolz. Ihr war ganz schwindelig, als sie endlich zum Stuhl taumelte, den ihr der König immer noch darbot.
»Aber ich bin natürlich nicht wegen der hübschen Ausstattung hier, Eure Erhabenheit«, erklärte sie, während sie sich schwer niederließ. »Ich habe Euch etwas zu sagen, was nicht länger warten kann. Etwas, was mir keine liebe Ruhe lässt.«
Sie warf einen Blick auf Willem, der ein wenig abseits stand. Sie hatte zwar seine Hilfe benötigt, um bis zum König vorzudringen, war sich jetzt aber unsicher, ob sie in seinem Beisein reden sollte.
»Sprecht weiter«, ermunterte Tibald sie.
»Nun, Hoheit, es geht um Rosemarie. Rosemarie, die fabelhafte Pianistin, meine beste Freundin und nicht zuletzt Eure Ratgeberin. Sie wäre ja selbst zu Euch gekommen, aber das Reisen strengt sie an, und darum seht Ihr nun mich hier vor Euch sitzen.«
Babsi zog ihre roten Handschuhe aus und patschte sich damit in die Hand.
»Rosemarie wie gesagt. In dieser Woche wurde drei Mal bei ihr eingebrochen.« Jede Silbe mit einem Schlag ihrer Handschuhe unterstreichend wiederholte sie: »Drei Mal.«
Und plötzlich wurde sie auf Tibalds Haare aufmerksam.
»Ach, du liebes bisschen, Hoheit, Ihr seid ja ganz weiß! Wie ist das denn möglich? Letztes Jahr im Palais Justizia wart Ihr noch blond wie sonst was, und heute Morgen seid Ihr weiß – schneeweiß! Ist das denn möglich?«
»Es ist möglich.«
Die Wirtin bewegte ihre Lippen tonlos wie ein Fisch.
»Mein Friseur hat auch so reagiert wie Ihr«, versicherte ihr Tibald. »Aber Ihr spracht von Rosemarie?«
»Ja, Hoheit … Rosemarie. Letzte Woche fehlten ein paar Dinge in ihrem Haus. Sie hat es nicht gleich bemerkt. Freilich, einem Sehenden wäre es sofort ins Auge gesprungen, aber nicht einer Blinden. Es war nichts furchtbar Wichtiges oder Wertvolles: eine Spieldose, Noten, ein Metronom. Aber dennoch: Jemand war in ihr Haus eingedrungen. Nur wie? Weiß der Kuckuck. Es gab keine Einbruchsspuren, die Tür war ordentlich verriegelt und so weiter. Allein das ist doch seltsam, nicht wahr, Hoheit?«
»Hat Rosemarie einen Verdacht?«
»Sie sagt, sie hätte nicht die leiseste Ahnung, Hoheit.«
Schnell wie eine kleine Brise war Manfred da und im selben Moment wieder weg. Babsi tauchte ein Plätzchen in ihren Tee und erzählte weiter:
»Zwei Tage später, oder besser gesagt zwei Nächte später, ist Rosemarie aus dem Schlaf hochgeschreckt. Weil sie ja nichts sehen kann, hat sie ein sehr feines Ohr, und sie konnte hören, dass da jemand in ihrem Haus ist. Sie ist ganz leise aufgestanden und hat sich vor die Haustür gestellt, denn nur durch die konnte derjenige ja hinaus. Das war ungeheuer mutig von ihr, findet Ihr nicht, Eure Herrlichkeit? Versteht Ihr, sie kann sich im Dunkeln so gut bewegen wie wir im Licht. ›Wer ist da?‹, hat sie gerufen, und darauf war’s wieder ganz still. Keiner mehr da.«
Behaglich lehnte Babsi sich in ihrem Stuhl zurück. Sie hatte eine Schwäche für Knalleffekte und genoss die Wirkung, die ihre Worte hervorgerufen hatten. Dann blickte sie bestürzt drein, weil sich das Plätzchen auf dem Grund der Teetasse aufgelöst hatte.
»Ihr habt von drei Einbrüchen gesprochen?«, hakte Tibald nach.
»O ja. Das dritte Mal, Hoheit, war erst gestern Morgen. Rosemarie ist wie jeden Dienstag auf den Markt gegangen, und als sie zurückkam, war ihr Klavier hinüber.«
Tibald seufzte tief, stand auf und wanderte durchs Zimmer.
»Was die wohl bei ihr suchen?«
Babsi verdrehte ihren Hals, um ihm mit dem Blick zu folgen.
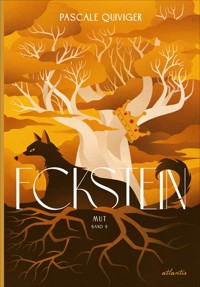
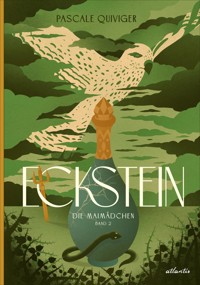
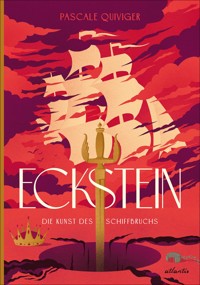













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












