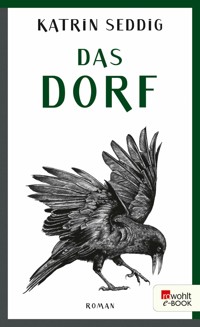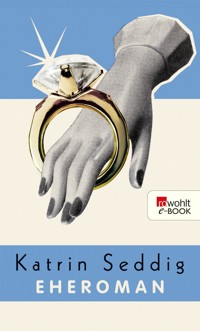
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ava Grünebach war schon immer ein bisschen anders. Sie hat einen verrückten Vornamen, nur fast normale Eltern, und sie hat Danilo, der sich schon mit zwölf in sie verliebt und mit sechzehn bei ihr einzieht – Danilo, der Avas Leben zu etwas Besonderem macht, weil er eine Art Prinz ist, obwohl er eigentlich bloß aus Kroatien stammt. Die beiden heiraten, still und für sich, aber bald werden sie der grausamsten aller Liebesproben unterzogen: dem Alltag. Danilo studiert, Ava arbeitet viel, als Krankenschwester wie als Mutter. Die Gespräche werden karger, die Freunde unterschiedlicher, doch Ava will mehr vom Leben: Sie findet es bei einem hübschen Fernfahrer, auf fremden Partys, bei ihrer ausgeflippten Freundin Merve, die immer stärker als «das Miese» sein will. Und langsam, im Lauf der Jahre, wird Ava unsicher, ob Danilo wirklich das Beste ist, was ihr passieren konnte … In «Eheroman» greift Katrin Seddig mitten hinein ins Leben und holt das Schönste, Traurigste und Großartigste heraus. Ein Roman über die Sehnsucht, den Zweifel und alles dazwischen, drastisch, sinnlich und voller tragikomischem Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Katrin Seddig
Eheroman
Über dieses Buch
Ava Grünebach war schon immer ein bisschen anders. Sie hat einen verrückten Vornamen, nur fast normale Eltern, und sie hat Danilo, der sich schon mit zwölf in sie verliebt und mit sechzehn bei ihr einzieht – Danilo, der Avas Leben zu etwas Besonderem macht, weil er eine Art Prinz ist, obwohl er eigentlich bloß aus Kroatien stammt. Die beiden heiraten, still und für sich, aber bald werden sie der grausamsten aller Liebesproben unterzogen: dem Alltag. Danilo studiert, Ava arbeitet viel, als Krankenschwester wie als Mutter. Die Gespräche werden karger, die Freunde unterschiedlicher, doch Ava will mehr vom Leben: Sie findet es bei einem hübschen Fernfahrer, auf fremden Partys, bei ihrer ausgeflippten Freundin Merve, die immer stärker als «das Miese» sein will. Und langsam, im Lauf der Jahre, wird Ava unsicher, ob Danilo wirklich das Beste ist, was ihr passieren konnte …
In «Eheroman» greift Katrin Seddig mitten hinein ins Leben und holt das Schönste, Traurigste und Großartigste heraus. Ein Roman über die Sehnsucht, den Zweifel und alles dazwischen, drastisch, sinnlich und voller tragikomischem Humor.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
(Umschlagabbildung: CSA Plastock/Getty Images)
ISBN 978-3-644-11151-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Vierter Teil
Fünfter Teil
Epilog
Für meine Schwester Anke
Erster Teil
Die kleine weiße Flamme zittert, flackert, vom scharfen Wind auf den Boden gedrückt, und verlischt dunkel qualmend.
«Mann, Mann, Mann», kichert der alte Biese in seinem Rollstuhl und schüttelt seinen eingefallenen Schädel mit der grün-weißen Werder-Bremen-Mütze.
«Halt die Fresse», antwortet der Schweinebauer und schraubt eine Flasche auf.
«Muss dat sein?»
«Du sollst die Fresse halten!»
Der Schweinebauer tränkt das Stroh mit dem Inhalt der Flasche, und sein Sohn Jörgi hält ein Feuerzeug dran, es flammt sofort hoch, Jörgi weicht zurück, alle weichen zurück, die Flamme greift auf die kleinen Zweige über, das Holz zischt und knattert, Rauch wächst schwarzfädrig in den dunklen Himmel, die nebligen Nächte haben das Holz feucht gemacht, aber wütend knallend brennt es nun an. Zögernd wird geklatscht. «Feuer», ruft mit hoher Stimme der alte Biese, der in eine mit Pferden bedruckte Decke gewickelt ist. Er hält die zitternden Hände über den Kopf, sieht zu Jörgi hoch, kichert und lässt die Hände langsam wieder auf seinen Schoß sinken.
Jörgi ist mit Ava zur Schule gegangen. Er saß kurzsichtig in den vorderen Bänken, das bebrillte Gesicht nach vorne gereckt, immer unruhig auf dem Stuhl hin und her rutschend, immer schnell am Weinen – Heul doch, heul doch, Jörgi! –, später weinte er dann weniger, er bekam Kontaktlinsen, eine kleine Honda und den passenden Führerschein. Die Schule wurde ihm egal, denn er wusste plötzlich, dass sie vorbeigehen und er Landwirt werden würde. Er redete viel vom Ferkelmarkt, von Futterpreisen und von Maschinen, die er später anschaffen wollte, und er wurde ruhiger, auf seiner vorderen Bank. Seine Oberarme wurden braun und hart, und nach der zehnten Klasse, die sich für ihn quälend hinzog, verließ er froh in die Zukunft blickend die Schule. Auf dem Schweinebauernhof gab es dann eine Party mit Bier vom Fass und scharf eingelegtem Grillfleisch aus einer Plastikbabywanne. Ava war auch dort gewesen. Sie hatte sich die Ferkel in den Ställen angesehen, kleine blasse Schnitzel, aneinandergequetscht und nummeriert, alles dunkel und schmatzend, wie Produktion, wie ewige, ewige Produktion. In den grauen Gängen Beton und Urin, Jörgi munter redend, das Bier in der Hand, mit dem Fuß nach dem Hintern eines Schweines tretend, das im Weg war, als er eine der Türen öffnen wollte, die metallisch die Ställchen verschlossen. «Da, das ist die Kannibalensau, die hat die anderen immer angefressen. Die hat ihre eigenen Ferkel angefressen. Bekloppte hast du immer, wie bei Menschen. Aber schmecken alle gleich.»
Hinter den Ställen und den kleinen quadratischen Siedlungshäusern an der Hauptstraße liegt das Ackerland der Familie, ein schmales, langgestrecktes Rübenfeld, daneben Kartoffeln, dann Mais. Im Mais hinter den Ställen lagen manchmal welche und knutschten oder bumsten sogar. Das erzählte Jörgi mal, wie sein Vater im Mais die bumsenden Verheirateten aufgescheucht hatte. Die nicht miteinander verheiratet waren, sondern jeweils mit jemand anderem. «Gibt doch Hotels. Müsst doch nicht bei mir im Mais. Schämt euch doch! Geile Böcke! Und zertrampelt mir alles.»
Vor einigen Tagen hat Jörgi mit dem Trecker die Scheuneneinfahrt auf dem Hof seines Vaters angefahren, und es ist ein langer schräger Riss in der Wand entstanden. Sabine erzählte, wie es war, sie hat, während es geschah, beim Jörgi im Trecker auf dem hüpfenden Schoß gesessen. Der Schweinebauer kam angerannt, stieg hoch auf den Trecker, riss den Jörgi samt der Sabine herunter, als würde das noch was bringen, den Jörgi vom Trecker zu reißen. Sabine rutschte und fiel in den schillernd schwarzen Modder der Treckerspuren – die neue Wrangler –, Jörgis Arm hing noch in der Hand seines Vaters, und sein Schultergelenk verdrehte sich knirschend. Er schrie, der Vater ließ ihn los, aber nur, um auf den quietschenden Jörgi einzuschlagen. Er drosch auf ihn rauf, als wäre er ein Schwein, als wäre er eine alte Sau, die nicht in den Stall rennt, die nicht schnell genug in den Schweinetransporter rennt, der sie zum Schlachthof bringt. Sabine rannte zur Telefonzelle an der Straße und rief die Polizei an: «Sein Vater schlägt auf den Jörg Petzow ein, der schlägt ihn tot, oder er schlägt ihm Organe kaputt», und heulte wild am Telefon. Die Polizei fragte nach, sie wollten Genaueres wissen, ob er ihn jetzt immer noch schlage, ob der Jörgi bewusstlos sei oder ebenfalls wegrennen könne, wenn er wollte, und ob der Vater vom Jörgi eine Waffe hätte oder einen Gegenstand, mit dem er ihn schlage. Der Vater vom Jörgi hatte sich mittlerweile seine Wut ausgehauen, der Jörgi schrie weiter wegen des ausgedrehten Arms und allem, der Vater stand nur da, keuchend und japsend mit glühend rotem Gesicht, und Sabine legte die Polizei einfach auf, weil sie kein gutes Gefühl mehr dabei hatte.
Jörgi verzieh ihr nicht, dass sie seinen Vater bei der Polizei hatte anzeigen wollen. Er machte gleich, nachdem der Arzt die Schulter eingerenkt hatte, mit ihr Schluss.
«Am Ende bin ich immer die Doofe», sagt Sabine, «immer ich.»
«Die sind hier alle so», sagt Ava. «Da kannst du nur die Doofe sein, das liegt nicht an dir, das liegt an denen.»
Sabine zuckt mit den Schultern. «Das hat doch nichts mit hier zu tun.»
«Doch. Hier sind alle wie …», Ava starrt auf den Deich, auf die Schwärze unten an der Elbe, auf die Silhouette ferner Industriebauten, «wie die Landschaft.»
Der Schweinebauer hat Jörgi dann als Wiedergutmachung das Feuer anzünden lassen. Beide, der Schweinebauer wie der Jörgi, sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
Der Schweinebauer ist ein Wichtiger hier, er hat eine preisgekrönte Sau, von der viele ein Ferkel wollen, und er hat zwei Windräder an der Nordsee. Das alles wird nun Jörgis Leben. Jörgis Leben ist kein großes Rätsel mehr.
Der steht immer noch ganz vorn, mit seinen hellen, verschwitzten Haaren, die Strickmütze in die Hosentasche gestopft, das Gesicht rotfleckig, das Feuerzeug in der Hand, ein Bier in der anderen, immer wieder kichert er hektisch und zieht dabei den Kopf zwischen die Schultern. Er steht in der Mitte von allem. Im glühenden Kern des Universums.
Die Welt ist so riesig, das Leben so unergründlich und der Tod noch mächtiger. Ava hebt den Kopf und betrachtet den Himmel. Die Sterne sind kaum zu sehen, dicke Fladen von schnell ziehenden Wolken verdecken sie. Der rasende, rasende Zug der Wolken, sie starrt nach oben und schwankt und greift nach der nächsten Schulter.
«Ist da was?», fragt Sabine und starrt in den Himmel, mit ihren runden, wässrigen Augen.
«Die Wolken ziehen so irre schnell dahin, so schnell, so rasend irre, wie dein Leben. Und jetzt ist es schon wieder vorbei. Jetzt bist du eine andere, und morgen bist du tot.»
«Ava, du bist immer so bescheuert.»
«Sieh doch mal hoch, sieh dir das an, dann merkst du, wie das alles rast.»
Sabine starrt mit tränenden Augen blinzelnd in den Himmel. «Schon irgendwie verrückt alles.»
«Siehst du», sagt Ava, «und morgen sind wir tot.»
«Ava, ich bin morgen nicht tot.»
«Nein. Du stirbst nicht. Für dich macht das Universum eine Ausnahme.»
«Ich will überhaupt nicht an so was denken, mit Tod und Universum. Immer erzählst du so was und versaust mir die Stimmung.»
Ava wiegt den Kopf hin und her und reibt sich den Körper warm und sagt: «Hol doch mal einer Bier.»
«Wo willst du denn Bier herkriegen?», fragt Jennifer, «und … meine Mutter ist hier, deine auch, alle sind hier, da kannst du doch nicht saufen, Mann.» Sie spuckt auf die Erde und häufelt mit dem Schuh Erde auf die Spucke.
«Bier gibt es bei Jörgi», sagt Sabine, «die haben fünf Kisten Beck’s, ich hol uns was. Er soll mal was sagen. Soll er mal tun. Er soll mal ein Wort sagen, wenn ich die Biere hol.»
Jörgi steht bei seinen Freunden, Markus, Thomas und Matthias. Sie haben die ganze Nacht mit Cola und dem Rottweiler Rambo auf dem Deich gehockt und den Holzhaufen bewacht, damit die Assis vom Nachbardorf nicht wieder kommen und ihn vorzeitig abbrennen. Das war vor zwei Jahren so, anschließend gab es endlose Schlägereien, Ivo Specker ist mit dem Moped gegen Annemarie Hegbloom gefahren, und sie musste ihre Ausbildung als Groß- und Einzelhandelskauffrau um ein Jahr verschieben, weil sie nicht laufen konnte.
Sabine spricht drüben mit Jörgi, die Biere an ihre Brust gedrückt, Jörgi starrt sie an. Er nickt langsam, dann sagt er etwas, Sabine sagt etwas, er rückt näher, sie lacht, er lacht, er tritt von einem Bein auf das andere, sieht verlegen auf die Erde, blickt dann hoch und legt plötzlich seinen traurigen roten Kopf an ihre Schulter.
«Der is schon besoffen», sagt Jennifer.
Ava nickt.
«Ich glaub, ist doch nicht Schluss.»
«Nein», sagt Ava, «es geht immer so weiter, weil sie nicht begreift, dass sich immer nur alles wiederholen wird, alles, und sie wird immer wieder in derselben Scheiße landen, weil sie einfach nicht begreift, wie es hier ist mit den Leuten, wenn sie dableibt. Mann, es ist doch traurig alles!»
«Mit welchen Leuten? Meinst du uns? Du bist doch hier bei uns dabei, Ava, du bist doch auch von uns?»
Ava starrt auf das wachsende Feuer, fest in ihre rosa Kapuzenjacke gehüllt, verkrampft zitternd, denn es ist kalt auf dem Deich.
«Ich geh weg. Ich heirate keinen von hier und füttere keine Schweine und auch keine Gören. Auf gar keinen Fall krieg ich Gören.»
«Keine Kinder? Nie?»
«Nie.»
«Das glaube ich nicht. Du spinnst doch immer nur. Du spinnst ein bisschen wie dein Vater … Sorry. War nicht so gemeint.»
«Ich spinn ein bisschen anders als mein Vater, ich spinn konkret. Ich habe Pläne. Ich sitze nicht rum und nerve andere Leute, wie der. Ist das klar?»
«Schrei doch nicht so!»
«Hättest du doch den Anorak genommen, Ava», ruft die Mutter von der Seite. Sie selbst ist in einen riesigen, auf dem Rücken mit einem silbernen Elefanten bestickten, hellblauen Steppmantel gehüllt. Auf dem fetten Berg von Körper sitzt das liebe Gesicht der Mutter wie ein reifes Früchtchen, von wilden rotbraunen Locken umwachsen.
«Wenn ich die Locken nicht gehabt hätte, dann wär auch alles anders gekommen», sagt die Mutter manchmal wütend, beim Kämmen vor dem Badezimmerspiegel, und meint damit, dass die Locken der einzige Grund gewesen seien, weshalb der Vater sie genommen hat. Ava weiß nicht genau, ob die Mutter das gern hätte, dass alles anders gekommen wäre, oder ob sie nun froh darüber ist, wie es ist. Sie weiß es selbst wohl nicht so genau. Der Vater meint dazu, wichtiger als die Locken wären die Brüste gewesen. Die Mutter ist schon dick gewesen, als sich die beiden kennenlernten. Nur ist sie später, nach Petras und Avas Geburt, noch dicker geworden. Ihre Brüste ebenso, ihre Brüste sind riesige, elastische Berge, für die der Vater sich immer noch begeistern kann. Er vergreift sich manchmal dran, mit seinen schmalen, langen Fingern, wenn die Mutter vor den dampfenden Töpfen steht und die Abluft vibriert und summt, dann schleicht er sich an und greift nach ihren riesigen Dingern. Die Mutter schreit ihn an, lässt aber seine Hände für eine Weile da hocken.
Sabine hat überlegt, dass Avas Vater vielleicht ein bisschen pervers ist, weil er solch ein Vergnügen an so einer fetten Frau hat. Aber Ava meint, es ist nicht pervers, es ist nur speziell. Es ist wie ihr Interesse an ganz alten Menschen. Aber das ist Sabines Meinung nach auch pervers. «Wenn du das pervers nennen willst, dass Leute Interessen haben und sich dafür begeistern können und auch mal was anderes schön finden können als die anderen alle, dann nenn das pervers. Dann bin ich vielleicht stolz, pervers zu sein. Ich bin so stooolz, pervers zu sein!», hatte Ava etwas lauter gesagt und sich ein bisschen in die Sache reingesteigert, weil sie nicht wirklich pervers sein wollte und kein sexuelles Interesse an Greisen haben wollte, wie sie es sich in der Nacht der Garagenparty von Avas Schwager Markus überlegt hatte. Da hatte er sich einen VW Golf gekauft und eine Party in der blitzesauberen gefliesten VW-Golf-Garage gemacht.
Im Nachhinein hat der Vater es trotzdem bereut, dass er sie geheiratet hat, denkt Ava, und die Mutter hat es sicherlich auch bereut, aber sie sagt es nicht, sie würde sich nicht einmal gestatten, so etwas zu denken. Beim Vater ist es was anderes, der tut nichts als denken und grübeln und bereuen. Wahrscheinlich bereut er sogar sich selbst.
«Ich fühl mich nicht ganz wohl hier» ist sein Standardsatz.
«Das sagst du doch immer und wo du auch bist», sagt dann die Mutter, «das interessiert bald keinen mehr.»
«Ich weiß», sagt der Vater darauf und grübelt weiter und lässt die Mutter die ganze Arbeit machen und den Frohsinn verbreiten, für ihn mit.
Jetzt sitzt er abseits auf einem Klapphocker, typisch, nimmt einen Hocker mit zum Osterfeuer und säuft aus einer Flasche den Rotwein, als könnte er nicht stehen wie alle, als wäre er kein Mann. Das sagt die Mutter auch immer, «als wäre er kein Mann. Trinkt roten Wein, als wäre er kein Mann».
«Wäre es dir lieber, er säuft Bier?», hat Ava sie gefragt.
«Ich will mich nicht beklagen», hat sie gesagt, «beklage ich mich über deinen Vater? Er säuft keinen Schnaps wie Jürgen. Das ist mir schon mal viel wert. Und red nicht so über deinen Vater.» Als wäre Ava es, die sich über ihn beklagt hätte.
Das Feuer wächst, es zischt hoch in den schwarzblauen Himmel, und wellende Hitze breitet sich aus. Von außen der dumpf feuchte Geruch von Fluss und Erde, von innen der von verbranntem Holz.
«Die Elbe riecht anders als andere Flüsse», hat der Vater einmal gesagt.
«Woher willst du das wissen?», sagte die Mutter, «du warst doch nie hier weg. Du kennst überhaupt keine anderen Flüsse.»
«Aber ich weiß es, alles riecht für sich anders, die Elbe riecht ein bisschen bitter frisch, so wie Elefantenkot.»
«Wie was?» Die Stimme der Mutter hatte sich fast überschlagen vor Wut über den bekloppten Vater.
«Weißt du, Avchen, einmal hab ich hier einen echten Elefanten gesehen, er stand auf einem Transportschiff, und hinter ihm lag ein dicker dunkler Haufen. Es war ein ganz flaches Schiff, und es war ein bisschen diesig, es sah aus, als wenn der Elefant schwebt.» Er hob die flache Hand gegen die Elbe und ließ sie, mit zusammengekniffenen Augen, anstelle des Elefanten über der Elbe schweben. «Und der Wind stand so … Ich konnte den Haufen leicht riechen, ich war ganz betäubt von dem Geruch, es war ein ganz … ganz besonderer … so frisch bitterer Geruch.»
Die Mutter schüttelte die wilden Locken. «Ich bin auch betäubt, allerdings von deinem Schwachsinn. Ich würde dir am liebsten den frisch bitteren Haufen vor die Birne klatschen, wenn es irgendwas nützen würde.»
Ava geht näher ans Feuer, sie drängt sich durch die Leute, ganz nach vorn, an die heißen Flammen, bis ihr Gesicht glüht und ihre Augen brennen.
Jedes Jahr, seit sechzehn Jahren. Immer an Ostern. Die Mutter im Rücken, den Vater im Rücken. Und die anderen.
Aus dem flatternden Feuer bohrt sich ein Geräusch heraus, ein Fiepen, ein durchdringendes Pfeifen. Von der Seite tönt der Realschullehrer: «Ich habe es gesagt. Das Feuer muss uuumgeschichtet werden. Ich habe es hundertmal gesagt. Da verbrennt jetzt irgend so eine arme Kröte – von Tierlein.»
«Am lebendigen Leibe», sagt der alte Biese in seinem Rollstuhl und stöhnt dabei, als würde er selbst verbrennen.
Das Gepfeife bohrt sich in Avas Schädel, sie hat noch nie so ein Geräusch gehört, es hat eine materielle Substanz, wie eine Waffe, wie eine Kugel, wie ein Messer. Luft holen, atmen. Wo ist die Mummi?
Sechzehn Jahre alt, Ava, und weinst nach der Mutter. Aber die Mutter ist nicht da. Es pfeift immer noch, immer noch, oder pfeift es nur in ihrem Kopf? Es pfeift überall. Die Jungen pfeifen und johlen, das Tierchen, die Kröte, pfeift, und vor allem pfeift es in ihrem Kopf. Ein Orchester, eine Symphonie, ein Pfeifstück am feierlichen Abend.
Dann findet Ava sich außerhalb des Kreises wieder, sie hockt auf dem feuchten Boden, sie riecht die modrige Erde, und eine Hand liegt auf ihrem Kopf.
«Huhu!», sagt der Junge, dessen Hand auf ihrem Kopf liegt.
Sie blickt auf, und im roten Licht des entfernten Feuers sieht sie eine große Brille, wolliges dunkles Haar, das wie ein Busch um den Kopf herum absteht, wie eine riesige Pelzmütze, und eine scharfe Adlernase.
Sie kann sich nicht entschließen aufzustehen, noch nicht, aber gleich, nur erst mal langsam atmen und das Denken normal werden lassen.
Der Junge sieht sie durch seine Brillengläser hindurch an, er ist noch klein, kleiner als sie und höchstens zwölf. Sie kennt ihn nicht. «Alles gut?», fragt er.
«Mir war nur kurz schlecht wegen des Tiers.»
Er nickt.
«Das passiert nun mal», will sie die anderen verteidigen, als wäre es klar, dass er nicht zu ihnen gehört, «das liegt daran, dass sich die Tiere da einnisten, und wenn man den Haufen nicht umschichtet, dann bleiben sie drin und werden mit verbrannt. Aber es macht viel Arbeit, das Umschichten, da muss man die Zeit für haben.»
Schweigen.
«Da haben die gar keine Zeit für.»
«Welche Tiere?», fragt er. «Was meinst du denn?»
Er nimmt seine Hand von ihrem Kopf, und an der Stelle seiner Hand entsteht ein kalter Fleck von verdunstendem Schweiß. Sie friert an der Stelle. Dann geht er weg und lässt sie da sitzen. «Eh, wo gehst du denn hin?», ruft sie ihm hinterher.
Aber er antwortet nicht. Er geht einfach weiter, als wäre sie ihm egal, als wäre es möglich, dass jemand wie sie ihm oder irgendwem anders egal ist. Sie läuft ihm nach. «Was soll das denn, erst so, dann so, was haust du denn jetzt ab?»
«Komm doch mit», sagt er, ohne stehen zu bleiben.
«Wohin soll ich denn mitkommen, was machst du denn?»
«Nach Hause.»
Ava kichert. «Was soll ich denn bei dir zu Hause?»
Und er geht, Blick nach vorn, geht mit seinen Gummistiefeln durch das quietschig nasse Gras, und sie geht nebenher und sagt: «Knutschen?», und kichert noch mehr.
Der Junge bleibt stehen und starrt sie an, mit dunklen Schatten, wo seine Augen hinter den Gläsern sind. «Würdest du?»
Ein Hauch von Atem streift sie.
«Ich knutsch doch keine Kinder. Mann. Wie komisch bist du denn?»
«Du bist doch an mir interessiert. Du gehst mir nach. Wie komisch bist du denn?»
«Ich bin überhaupt nicht an dir interessiert. Ich geh dir auch nicht nach.»
«Dann tschüs», sagt er und stiefelt quietschig weiter.
«Tschüs», sagt Ava und sieht rüber zum Feuer, das Funken in die Nacht sprüht. Wie sie dort stehen und froh sind und lachen. «Wie heißt du denn?», ruft sie dem Jungen hinterher.
«Danilo», sagt er im Gehen und ohne sich umzudrehen.
«Ich bin Ava», ruft sie.
«Ich wei-heiß.»
Sie läuft ihm wieder hinterher. «Wieso? Das stimmt doch gar nicht?»
«Ich wohne hier. Ich weiß, wie du heißt.»
«Echt? Seit wann wohnst du denn hier?»
«Seit September. Ich sehe dich oft, bei Regines Minimarkt … oder am Bus, also an der Straße, wo der Bus hält, und auch im Bus, da hast du vor mir gesessen, und an der Tankstelle bei der Kreuzung hast du Bier gekauft. Und einfach so.»
«Und einfach so. Also, ich hab dich jedenfalls nicht gesehen, noch nie.»
Er zuckt mit den Schultern.
Sie versucht, sich zu erinnern. Aber sie hat ihn wirklich noch nicht gesehen. Sie kann sich jedenfalls nicht erinnern.
«Wenn du mitkommst … kann ich dir was zeigen», sagt er und zappelt mit seinem linken Bein, das in einer Cordhose steckt.
«Ja? Was denn?»
Er greift nach ihrer Hand, sie sieht sich rasch um, ihre Hand hängt kraftlos in seiner, doch es ist inzwischen vollkommen dunkel, und niemand ist unterwegs, alle sind beim Feuer, seine Hand ist warm und trocken, und sie lässt ihn einfach und geht mit.
Was soll er ihr zeigen können? Ihr fällt nichts ein, aber das ist ihr egal. Sie will auch gar nicht denken, sie hat gerade überhaupt keine Entschlossenheit. Sie ist ganz labberig in sich drin. Sie könnte heulen vor lauter innerer Schwäche und gleichzeitig lachen, weil sie an der Hand von dem Kleinen mitläuft wie ein Kalb.
Im Dorf ergießt sich weiß das Licht der Straßenlampen auf ihre Gesichter, Danilos Wangenknochen und seine gebogene Nase treten scharf unter dem Gewöll von Haaren hervor. Im Licht sieht er älter aus und fremder. «Wo hast du denn vorher gewohnt, bevor du hergezogen bist?», fragt Ava Danilo, der schweigend neben ihr hergeht, ihre Hand fest in seiner, als würde sie ihm gehören.
«In Hamburg. Da hat es meiner Mutter nicht gefallen. Sie mag es nicht in der Stadt.»
«Ich habe dich echt noch nie hier gesehen.»
«Du hast nur nicht hingeguckt.»
«Kann sein.»
Die Mädchen und Jungen ihres Alters kennt sie im Umkreis von mehreren Kilometern. Die Jüngeren nicht. Die interessieren sie nicht. Das ist nun mal so.
Vor einem kleinen, alten Haus bleibt Danilo stehen.
«Hier ist es.»
«Hier?»
In dem Haus wohnte bis zum Sommer des Vorjahres Herbert Heinzen. Er sprach von sich selbst immer in der dritten Person, er sagte immer: «Herbert geht zum Friedhof», «Herbert kauft sich Berliner in Regines», «Herbert muss jetzt schlafen gehen.» Herbert teilte sich den Leuten gerne mit, wenn sie gerade da waren, und sie nickten und sagten: «Das mach mal, Herbert.» Manchmal stand er nachts auf der Kreisverkehrsinsel im Dorf und redete wirres Zeug. Er ist im Krieg verschüttet gewesen, sagt die Mutter. Aber er kam nie in ein Heim, was auch nicht gut für ihn gewesen wäre, sagt auch die Mutter, da er das Eingesperrtsein nicht ausgehalten hätte. Im August lag er auf der Kreuzung, auf dem Stück Rasen im Kreisverkehr, sein Kopf auf einem Bettkissen, er hielt es mit beiden sehnig dünnen Armen umfasst, der knochige Kopf im rosa Kissen, das graue Haar verknittert, lag er eingerollt im Gras und war tot. Ava sah ihn, viele kamen und sahen ihn, bis ein Arzt kam und bis jemand eine Decke über ihn legte und ihn mitnahm. Er war nicht gern in Häusern, er schlief lieber auf einer Campingliege auf seinem Hof unter dem schwarzen Himmel, wenn es warm genug war, und hatte immer alle Fenster und Türen weit auf stehen, wenn er drinnen war.
Nun wohnen die hier, denkt Ava, und es passt ihr nicht, aus irgendeinem Grund. Das Haus hat sich kaum verändert. Es ist nicht gestrichen worden, das Dach nicht neu gedeckt, die Fenster sind nun geschlossen mit Gardinen davor, es sieht jetzt verkommen aus, vorher sah es verrückt aus und hatte eine verrückte Energie, weil der Wind durch das Haus pfiff und die Fenster und Türen mit Stricken an Haken festgebunden waren, jetzt ist es alt und verkommen und sieht kaum bewohnt aus. Aber aus einem der Fenster dringt Licht.
«Was soll ich denn hier?», fragt sie und lässt Danilos Hand los.
«Jetzt bist du schon hier, jetzt komm auch!», sagt er und nimmt wieder fest ihre Hand in seine und quetscht ihre Finger, während er mit der anderen einmal vorsichtig, liebevoll darüberstreicht, sodass ihre Härchen auf dem Arm sich aufrichten.
Er öffnet das Tor, das schief in den Angeln hängt, und sie gehen auf den dunklen Hof zu den Schuppen, die ebenso schief in der Dunkelheit stehen, wie kleine, schräg nach vorn geneigte Felsen.
«Was ist denn hier?», fragt Ava. «Ich krieg Schiss, Mann. Du tickst doch nicht ganz richtig.»
«Warte doch», sagt er, «du wirst schon sehen. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin doch bei dir.»
«Na, wenn du bei mir bist, du Beschützer, du Beschützerlein.» Ava muss wieder kichern. Das Kichern in ihrem Bauch beruhigt sie.
Er zieht sie hinter sich her, öffnet den Riegel von einem der schiefen Schuppen, die Tür knarrt, trockener Geruch von Stroh und Erde hängt in der Luft des kleinen Raumes. Ihre Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit. Das schwache Licht einer Straßenlaterne dringt von fern durch die verdreckten Scheiben eines kleinen Fensters, und sie erkennt einen Mann, der auf einem Stuhl sitzt.
Ava quiekt. Sie wusste gar nicht, dass sie so quieken kann. Wie ein ganz kleines Schweinchen. Ihr Herz rast, und sie bereut alles, Scheiße, Mann, verdammte Scheiße, wenn sie nur nicht plötzlich so gelähmt wäre.
Aber nichts geschieht, Danilo hält noch immer fest ihre Hand, und der Mann regt sich nicht. Es sieht aus, als würde er sich überhaupt nicht bewegen, nicht mal ein bisschen, nicht mal atmen, es sieht aus, als wäre er tot. Und wenn er das wäre, tot, dann wäre das ungefährlich. Sie hat bereits einen Toten gesehen, Herbert Heinzen auf der Kreuzung, er sah lieb aus und ruhig. Sie hatte keine Angst vor ihm gehabt.
«Wer ist das?», fragt sie in die staubige Stille.
«Das ist mein Vater.»
«Dein Vater?»
«Er ist nicht echt. Es ist nur eine Kleiderpuppe aus einem Laden. Aber sein Kopf sieht echt aus. Meine Mutter hat ihn gemacht, sie hat früher Tiere fürs Museum gemacht, in Kroatien, sie kann auch Wachsköpfe machen. Und das ist mein Vater. Guten Tag, Vatilein. Guten Tag, Danilo, und guten Tag, schöne junge Frau. Freut mich sehr. Aber das wollte ich dir gar nicht zeigen.»
«Nicht?»
«Guck doch mal richtig, geh näher ran!»
Ava geht näher an den steifen Vater ran, sie tastet sich mit ihren Stoffschuhen über den mit Schutt bedeckten Fußboden. Es riecht säuerlich und nach dumpfwarmem Tier. Sie geht so nahe heran, bis sie etwas sich auf dem Schoß des Vaters bewegen sieht. «Was ist das?»
Doch im Licht der plötzlich eingeschalteten Hoflampe kann sie es ganz ausgezeichnet erkennen. Im zerfressenen Anzugstoff von Danilos Vater befindet sich ein Nest, aus dem sich blinde, nackte Schnäuzchen nach oben strecken.
«Kleine Mäuse», sagt sie.
«Mäusebabys», bestätigt er und kichert und hüpft im Schuppen herum. «Mäusebabys auf Tatas Schoß und beißen ihm die Eier ab. Was sagst du dazu?»
Er kommt zu ihr und greift wieder nach ihrer Hand. Er stellt sich ganz dicht vor sie hin, reckt sich und seinen wuscheligen Kopf und seine große Brille nach ihr, die über ihm ist, seine Lippen leicht geöffnet, sie spürt seinen Atem. Er will knutschen. Er will es wahr machen.
«Danilo», ruft eine Frau von draußen, sicher die, die auch das Hoflicht angeschaltet hat.
Danilo hebt den Zeigefinger an seine Lippen.
«Danilo», ruft die Stimme wieder.
Schritte nähern sich. Die Frau erscheint in der Tür. «Danilo, was machst du hier? Und das Mädchen? Was machst du beim Vater?»
«Der Vater hat Babys bekommen», sagt Danilo.
«Wie bitte sagst du?»
«Mäusebabys.»
«Schlag sie tot, Danilo.»
«Nö, mach ich nicht.»
Er zieht Ava zur Tür, schiebt sie durch und drückt die Frau auch mit hinaus und verschließt die Tür mit dem Riegel.
«Guten Abend», sagt Ava, «ich bin Ava Grünebach», wie sie es von den Eltern gelernt hat, immer vorstellen und guten Tag sagen.
«Ivana», sagt die Frau, sie drückt Avas Armgelenk, als würde sie es kneifen, und geht kopfschüttelnd zum Haus zurück.
Auf der Treppe winkt sie Danilo zu sich. Aber der läuft mit Ava raus auf die Straße und sagt: «Mein Vater ist tot, in Kroatien, vielleicht auch nicht, vielleicht ist er lebendig in Kroatien und liegt schön braun an der Adria und frisst sich voll.»
Ava starrt ihn an und versucht, die Eindrücke zu ordnen, aber es zappelt in ihr wie Danilos Knie, wie sein Tick in ihrem Gehirn.
«Früher war er nicht im Schuppen, sondern im Haus.»
«Aber wieso denn?», fragt Ava.
«Damit ich ihn kenne, als Kind, verstehst du? Damit auch ein Vater da ist, beim Abendbrot und so. Das vergisst du doch sonst, oder?»
«Das ist ja vollkommen verrückt. Ihr seid ja verrückt!»
Danilo grinst, schaut auf den Boden und zappelt wieder mit seinem Knie, als würde im Gelenk ein kleiner Motor laufen. «Für mich war es normal so. Vater sitzt am Tisch. Und nervt nicht rum.»
Ava starrt Danilo an und das Haus und wieder Danilo mit seiner Brille.
«Als Kind, da war alles normal so», sagt Danilo.
«Was denkst du denn, was du jetzt bist? Du bist immer noch ein Kind», sagt Ava.
«Überhaupt nicht.»
«Nein? Wie alt bist du – zehn, elf, zwölf?»
Danilo zieht sie am Arm zu sich heran, sie schiebt ihn weg.
«Wie alt?»
«Ich bin fast dreizehn.»
«Also zwölf.»
«Und?»
«Du bist zwölf, und ich bin sechzehn, Danilo. Ich knutsche nicht mit Jungen, die zwölf sind. Du bist ein Kind.»
«Ich bin aber weiter als die anderen.»
«Wer sagt das?»
«Ich.»
«Na so was. Soll ich dir mal was sagen, Danilo? So funktioniert das nicht. Du musst dich erst mal verlieben, nicht? Dann muss die Frau zu dir passen und wollen, und dann kannst du mit ihr knutschen. Okay?»
«Ich hasse dich», sagt er leise, nimmt seine Brille von den Augen und wirft sie wütend auf die Erde.
Ava bückt sich und hebt die Brille auf. «Was machst du denn? Du kannst doch deine Brille nicht auf die Erde werfen, dann geht sie kaputt!»
«Soll sie doch. Soll sie doch. Es ist doch nur wegen der Brille … und allem!»
Danilo läuft zurück zum Haus und verschwindet in der Einfahrt.
«Es ist doch nicht wegen der Brille, damit hat es gar nichts zu tun.»
Ava bleibt auf der Straße stehen. In einer langen Pfütze spiegelt sich im Straßenlampenlicht die Mauer vom Hof. Ein trüb glänzendes, sich leicht bewegendes Mauerwerk. Soll er machen, was er will. Sie ist dafür nicht verantwortlich. Sie hat damit nichts zu tun. Sie will zurück zu den anderen. Sie hätte sich nicht auf den einlassen sollen. Sein fremder Atem, seine feuchte Hand, alles klein und komisch und nervig. Ihre Lippe brennt, sie fährt mit der Zunge über einen kleinen, feuchten Riss. In der Hand die Brille, Sand an den Bügeln, sie wischt sie an ihrem Bauch ab. Dann geht sie ihm, tief aufseufzend, hinterher. Später kann sie sich nicht mehr genau erinnern, warum. Es sind ihr eher verborgene Gründe.
Im Schuppen fiept es. Der Vater ist umgekippt, und Danilo tritt auf seinem Körper herum.
«Was soll das?», sagt sie, «hör sofort damit auf, du Idiot, du kleiner!»
«Meine Mutter hat gesagt, ich soll sie totmachen! Hast du doch gehört. Hat sie doch gesagt.»
Er trampelt wild keuchend auf den fiependen Dingern und auf dem Vater herum. Jedenfalls sieht es so aus, denn auf dem dunklen Boden in dem dunklen Schuppen kann sie sonst nichts sehen. Dann hört er damit auf und zieht die Nase hoch. «Du bist so gemein», flüstert er heiser und schnieft.
«Ich weiß», sagt Ava. Sie geht zu ihm, setzt ihm die Brille auf das Gesicht und fährt ihm über das wuschelige Haar. Unter den dünnen Sohlen ihrer Schuhe fühlt es sich an, als ob sie auf Mäusebabys steht. Sie drückt sein feuchtes Gesicht gegen ihre Brust und streichelt sein Haar. «Ist doch alles nicht so schlimm», sagt sie. Sie dreht sein Gesicht zu sich hoch und will ihm einen kleinen, sanften Kuss auf die Stirn geben, wenn das hilft, wenn das hilft und ihn glücklich macht, für diesen Moment. Aber seine feuchten Lippen drücken sich mit solcher Macht gegen ihre, seine Zunge schiebt sich hervor und züngelt an ihrer Lippe herum, die sie sofort fest zusammenkneift. Mit einem Zwölfjährigen knutschen, auf toten Mäusebabys neben dem gestürzten Vater. Das ist mal toll, Ava, ganz toll, das ist mal richtig zum Angeben. Sie schiebt ihn mit Gewalt von sich fort. «Jetzt hör endlich auf!»
«Ich liebe dich», sagt er.
«Du liebst mich nicht, du weißt überhaupt nicht, was das ist!» Sie weiß selbst nicht, was das ist. Das ist das Blöde. Sie weiß alles nur aus Filmen. Wie der Vater.
«Du liebst mich auch.»
«Ich liebe dich?» Ava könnte heulen. Warum hat sie plötzlich so was am Hals? Warum steckt sie plötzlich in so was Bescheuertem drin? Es kann doch alles nur ihre eigene Schuld sein, wieder mal.
Danilo hüpft im Schuppen rum. «Love. Ich bin Love. Du bist Love.»
«Hör auf damit! Und wehe, du erzählst das jemandem!», sagt Ava.
«Doch, das erzähle ich allen», sagt er.
Die Tür öffnet sich, und die Mutter erscheint mit einer Taschenlampe in der Hand. «Danilo? Danilo?»
«Nein. Otac. Er ist zurückgekehrt, in den Mäusestall.»
«Du sollst nicht Spaß machen damit!»
«Ich habe den Vater zerstampft!»
«Was?»
Ava starrt die Mutter mit der Lampe an. Wie wird sie reagieren? Wie würde ihre eigene, dicke, liebe Mutter reagieren, wenn sie den Vater zerstampft hätte?
«Ich habe den Vater zerstampft, damit du es weißt.»
Die Mutter beleuchtet mit ihrem schwachen gelben Strahl den Boden. «Du bist ein Teufel, du bist ein Teufel! Wenn er noch da wäre, würde er dir Schläge geben!»
«Er ist nicht da», sagt Danilo, «und er kommt auch nicht mehr.»
«Mir ist es hier zu strange», flüstert Ava und verlässt den Hof.
«Ava, Liebste, schlaf gut!», ruft ihr Danilo hinterher.
Sie geht schneller. Sie geht zwischen den klaren, hellen Straßenlaternen nach Haus. Sie will nicht mehr zurück zum Osterfeuer. Sie will in ihre Küche und etwas Warmes trinken und das Radio anmachen und den Kühlschrank summen hören und die Fotos über der Spüle betrachten.
Das Osterfeuer ist anders geworden. Die Leute sind anders geworden. Was ist nur los?
Sie kocht sich Tee und hört im Radio die Nachrichten. Sie denkt an Danilos Mutter. Sie trug dunkle Hosen in Gummistiefeln, ihr Haar war hochgesteckt und ihr Gesicht knochig. Wenn Avas Vater verschwinden würde? Im Krieg oder anderswo?
Im Regal stehen seine Bücher, im Schrank seine Filme und in der Küche sein Rotwein, seine Jacke hängt an der Garderobe. Der Vater kann nicht weg sein, im Krieg, weil er da ist. Weil er beim Osterfeuer ist und alle verärgert, die Mutter, die Leute im Dorf und auch sie. Der Vater ist ein Spinner. Aber er ist da und nicht tot oder im Krieg. Das könnte er auch nicht. Er könnte nicht schießen, er würde im Weg stehen und den anderen Soldaten etwas über das Töten erzählen. Obwohl er über das Töten nichts wüsste. Vielleicht ist das nicht das Schlechteste an ihm. An ihm ist sowieso einiges gut. Er macht ihr keine Vorschriften, so wie die Väter anderer Mädchen. Wenn sie etwas will, dann sagt er immer: «Hast du dir das überlegt, mein Mädchen, ob du das auch wirklich aus deinem Herzen heraus willst?» Sie hat, seit sie klein war, immer überlegt, ob sie wirklich, aus ihrem Herzen heraus genau das wollte, was sie wollte. Sie hat ganz in ihr Herz hineingefühlt, hat versucht, die Entscheidung aus diesem schlagenden Organ herauszuziehen. Das ist recht schwer gewesen. Vor allem, wenn sie einfach nur in die Disco wollte.
Trotz seiner Nutzlosigkeit für den Haushalt und das Leben hängt die Mutter sehr am Vater, davon ist Ava überzeugt. Und die Entscheidungen über die Dinge, die Ava tun oder nicht tun darf, überlässt sie meist ihm. Der Vater hängt ebenso an der Mutter wie sie an ihm. Beide hängen aneinander wie Dick und Doof – sagt Avas Schwester Petra. «Die Alten sind wie Dick und Doof.» Obwohl der Vater keinesfalls Doof sein kann, denn doof ist er nicht. Er ist ein sehr kluger Mann. Die Eltern sind noch irgendwie aneinander interessiert, Petra meint, sie bumsen noch. Ava verzieht bei solchen Worten das Gesicht, sie will über die Eltern nicht auf diese Art und Weise nachdenken, aber Petra wiederholt dann absichtlich und vergnügt: «Die bumsen noch, Dick und Doof, die sind noch heiß, kannst froh sein, wenn nicht noch ein Schwesterlein bei rauskommt.»
Ava heißt nach einer Filmschauspielerin, nach Ava Gardner. Das war der Wunsch vom bekloppten Vater. In dem Zusammenhang ist immer die Rede vom bekloppten Vater, denn die Mutter war dagegen. Aber die Abmachung war, dass er den zweiten Namen bestimmt, den ersten hat die Mutter bestimmt, da ist Petra bei rausgekommen, kann man nichts gegen sagen, aber Ava ist doch ein viel besserer Name. Ava Gardner ist eine schöne, eine sehr, sehr schöne und sehr elegante Frau gewesen. Der Vater kennt alle Filme, er hat sie fast alle auf Video. Ava kennt die Filme auch, sie hat Ava mit neun in «The Killers» gesehen. Sie hat immer wieder versucht, so zu gucken, wie Ava guckt, als Burt Lancaster sie das erste Mal auf einer Party erblickt, er ist mit einer anderen Frau da, aber als sich Ava umdreht und so unglaublich toll aussieht, kriegt er sie nicht mehr aus dem Kopf und hat die andere Frau sofort vergessen. Das hätte er besser nicht tun sollen, denn Ava wird sein Verderben sein, das war es, was Ava am meisten Vergnügen machte, dass Ava sein Verderben sein würde. Sie sah den Vater an und sagte: «Diese Frau wird sein Verderben sein», und der Vater nickte stumm, ohne den Blick abzuwenden.
Der Vater hat sein eigenes Schlafzimmer mit blauem Teppich und zwei Bücherregalen. Er schläft nicht mehr mit der Mutter in einem Zimmer. Das hat im Dorf zu Gerede geführt, aber die Mutter sagt: «Die soll’n die Fresse halten!» Die Mutter ist rhetorisch etwas anders drauf als der Vater. Ihre Eltern waren Schafbauern. Die Mutter hat selber lange ein Schaf gehalten, sie war so dran gewöhnt gewesen. Aber ein Schaf macht nicht viel Sinn. Es rennt immer am Pflock im Kreis, bis es sich eingedrieselt hat, und dann würgt es, bis jemand es ausdreht. Die Großeltern haben immer noch jede Menge Schafe und neuerdings auch Ziegen. Avas Vater wird von ihnen nicht besonders gemocht. «Der hat nichts im Kopf als Spinnereien.» Als die Mutter den Vater damals angeschleppt hat, da hat der Opa ihn sofort aus dem Haus geworfen. Er hat ihn an den Schultern gefasst und umgedreht und gesagt: «Geh mal schön wieder nach Hause, Herr Professor, meine Tochter kriegst du nicht.»
Aber die Mutter hat ihn trotzdem genommen. Sie wollte weg von den Grobheiten auf dem Bauernhof, von dem Schafdreck und dem Rübeneintopf. Sie wollte keinen Mann wie ihren Vater, der tagein, tagaus in schwarzen Gummistiefeln und mit Hosenträgern über dem Flanellhemd rumlief und sich beschwerte, wenn es zu wenig Kartoffeln bei Tisch gab. Das hat sie Ava irgendwann erzählt, und Ava konnte es verstehen, obwohl Ava den Opa auch ziemlich mag. Aber sie kriegt ihn auch nicht als Mann. Das ist was anderes. Da hat man mehr Hoffnungen und Romantik.
Der Vater hatte die Mutter mit den dicken Locken und Titten zum Essen im Weinkeller in Lüneburg, wo er wohnte, eingeladen, und ihr nach dem Essen ein Gedicht vorgelesen. Das Gedicht muss was Besonderes gewesen sein, die Mutter soll Tränen in den Augen gehabt haben. Ava hätte gerne gewusst, um welches Gedicht es sich handelt, aber weder der Vater noch die Mutter geben ihr da Bescheid. «Das gehört deiner Mutter und nicht anders», hat er gesagt.
«Das haben tausend Leute schon gelesen. Dann kann ich es doch auch lesen.»
«Lies doch, was du willst.»
Sie will gar keine Gedichte lesen, nur dieses eine, aber das darf sie nicht.
Anschließend hat der Vater die Mutter wahrscheinlich rumbekommen. Das hatte sie nicht direkt erzählt, aber so wird es wohl gewesen sein. Die Mutter hatte eigentlich keine Ahnung von Gedichten, trotzdem hatte sie eine Sehnsucht in sich, nach einem Mann, der so etwas mit Gedichten in sich hatte und an sie weitergab.
«Heutzutage kannst du mit Gedichten keine mehr rumkriegen», hat Petra gesagt. «Wenn mir einer mit nem Gedicht kommt, dann lache ich mich tot.»
Petra hat einen Mann, der im Leben keine Gedichte vorlesen würde, Markus Mertens, der Dachdecker ist, sein dunkles Haar oben recht kurz und hinten etwas länger trägt und samstags DJ macht. Er spielt Oldies auf Ü-30-Partys. Petra sagt, sie mag das auch viel lieber als zum Beispiel moderne Popmusik. Ava mag überhaupt keine Ü-30-Partys, wo alle Ü-40 sind und immer, immer die gleiche Musik gespielt wird. «Jetzt flippen sie gleich richtig aus, warte, Ava», sagt Markus dann und dreht die CD in seiner Hand und zieht an seiner Fluppe und legt «Heart of Glass» von Blondie auf und brüllt: «Damenwahl!» Zu Hause hört er genau das Gleiche. Zu Hause bastelt er an seinem Volkswagen rum, der in der Garagenauffahrt von Petras und seinem kleinen gemieteten Reihenhaus steht, und aus dem CD-Player im Auto schreien Blondie und Rolling Stones, und er fummelt unter dem Auto und singt: «I can’t get no, Satisfaction. Geiler Song, geiler Song. Jagger. I can’t get no.» Das sind Markus’ Gedichte, sozusagen.
Wenn Ava einer mal ein Gedicht aufsagen würde, dann würde sie sich das gar nicht erst zu Ende anhören, aber es würde auch niemand machen. Das ist endgültig vorbei, dass Leute anderen Leuten Gedichte vortragen und sich was davon versprechen. Das war früher mal, vielleicht, aber jetzt nicht mehr. Oder? Ihr Vater tut es immer noch, manchmal liest er in der Küche hinter der kochenden Mutter laut ein Gedicht vor, er mag die Worte, er sagt: «Hör, wie das klingt, höre das, der Mann ist ein Genie.» Die Mutter tippt sich dann an die Stirn, aber sie hört ihm zu, sie wird irgendwie schwach bei Gedichten, im Geheimen ist sie ein Fan vom Vater; wenn er sich da so dran freut, das kann sie kaum begreifen, aber trotzdem fühlen. Deshalb sind die Mutter und der Vater immer so süß in der Küche, findet Ava. So einer wie der Vater, wenn der heute geboren werden würde, dann würde er wieder so werden und Gedichte aufsagen. Aber so einen wie den Vater gibt es einfach nicht noch mal. Und Ava will um Gottes willen so einen Mann auch nicht haben.
Sie muss an Danilo denken, wie er im Schuppen stand und auf den Mäusen rumtrampelte. Er schien sich so sicher. Wenn man so klein ist, zwölf Jahre alt, da ist man ein Kind, da ist man doch nicht sicher, was die Liebe angeht. Oder liegt es daran, dass er Kroate ist? Sind die vielleicht anders in ihrer Entwicklung und ein bisschen eher sicher und wie Erwachsene? Aber eigentlich sind es doch überall verschiedene Menschen, Kroaten oder Deutsche, ganz verschiedene Menschen, manche so und manche so. Der Kleine ist eine spezielle Sorte. Möglich, dass er keine Freunde hat. So, wie er aussieht und rumläuft und spinnt mit seiner großen Brille. Sie muss aufpassen, dass sie ihm in nächster Zeit nicht über den Weg läuft. Wenn im Dorf rauskommt, dass sie den geküsst hat, dann aber hallo. Die würden sie richtig verarschen. Alle. Oh nein, das wäre schlimm, das muss sie unbedingt verhindern. Hoffentlich rennt er ihr nicht hinterher. Das wäre dem zuzutrauen, dass er sie bei der nächsten Gelegenheit wieder abknutscht. Herrgott, Ava, wie konntest du das nur tun? Bist du denn noch ganz dicht?
Die Tür klappt. Die Eltern kommen.
«Ava», ruft die Mutter im Elefantenmantel, den sie sich vom Körper pellt, wickelt ihr Tuch ab und keucht: «Wo warst du denn? Wir haben dich gar nicht mehr gesehen, wir haben uns schon Sorgen gemacht, dass du wer weiß wo bist.»
«Ich war nicht wer weiß wo. Ich bin sechzehn, und da musst du nicht immer gleich so einen Aufstand machen.»
«Aber Bescheid kannst du ja wohl sagen, wenn du weggehst. Wir sind doch auch zusammen hin.»
«Ich musste weg. Mir war ganz schlecht. Habt ihr das nicht gehört, wie das kleine Tier geschrien hat? Mir war richtig schlecht. Und ihr wart nicht da.»
«Natürlich waren wir da», sagt die Mutter, «natürlich waren wir da. Wo sollen wir denn gewesen sein?»
«Ich weiß es nicht. Ich habe dich doch gesucht, weil mir schlecht war, weil ich wegwollte, und du warst nicht da, der Vater auch nicht, also bin ich abgehauen.»
Der Vater setzt sich in den Sessel und schlägt ein Buch auf.
«Es war daheim auf unserm Meeresdeich;
Ich ließ den Blick am Horizonte gleiten,
Zu mir herüber scholl verheißungsreich
Mit vollem Klang das Osterglockenläuten.»
«Du sagst nichts», sagt die Mutter und starrt ihn wieder anhimmelnd und schon leicht beruhigt an, «ich rede mir den Mund wund, und du sagst nichts. Findest du es denn richtig? Sie kann doch wohl Bescheid sagen, wenn sie geht, oder, Frank?»
«Du kannst Bescheid sagen, wenn du gehst, Ava.»
«Ich hätte euch Bescheid gesagt.»
«Zum Bescheid sagen gehört Eltern suchen und Worte der Erklärung aussprechen, sei kein Kleinkind, Ava.»
«Mir war nicht gut.»
Die Mutter geht in die Küche, Kaffee kochen, immer kocht sie Kaffee, auch wenn es spätabends ist, immer trinken sie und der Vater Kaffee, wenn sie nach Haus kommen.
Der Vater wendet sich wieder seinem Buch zu und liest sauber artikuliert und sanft betonend:
«Im tiefen Kooge bis zum Deichesrand
War sammetgrün die Wiese aufgegangen;
Der Frühling zog prophetisch über Land,
Die Lerchen jauchzten und die Knospen sprangen.
Entfesselt ist die urgewalt’ge Kraft,
Die Erde quillt, die jungen Säfte tropfen,
Und alles treibt, und alles webt und schafft,
Des Lebens vollste Pulse hör ich klopfen», und sieht hoch zu Ava. «Wer ist der Junge?»
Ava starrt ihn an, wie kann der Vater immer und immer alles über sie wissen? Es ist doch verrückt. «Er heißt Danilo, er ist noch klein, erst zwölf. Er wohnt im Haus vom verrückten Herbert. Mit seiner Mutter. Sie sind aus Kroatien.»
«Du weißt ja schon einiges.»
«Ja, das hat er mir erzählt, er ist nett.»
«Das dachte ich mir.» Er liest stumm die Gedichte von Theodor Storm, der Familie Heimatdichter für die offiziellen Feiertage, und das Thema ist beendet. Die Mutter wird davon vorerst nichts erfahren.
Am Städtischen Klinikum Lüneburg, wo sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester beginnt, lernt sie Andreas kennen. Er ist groß und dünn und geht, vielleicht wegen seiner Größe, immer ein bisschen gebeugt hinter den Ärzten her. Er ist Assistenzarzt und großer Fan vom Chefarzt Dr. Kohlmann. Beate sagt immer Dr. Kohlarsch. Wenn er es auch nur einmal hört, kann Beate sich warm anziehen, aber vielleicht hat er es sogar schon gehört.
Es ist nicht Avas Art, Leute so schnell einzuteilen, in Ärsche und Nichtärsche, sie sieht sich das erst mal eine Weile an, auch das hat sie vom Vater, der sieht sich aber eigentlich alles immer ewig an und fällt kaum je sein Urteil. «Warte ab, Avalein, wie sich der Mensch entpuppt, das dauert manchmal lange. Dann kriecht er aus sich heraus und flattert und ist vielleicht sehr schön, und du bist vorschnell gewesen.» Die Mutter ist vorschnell und schlägt eher in Beates Richtung. Sie mag Leute sofort oder sofort nicht. «Ich kann die nicht ab. Die geht mir so was von auf den Zeiger, sag ich dir.» Aber sie kann ebenso schnell ihre Meinung ändern, wenn diejenige ihr nett guten Tag sagt oder das Glas Gurken aus dem Regal bei Edeka reicht. «Die is doch irgendwie sehr nett, Avchen, oder?» Der Vater kommt mit seiner Meinung über Leute quasi nie zu Potte, wenn man so will. Er überlegt noch, wenn die Leute schon tot sind. Sie sind immer so und auch ein bisschen so und ein bisschen auch wieder so. Ava hat was davon geerbt, glaubt sie, sie wäre lieber konkreter, wie die Mutter, aber sie kann nicht. Es kommt ihr nicht aus dem Herzen durch das Gehirn auf die Zunge.
Sie zweifelt am Dr. Kohlarsch noch rum, aber vor allem auch, weil Andreas ihn so gut findet, so charismatisch, sagt er, und das ist genau das Arschige an ihm, das kann jemand wie Andreas auch charismatisch finden. Und als Arzt sooo gut. Er ist als Arzt sooo gut. Andreas will ein ebenso guter Arzt werden wie Dr. Kohlmann. Er hat schon ewig lange studiert und ist um einiges älter als Ava, wobei es ihr eigentlich nicht so vorkommt. Im Gesicht sieht er aus wie ein Junge, mit seinen Sommersprossen über der knubbeligen Nase. Und er kichert wie ein Mädchen, wenn jemand was sagt, das an einen Witz erinnert. Beate dreht sich dann um und verdreht die Augen.
Sie trifft ihn mehrmals an dem Tag, als Frau Brunnhofer stirbt. Sie trifft ihn an Frau Brunnhofers weißem und dennoch riechendem Bett – aber es ist nicht das Bett, das riecht – vor ihrem grauen Gesicht. An Frau Brunnhofers Tod ist nichts mehr zu ändern. Sie stirbt ohne Angehörige, weil sie keine hat. Dafür hat sie eine Patientenverfügung, und Dr. Kohlarsch hält sich dran. Keine Beatmung. Keine künstliche Ernährung.
«Sehr fortschrittlich», sagt Andreas und sieht zur Seite und holt Kaugummis aus seiner Kitteltasche und steckt sie wieder hinein. Andreas Sommersprosse, Herr Balzer damals noch für sie. Er kommt immer wieder an ihr Bett, um nach ihr zu schauen, nervös zappelig und innerlich zerrissen, wie Ava scheint.
«Ach seien Sie doch ehrlich», meint sie im Gang zu ihm, «am liebsten würden Sie doch die ganzen Schläuche auf der Stelle in die Frau reinstecken, damit sie noch eine Weile lebt.»
Er starrt sie an, seine hellen kleinen Augen müde und in den Winkeln vertrocknet und leicht gerötet, «ja», flüstert er und senkt den Kopf und reibt sich die juckenden Augen. In diesem Moment verliebt sie sich in Herrn Balzer, Andreas.
Wenn sie sich an diesem Tag am Bett der sterbenden Frau begegnen, sehen sie sich gegenseitig an, dann wieder die Frau, ihr nach innen gesunkenes Gesicht, ihre Augen in den Höhlen ihres Schädels, und dann wieder sich, ihre jungen Gesichter. Ava sieht die straffe Haut auf seinen Wangenknochen, auf denen versprengte, winzig kleine Sommersprossen sitzen, die etwas Albernes haben. Seine Schultern sind nach vorn gebeugt, sein helles Haar streicht er alle Minute nach hinten, und die Frau atmet kaum, in langen Abständen, und starrt schon ganz woandershin, wo die Vögel singen und die Bienen summen und sich das große Nichts öffnet. Ihre Hände liegen reglos und vertrocknet auf der Bettdecke, wie alte Knochen in einem Erdloch, die Medikamente gegen die Schmerzen haben sie gleichgültig gegen alles gemacht, und Andreas und ihr ist es jetzt auch fast egal. Leute sterben im Krankenhaus. Irgendwann muss mal Schluss sein. Man kann sich nicht an einer Frau aufhalten. Um sechzehn Uhr ist sie tot.
Zwei Wochen später trifft sie Herrn Balzer, Andreas, im Schwesternzimmer, wo er gar nichts zu suchen hat. Er fragt nach Nähzeug.
«So was hab ich nur bei mir zu Hause», sagt sie.
«Dann kann ich da vielleicht mal vorbeikommen?», sagt er und blinzelt müde und lächelt, und sie glaubt, es kann nicht sein, dass er das gesagt hat, oder er hat es nicht so gemeint, wie es sich erst einmal anhört, wenn man normal denkt. Beate und Elvie reißen die Augen auf, und Beate schreit: «Herr Balzer baggert die Ava an, eh eh eh!»
«Ph!», sagt Ava, und ihr Gesicht wird heiß. Aber Beate hat recht.
Beate reißt Elvie am Arm mit aus dem Zimmer, und auf dem Gang kichern sie.
Allein gelassen mit Herrn Balzer, sagt sie: «Ich kann das Nähzeug auch mitbringen und den Knopf annähen, oder worum es geht, obwohl das echt nicht zu meinen Aufgaben als Auszubildende gehört … Herr Balzer. Echt nicht.»
«Ja, ich wollte auch nur …», sagt er, «dass wir vielleicht mal ein Bier trinken oder so.»
«Oder so.» Sie grinst. «Oder was oder so?»
«Oder Wein. Oder Cola. Oder Milch.»
«Milch ist nicht mehr gesund für Erwachsene. Eher was Gesundes doch wie Bier. Bier ist sehr gesund wegen des Hopfens, das hilft vorbeugend gegen Krebs.»
Seit der Tschernobylkatastrophe im Frühjahr ist die Angst vor Krebs bei den Leuten fast wie die Angst vor der Grippe geworden, wenn auch ungleich größer, aber der Krebs ist näher an sie herangekrochen, ist weniger ein Schicksal als eine Bedrohung geworden, der man sich zu entziehen versucht. Im Frühsommer waren weniger Leute draußen auf den Straßen gewesen, eine feine, großflächige Angst hatte sich ausgebreitet, eine Angst vor dem Essen und dem Leben, und ein großes Misstrauen hatte sich dafür breitgemacht. Ava, die täglich mit dem Krebs umging, hatte die Angst nicht so akut gespürt, sondern wie eine Enttäuschung über die Unsicherheiten, die das Leben bereithielt, über die mangelnde Fürsorge und den mangelnden Schutz, den Staaten und Regierungen boten, und sie war endgültig und aus eigenem Entschluss aus dem Kinderleben in das bittere Erwachsenenleben hineinmarschiert.
Am Abend, in der Kneipe September, fragt er sie, wie sie das sieht mit den Patientenverfügungen und den lebenserhaltenden Maßnahmen. Sie sagt: «Och, es ärgert mich nur, wenn die Leute Schmerzen haben, das ist alles.»
«Es ärgert dich?»
«Wenn die Leute Schmerzen haben, wenn man das richtig sieht, und wenn sie sich so verzerren deshalb, wenn Leute sich so im Gesicht und am Körper verzerren und ganz schief werden, weißt du? Wie das aussieht, du weißt doch, was ich meine, oder? Das kann ich nicht leiden. Auch wenn sie krank sind und das nicht anders geht, auch wenn sie sehr krank sind und das nicht mehr besser wird, sie sollen es gut haben und angenehm, und es soll ihnen nichts weh tun, das ist das Wichtigste.»
«Und sterben? Ist das nicht viel schlimmer, dass sie sterben?»
«Vielleicht. Ja. Wahrscheinlich. Aber das macht mich nicht so wütend, wie wenn jemand Schmerzen hat. Ich weiß nicht, warum.»
«Ein Kind, stell dir vor, ein Kind stirbt. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.»
Sie sieht ihn an, über das große Bierglas hinweg in der braunen, staubigen, lichtlosen Schankstube mit all dem muffigen Holz. «Ich weiß. Das habe ich gesehen. Da reiße ich mich zusammen und mache alles, wie es sein muss, nach Vorschrift, das ist alles ganz mechanisch und ordentlich, und ich denke, halt den Mund, Ava, keiner interessiert sich jetzt für dich. Und es ärgert mich nicht. Das wäre … frech.»
In seiner Wohnung an der mittelalterlichen Münzstraße, auf seinem lila bespannten Bett, entjungfert er sie. Sie sagt ihm nicht, dass er sie entjungfern wird. Was soll man dazu auch sagen? Du, ich bin noch Jungfrau? So ein Wort ist an sich schon altmodisch und peinlich. Oder zu sagen, ich habe noch nie … Und dann im Satz stocken. Das hat sie sich auch überlegt. Alles. Aber dann hat sie beschlossen, es auf sich zukommen zu lassen und gar nichts zu sagen. Denn wenn ein Mann weiß, dass er eine Frau entjungfern wird, dann kriegt er Angst. Das hat Beate ihr gesagt. «Die ziehn manchmal den Schwanz ein, wenn die eine anstechen solln.» Schwanz einziehen ist sowieso Andreas’ Stärke – oder Schwäche? Als er es dann eben tut, sie anstechen, da sagt er immer: «Tut mir leid, ich komme nicht rein, du machst dich so zu.» Sie lacht und sagt: «Ich bin so. Gib dir Mühe. Du musst da jetzt durch.» Er starrt sie an und murmelt: «Ach so ist das, ach so ist das.» Und sein Schwanz schrumpelt zusammen. Sie will überhaupt keinen Sex. Sie ist so unaufgeregt wie beim Wäschewaschen. Aber sie will dennoch unbedingt angestochen werden, jetzt sofort will sie es hinter sich bringen. Wie den Zahnarzt oder wie eine Strafpredigt. Spaß am Fummeln hat sie schon genügend gehabt, aber die wahre Freude muss erst beim echten Ficken kommen. Deshalb muss es endlich geschehen, und Andreas muss sie anstechen. Zu diesem Zweck müsste er erst mal einen Stachel haben und kein Würmchen. «Andreas, mach doch! Ich will so gerne, dass du es machst.»
«Ach nö, ich kann jetzt nicht mehr, Mausel.»
«Du kannst. Sieh, wie du gleich kannst. Sag nicht immer Mausel.»
Sie trinkt ein großes Glas Wodka-Orangensaft, sie wird es jetzt irgendwie hinkriegen, sie will, sie nähert sich seinem Schwanz, sein spärliches, pfirsichfarbenes Schamhaar an ihrer Wange, säuerlicher Geruch, sie hat keine Ahnung, wie man es macht, aber sie denkt sich, irgendwie dran rumlecken wird schon helfen. Und es hilft. Er regt sich, und Andreas murmelt «uh, ah», sie muss sich das Lachen verkneifen, wenn sie lacht, war alles umsonst. Als er hart ist, hebt sie ihren Kopf, legt sich neben ihn, spreizt die Beine und sagt: «Jetzt tu es mit Gewalt!»
Er zögert keine Sekunde mehr, ihr sein Ding gefühllos reinzustoßen, es gibt einen schneidenden Schmerz, es tut alles etwas weh und ist nicht so erregend wie Fummeln, aber es ist vollbracht, und sie ist sehr, sehr zufrieden mit sich. Als hätte sie selbst ihre Entjungerung durchgeführt. Jetzt ist sie bereit für alles Kommende, und sie denkt dabei keinesfalls nur an Andreas.
«Aids kannst du wohl kaum haben», sagt er hinterher.
«Nein», sagt sie, «aber schwanger kann ich werden, Assiarzt.»
Assiarzt sagt Beate immer. Beate ist nicht so dafür gewesen, dass sie mit Assiarzt Andreas schläft. Sie meinte, man sollte eher bei seinesgleichen bleiben. Also Kfz-Mechaniker. Oder Ähnliches. Außerdem ist er alt. Verhältnismäßig. Fast dreißig. Was nicht alt ist als Assistenzarzt, meint Andreas.
Schwanger kann sie nicht werden, denn natürlich nimmt sie die Pille. Aber dass er so leichtsinnig ist, nicht danach zu fragen – dabei ist er fast doppelt so alt wie sie. Im Krankenhaus tut er, als würden sie sich nur flüchtig kennen. Ist auch besser so. Sie ist siebzehn. Demnächst achtzehn. Er ist Assiarzt. Man vögelt nicht mit Auszubildenden. Mit ausgelernten Schwestern schon eher. Das machen einige. Sogar verheiratete Ärzte. Da ist nicht so viel dabei. Es gibt auch einen Pfleger, der was mit einer Ärztin hat, er heißt Hartwig. Die Ärztin ist vor zwei Jahren von ihrem Mann geschieden worden, und sie war ein bisschen down und hat auch ein wenig zugenommen, deshalb hat es ihr gut gepasst, meint Beate. Beate hat auch schon mit Hartwig. Aber sie meint weiter, ein Mann wie er macht eine Frau unglücklich, weil er mit einer allein nie zufrieden ist. «Da kannste gleich in Harem gehen, Ava», sagt sie. Aber sie versteht sich gut mit ihm. Wahrscheinlich passen sie gut zusammen, denn Beate nimmt es auch nicht so genau. Hartwig