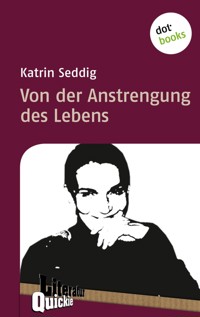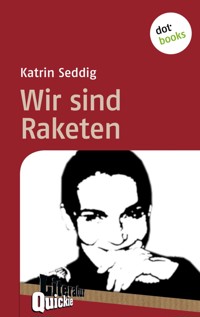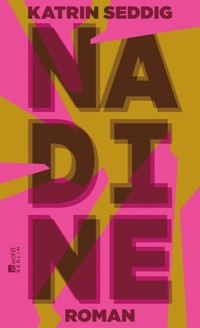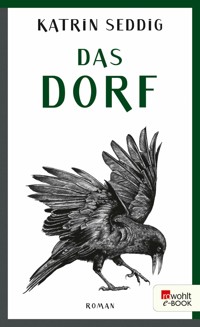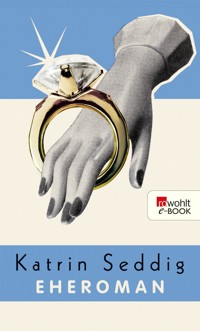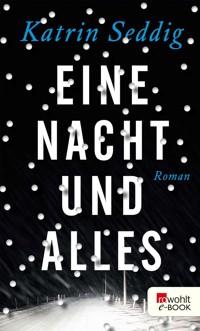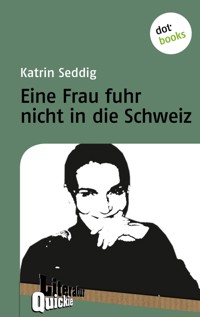9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hamburg, 2017, kurz vor dem umstrittenen G20-Gipfel. Scheinbar unberührt geht das Leben der Familie Koschmieder seinen Gang, man wohnt in Hamburg-Marienthal, geordnete Verhältnisse. Doch je näher der Gipfel rückt, desto weiter ziehen sich die Risse, die eben noch irgendwo an den Rändern klafften, in die Familie hinein. Die Tochter Imke, engagiert bei der «Jugend gegen G20», denkt immer radikaler, mitgezogen von Freunden. Ihr Bruder Alexander ist Polizist und überzeugt von einer klaren Linie; vielleicht will er auch nur sein geheimes inneres Chaos bändigen. Die Geschwister, die sich eigentlich nahe sind, stehen in der sommerheißen, explosiven Stadt plötzlich auf verschiedenen Seiten. Als die Mutter an einer politischen Kunstaktion teilnimmt, der Vater in ein Gerangel gerät und Imke ganz unerwartete Erfahrungen mit Gewalt, Ohnmacht und Freundschaft macht, verwischen alle Fronten. Die Situation wird für jeden zur Prüfung. Katrin Seddigs Familienroman beleuchtet die Ereignisse um den G20-Gipfel – und zeichnet eine erschütterte Gesellschaft, in der alle Gewissheiten ins Wanken geraten. Wer erzählt die richtige Geschichte? Und ist das eigentlich die Frage, auf die es ankommt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Katrin Seddig
Sicherheitszone
Roman
Über dieses Buch
Hamburg, 2017, kurz vor dem umstrittenen G20-Gipfel. Scheinbar unberührt geht das Leben der Familie Koschmieder seinen Gang, man wohnt in Hamburg-Marienthal, geordnete Verhältnisse. Doch je näher der Gipfel rückt, desto weiter ziehen sich die Risse, die eben noch irgendwo an den Rändern klafften, in die Familie hinein. Die Tochter Imke, engagiert bei der «Jugend gegen G20», denkt immer radikaler, mitgezogen von Freunden. Ihr Bruder Alexander ist Polizist und überzeugt von einer klaren Linie; vielleicht will er auch nur sein geheimes inneres Chaos bändigen. Die Geschwister, die sich eigentlich nahe sind, stehen in der sommerheißen, explosiven Stadt plötzlich auf verschiedenen Seiten. Als die Mutter an einer politischen Kunstaktion teilnimmt, der Vater in ein Gerangel gerät und Imke ganz unerwartete Erfahrungen mit Gewalt, Ohnmacht und Freundschaft macht, verwischen alle Fronten. Die Situation wird für jeden zur Prüfung.
Katrin Seddigs Familienroman beleuchtet die Ereignisse um den G20-Gipfel – und zeichnet eine erschütterte Gesellschaft, in der alle Gewissheiten ins Wanken geraten. Wer erzählt die richtige Geschichte? Und ist das eigentlich die Frage, auf die es ankommt?
Vita
Katrin Seddig, geboren in Strausberg, studierte Philosophie in Hamburg, wo sie auch heute mit ihrer Familie lebt. Über ihren Roman «Runterkommen» (2010) schrieb die «taz»: «Ein brillantes Debüt ... Anrührend, witzig und nüchtern.» Über «Eheroman» (2012) meinte «Der Tagesspiegel»: « Grandios, wie Katrin Seddig jeder ihrer Figuren einen eigenen Ton verleiht»; zuletzt erschien 2017 «Das Dorf». Katrin Seddig wurde mit dem Calwer Hermann-Hesse-Stipendium 2020 und für den noch nicht veröffentlichten Roman «Sicherheitszone» mit dem Hamburger Literaturpreis 2019 ausgezeichnet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung any.way, Hamburg,
nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Jose A. Bernat Bacete/Getty Images
ISBN 978-3-644-00689-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Es ist gut, dass die Hamburgerinnen und Hamburger in diesen Tagen solidarisch zusammenstehen, damit unsere Stadt weltoffen und liberal bleibt. Das war, ist und bleibt die Stärke dieser freien Stadt.»
Olaf Scholz, letzte Sätze der Regierungserklärung vor der Hamburgischen Bürgerschaft zu den Vorkommnissen im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel
«Ich ziehe das Chaos der Hölle dem Chaos der Ordnung vor.»
Wisława Szymborska
Am Donnerstag, dem 6. Juli, wird Paul Jonas von einem Polizisten mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen. Er hockt, zusammengesackt, auf der Flutmauer, und über ihm und neben ihm, um ihn herum tobt ein Kampf, den er nicht mehr versteht, weil er nicht mehr denkt.
Das Gehirn ist allerdings immer aktiv. Der Mensch denkt auch dann noch, wenn er nicht mehr bewusst denkt. Immer denkt der Mensch auf irgendeine Weise. Auch wenn er das später nicht mehr glaubt, weil er nur das glaubt, woran er sich erinnern kann. Aber Erinnerungen sind nicht die Wahrheit. Was die Wahrheit ist, das weiß man nicht. Jeder Splitter Erinnerung ist Teil einer Wahrheit. Und es gibt sehr viele Wahrheiten, mehr, als es Menschen gibt.
Paul Jonas hockt zusammengesunken auf der Flutmauer und denkt etwas, von dem er später nichts mehr wissen wird.
Erster Teil
Früher hatten sie richtigen Winter. Harten, blauen Schnee. Helga zieht ihren hellbraunen Steppmantel an und geht in den Hof. Sie schaut in den Himmel, aus dem sich ein Gewicht auf sie senkt. Sie spürt den Druck im Nacken und über den Augen. Sie muss die Pillen nehmen. Sie spaziert ein Stück, den Weg entlang, an den Häusern der Nachbarn vorbei. Wenn sie einen müden, kleinen Hund hätte. Sie hätte gern einen Hund, einen, der nicht mehr so heftig am Leben zieht, der – wie sie – das Gemäßigte liebt, der klein und kindlich ist, dem sie auf dem Schoß die Kletten aus dem Fell ziehen könnte.
Auf dem Bürgersteig knirscht der Sand. Vorsichtig setzt sie ihre Beine voran. Sie sieht die anderen Leben in den Fenstern. Sieht die Späher-Loknecht, wie sie die Lichterketten aus der Hecke zieht, was glubscht die so?, und Renate Lübcke, auch so ’ne Kadreiersche, fegt die Auffahrt zur Garage, in einem Kleid! Sie grüßt, ohne die Miene zu verziehen. Bewegen soll sie sich. Aber der Druck auf ihren Kopf nimmt zu. Sie muss die Pillen nehmen. Einmal bleibt sie stehen und fragt sich, wo ihr Haus ist. Sie muss sich konzentrieren. Sie darf sich nicht so ihren Erinnerungen hingeben. Aber das meiste in ihr ist jetzt Erinnerung. Früher war es nicht so. Jetzt wird es immer mehr. Es umfängt sie, und sie geht darin umher wie in einem alten Haus. Es ist ein Heimkehren. Sie weiß, was das bedeutet, aber es macht ihr keine Angst. Sie hustet und spuckt auf den Boden.
In einem Winter hatten sie eine Schaufel im Flur. Am Morgen mussten sie sich auf die Straße hinausschaufeln. Der Schnee kam zur Tür herein, und da mussten sie sich dann einen Weg bahnen. Den brauchten sie, weil sie einkaufen mussten, in die Schule und zur Arbeit. Aber die Stadt lag so voller Schnee. Die Straßen waren weiße Betten, und alles versank in diesem dicken Schnee. Jeden Morgen rannten Gretchen und sie hubbernd zum Fenster, um zu sehen, ob es über Nacht noch mehr Schnee gegeben hatte. In diesem Winter erfror Hedwig Wisnewski, eine alte Nachbarin, die ein Eichhörnchen im Käfig hielt und einen Raben, der an einer Schnur festgebunden war. An dieser Schnur flog er im Haus herum und verhedderte sich manchmal. Hedwig Wisnewski war eine Deutsche, die einen Polen geheiratet hatte. Einen Brennholzhändler, der ein Jahr nach der Hochzeit starb und ihr sehr viel Brennholz hinterließ, das sie einfach nicht mehr verkaufte. Sie erfror inmitten dieses ganzen Brennholzes, das nur wenige Meter vom Haus jahrelang in einer Scheune gelagert hatte. Sie waren manchmal zu Hedwig Wisnewski gegangen, weil sie die Kinder mit alten, aufgeweichten Bonbons lockte. Hedwig Wisnewski stand krumm gebeugt, strich ihnen mit zittrigen Händen über ihre Köpfe und weinte stumm. Sie weinte andauernd. Niemand wusste, warum. Die Tränen liefen einfach so aus ihr heraus. Und deshalb gingen sie nicht besonders gerne zu ihr. Trotz der Bonbons, die doch schmeckten, wenn man sie erst einmal angelutscht hatte. Und trotz des Eichhörnchens, das sie aus dem Kaburr ließ und das herumturnte, an den Gardinen hochkletterte und mit einem Satz heruntersprang, wenn sie ihm einen Nusskern hinhielten. Und der Rabe flog im Kreis mit seiner Schnur und schrie: Reb, reb, reb.
Helga bleibt stehen. Sie sieht sich um. Sie weiß genau, wo sie ist. Sie kennt die Straße und jedes Haus, auch die neuen Häuser kennt sie. Sie kennt die Bäume und Sträucher, die Hecken und jede einzelne Gehwegplatte. Aber manchmal ist es so, dass sie, obwohl sie alles kennt, nicht mehr weiß, wo sie ist. Das Kleine ist noch da, aber das Große ist vergangen. Als ob sie jeden Millimeter dieser Welt kennt, aber die Welt als Ganzes ihr fremd ist. Wie kann das sein? Das sind immer nur kurze Momente, und manchmal ist ihr sogar, als ob sie sie, trotz der sie ankommenden Furcht, auskostet. Als ob sie sich, in diesen Momenten des Vergessens, ein anderes, ein ganz neues Leben aussuchen könnte.
Im Schnee entstanden tief eingeschnittene Wege, bläulich, hohe Wände zu beiden Seiten. Dann entstanden Verbindungen zwischen diesen Wegen, und je mehr Wege es gab, desto höher wurden die Wände; es entstanden Gebirge aufgeworfenen, vereisten Schnees. Am Morgen waren die Wege wieder eingeschneit, man musste schippen, die Wände wurden noch höher.
Der Vater steht in der Diele, hat eine dicke Arbeiterjacke an, zwei Hosen übereinander, und Schneeklumpen hängen in seinem Bart. Zornig tritt er mit den Füßen gegen den grausamen Schnee, der morgens zur Tür hereinfällt, er ist kein Arbeiter und nicht für körperliche Arbeit gemacht. Die Mutter schaufelt heimlich, wenn der Vater weg ist, die Wege richtig frei. Die Mutter hat mehr Kraft in den Armen, aber der Vater sagt, dass es eine Männerarbeit ist. Die Männer schaufeln den Weg frei, und die Frauen kippen mit warmem Wischwasser graue Löcher in den Schnee.
Als es endlich aufhörte zu schneien, fand das Eissegeln statt, da lief sie mit Gretchen und Martha hin, und sie sahen zu, bis ihnen die Zähne klapperten, dann rannten sie nach Hause, wo es Plinsen gab oder Klunkersuppe mit Zucker und Zimt.
Sie zieht die Nase hoch und schnuppert. Sie sehnt sich nach Zucker und Zimt. Sie hatten schwere, steife Mäntel an, und ihre Stiefel waren zu eng mit den dicken, gestrickten Strümpfen. Ihre Füße waren taub gefroren und schmerzten dann im Warmen, als würden sie auseinandergerissen. Aber sie sagten nichts. Nie sagten sie was.
Als sie zurück zu ihrem Haus kommt – es ist ja gar nicht wahr, dass sie die Welt nicht mehr kennt –, tun ihr die Knie weh, und ein feuchtes Stieben ist in der Luft, ein Regen fein wie Staub, da sieht sie, noch bevor sie wieder richtig auf den Hof eingebogen ist, etwas Merkwürdiges. Sie bleibt am Torpfeiler stehen und späht. Thomas tritt mit einem Koffer aus der Haustür. Er geht drei Schritte auf den Hof, wendet sich um und blickt zurück zum Haus, und sie steht hinter dem Pfeiler und sieht ihn, es stiebt, und der Druck nimmt zu. Sie muss die Pillen nehmen. Nach einer Weile steigt er, mit dem Koffer in der Hand, die Treppe hoch, die in die kleine Wohnung führt, die sie über der Garage ausgebaut haben. Die Fenster erblühen gelb, und sie sieht seine Silhouette. Sie spuckt noch einmal auf den Boden, obwohl sie gar nicht mehr richtig Spucke im Mund hat.
«Plawucht!», zischt sie und geht würdevoll über den Hof wie eine Frau, die genau das Leben hat, das sie wollte.
Natascha Koschmieder faltet die Wäsche zusammen, während sie im Fernsehen einen Jacques-Tati-Film zeigen. Weihnachten ist vorbei. Er wollte warten, bis Weihnachten vorbei ist, hat er gesagt, weil er es Weihnachten nicht tun wollte, die Familie zerstören. Er wollte ihnen allen das Fest nicht verderben. Das ist rührend von ihm, denkt sie, dass er ihnen das Fest nicht verderben wollte. Sie stellt das Bügelbrett hinter dem Sofa auf und legt sein hellblaues Hemd darauf. Sie stellt mehr Dampf ein. Es zischt. Kalkiges Wasser tropft auf den Stoff. Sie wischt einen kleinen, braunen Krümel Kalk mit der Fingerspitze weg. Dann sieht sie durch das tiefe Fenster über den Hof hinüber. Aus dem kleinen Schornstein qualmt es ein paar Minuten lang, dann hört es wieder auf. Er kriegt das Feuer nicht an, denkt sie. Es ist so lächerlich, dass er drüben eingezogen ist. So lächerlich. Den Raum über der Garage haben sie vor ein paar Jahren als Gästewohnung ausgebaut. Es war ihre Idee gewesen, ihr Projekt. Sie hatte so eine Idee von einer Wohnung gehabt, die ganz anders als ihr Haus war. Ihr Haus, das Haus, in dem sie wohnt, ist gar nicht ihr Haus. Es gehört Helga. Aber es ist ihr Zuhause. Sie haben die Kinder hier aufgezogen. An den Wänden hängen Fotografien aus Helgas und Walthers Leben, neuere Fotos aus ihrem und Thomas’ Leben und natürlich die Kunst der Kinder. Die Kinder haben zu den üblichen Anlässen Dinge für sie angefertigt, die Bilder haben sie stets an der Wand aufgehängt, anderes in die Regale gestellt. Das Haus ist immer voller geworden. Sie haben nicht versucht, ein anderes, moderneres Haus daraus zu machen. Sie haben es sich immer voller gestellt, und sie hat sich immer wieder gesagt, dass sie es so mag, so voller Erinnerungen, so warm. Nur manchmal hat sie eine kühle Sehnsucht bekommen, nach Leere, nach einer weißen Wand, nach Design und nach der Frische eines Neuanfanges. Sie hätte Geschmack gehabt, sie hätte gewusst, wie man einen leeren Raum einzurichten gehabt hätte. Und aus diesem Grund, und nicht dem vorgeschobenen, hatte sie die Gästewohnung haben wollen. Ein anderes Leben in einer hellen, klaren Wohnung, darum ging es. Eine Option. Einen eigenen Raum, jungfräulich, von ihr erschaffen.
Während der vorletzten Sommerferien hatten ihre Nichten Karla und Marie zwei Wochen dort gewohnt, dann ihre Mutter, als sie sich im letzten März in Eppendorf im Krankenhaus behandeln ließ. Im Oktober dann ein Freund von Thomas, der bei seiner Frau rausgeflogen war. Ronald Park war ein unangenehmer Mensch gewesen, und sie hatte nicht verstanden, wie Thomas ihn bei ihnen hatte wohnen lassen können. Er dankte es ihnen viel zu wenig, dass er in ihrem Haus schlafen konnte. Karla und Marie hatten der Wohnung mehr Schaden zugefügt, das ist schon wahr, in nur zwei Wochen hatten sie eine Kerbe in die Schlafzimmertür gehauen und einen Fleck auf die Armlehne des Sofas gemacht, den man, ganz blass, immer noch sehen konnte. Aber das waren unschuldige Sachen, sie waren jung, die Nichten, sie waren unbesonnen und lebten wie die Pflanzen. Sie breiteten sich aus, nahmen sich Raum und kannten keine Verfeinerung. Aber sie bedankten sich, sie buken Natascha Muffins und schenkten ihr eine Schürze. Die Schürze war schrecklich, aber sie meinten es lieb. Die Schürze hat sie dann tatsächlich angefangen zu tragen. «Koch dich glücklich!», steht darauf. Es macht ihr gar nichts mehr aus, eine Schürze beim Kochen zu tragen, im Fernsehen tun sie es auch, und es schützt ja wirklich vor Flecken.
Ronald Park allerdings hatte, in ihren Augen, die Wohnung entweiht. Eines Abends hatte er eine Frau mitgebracht. Sie hatte von ihrem Schlafzimmer aus gesehen, als sie beim Schlafengehen das Fenster kippte, wie er mit einer Frau in Trenchcoat die Treppen hochschlich, sie hörte sie leise reden. Sie schauspielerten, wie sie übertrieben vorsichtig die Treppe emporstiegen, als könnten sie ertappt werden, und sie kam sich verhöhnt vor, von diesem Schauspiel gegenüber ihrem Haus, gegenüber ihrem Fenster. Sie kicherte in ihrem Trenchcoat, die blöde Kuh, und Ronald Park küsste sie oben vor der Tür, bevor er aufschloss. Natascha beobachtete, barfuß und frierend in ihrem gebügelten Schlafanzug hinter dem Vorhang stehend, wie sie innen das Licht anschalteten, wie sie sich als schwache Schatten bewegten. Dann ging das Licht irgendwann aus.
«Was gibt’s denn da zu sehen?»
«Er hat wen mitgebracht.»
Sie hatte sich umgedreht und das Licht ausgeschaltet. Dann hatte sie nicht schlafen können. Sie hatte immer nur daran denken müssen, was dieser Mann dort in ihrer Wohnung, in ihrer Bettwäsche, wohl mit dieser Frau tat, während sie hier in ihrem eigenen Leben neben ihrem eigenen Mann lag, der schon lange schlief. Es war ihr vorgekommen, als würde dieser Ronald Park ihr ihr Leben wegnehmen, das von ihr vorbereitete, von ihr entworfene Leben.
Aber dann zog er wieder aus, und sie ging hinüber und putzte die Wohnung, die gar nicht dreckig war. Er war sorgfältig mit ihr umgegangen, anders als Karla und Marie, die sie aber liebte und denen sie alles verzieh. Sie lüftete durch, sie bezog die Betten neu, und am liebsten hätte sie die Bettdecke weggeworfen. Im Laufe der folgenden Monate erhielt die Wohnung etwas von ihrer Jungfräulichkeit zurück. Sie wurde nicht benutzt. Manchmal, wenn Thomas nicht da war, ging sie hinüber und setzte sich auf das Sofa. Es war eine schöne Wohnung. Sie saß auf dem Sofa und atmete die saubere, die neue Luft ein. Es gab kaum Erinnerungen in diesem Raum. Nur ein paar Besuche, die keine Bedeutung mehr hatten. Es war alles fast noch so, wie sie es bestimmt hatte. Es war ihre Wohnung. Ihr unbekanntes Leben.
Sie hängt das hellblaue Hemd auf einen Bügel und trägt es hoch ins Schlafzimmer. Hängt es in seinen Schrank, zu seinen anderen Hemden. Alle von ihr gebügelt. Jedes einzelne dieser Hemden hat sie in der Hand gehabt. Sie hat es aus der Waschmaschine geholt, es unten im Wäschekeller aufgehängt, denn er mag sie aus dem Wäschetrockner nicht. Die Nähte ziehen sich im Trockner zusammen, und sie werden weich. Weich mag er seine Hemden nicht, sie sollen etwas steif sein, und gebügelt. Sie bügelt seit vielen Jahren seine Hemden. Sie bügelt sie nicht, weil er es verlangt, es ihr jemals gesagt hätte. So ein Mann ist er nicht, denkt sie. So ein Mann – ist er nicht. Sie setzt sich auf die Kante des Bettes, ihrer beider Bettes. Aber, denkt sie, was für ein Mann ist er? Was für ein Mann? Sie zwingt sich, nicht durchs Fenster auf die Garagenwohnung zu schauen. Sie sitzt auf der Kante des Ehebettes und schaut auf den Fußboden. Vor ihr der geöffnete Schrank mit seinen verschiedenen Hemden, hinter ihr das Fenster und der Hof, und dahinter, irgendwo in diesem Raum, da ist er. Wenn der ganze Hof und alles drum herum als eine Wohnung zählen würde, denkt sie, dann würden sie immer noch zusammenwohnen, in gemeinsamen Räumen. Dann wäre es gar nicht so weit weg, wo er jetzt ist. In Schlössern, denkt sie, muss es so gewesen sein. In Schlössern haben sie sehr weit auseinandergewohnt, damals. Sie haben sich manchmal kaum gesehen. Wenn sie sich nicht sehen wollten, dann haben sie sich nicht gesehen. Sie haben ja damals auch aus anderen Gründen geheiratet, denkt sie. Nicht aus Gründen wie wir, denkt sie, und denkt eine Weile über diese Gründe ihrer Heirat nach und kommt zu keinem Ergebnis. Dann steht sie auf, im Schlafzimmer ist es ganz dunkel geworden, und sieht jetzt doch hinüber, sie stellt sich hinter den Vorhang und sieht hinüber zu den Lichtvierecken. Es sind drei Fenster, dicht nebeneinander. Das Licht ist warm. Er wird es schön haben, denkt sie. Und dann wird sie endlich wütend. Wie kann er es wagen, in diese Wohnung zu ziehen? Wie kann er es wagen, dieses von ihr eingerichtete Leben zu betreten? Wie kann er es wagen, sie hier zurückzulassen, während er dieses neue Leben beginnt, in ihrer Wohnung. Sie ist so wütend, dass sie knurrt.
Natürlich hat sie es vermieden, an die Frau zu denken. Sie weiß nichts über sie. Es ist nur irgendeine Frau. Sie war vielleicht zu schockiert gewesen, um Fragen zu stellen. Was ist das für eine Frau? Liebst du sie? Willst du zu ihr ziehen? Habt ihr Pläne? Solche Fragen hätte sie vielleicht stellen sollen. Aber sie hat gar keine Fragen stellen wollen. Sie hat gedacht, dass sie diese Frau nicht interessiert. Sie ist ja noch gar nicht richtig existent. Sie ist ein Phantom. Sie hat gar keinen Namen.
Und dann sieht sie von hinterm Vorhang aus, dass er drüben telefoniert. Er läuft im Raum herum, die Hand am Ohr, und telefoniert. Und da ist die Frau plötzlich da, ist in ihrem Schloss, in ihren weiten Räumen, da läuft sie herum, ist da, ohne von ihr bemerkt worden zu sein. Sie ist ein Eindringling, eine Kammerzofe, die sich in ihrer Schönheit, mit ihrem jugendlich unschuldigen Körper, ihren dicken Zöpfen und ihrer weißen Haube in ihr Leben gedrängt hat. So ein Biest, denkt sie. Und da redet er mit ihr und denkt, sie merkt es nicht. Jetzt ist diese Schlampe auch noch in meinen eigenen Räumen, denkt sie, und dass sie nicht Schlampe denken möchte, sie ist doch gar nicht so ein Mensch. Was hat er aus mir gemacht?, denkt sie – eine Frau, die Schlampe denkt über eine andere Frau, das hat er aus mir gemacht. So eine bin ich jetzt geworden. Eine bemitleidenswerte Frau, der man vielleicht verzeihen muss, dass sie Schlampe über eine andere denkt. Eine Frau mit Schürze, die im Wohnzimmer vor dem Fernseher seine Hemden bügelt. Seine Hemden bügelt, während er drüben in meiner Wohnung mit seiner Schlampe telefoniert. Schlampe, denkt sie, schon wieder, über diese Frau, die sie gar nicht kennt. Dieses unschuldige, junge Ding. Und wenn sie gar nicht jung ist? Sie will nicht darüber nachdenken. Sie will überhaupt nicht mehr nachdenken. Jedenfalls nicht solche Gedanken, die sich nicht steuern lassen. Sie will nicht von diesen Gedanken beherrscht werden, die sie nur herumwirbeln, sie im Griff haben, während sie sie nicht im Griff hat. Sie muss ihre Gedanken in den Griff bekommen!
Sie löst sich von dem Vorhang. Er telefoniert auch nicht mehr. Sie geht die Treppe hinunter, den leeren Wäschekorb unter dem Arm, bringt ihn in den Keller. Dann geht sie in die Küche, um das Abendessen zu kochen. In der Küche steht Helga und trägt ihre Schürze um den spitzen Bauch gebunden. Koch dich glücklich!
Sie zogen zwei Monate später schon in die erste Etage, während sie von dort aus das Erdgeschoss renovierten. Sie sprachen in dieser Zeit über ein Kind. Aber sie bekamen noch lange keins. Sie bekamen ein Haus, aber kein Kind. Bekamen eine Mutter, aber kein Kind.
«Wruken gibt’s», Helga hantiert am Herd. «Ich dachte, ich helf dir ein bisschen, an so einem Tag.»
Natascha starrt auf das Gemüse, Fleisch, die Zutaten, die Helga auf dem Tisch aufgehäuft hat. Helga tätschelt ihr die Schulter.
«Du weißt, Imke isst kein Fleisch.»
«Wir können es ja rausnehmen.»
Natascha schüttelt den Kopf.
«Du kannst kein Fleisch in das – was überhaupt? – tun. Wenn du Fleisch reintust, dann isst sie es nicht.»
«Aber ich kann es doch rausnehmen. Wenn du nicht weißt, was Wruken sind …», sie schüttelt den Kopf, «das weiß doch jeder, was das ist, das sind Steckrüben.»
«Helga, sie kann doch eine Fleischbrühe von einer Gemüsebrühe unterscheiden. Das ist doch Fleischsuppe, auch wenn du das Fleisch später rausnimmst.»
«Aber wie soll ich denn Wruken kochen, ohne Rindfleisch?»
Natascha zuckt mit den Schultern. Imke kommt in die Küche.
«Ohne Rindfleisch kann man keine Wruken kochen», sagt Helga streng zu Imke.
Imke starrt sie an.
«Ich bin sowieso gleich weg.»
«Du gehst weg?», fragt Natascha.
«Zu Freunden.»
«Kommst du wieder?»
«Weiß nicht», sagt Imke. «Mal sehn.»
«Sagst du Bescheid?»
«Hm.»
Als sie aus der Küche ist, sagt Helga: «Sie kann wohl plachandern, wie sie will?»
«Warum nicht?»
«Da kann doch auch mal was passieren. Kennst du diese Freunde?»
«Ich vertraue ihr.»
«Das kann man in diesem Alter nicht. Siebzehn.»
Sie sagt es abfällig, als wäre die Zahl eine Krankheit. Sie setzt das Rindfleisch mit den Knochen auf, die sie aus ihrem eigenen Kühlschrank mitgebracht hat, schneidet die Steckrüben, die Mohrrüben, die Kartoffeln.
«Habt ihr denn früher immer gewusst, wo eure Söhne waren?»
«Ja, das wussten wir. Sie haben immer gewusst, wann sie zu Hause zu sein hatten. Da gab es feste Regeln. Das geht nicht anders. Und dann ist sie auch noch ein Mädchen.»
Natascha weiß von Thomas, dass seine Eltern kaum etwas von den Jungs gewusst hatten. Sie hatten sie belogen über fast alles, was sie taten. Thomas hatte ihr Geschichten erzählt. Sie waren in der Nacht oft aus dem Fenster geklettert. Waren auch erwischt worden, von Walther, der dann Strafen verteilte. Aber all diese Dinge hatte Helga wohl vergessen, oder sie wollte sie vergessen.
«Was ist bei einem Mädchen anders?», fragt Natascha.
Helga trocknet sich die Hände an einem Küchentuch ab.
«Einem Mädchen kann viel zustoßen. Es ist eine Menge Packzeug unterwegs.»
Mit Packzeug, weiß Natascha, meint Helga kriminelle Ausländer. Kriminelle Ausländer findet sie ein großes Thema.
«Ich kann sie nicht einsperren. Und wie gesagt, ich vertraue ihr.»
«Vertrauen ist ja schön …», sagt Helga und blickt sie so an, vielsagend, spöttisch, mitleidig. Mit ihrem alten Gesicht. Sie hat ein rundes Gesicht, einen ganz anderen Schädel als Thomas. Sie hat ein breites, rundes Gesicht und eine rostrote Dauerwellenfrisur. Sobald weißes Haar nachwächst, geht sie zu ihrer Friseurin. Sie trägt weite, seidige Blusen mit kräftigen Mustern, schmale Hosen, die an ihrem spitzen Bauch weit sein müssen. Im Winter zieht sie feingestrickte Pullover über die Blusen. Sie strickt diese Pullover mit sehr komplizierten Mustern in ihrer Wohnung unter dem Dach vor dem laufenden Fernseher. Sie strickt und isst dabei Vollkornkekse, weil sie glaubt, dass die gesund sind, und sieht sich Filme im ZDF an. Manchmal hört sie ostpreußische Volkslieder und weint.
«Meinst du, ich hätte meinem Mann nicht vertrauen sollen?», fragt Natascha.
Helga wiegt den Kopf.
«Als Frau muss man immer auf der Hut sein.»
«Was soll das heißen? Ich hätte mehr achtgeben sollen? Ich hätte misstrauischer sein sollen? Ich habe etwas verkehrt gemacht?»
Darüber hat sie ja tatsächlich nachgedacht. Die ganze Zeit schon. Darüber, was sie verkehrt gemacht hat. Zu Hause trägt sie immer diese ausgeleierte rote Hose. Manchmal wäscht sie sich vier Tage lang die Haare nicht. Seit zwei Jahren macht sie keinen Sport mehr. Oft hat sie sich nicht dazu durchringen können, ihm zuzuhören, sich mit ihm zu unterhalten. Sie hat nicht versucht, seinen Körper zu lieben, hat seinen Körper nicht mehr verehrt. Dabei muss er verehrungswürdig sein. Er ist verehrungswürdig. Sie seufzt in körperlicher Hingabe an ihren verlorenen Ehemann. Sie blickt auf die Schürzenschleife über dem schmalen Becken ihrer Schwiegermutter. Auf den kleinen, flachen Po unter der Schleife. Die Riemen ihrer Kunstlederpantoffeln über den Hacken.
«Kind», Helga dreht sich von der Arbeitsplatte zu ihr um, «ich bin doch auf deiner Seite.»
Das Fleischwasser blubbert. Fleischbrühendampf hängt in der Luft. Die Küchenscheiben beschlagen. Natascha öffnet das Fenster.
«Du bist doch noch nie auf meiner Seite gewesen.»
Helga zuckt mit den Schultern.
Nach einer Weile sagt sie: «Klunkersuppe.» Als würde sie das Wort in ihrem Mund probieren. Natascha sieht sie fragend an.
«Das kennt ihr nicht. Das gab’s, als noch richtig Winter war.»
Während es draußen regnet und er auf dem gelben Sofa fernsieht, denkt er an Nathalie, bei der er nicht sein darf, weil sie ihre Familie zu Besuch hat. Im Fernsehen küssen sie sich, und es läuft auf Sex hinaus. Aber was er sieht, das ist nicht echt. Es ist auch gar nicht so gedacht. Es ist übertrieben, soll die Menschen vor dem Fernseher erreichen, das Wollen und das Müssen darin. Denn es ist ja so, dass der Fernseher klein ist und um ihn herum das Fenster, die Gardinen und die Wand, die leere Blumenvase und die Leisten zwischen Wand und Fußboden, die einen sauberen, hübschen Übergang schaffen. Sie wollen sich immer so heftig, sie müssen immer so sehr, dass das Zögernde, das Unentschlossene, das es echt machen würde, nie vorkommt. In Wirklichkeit ist es ja ein Hin und Her. Ein Überwältigtsein, das dann von einem Erschrecken, Zurückweichen abgelöst wird. Und nur durch dieses Zurückweichen entsteht ja ein neues Verlangen und Einanderwollen. Und dann der Alltag, die Unvollkommenheit der Körper, das Abgestoßensein, denn in all dem Begehren, in der Anbetung ist auch immer eine Abstoßung enthalten, in allem ist ja, denkt er und kratzt sich am Sack – hier in dieser Wohnung kann er sich ungestört am Sack kratzen, so oft und so lange er will, und er hat eine Gewohnheit draus gemacht –, immer auch das Gegenteil enthalten, das können sie im Film einfach nicht zeigen. Da gibt es nur eine Bewegung in eine Richtung, denn dieses Zagen ist ja hauptsächlich in den Köpfen und drückt sich in kaum mehr aus als in einem Wimpernschlag, einem etwas schwächeren oder auch zu starken Druck, wenn man plötzlich den inneren Kontakt verliert zu dem, den man begehrt.
Es hatte geregnet, und sie hatte auf dem Parkplatz vor der Schule gestanden, ans Auto gelehnt, und geraucht. Der Regen war über ihr Gesicht gelaufen, über ihr Haar, auch ihre Zigarette musste gleich ausgehen. Er hatte Imke mit dem Auto zur Schule gefahren, ihr Fahrrad war kaputt, zur dritten Stunde, weil die ersten Stunden ausgefallen waren.
«Sie werden ganz nass», hatte er zu Nathalie gesagt und sie angestarrt, hemmungslos, wie ihm später bewusst wurde.
«Wirklich?», hatte sie gesagt, und das war ihm wie eine Provokation vorgekommen. Als ob sie ihn herausfordern wollte.
Es gab ein Geplänkel, ein albernes Hin und Her, wie es solchen Bekanntschaften vorausgeht. Ein Spiel zwischen Mann und Frau, ein durchsichtiges Spiel.
Und dann hatte er ihre Telefonnummer bekommen und war nach Hause gefahren. Diese Telefonnummer war für einige Tage in seinem Kopf verschwunden, er wollte sie vergessen, er erlaubte sich gar nicht, an diese Telefonnummer zu denken, denn es war ja ganz und gar unmöglich, dass er sie anrief. Es war albern, undenkbar, seiner nicht würdig, und er schämte sich des Geplänkels mit dieser offensichtlich viel jüngeren Frau, die noch nicht einmal wusste, dass er verheiratet war. Zugleich war er immer mehr besessen von dieser Telefonnummer, von der Möglichkeit, diese Frau in die Arme zu nehmen. Ihre Provokation war ihm direkt in den Schwanz gefahren und hatte sein Denken verwirrt. Sein Körper war seiner Frau ja entwöhnt, sein Körper orientierte sich neu.
Er rief sie an einem Nachmittag vom Laden aus an, er zitterte ein bisschen dabei, war aufgeregt wie ein Kind, er rief an, und sie ging nicht ran, nur die Mailbox, und bevor er es sich überlegen konnte, sagte er: «Ich wollte ja anrufen. Ich dachte, also, ich wollte einfach anrufen. Das ist alles. Ich bin Thomas Koschmieder, vom Parkplatz, als es geregnet hat. Jedenfalls hast du jetzt meine Nummer.»
Er hatte sie vorher noch gar nicht geduzt, aber er schaffte es nicht, sie jetzt zu siezen. Das passte nicht zu diesem Anruf, der ihm vollkommen misslungen vorkam. Er wünschte, es wäre ihm souveräner gelungen.
Am Abend, als er mit Natascha vor dem Fernseher saß, rief sie zurück. Kaltblütig ging er mit dem Telefon raus auf den Hof.
«Nathalie», sagte sie. «Ich hätte nicht gedacht, dass du anrufst.»
«Na ja», sagte er, «ich auch nicht.»
Dann schwiegen sie, weil sie sich gar nicht kannten und nicht wussten, was sie reden sollten. Sie schwiegen nicht lange, nur ein paar Sekunden, und hörten den Atem des anderen und wurden vielleicht davon schon erregt. Vielleicht war das Entscheidende dieses Telefonates das Schweigen zwischen ihnen.
«Wir könnten doch», schlug sie vor, «vielleicht mal einen Kaffee trinken, irgendwo.»
Sie verabredeten sich also, und er erfuhr, dass diese Nathalie, diese nassgeregnete Frau mit diesem hellen, offenen Gesicht, eine Lehrerin war, Lehrerin an der Schule seiner Tochter. Und sie erfuhr, dass er ein verheirateter Mann war, der Vater einer Tochter, die sie unterrichtete.
Trotz dieser Umstände schliefen sie zwei Wochen später miteinander. In ihrer Wohnung. Sie ging so zielstrebig vor, dass es ihn erschreckte. Sie sorgte ganz allein für ihre Lust, und er half ihr dabei, obwohl es ihn erst verwirrte, sich ihren wortlosen Anweisungen zu fügen. Aber bald machte es ihm Spaß. Er musste sich nicht mehr bemühen, er konnte einfach mit ihr schlafen. Sie wollte oft, und wenn sie nicht wollte, dann brauchte er sich auch gar keine Mühe zu machen, dann wurde es nichts. Alles war klar zwischen ihnen. Dass ihr Körper so kräftig und bestimmt war, dass sie so selbstbewusst für ihre Lust sorgte, das erstaunte ihn, und er begann, sie zu bewundern und zu lieben.
Während es draußen regnet und er auf dem Bett fernsieht, denkt er an Simon. Im Fernsehen küssen sie sich, es läuft auf Sex hinaus. Aber Sex wird nicht gezeigt. Wenn er Sex sehen will, muss er den Computer anschalten. Aber da geht es alles so schnell, und es lohnt sich eigentlich gar nicht, den Computer anzuschalten. Es ist auch immer das Gleiche, und er hat eigentlich gar keine Lust auf das ganze Gebumse, das ist ja alles widerlich und auch ein großer Beschiss. Die geben sich doch gar keine Mühe. Die arbeiten nur was ab. Das sieht man genau. Das ist nicht, was er will. Er weiß gar nicht richtig, was er will. Er denkt an Clark. Schön war das auch nicht, am Ende nur Schmerz und Scham. Er schämt sich immer noch, wenn er daran denkt.
Er steht auf und geht rüber zu Oma.
«Hast du an die Pillen gedacht?»
Sie kommt ihm im Bademantel entgegen, das Gesicht dick mit Creme eingeschmiert, es riecht nach Parfüm. Sie parfümiert sich immer ein. Die ganze Etage stinkt danach, er selbst riecht oft danach, seine Sachen, weil er ja auch in dieser Luft wohnt, sein Zimmer riecht danach, und er ist dankbar, dass niemand, den er kennt, in dieses Zimmer hineinschnuppern kann. Das Strickzeug liegt auf dem Couchtisch, ihre Kekse und ein halbvolles Glas Milch. Der Fernseher ist auch bei ihr an, da küssen sie sich, die Gleichen, beim Bumsen sind sie immer noch nicht angelangt. Und wenn das kommt, schaltet sie dann um?
«Wenn ich dich nicht hätte, mein Alexander», sagt Helga und nimmt die Pillen aus dem Schrank.
«Du denkst ja nicht dran.»
«Ich denke schon dran, aber dann vergesse ich’s wieder.»
Er küsst sie auf die Haare, über die sie, für die Nacht, immer eine Art künstliches Spinnennetz zieht. Er nimmt ihren großen, puppenhaften Kopf in seine Hände, die danach kleben, von der dicken Creme, und steckt seine Nase in das eingesponnene Haar.
«Pass doch auf, meine Frisur!», schimpft sie.
Es gibt nichts Schöneres, als die Nase in Helgas versponnenen Muff zu stecken, ein zartes, künstliches Gewebe wie Zuckerwatte, chemisch süß duftend.
«Ich hoffe, du schläfst heut Nacht besser.»
Sie winkt ab.
«Bald schlaf ich für immer.»
«Hör doch auf zu spinnen!»
Er hasst es, wenn sie sowas sagt. Sie sagt es mit Absicht, damit ihm das weh tut und er sie noch mehr liebt. Und sie schafft das, immer. Er seufzt und geht in sein Zimmer.
Als er fünf war, haben sie ihm gesagt, dass er adoptiert ist. Erst hat er sich darunter nichts vorstellen können. Er hatte ja Eltern. Dass seine Mutter ihn nicht geboren hatte, das hatte ihn so wenig interessiert, wie es andere kleine Kinder interessiert, dass ihre Mutter sie geboren hat. Erst als ihm eines Tages der erschreckende Gedanke zugeflogen war, dass es dann eine andere Frau geben musste, die ihn zur Welt gebracht hatte, erst da hatte er das Seltsame seiner Situation begriffen. Der Gedanke an eine andere Mutter war ihm so absurd vorgekommen, so unangenehm, dass er ihn loswerden wollte. Er hatte eine Zeitlang große Angst davor gehabt, dass die andere Mutter auftauchen und ihn mitnehmen könnte. Er hatte sich so in den Gedanken hineingesteigert, dass er heimlich seine Sachen sortiert und überlegt hatte, welche Dinge er mitnehmen wollte. Er hatte solche Angst vor diesem in ungewisser Zukunft liegenden Ereignis gehabt, dass er es sich irgendwie auch schon herbeiwünschte, um die endlose Qual des Wartens loszuwerden.
Die Eltern hatten damals einen Kinderpsychologen zu Rate gezogen, Dr. Wörschredt, als sie meinten, sie würden mit ihm nicht zurechtkommen. Sie sagten, er wäre oft abwesend. Es war eine Zeit des großen Verabschiedens, auch von seinen Freunden in der Schule hatte er sich verabschiedet, erzählte ihnen, dass er bald weggehen würde. Es war ihm, im Nachhinein, wie ein echter Abschied vorgekommen, denn nach dieser Episode war er wirklich ein anderer, auch neue Freunde hatte er sich gesucht.
Die Eltern waren erleichtert gewesen, als sie erfahren hatten, dass es nur die Angst war, die ihn so verändert hatte. Dass er Angst davor gehabt hatte, die Familie verlassen zu müssen. Diese Angst, sagten sie, könnten sie ihm nehmen. Damit würden sie klarkommen.
Wir lieben dich. Du bist unser Sohn. Wir sind deine Eltern. Du musst uns nicht verlassen.
Und er ist immer noch hier. Er wohnt noch unter ihrem Dach. Er ist zweiundzwanzig und wohnt bei seinen Eltern. Es ist nett in seinem Zimmer. Er mag die Dachschrägen und die dunklen Holzbalken. Alles ist ordentlich aufgeräumt. Er putzt jedes Wochenende die Fenster, saugt unter dem Bett, wischt Staub und wechselt die Bettwäsche. Er hat alle seine Sachen, die DVDs, seine Star-Wars-Figuren und die Bücher über die polizeiliche Ausbildung sortiert und in dem weißen Regal aufgereiht. Seine Kleider liegen und hängen ordentlich im Schrank. Wenn er unruhig und schlecht gelaunt ist, dann geht er ins Bad und lässt Wasser in den blauen Eimer laufen. Er nimmt einen sauberen Lappen und fängt an, sein Zimmer zu putzen. Er hockt auf den Knien und wischt die Fußleisten, holt den Staub von den Bücherrücken und wischt bis in den letzten Winkel. Er putzt auch Helgas Wohnung, sie kriegt es nicht mehr so gut hin. In die Ecken geht sie nicht. Unter dem Sofa bleibt es dreckig. Sie krümelt auch, zunehmend krümelt sie herum, mit ihren Keksen und Broten, die sie sich mit vor den Fernseher nimmt. Sie scheint es gar nicht zu sehen, dass andauernd alles vollgekrümelt ist.
Er liegt auf seinem Bett und spielt mit dem Handy. Er schreibt: «Mir ist so heiß. Und Bier ist alle.» Er schreibt das an Simon. Aber er schickt es nicht ab. Er schreibt noch ein paar andere Nachrichten an Simon. Die erste hätte er vielleicht noch abschicken können, aber diese hier, die er jetzt schreibt, die kann er nicht abschicken. Er schreibt: «Ich möchte dich küssen.» Dann schreibt er: «Du bist schön.» Dann: «Ich steh auf deinen Rücken. Deinen Arsch. Deine Brust. Deine Haare.» Dann schreibt er: «Ich will dich ficken.» Dann lässt er die Hand mit dem Handy sinken. Mit ausgebreiteten Armen liegt er im Bett. Ich will dich ficken. Wenn er das abschicken würde.
Er denkt an das Mädchen, das er mit Simon und Ralph zusammen gesehen hat. Sie tranken Bier und laberten so rum, dummes Zeug, einfach nur so, und da saß dieses Mädchen und wartete vielleicht auf jemanden, schmal, kurze dunkle Haare, in weiten Hosen, sie hatte große Schneidezähne, wenn sie lächelte, und sie lächelte immer wieder und sah von ihrem Platz aus immer wieder zu ihm her.
Sie mögen ihn. Solange sie nicht wissen, dass er Polizist ist. Manchmal, wenn es so einfach gewesen war, wenn ein Mädchen sehr hübsch war, klug und freundlich, wenn sie zusammen über etwas gelacht hatten, wenn sie sich so rübergebogen hatte, zu ihm hin, dann hatte er sich überwunden. Er hatte es eine Zeitlang sogar richtig gewollt. Er hat die Mädchen genießen wollen. Er hat sich aber, zu jedem einzelnen Schritt, überwinden müssen. Er hat ihnen ihre Schönheit zugestehen müssen, denn hübsch waren sie ja alle gewesen, diese Mädchen, die sich ihn ausgesucht hatten. Er hat sich das Anziehende an ihnen erklären müssen, es sich fassbar machen, er hat mit ihnen plaudern, flirten und sie dann verführen wollen. Aber sie hatten diesen Part mehr als er übernehmen müssen. Er hat das Plaudern, Flirten und Verführen nicht besonders gut gekonnt. Es war zu schwer gewesen, es hatte ihn angestrengt. Sie küssten ihn, und er küsste sie. Er versuchte sogar, mit ihnen zu schlafen. Aber sie waren dann nie weiter gekommen als bis dahin. Es war einfach nicht das Richtige. Er gestand es sich ein und hörte damit auf. Es erleichterte ihn, und er konnte wieder entspannter mit ihnen sein. Er ist gerne mit Frauen zusammen. Er hat Respekt vor ihnen, vor ihrer Andersartigkeit, und er schätzt sie, weil sie sich solche Mühe geben, weil sie sich anstrengen. Die Frauen, so kommt es ihm vor, strengen sich mehr an als die Männer. Sie kommen damit nicht weiter, aber es ist ihm immer angenehm gewesen, mit Frauen zusammenzuleben. Mit der Mutter, der Schwester und der Oma. Mit dem Vater ist es anders gewesen, er hat im Haus nicht so gelebt. Er hat am Esstisch gesessen, er hat ferngesehen, und es hat auch Gespräche gegeben. Aber im Haus gelebt haben nur die Frauen. Und er. Vielleicht, so fühlt er ganz unklar, ist es doch eine natürliche Sache, dass der Vater jetzt getrennt von ihnen lebt, in dem Haus auf dem Hof. Vielleicht ist das besser.
Er döst auf dem Bett, da tönt sein Handy in seiner ausgestreckten Hand. Er weiß, von wem er die Nachricht bekommen hat, er hat es so eingestellt, dass Nachrichten von Simon anders klingen als Nachrichten von anderen.
«Sitzen im Vierundzwanzig. Kommst rum?»
Es gefällt ihm nicht, dass Ralph vermutlich der andere Teil vom «wir» ist, mit Ralph nimmt es immer dieselbe Richtung, da labern sie immer nur rum und fallen vielleicht noch unangenehm auf, aber er zieht sich seine Hose an, er kämmt seine Haare, er putzt die Zähne, dann verlässt er das Haus. Der Himmel ist dunkel, aber das Licht aus den beiden Häusern, dem großen mit den vielen Fenstern und den drei kleinen über der Garage, erhellt noch den Hof. Es ist kalt. Es ist viel zu kalt und viel zu spät. Er startet den Wagen, der, wie schon der Volvo, immer vor der Garage parkt, weil in der Garage zu viel Zeug steht. Er hat ihn sich selbst gekauft, von seinem selbstverdienten Geld, einen Citroën C4 in Weiß, mit Lederlenkrad, Alufelgen, Sitzheizung und allem Schnickschnack. Ein Auto, das er nicht braucht. Ein Familienwagen. Darum fahren auch alle mit diesem Auto, außer Imke, die hat noch keinen Führerschein, die wird wahrscheinlich auch keinen brauchen. Imke hasst sein Auto. Imke hasst seinen Beruf. Seine Ordnung, seine Freunde, seine Musik und seine Klamotten. Imke hasst alles an ihm. Nur ihn hasst sie nicht. Er hasst sie auch nicht. Er liebt kaum einen anderen Menschen so wie diese größte Schlampe auf der Welt.
«Siehst du die Weiber da drüben?», sagt Simon. «Die sind doch ganz fabelhaft.»
Fabelhaft, das sagt er seit einer Weile. Er hat das Wort irgendwo gehört. Und jetzt sagt er es andauernd.
«Die sind nicht schön oder so, aber ich finde sie ganz fabelhaft», sagt Simon und lächelt. Er will die Weiber gar nicht anmachen. Alexander ist erleichtert. Er ist ein bisschen betrunken, und wenn Simon betrunken ist, also noch nicht richtig besoffen ist, sondern noch kurz davor, dann betritt er die weiten Hallen der Liebe. Dann liebt er die Menschen, alle Menschen liebt er dann. Sein Herz weitet sich durch Alkohol. Und in diesen Momenten liebt er auch Alexander. Er legt seinen Arm um ihn und drückt ihn. Alexander riecht seinen Bieratem.
«Die sind viel zu gebildet, für uns», flüstert Simon. «Die wollen uns gar nicht.»
«Da kannst du recht haben», sagt Alexander.
Simon ist ein großer, starker Mann. Er trainiert im selben Studio wie Alexander, nur mit mehr Biss, mit mehr Wut. Es ist ihm wichtig, stark zu sein. Er hat ihn schon öfter beim Duschen gesehen, und da reden sie dummes Zeug und schäumen sich wie wild unter den Armen ein und betrachten sich verstohlen. Seine Oberarme sind wie riesige, zum Sprung gespannte Froschschenkel, mit diesen Äderchen und in dieser Angespanntheit, und seine Waden sind so rund wie die Waden von Alexanders Cousine René. Ein kleiner Streifen flaumigen Haares wächst von unten zum Bauchnabel empor. Alexander seufzt. Simon hat ein blau-weiß gestreiftes Poloshirt von Lacoste an. Poloshirts von Lacoste sind seine Ausgehkleidung. Sein Gesicht ist braun, auch im Winter. Seine Gesichtszüge sind hart, aber er hat eine unkontrollierte, sehr bewegte Mimik. Er kneift die Augen zusammen und kraust die Nase, er sieht oft gequält aus, wie ein Kind, das plötzlich die Nerven verliert, wegen einer Sache, die nur das Kind versteht und die es nicht in der Lage ist, der Welt begreiflich zu machen. Er hat keine Beherrschung in seinem eisernen, braunen Gesicht.
«Mit wem warst du hier?», fragt Alexander.
«Mit wem?» Simon sieht ihn an.
«Du hast wir gesagt, in der SMS.»
«Mit wir hab ich mich gemeint», sagt Simon.
«Dich?»
«Und die Frauen.»
«Diese Frauen?»
«Diese Frauen.»
Alexander nickt. Er bestellt sich ein Bier. Eins kann er trinken.
«Du hast doch mit diesen Frauen gar nichts zu tun, man, Alter? Hast du gedacht, die reden mit dir? Warst du so optimistisch?»
«Ich habe gar nichts gedacht. Es hat sich besser angehört.»
«Wir hat sich besser angehört?»
«Mehr so nach Gesellschaft.»
Alexander nickt. Simon bestellt zwei Helbinger für beide.
«Trink!»
«Ich bin mit dem Auto.»
«Trink!»
«Du musst morgen arbeiten. Das hast du doch nicht vergessen?»
Simon winkt ab. Er kippt seinen Schnaps runter. Dann grübelt er über morgen nach, Alexander sieht es ihm an. Morgen kommen die Bremer ins Volksparkstadion. Simon ist immer für den HSV. Er ist Fan, und er kann den Hass der anderen Fans vielleicht verstehen. Aber er steht immer auf einer Seite. Alexander steht auf keiner Seite. Er ist ein Polizist, der seine Arbeit macht. Er beobachtet sich selbst mit Stolz, wie er ordentlich und neutral dabei ist. Er ist keiner, der ausrastet, er ist professionell. Kann sich zusammenreißen. Er hat sich etwas ausgedacht, was er sich denken kann. Er denkt: Das geht dich nichts an. Wenn es heikel wird, dann denkt er immer: Das geht dich nichts an. Und dann ist es, als würde er die Dinge damit von sich weghalten. Er hat es von Helga. Er hat ihr von seinen Problemen erzählt. Wie er fühlt, welche Wut er manchmal empfindet. Sie hat gesagt: «Mein Alex, das geht dich nichts an.» Er hat ihr erzählt, dass er einen Einsatz nicht gut findet, dass er sich nicht wohlfühlt bei bestimmten Dingen, die er zu tun hat. Da hat sie gesagt: «Mein Alex, das geht dich nichts an.» Und daran muss er denken, in solchen Situationen. Es hat geholfen. Es hilft. Er sagt es fest vor sich hin: Es geht dich nichts an.
Für Simon ist das alles anders. Alexander hat versucht, ihm etwas von Helgas Lebensweisheit in die Einsätze mitzugeben, aber Simon hat ihn nur angesehen und den Kopf geschüttelt. «Sag mal, spinnst du, Alter? Es geht mich nichts an? Das ist mein Einsatz!»
Einmal hat Alexander ihn weinen sehen. Es war nach einem Fußballspiel, die Bayern waren da gewesen, ein Riesentheater, und es war ganz unverständlich, wo die alte Frau in dem Getümmel nach dem Spiel auf einmal hergekommen war. Sie lag plötzlich auf der Straße, auf dem Rücken, wie ein verlorenes Kleidungsstück, inmitten der taumelnden Menge, sie trug einen Mantel aus einer Art ganz kurzen, grauen Felles, wie Katzenfell, hatte er gedacht, ob es Mäntel aus Katzenfell gab? Und aus ihrer knochigen Hand war ein Strauß Unkraut gefallen, die einzelnen Pflanzen lagen auf der Straße verteilt. Es war ihm nicht klar, ob es sich um gekaufte Blumen gehandelt oder ob sie irgendwo etwas ausgerissen hatte, ob sie vielleicht verrückt gewesen war. Sie mussten um sie herumstehen, damit sie nicht zertrampelt wurde, und sie erfuhren später, dass sie gestorben war, bevor der Krankenwagen sie in dem Getümmel erreicht hatte. Simon hatte bei ihr gekniet, das Visier hochgeklappt, und Tränen waren über sein Gesicht gelaufen, während rundherum ein Sturm tobte. Er hatte sich dadurch nicht direkt unbeliebt gemacht. Die anderen mochten es, wenn man Gefühle zeigte, gegenüber den richtigen Menschen. Sie hätte ihn an seine Oma erinnert, hatte Simon gesagt, aber Alexander glaubte es nicht. Simons Oma war eine starkgeschminkte, laute Frau, die belegte Brötchen in einem Fischladen im Billstedt Center verkaufte. Wie sollte diese lebhafte, unwirsche Frau ihn an das Knochenbündel auf der Erde erinnert haben? Simons Weinen ging auf etwas anderes zurück. Womöglich auf Überforderung.
«Das Spiel.» Simon grinst und blinzelt müde mit den Augen.
«Na ja, das wird schon was geben.»
«Aber demnächst», sagt Simon und nimmt sich Alexanders Kümmel vor, «da kommt G20. Schon mal dran gedacht?»
«Ich denk nicht viel nach.»
«Es hat auch keinen Sinn. Du machst halt, was du machen musst. Ist ja auch nicht so, dass du groß denken sollst. Du sollst die Klappe halten und tun, was sie dir sagen. Das ist alles. Und das gefällt mir daran.»
«Machst du dir Sorgen wegen G20?»
«Ach was», sagt Simon.
«Und am Ende stehen uns die da gegenüber», sagt Alexander und hebt den Kopf Richtung der Frauen, der fabelhaften Weiber.
«Solche wie die», sagt Simon. Und nach einer Weile: «Und deine Schwester.»
«Wie kommst du auf sowas?»
«Na ja, ich hab sie gesehen. Mit so …»
«Mit so was?»
«Mit so Zecken halt.»
«Wieso Zecken?»
«Na, weil sie so aussehen. Du weißt doch, wie die aussehen. Pass mal auf, mit wem die rumhängt, deine Schwester. Pass da mal lieber auf!»
Imke läuft vorbei an beleuchteten Garagen und Einfahrten, an Hecken, an Büschen voller auf- und abtanzender kleiner, weißer Lichter, an wandhohen Fernsehbildern, Golden Retrievern vor dem Kamin und blinkenden Weihnachtsbäumen, läuft vorbei wie an störrischen, alten Erinnerungen. Die Reste vom Silvesterfeuerwerk sind schon aufgekehrt, ein einzelner Weihnachtsbaum liegt, wie gerade erst in der Baumschule abgesägt, neben dem Gehweg, den Fuß in der Luft, und etwas Flatterndes hat sich in seinen Haaren verfangen: ein verklebtes Hamburger Wochenblatt. Räder quietschen auf den Schienen.
Vor dem Bahnhof Wandsbek kommt ihr eine Frau in einem gelben Anorak entgegen, die einen Hund hinter sich herzieht, der auch einen gelben Anorak trägt. Der Hund absolviert mühsam Schritt für Schritt, die Frau wartet, bis der Hund bei ihr ist, dann geht sie weiter, soweit es die Hundeleine erlaubt, wartet wieder. Der Hund seinerseits beginnt seinen schweren Marsch erst, wenn sie stehen geblieben ist, nie gehen sie gemeinsam, zur gleichen Zeit. Wie viel Geduld kann man haben?, fragt sich Imke. Wie viel Geduld? Müssen sie denn gehen? Müssen sie denn überhaupt gehen, wenn sie nicht wollen?
Als die Frau vor ihr angelangt ist und stehen bleibt, bleibt Imke auch stehen: «Er hat keine Lust mehr, was?»
Die Frau hat die Kapuze ihres gelben Anoraks so fest um ihr Gesicht gebunden, dass ihr an den Rändern eingeschnürtes Gesicht herausquillt wie das einer Knetfigur. So weich und nachgiebig scheint das rötliche, leicht geschwollene Gesicht zu sein, als könnte man, wenn man wollte, ein ganz anderes Gesicht in es hineinkneten.
«Wie bitte?»
«Der Hund. Er will gar nicht mehr laufen.»
Die Frau sieht den Hund an, der die Frau ansieht, als würden sie sich gar nicht kennen oder sich wundern, dass sie einander haben.
«Wir haben Arthrose», sagt die Frau und meint vielleicht den Hund, aber vielleicht hat sie auch Arthrose. Vielleicht haben sie alles zusammen, der Hund und sie.
«Der Arme», sagt Imke.
Der Hund kommt heran und schnüffelt an Imkes Stiefeln, er riecht nach Hund. Der Geruch berührt Imke in der kalten, klaren Luft wie der überwältigende Geruch eines ganzen Pferdestalles. Der gelbe Anorak des Hundes ist in kleine Rhomben abgesteppt. Er hebt den Kopf und sieht Imke aus verklebten Augen an, wie, als hätte er eine Frage.
Winzige Schneeflocken taumeln durch die Luft, klein wie graue Fliegen. Punkte auf der Netzhaut. Der Hundegeruch und die Kälte und die winzigen Punkte verbinden sich zu einer kompakten Erinnerung für irgendwann später. Im Sommer. In der Nacht.
«Er ist einfach nur dickköpfig», sagt die Frau und lächelt angestrengt, ihre Lippen zittrig offen.
«Er hat bestimmt Schmerzen?»
«Das macht doch nichts», sagt die Frau und lächelt, noch stärker zittern ihre Lippen. «Das ist er doch gewohnt.»
Imke nickt, obwohl sie es nicht versteht und es ihr plötzlich vorkommt, als ob dies alles in einem isolierten Raum stattfindet, in dem sie nur getestet wird. Die Frau hat ja recht. Der Hund istdickköpfig, jetzt sieht sie es ja selbst. Die Dinge verändern sich, sobald man Einblick bekommt. Die meisten Sachen sind verborgen.
Die Bahnstation ist so tot, als würde niemals mehr eine Bahn kommen. Die Station ist immer so. Eine stille Station, in der Menschen nur stören. Zu anderen Zeiten sind schon welche da. Aber dann ist es vielleicht eine ganz andere Station. Am Abend und im Winter sind da keine. Jedenfalls nicht heute. Heute schneit es in ganz kleinen Flocken, und durch einen verschmierten, dunklen Himmel schimmert matt und verwischt ein weißer Mond.
Hier wohnt sie. Zwischen den türkisfarbenen, rechteckigen Pools. Surrend öffnen sich abends die Garagentore. Schlanke Frauen fegen in offenen Steppmänteln, unter denen sie enge Rollkragenpullover tragen, den Gartenweg. Freundlich reden sie mit dem Gärtner und ziehen wie nebenbei ein welkes Blatt aus ihrem langen, glatten Haar. Am Wochenende spazieren kleine Mädchen, in den Reitstiefeln, die sie so gerne tragen, dass sie damit schlafen gehen – und die Eltern erlauben es, so sind diese Eltern –, mit dem Vater durch die Grünanlage. Abends üben sie dann noch einmal das hübsche Klavierstück, bevor sie den Fernseher einschalten.
Sie hätte nicht gedacht, dass sich in ihrer Familie jemals etwas ändern würde. Sie hat schon sehr lange gemerkt, dass die Zeit einfach stehenbleibt. Dass sie selbst darin feststeckt, dass sie niemals richtig rauskommt, dass ihre Kindheit niemals zu Ende geht. Diese Kindheit zieht sich endlos dahin. Sie geht ja immer noch zur Schule. Sie wirft ja immer noch jeden Abend ihre Klamotten auf den runden Ikea-Teppich vor ihrem Bett. Sie klappt immer noch denselben hellblauen Toilettendeckel hoch, jeden Tag mehrmals, und ihre Eltern sind wie Bäume, neben denen sie wurzelt, eine freundliche Gewissheit.
Aber wenn sie gleich bei Miguel ist, mit Elisabeth, Lara, Paul, Elias, Victoria und Maja, dann kann sie sagen: Olla! Mein Vater ist über die Garage gezogen.
Und Lara wird sagen: Krass!
Während sie schon in der Bahn sitzt und alldem entgegenfährt, kommt ihr ein Gedanke: Vielleicht zieht die Anorak-Frau den Anorak-Hund wie eine Art kranken, kleinen Teil von sich selbst hinter sich her. Sie hofft, jemandem von diesem Gedanken erzählen zu können.
Am Nachmittag trifft sie Frau Marquart mit ihrem Hund. Sie und der Hund tragen beide den gleichen Anorak. Was sie sich da wohl drauf einbildet! Sie gehen ein Stück zusammen.
«Möchten Sie vielleicht ein Stück Linzer Torte? Ich habe zu Hause so eine schöne Linzer Torte», sagt Frau Marquart.
Helga schüttelt den Kopf.
«Ich möchte lieber nichts mit mir rumschleppen», sagt sie.
«Sie können sie bei mir essen», sagt Frau Marquart.
«Wir haben ja sowas auch zu Hause», sagt Helga, «Torten haben wir, Kuchen, der ganze Schrank ist voll.»
Sie möchte auf gar keinen Fall zu Frau Marquart. Frau Marquart möchte sie immer mit zu sich nehmen, sie ist auch so eine Kadreiersche. Immer sucht sie einen Vorwand. Und es ist gar nicht sicher, das mit der Linzer Torte.
«Wissen Sie, ich darf ja sowas gar nicht essen», sagt Frau Marquart.
Helga zuckt mit den Schultern.
Es ist kalt geworden. Eigentlich gar nicht so kalt, aber windig ist es und nass, die Luft wie Eis in ihrem Gesicht. Die Klunkersuppe kommt ihr in den Sinn. Und von da ihr Appetit auf Linzer Torte.
«Haben Sie denn wirklich Linzer Torte?», fragt sie.
Hoffnungsvoll blitzen Frau Marquarts Augen auf.
«Fast noch die ganze. Ich darf ja sowas gar nicht essen.»
Helga nickt. Natascha ist nicht für Torte zu begeistern. Sie bäckt nicht. Keine einzige Torte hatten sie zu Weihnachten. Nicht mal Kuchen, nur gekauftes Gebäck.
«Ein Stück würde ich nehmen», sagt Helga.
«Ich mach uns auch Kaffee», sagt Frau Marquart.
In Frau Marquarts geducktem Haus riecht alles nach Hund. Helga bleibt im Eingang zu Frau Marquarts Wohnzimmer stehen. Seit langem schon ist sie in keinem fremden Haus mehr gewesen. Sie kennt alle Häuser und Gebäude, die sie regelmäßig betritt, seit vielen Jahren. Sie kennt den Friseurladen und die Boutique, in der sie ihre Kleidung kauft. Sie kennt den Supermarkt und kennt die Wohnungen der drei Frauen, mit denen sie sich manchmal zum Canasta trifft.
Die Fremdheit schlägt ihr entgegen wie eine böse Erinnerung, und sie hält sich am Türrahmen fest. Sie wollte gar nicht in ein fremdes Haus. Alles ist fremd.
«Ist Ihnen nicht gut?», sagt Frau Marquart.
«Ich hab die Pillen gar nicht mit», sagt Helga. Sie geht, mit Unterstützung von Frau Marquart am Arm, zum Sofa, wo sie sich neben einem Stapel Zeitungen niederlässt. Jemand müsste hier aufräumen, denkt sie. Es riecht alles nach Hund. Und nach Fremdheit, der Geruch ist so stark, dass ihr schlecht wird. Sie atmet schnell, dann lehnt sie sich im Sofa zurück und legt ihre Hände im Schoß zusammen.
Frau Marquart kommt mit Kaffee und Linzer Torte aus der Küche.
«Hier», sagt sie, «Linzer Torte.»
«Wenn Sie sie doch nicht essen können?», sagt Helga.
«Wie bitte?», sagt Frau Marquart.
«Sie sagten, dass Sie sie nicht essen können», sagt Helga.
Frau Marquart schweigt. Helga fragt sich, ob sie sie beleidigt hat.
«Ich komme ja aus Österreich», sagt Frau Marquart, «aus Weißkirchen an der Traun.»
Helga fühlt sich verpflichtet, nachzufragen, obwohl sie im Kopf mit anderem beschäftigt ist. Sie essen beide Torte, auch Frau Marquart, obwohl sie sie nicht essen darf, und Frau Marquart erzählt von Weißkirchen an der Traun und ihrem deutschen Mann und ihrem Leben in Hamburg. Helga nickt freundlich und verständnisvoll, sie hat ein ganz eigenes, eingeübtes Gesicht dafür, und denkt daran, wie sie im Türrahmen stand und die Fremdheit ihr wie etwas Altbekanntes entgegenschlug.
In einer Atempause der Frau Marquart, als sie sich etwas auserzählt hat, sagt Helga blitzschnell: «Wir mussten ja im Winter weg, wir packten alle unsere Sachen auf einen Wagen, der gehörte den Wiemers, die Jungen von denen, Karl und Fritz, die waren so jung schon im Krieg, der Karl war achtzehn, und der Fritz war neunzehn, als er musste. Ich kroch mit Gretchen unter die Bettdecken, oben auf dem Wagen. Unsere Mutter saß neben dem alten Wiemer auf dem Kutschbock, seine Frau hinten bei uns, unter dem Zelt.»
«Noch Kaffee?», fragt Frau Marquart.
Die Pferde schnauben, ihr Atem dampft in der Kälte. Es sind viele Menschen unterwegs, auf denselben Wegen wie sie, wie schwarze Ameisen wimmeln sie auf den Wegen durch die frostig weißen Felder, überall nur Steine und hartgefrorene Erde, keine Rübe liegt da mehr. Sie können die Front hören. Das Donnern.
«Wir haben eigentlich alles dalassen müssen. Unser Zimmer, das von Gretchen und mir, ist noch voll gewesen, weil wir die Sachen gar nicht mitnehmen konnten.» Nur das Album hatte sie mitgenommen, in dem so viel Unsinn dringestanden hatte, aber damals war ihr das Album wertvoll vorgekommen, doch daran denkt sie nur kurz und erzählt nichts davon. «Wir schliefen bei Bauern, zu viert in einem Bett, oben auf dem Boden, oft auch auf dem Fußboden, nur eine Pferdedecke drunter. Da war eine Frau, die hatte keine Haare mehr und hat nicht mal ein Kopftuch getragen, hat so», Helga fasst sich vorsichtig an ihr aufgeplustertes Haar, «gar nichts da gehabt als kahlen Kopf. Und die gab uns Pflaumenmus. Auf einer frischen, warmen Stulle!»
Dick ist die Frau, rote Flecken auf ihren dicken Wangen, und sie reicht ihnen, die sie schmutzig in dieser Kammer sitzen, auf großen Betten, mit ihren schmutzstarrenden Schuhen an den Füßen und ganz verkrampft und zitternd von der Kälte, da reicht ihnen diese kahlköpfige Frau warme Stullen mit Pflaumenmus, und Gretchen fängt an zu weinen. Sie weint so sehr, dass sie die Stulle gar nicht essen kann. Sie würgt an der Stulle rum, und Helga gönnt Gretchen die Stulle nicht, weil sie sie nicht mit der rechten Freude essen kann.
«Ich erinnere mich noch ganz genau an diese Pflaumenmusstulle, als wäre es eben erst gewesen. Und wie mir der Kiefer noch geklappert hat, während ich die Stulle gekaut hab.»
Frau Marquart legt ihr ein zweites Stück Linzer Torte auf den Teller, ungefragt, und gierig schlingt Helga es in sich rein, Bissen um Bissen. So etwas Leckeres hat sie schon lang nicht mehr gegessen, das muss man schon sagen. Frau Marquart sieht es gern. Wie eine Mutter lächelt sie. Dann nimmt sie ein Stück krümeligen Rand, das von der Torte abgebrochen ist, und legt es dem Hund in seinen Korb. Der Hund stubst es mit der Nase an, schnappt es und schmatzt mit der Zunge nach, leckt sich das weiße Maul. Fast ein bisschen wie Pfiffi, nur nicht so klug.
«Wir mussten über das Haff, weil die Russen schon da waren, auf der anderen Seite, von den Polen her. Über die Frische Nehrung Richtung Westen, wo es später nicht mehr ging, auch wegen der Russen. Aber da ging es noch, und wir konnten rüber. Und dann dachten wir, dass wir es geschafft hatten. Wir dachten immer wieder, dass wir es geschafft hatten. Aber wo wir auch hinkamen, die Russen kamen nach.»
Die Marquart nickt. «Ja, die Russen», sagt sie.
Am Ende hat sie geglaubt, dass sie immer weitermüssten. Immer weiter, immer weiter, für immer, und niemals wo ankommen.
«Da war ein kleiner Junge auf dem Weg, weit und breit kein Mensch. Der Wiemer packte ihn zu uns unter die Decke. Aber dann war der Junge plötzlich tot. Wir ließen ihn im nächsten Dorf. Sie wollten ihn gar nicht nehmen, die dachten, dass es unser Junge wäre. Wir wussten nicht mal, wie er hieß.»
Auf der Flucht starb dann auch die Mutter, ähnlich still wie der kleine Junge. Aber das will sie der Marquart nicht erzählen. Gehustet haben ja alle, das hieß ja nichts.