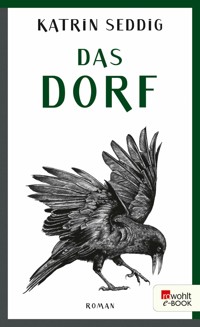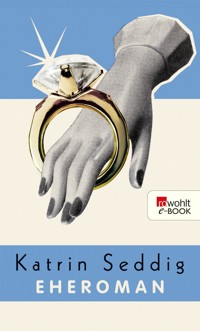10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schritte auf den Gehwegplatten, Läuten an der Tür. Gerade noch begann ein ganz normaler Abend, dann plötzlich ist alles anders. Mizzi ist tot. Vor den Zug gesprungen. Nadine versucht zu begreifen, was passiert ist mit ihrer Tochter, die sie nie wirklich verstanden hat. Und je mehr sie nachbohrt, auch in sich selbst, desto größer wird ihre Wut. Auf ihre kühl gewordene Ehe und ihren Mann Frank, der sich in der Trauer noch weiter entfernt. Auf ihren pflegebedürftigen, früher so herrschsüchtigen Vater, der ihr als Kind ständig das Gefühl gab, nicht ganz richtig zu sein. Auf Mizzis apathischen Mann Jonas und auf Christian, Nadines Chef, einen mittelmäßigen Anwalt. Und als Nadine dann erfährt, dass Mizzi einen heimlichen Liebhaber hatte, der irgendwie in alles verstrickt sein muss, explodiert in ihr eine Bombe. Nadine wirft einen gnadenlosen Blick auf ihr Leben und erkennt endlich die Rolle, die sie darin als Tochter, Ehefrau, Mutter einnahm. Sie wollte es immer allen recht machen, hat immer nach den Regeln gespielt. Das ist jetzt vorbei. Mizzi ist tot, und Nadine will Rache. Mit brillanter Beobachtungsgabe erzählt Katrin Seddig von einer Frau, die der Welt den Kampf ansagt – fesselnd wie ein Thriller, tragikomisch und herrlich boshaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Katrin Seddig
Nadine
Roman
Über dieses Buch
Schritte auf den Gehwegplatten, Läuten an der Tür. Gerade noch begann ein ganz normaler Abend, dann plötzlich ist alles anders. Mizzi ist tot. Vor den Zug gesprungen.
Nadine versucht zu begreifen, was passiert ist mit ihrer Tochter, die sie nie wirklich verstanden hat. Und je mehr sie nachbohrt, auch in sich selbst, desto größer wird ihre Wut. Auf ihre kühl gewordene Ehe und ihren Mann Frank, der sich in der Trauer noch weiter entfernt. Auf ihren pflegebedürftigen, früher so herrschsüchtigen Vater, der ihr als Kind ständig das Gefühl gab, nicht ganz richtig zu sein. Auf Mizzis apathischen Mann Jonas und auf Christian, Nadines Chef, einen mittelmäßigen Anwalt. Und als Nadine dann erfährt, dass Mizzi einen heimlichen Liebhaber hatte, der irgendwie in alles verstrickt sein muss, explodiert in ihr eine Bombe. Nadine wirft einen gnadenlosen Blick auf ihr Leben und erkennt endlich die Rolle, die sie darin als Tochter, Ehefrau, Mutter einnahm. Sie wollte es immer allen recht machen, hat immer nach den Regeln gespielt. Das ist jetzt vorbei. Mizzi ist tot, und Nadine will Rache.
Mit brillanter Beobachtungsgabe und tiefgründigem Humor erzählt Katrin Seddig von einer Frau, die der Welt den Kampf ansagt – fesselnd wie ein Thriller und herrlich boshaft.
Vita
Katrin Seddig, geboren in Strausberg, studierte Philosophie in Hamburg, wo sie auch heute mit ihrer Familie lebt. Über «Runterkommen» (2010) schrieb die taz: «Ein brillantes Debüt … Anrührend, witzig und nüchtern.» Über «Eheroman» (2012) urteilte Der Tagesspiegel: «Grandios, wie Katrin Seddig jeder ihrer Figuren einen eigenen Ton verleiht». Zuletzt erschienen «Das Dorf» (2017) sowie der Roman «Sicherheitszone» (2020), für den Seddig mit dem Hamburger Literaturpreis und dem Hubert-Fichte-Preis ausgezeichnet wurde.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Miriam Bröckel
ISBN 978-3-644-01646-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Sie fährt in den Wald und gräbt ein Loch. Es ist nicht einfach, denn der Boden ist voller Wurzeln und Steine. Obwohl es erst früher Nachmittag ist, wird es schon dunkel. Silbern schimmern die Wassertropfen in den verlassenen Spinnennetzen, Kälte steigt vom Boden auf. Trotzdem schwitzt sie. Es ist eine fiebrige Hitze, die sie von innen heraus schwächt wie eine Krankheit, die sie aber auch antreibt. Einzelne schwere Tropfen klatschen auf ihren Kopf, während sie sich stetig weiter in den Boden gräbt. Immer tiefer gräbt sie, hundert Schichten unter ihren Füßen. Blätter, Äste, Tiere, Pilze, Würmer. Alles lebt, alles stirbt, verfault, wird zu Erde. Dann kommen neue Blätter, neue Äste, neue Tiere, leben, sterben, verfaulen, werden zu neuer Erde, immer und immer so weiter. Ab und zu kommt mal ein Mensch dazu, wo ist der Unterschied? Es gibt keinen. Irgendwann ist alles Erde.
1
Sie liegt, die Arme im Nacken verschränkt, im hinteren Teil des Gartens auf einer Liege und betrachtet ihre ausgestreckten Beine. Egal wie viele Übungen sie macht, sie hat einfach keine zierlichen Fesseln, und wie soll sich das auch ändern? Den Waden fehlt dadurch der Schwung, wie ein kräftiger Stamm laufen ihre Beine nach oben, wenn sie länger steht, schwellen die Adern an, und alles bekommt ein hässliches Muster.
«Lass uns den Abend doch noch ein bisschen genießen», hatte Frank vorgeschlagen.
Wie soll man denn einen Abend genießen, wenn er so was sagt?
Ein sanfter Wind weht, und ein Ahornblatt trudelt über den Rasen. Es bleibt im Gras hängen, wird dann vom Wind wieder aufgehoben und ein Stück weitergetragen. Der Sommer ist vorbei, auch wenn es immer noch August ist und tagsüber richtig heiß. Aber etwas ist schon anders. Vielleicht ist es das Licht, vielleicht ist es der Wind, oder vielleicht sind es die Blätter? Vielleicht ist es auch das tote Kaninchen, das sie gestern Morgen in der Nähe des Zaunes gefunden hat. Es war noch ganz klein, und zuerst hatte sie gedacht, es wäre ein Spielzeug. Das Fell ganz zerdrückt und feucht von der Nacht.
Immer schon hat ihr diese Zeit des Jahres zugesetzt, der Übergang. Wenn es dann wirklich Herbst geworden ist, macht es ihr nichts mehr aus. Aber Ende August stirbt etwas.
«Warum lachst du?», fragt Frank. Er sitzt auf einem der Stühle, die zu derselben Garnitur Gartenmöbel gehören wie ihre Liege, und liest in einer Zeitung. Aber jetzt nicht mehr. Er sieht sie über seine Lesebrille hinweg an.
«Der Sommer ist vorbei.»
«Darum hast du gelacht?»
Sie zuckt mit den Schultern und verzieht das Gesicht.
«Was daran ist lustig?»
«Ich weiß es nicht.»
Eine Weile sieht er sie noch auf diese forschende Art an, dann liest er wieder in seiner Zeitung. Sie denkt, dass er gar nicht liest oder dass er liest und gleichzeitig über etwas anderes nachdenkt, über sie natürlich. Und schon schaut er sie wieder über die Brille hinweg an.
«Macht es dich traurig? Hast du deshalb gelacht, weil es dich traurig macht?»
«Kann schon sein.»
Er räuspert sich, seit einiger Zeit hat er diese Angewohnheit, er hebt die Augenbrauen, dreht den Kopf und lässt seinen Blick über den Garten schweifen. «Wir haben es doch wirklich schön hier, nicht?»
Sie kann ihm darauf nicht antworten. Aber er erwartet es gar nicht. Da starrt sie wieder ihre Beine an, die wenigstens nicht schön sind. Das würde er nicht sagen können.
Sie kehren beide zu ihren Gedanken zurück, jeder für sich. Sie zu dem Ende des Sommers und ihren Beinen. Halb sitzt sie, halb liegt sie und beobachtet die kleinen Fliegen über dem Kompost, die zitternden Spinnennetze, die zwischen Geräteschuppen und Hecke gesponnen sind, die Spatzen, die sich immer wieder wild auf etwas stürzen, das ihr verborgen bleibt, und die Wespen, die schon seit Tagen wie besoffen taumeln, auf dem Boden kreiseln und brummen, als könnten sie so ihrem Schicksal entgehen. Sie hört Frank mit der Zeitung rascheln. Sieht seinen Körper auf dem Stuhl sich krümmen, das Alter von ihm Besitz ergreifen. Er ist schon alt. Seine Haltung ist die Haltung eines alten Mannes. Die Art, wie er auf dem Gartenstuhl sitzt, ein Bein steif über das andere geschlagen, die rührenden, hellblauen Strümpfe an seinen mageren, alten Waden, und wie er in die Zeitung starrt, weil er etwas braucht, an dem er sich festhalten kann.
Sie sagt: «Der Garten ist wirklich schön», weil sie ihn beruhigen will. Um ihm etwas von seiner eigenen Angst zu nehmen. «Ich könnte glatt noch Lust auf einen Schluck Wein bekommen.»
Sie sieht, dass er sich freut.
«Ich habe vorhin welchen kalt gestellt.»
Zu rasch, zu unkoordiniert richtet er sich auf, stößt dabei ein Wasserglas vom Gartentisch, die Zeitung gleitet ihm aus der Hand, und fast hätte sie gelacht. Bekümmert starrt er auf die Scherben, geht dann aber auf das Haus zu, ohne sich weiter zu kümmern. Sorgfältig lenkt er seine Schritte über die Gehwegplatten. In dem Moment bedauert sie, dass er geht. Sie bedauert, dass er deswegen das Glas zerschlagen, die Zeitung durchnässt, seinen gemütlichen Platz verlassen hat. Sie will ihm nachrufen: Komm zurück! Sie will doch gar keinen Wein. Es war doch nur ein Impuls gewesen.
Kurz darauf hört sie aus der Entfernung die Hausklingel. Sie bleibt sitzen, dreht nur den Kopf, sieht das gelbe Licht im Fenster, hört die Stimmen.
Sie weiß, dass etwas passiert sein muss, etwas, das das Fehlerhafte, Unerhörte dieser späten Störung rechtfertigt. Sie denkt, dass es hier, im Garten, solange sie auf ihrer Liege sitzt, noch nicht passiert ist. Hier haben sie es doch wirklich ganz schön, jetzt kann auch sie es sehen. Ganz deutlich wird es ihr bewusst, wie schön sie es haben, wie wichtig es ist, sich das immer wieder zu sagen.
Sie sieht Frank, wie er in der Terrassentür erscheint. Er hat einen Abdruck im Gesicht und will diese Form nun ihr aufdrücken. Sie denkt: Nein, das tust du nicht.
Er kommt auf sie zu. Sie kann es nicht verhindern. Auch jetzt setzt er seine Füße sorgfältig auf die Platten und tritt nicht einmal versehentlich auf den Rasen.
«Es war die Polizei.»
Sie will es nicht wissen, aber es bleibt ihr nichts anderes übrig.
«Mizzi ist tot. Sie ist unter den Zug gekommen.»
Wie ein Kind steht er da, wie ein Kind, denkt sie. So ein hässliches, altes Gesicht zu seiner ganzen Kindhaftigkeit.
«Wie kommt sie denn unter den Zug?»
«Sie ist selbst …»
Ein rötliches Blatt taumelt über seinem Kopf. Sie sieht, wie es sich bewegt, hin und her, und schließlich – ist das zu glauben? – auf seinem Kopf liegen bleibt.
Danach kann sie den Gedanken nicht mehr loswerden, dass all das nicht passiert wäre, wenn sie Frank nicht hätte gehen lassen. Wenn sie nicht den Wunsch nach Wein geäußert hätte. Sie hatte doch gar keinen Wein gewollt. Es war doch gar nicht nötig gewesen.
Jetzt ist sie wieder, was sie vor Mizzi gewesen war. Wenn sie vorübergehend geglaubt hatte, jemand Besseres geworden zu sein, jemand, der eine Tochter wie Mizzi hat, dann hatte sie sich geirrt. Insgeheim aber hatte sie es immer gewusst, von Anfang an. Dass es nicht richtig war, dass es ihr nicht zustand.
2008 warf Mizzi ihren Eltern nur einzelne Worte hin, die sie bellte wie ein Hund. In Nadines Gegenwart war sie mürrisch und düster; sobald ihre Freunde auftauchten, blühte sie auf und war heiter und sogar übermütig. Nadine konnte sich nicht erklären, was Mizzi das Leben zu Hause so zur Hölle machte, dass sie es ihrerseits ihren Eltern zur Hölle machen musste.
Nadine kroch in der Nacht aus ihrem Bett, weil sie Mizzi irgendwo liegen sah, im Wald, an einer Straße oder auf irgendeiner Matratze. Sie fuhr herum, klingelte wahllos bei den Freunden, von denen sie noch wusste, die aber inzwischen mit Mizzi gar nichts mehr zu tun hatten. Nur ein einziges Mal hatte sie Erfolg.
Es war drei Uhr morgens, sie fuhr die Landstraßen zwischen den Nachbarorten ab, sie konnte nicht damit aufhören, sie wusste, wenn sie das tat, würde sie es hinterher bereuen. Sie wusste nicht, warum sie das wusste, aber sie wusste es eben. Sie wusste auch, dass dieses Wissen nichts bedeutete, aber das entließ sie nicht aus ihrer Pflicht.
Sie erkannte sie gleich. Mizzi trug ihren kleinen Rucksack auf dem Rücken und wankte als schmaler, schiefer Schatten auf der Straße dahin. Sie wandte sich halbherzig den Scheinwerfern zu und hob müde ihren Arm. Nadine stieg sofort aus und schrie: «Mizzi!»
Mizzi starrte sie eine Weile an, bevor sie sagte: «Machst du’n hier?»
Wankend öffnete sie die Beifahrertür und stieg ein. Sie zog die Beine hoch auf den Sitz, legte die Arme um die Beine, den Kopf auf die Knie.
«Lass mich in Ruhe!»
Nadine gehorchte. Aus den Augenwinkeln sah sie Mizzis zusammengerollte Figur.
Als sie ausstiegen, konnte sie sich nicht mehr beherrschen.
«Ich dreh durch, Mizzi, ich dreh noch durch!»
Mizzi schlang ihre Arme um sie.
«Ich dachte, dass wenigstens einer mal anhält», schluchzte sie, «aber keiner hält an, keiner!»
«Solche Arschlöcher!», sagte Nadine, die es nicht wagte, nach all den anderen Details zu fragen.
Mizzi weinte an Nadines Hals, und Nadine fühlte sich sehr glücklich, auch wenn sie wusste, dass es nicht ideal war, da ihre Tochter sehr unglücklich war.
Es blieb das einzige Mal. Wie oft fuhr sie danach noch diese verfluchte Chaussee entlang und starrte sich die Augen aus? Sie sah sie als Schatten, zusammengekauert im Graben. Sie sah sie in den Büschen. Sie sah sie im Wald, an dessen Rand Nadine wirklich anhielt, in den sie wirklich hineinging. Als sie zwischen den schwarzen Stämmen stand und ihr Blut in den Ohren rauschte, fragte sie sich, ob ihre Tochter sie liebte. Sie wusste es nicht.
2
Der Hund bellt in seinem Zwinger. Er bellt gleichmäßig, hoffnungslos, er will etwas kundtun, aber er erwartet nichts. Sie tritt an die Stäbe seines staubigen Heims. «Was bellst du so?»
Für einen Moment hört er auf zu bellen und sieht sie an, kläglich fiepend, aus verklebten, alten Augen.
«Mizzi ist tot.»
Als sie ihren Vater im Schlafanzug in seinem Sessel vorfindet, kommt es ihr so vor, als ob er es schon weiß.
Sie denkt, der Hund, das ist er.
Sie denkt, der Hund geht mich nichts an.
Sie denkt, es ist nicht meine Schuld.
Er sitzt in seinem Sessel, in seinem Schlafanzug, die Hände im Schoß ineinandergelegt, und starrt sie misstrauisch an. Wenn er bellen könnte, würde er es tun.
Das Haus hat die Sauberkeit, die Fremde schaffen. Es ist geputzt, aber niemand wirft etwas weg. Er hat es ihnen verboten, denn jetzt will er alles behalten. So stapeln sich die Dinge. Im ganzen Haus hängen Bügel herum. Sie hängen an den Türen, an den Schrankgriffen, sie liegen oben auf der Sofalehne.
«Wo kommen denn die ganzen Bügel her?»
Und jetzt ist das der erste Satz, den sie zu ihm gesagt hat, und sie kann den, den sie als Erstes sagen wollte, nicht mehr sagen. Ihr Vater starrt sie an, als müsste er die Frage erst in seinen Kopf einlassen.
«Passen nicht mehr, die Sachen. Die Frau hat sie mitgenommen.»
«Welche Frau?» (Immer mehr Sätze, die nicht zu dem Satz passen, den sie sagen wollte.)
«Die Polin.»
«Frau Koscinski. Ihr Mann ist Pole. Sie ist Deutsche.»
«Die und die andere, die Dicke. Die hat auch was mitgenommen.»
«Frau Prosch.»
Obwohl es sauber ist, riecht das Haus. Früher hat es nicht gerochen. Vielleicht hat es gerochen, aber es roch wie sie, und sie roch wie das Haus, das lila Sofa, ihre klumpige Bettdecke, die gelben Übergardinen, das Mittagessen, ihre Pullover und ihr Atem, es war alles ein und dasselbe, die Luft, in der sie lebte und aus der sie bestand und die sie deshalb nicht riechen konnte.
Jetzt kann sie sie riechen, sie riecht nach Medizin und Alter und dennoch wie etwas, das ihr auf unschöne Weise bekannt vorkommt. Wie etwas, das sie einfach nur vergessen hatte.
Mit Gewalt wird das Haus sauber gehalten. Aber es wird nichts nützen, denkt sie schadenfroh, sie weiß selbst nicht, warum. Sie fragt sich, was die Frauen mit den riesigen Altherrensachen ihres Vaters anfangen konnten. Vielleicht hat er sie ihnen aufgenötigt. Beide Frauen sind jung und zugezogen. Deswegen kennt er sie nicht und will sie auch nicht kennen. Es wäre zu viel von ihm verlangt, sich noch an ihre Namen zu gewöhnen. Aber es gefällt ihm, dass sie regelmäßig da sind, es gefällt ihm, dass sie putzen. Sie hat gesehen, wie er sie beobachtet von seinem Sessel aus. Er macht sich nicht einmal die Mühe, sich anzuziehen, im Schlafanzug verfolgt er sie beim Saugen, schlurft auf seinen Hausschuhen hinterher, sieht ihnen auf die Finger beim Toilettereinigen, gibt ihnen Anweisungen für die Pflege der Dielen: «Nur feucht, nicht nass!» Und manchmal lobt er sie auch, er ist ein gerechter Mann.
1947, ungefähr ein Jahr nach seiner Geburt, kam ihm sein Vater abhanden. Wegen «Diebstahls und Hehlerei» wurde er vorübergehend eingesperrt. Danach verschwand er ganz.
Seine Mutter war eine kleine, energische Frau mit wundervollen lockigen Haaren und einem zu kurzen Bein, weshalb sie immer ein wenig humpelte. Sie liebte den kleinen Wilfried über alles, ihren «kleinen Mann». Er schlief im Ehebett auf der verlassenen Seite seines abtrünnigen Vaters, bis er fünfzehn war, dann zog er – gegen ihren Willen – auf das Sofa um.
Wenn er sich abends mit Freunden traf, weinte sie und drohte manchmal: «Wenn du mich auch verlässt, dann bringe ich mich um.»
Sie arbeitete als Haushaltshilfe in einer Arztfamilie und opferte sich für ihn auf. Er wusste, dass sie sich aufopferte, denn sie sagte es ihm jeden Tag. Sie verzichtete auf einen neuen Rock, auf den Friseur, auf ein eigenes Leben, damit er alles bekam, was er sich wünschte, aber auch für ihn hatte das alles seinen Preis. Er konnte keine Freunde haben und nicht mit Mädchen ausgehen, es endete alles immer im Selbstmord seiner Mutter.
«Mach nur so weiter, und es wird dir noch leidtun.» (Es tat ihm jetzt schon leid, aber er musste einfach weitermachen.)
«Eines Tages bin ich nicht mehr da, und dann wirst du dich wundern.» (Wie hätte er sich noch wundern können, nach all den Ankündigungen?)
«Glaub mir, irgendwann gehe ich ins Wasser!» (Welches Wasser? Es gab kein Wasser bei ihnen.)
«Ich nehme was ein, und dann wirst du schon sehen.» (Das Rattengift versteckte er.)
«Dann geh ich eben vor die Hunde.» (Das war zu diffus, um ihn zu ängstigen.)
«Am Ende mach ich’s wie Berthe Riedner.» (Berthe Riedner war in dieser Hinsicht ein Vorbild, sie hatte sich auf dem Dachboden erhängt, obwohl sie eigentlich «gar keinen Grund gehabt hatte!», wenn es nach seiner Mutter ging.)
«Lieber möcht ich draufgehen als so leben!» (Nachdem er eine Nacht mit anderen Heranwachsenden in der Kiesgrube verbracht hatte und sie sich «zu Tode geängstigt» hatte.)
«Wozu dann noch leben?»
«Wozu dann noch leben?» Sie hatte unendlich viele dieser Sätze parat. Es gab so viele Möglichkeiten, sich umzubringen. Manches deutete sie nur an, um seine Fantasie zu beschäftigen. Sie wünschte sich, dass er sich darüber Gedanken machte, aber ihre Rätsel waren so leicht zu lösen, dass es seine Intelligenz beleidigte. Dennoch, stets schwor er, in Zukunft alles zu tun, was sie verlangte, das war das Einzige, was sie beruhigte. Nie würde er sie verlassen, für irgendein Flittchen oder für irgendwelche Diebe und Gesindel, wie sein Vater es getan hatte – obwohl er immerhin nicht freiwillig ins Gefängnis gegangen sein konnte.
Als er älter wurde, konnte er sie nicht mehr ernst nehmen. Aber die Verantwortung für sie blieb. Er war ihr etwas schuldig – alles.
Nadine streift im Haus herum, er deutet es auf seine Weise.
«Sie arbeiten nicht sauber!», krächzt er ihr hinterher. Er hat diese Stimme erst seit einiger Zeit.
Als sie sich gerade zu ändern begann, weigerte er sich, sie zu benutzen. Konnte er nicht mehr mit seiner alten Stimme sprechen, wollte er gar nicht mehr sprechen. Ein halbes Jahr schwieg er. Aber er war nicht der Mann, der schwieg. Er war nicht der Mann, der seine Meinung für sich behielt. Er war nicht der Mann, der keine Anweisungen gab.
Er muss Anweisungen geben und seine Meinung sagen. Bis zum bitteren Ende. Wie soll man ein gerechter Mann sein, wenn die anderen es nicht merken?
Jetzt schreit er wieder, und wenn er leise spricht, hört es sich fast noch normal an, aber wenn er schreit, dann krächzt er in diesem Ton, der sie an Zeichentrickfiguren erinnert. Er wird in seinem Schlafanzug, in seiner hilflosen Wut zu etwas Unwirklichem, Monströsem und gleichzeitig Komischem. Manchmal sagt sie zu Frank: «Mein Gott, er ist so eine Comicfigur, du müsstest ihn mal sehen!»
Und manchmal muss sie dann an eine andere Comicfigur denken, drei Zähne im Mund inmitten eines Flaschengartens – ihre Mutter.
1973 lag ihre Mutter oft in eine mexikanische Decke gewickelt auf dem violetten Sofa und starrte lächelnd durch Nadine hindurch, wenn die sie ansprach, und Nadine wusste, dass sie nun zufrieden war. Wenn ihre Mutter zufrieden war, konnte sie nichts, als zufrieden gucken. Ilona Brandt erklärte ihrer Tochter diesen Zustand mit großem Ernst: «Du läufst in einem Wald herum, in einem ganz bunten Wald, überall so Glöckchen und Blumen und Musik, alles glänzt und glitzert, und es tropft so, es tropft und tropft, es sind ganz goldene, süße Tropfen.»
«Kann man die essen?»
«Tropfen kann man nicht essen, man kann sie höchstens trinken.»
«Kann man die trinken?»
«Natürlich. Sie schmecken kolossal.»
«Oh ja, ich würde sie alle auflecken.»
«Und plötzlich kommen Schuhe auf dich zu, mit Augen!»
«Ohne Mensch?»
«Nur die Schuhe, sie sehen dich an. Sie sind böse, diese Schuhe, und sie kommen auf dich zu, und du willst weglaufen, aber das kannst du natürlich nicht. Du willst mit deinem Gewehr auf sie schießen, aber das Gewehr wird ganz weich, es biegt sich so runter wie Gummi. Das ist nicht schön, oder doch?»
Sie streichelte Nadine über den Kopf, immer wieder über den Kopf, streichelte und streichelte und sah durch sie hindurch.
«Oder weißt du vielleicht, ob dieser Teppich hier, dieser hässliche Teppich, wirklich da ist? So ein hässlicher Teppich, er ärgert mich so!»
Dann wurde ihre Mutter plötzlich wütend und riss an dem Teppich, dass der Fernsehtisch umkippte und der Aschenbecher herunterfiel und die Asche im ganzen Zimmer herumstaubte. Sie zerrte den Teppich durch die ganze Wohnung bis vor die Tür, wo ihr Vater ihn später entdeckte und einen Streit darüber begann.
«Du bist ja nicht normal!»
«Ich kann mit so einem Teppich nicht mehr leben. Albträume bekomme ich davon!»
Aber der Teppich kehrte zurück.
Nadine sammelt die Bügel ein und streift herum, als müsste sie irgendetwas finden. Im Haus ist es dunkel, immer schon gewesen. Im Haus war es immer Herbst oder Winter, nie Sommer oder Frühling. Doch, Frühling war es schon manchmal gewesen. Im Frühling saß sie am Fenster und sah Regen von den Ästen tropfen, auf die Krokusse, die violett und gelb durch die schwarze Erde brachen. Aber Sommer? War es jemals in diesem Haus Sommer gewesen?
Vielleicht in der Kiesgrube, während die Kassettenrekordermusik sich an den Grubenwänden brach und sie schwitzende Salamibrötchen aus einer braunen Papiertüte hinunterschlangen, knirschenden Sand im Mund, in den Haaren und in den Ohren. Vielleicht auf den heißen runden Pollern vor Hertie, auf denen sie Eis aßen, das auf ihr T-Shirt tropfte, das T-Shirt mit der Mickymaus auf dem Bauch. Vielleicht auch in der Schule, wo sie ein Diktat schrieben, tief über die Tische gebeugt, unter der metallenen Stimme von Frau Kallies, während hinter den Fenstern nur Hitze war und ein silbriger Himmel. Die schwierigen, harten Wörter platzten in die Stille des Sommers und hinterließen in ihrem Kopf Nachklänge bis in die Nacht hinein, bis in den Schlaf. Susi geht morgen mit ihrem Hund spazieren. Anna fährt mit der Bahn an das Meer.Jonas wünscht sich einen Goldfisch. Goldfisch ist ein zusammengesetztes Substantiv. Zusammengesetzte Substantive schreibt man zusammen.
Aber im Haus, dem dunklen, hatte es keinen Sommer gegeben. Auch keine Goldfische. Nadine ging nicht mit dem Hund spazieren, ein Hund ist kein Spielzeug, ein Jagdhund ist für die Jagd da.
Ein Stück hinter dem Ahorn beginnt das Grundstück der Musch. Es ist nichts als Unkraut und Dreck. Sie weiß nicht mal, ob die Musch immer noch da lebt, in diesem höhlenartigen Haus, baufällig, schimmlig, selbst schon Unkraut. Sie hat sie schon lange nicht mehr gesehen. Aber manchmal, wenn es dunkel wird, sieht sie da immer noch ein Licht brennen.
1975 war das Grundstück der Musch ein Urwald wild wuchernder Sträucher und Gräser, Stockrosen ragten im Sommer stolz aus all dem Gestrüpp hervor, krumme, uralte Obstbäume bewegten an windigen Abenden geisterhaft ihre Arme.
Mal gruselte es sie, mal sehnte sie sich, so düster, so überwältigend wild war es dort, direkt neben dem gepflegten Rasen ihres eigenen Zuhauses, das der Wildnis in nichts glich, das nicht Teil derselben Welt sein konnte und es doch war. Denn putzte nicht die Musch bei ihnen und in der Bäckerei?
Die Küche, in die auch am Tage kaum Licht drang, war das warm pochende Herz des kleinen Hauses. Das Grün klopfte an Windtagen an die Fenster, umschlang zärtlich das Mauerwerk des Hauses, in das es, davon war Nadine überzeugt, irgendwann eindringen würde. Es würde Besitz ergreifen von den Dingen, die hier lebten, würde über den Fußboden kriechen, die Wände hochwachsen, die Möbel umschlingen. Am Ende würde es die Musch zu fassen kriegen, und auch sie würde zu Blättern werden, zu Gras und zu Blumen. Aber es würde ihr nichts ausmachen. Nichts würde je der Musch etwas ausmachen, denn die Musch war gegen alles gewappnet. Sie war der unverletzlichste Mensch, den Nadine kannte.
Die Wände der Küche waren mit einer Tapete beklebt, deren Muster nur an manchen Stellen noch zu erkennen war, aber das war auch nicht wichtig, denn es hingen dort sehr viele interessante Bilder. Es gab Bilder vom erwachsenen Jesus, der die Hand hob, während Menschen vor ihm auf dem Boden knieten oder sich bückten mit gefalteten Händen. Es gab Bilder von Maria, wie sie den niedlichen kleinen Jesus auf dem Schoß hielt. Es gab ein sehr großes Bild von einer violettbraunen Heidelandschaft mit einem nachdenklich in die Ferne blickenden Schäfer und Schafen natürlich. Über dem Tisch hing eine ganze Flotte von Segelschiffbildern, auf allen war das Meer stürmisch, hohe Wellen unter einem schwarzen Himmel, unter einem gelblichen Himmel, unter einem rötlichen Himmel und unter einem grün-schwarz-gelben Himmel, die Wolken aufgetürmt, der Sturm braust, die Boote tapfer, der Mond ein weißer Fleck hinter den bedrohlichen Wolken. Über der Spüle hing ein Bild von einer Frau, die am Fenster saß und traurig in die Ferne guckte, während ihr ihre Handarbeit aus den Händen glitt. Sie dachte ganz sicher an ihren Geliebten, aber der war wahrscheinlich gestorben oder hatte sich eine andere genommen.
Nadine konnte sich zu den Bildern eine Menge denken. Deshalb saß sie manchmal so da und starrte, während sie ihren Kakao schlürfte oder an ihrem Brötchen knabberte oder auch sonst gar nichts tat, während die Musch auch nur die Wand betrachtete. Und vielleicht dachte sie ja dasselbe wie Nadine, vielleicht auch nicht, aber das war egal. Denn die Musch ließ Nadine immer in Ruhe ihre eigenen Gedanken denken.
Auf dem Boden der Küche stand eine große Holzkiste, in der Zeitungen lagen, Kataloge, Werbebroschüren, Dinge, die die Musch nicht wegwerfen wollte, denn sie hatte die Angewohnheit, alles zu behalten. Sie sammelte Korken und Gummibänder, Verschlüsse und Gläser, Kartons und Tüten. Die Sachen verstopften ihr kleines Haus und machten es schön.
«Wenn du einen Gummi brauchst oder ein Glas …», sagte die Musch.
Nadine nahm sich ein Glas und einen Gummi und legte schließlich nach einiger Überlegung den Gummi in das Glas, verschloss es mit dem Schraubdeckel und stellte beides auf ihr Fensterbrett.
Am Glas vorbei sah sie den oberen Teil der Wildnis, die hinter der Mauer ihres eigenen Gartens hervorragte wie ein ungeschnittener Haarschopf, dem Vater ein ewiges Ärgernis.
Nachdem ihre Mutter weg war, ging Nadine jeden Morgen zur Musch.
Im Herd knallte das Feuer. Der Hund lag auf einer Decke davor und bewegte die Schwanzspitze oder auch mal ein Ohr. Die Musch sang Schlager aus dem Radio mit und rannte herum, um das Frühstück zu bereiten. Ihre krummen Beine steckten in blassbraunen Strumpfhosen, in gestrickten Strümpfen, in abgeschnittenen Gummistiefeln. Nadine konnte sich an all diesen Dingen gar nicht sattsehen. Die Musch packte die Brötchen auf die heiße Herdplatte, bis sie knusprig waren, Nadine deckte den Tisch, dann aßen sie und hörten dem Radio zu. Die Musch lachte und hielt sich die Hand vor den Mund, weil sie schlechte Zähne hatte, aber Nadine wusste es sowieso. Es war ihr egal, sie mochte alles an der Musch, sogar den Geruch, den das Haus und ihre Kleidung ausströmten.
«Mathe ist ’ne schwierige Sache», sagte die Musch. «Manche Köpfe sind nicht dafür gemacht.»
«Wofür ist mein Kopf gemacht?», fragte Nadine. «Das würde ich gerne mal wissen.»
«Ich bin schon doof geboren», sagte die Musch, «aber du hast einen schlauen Kopf. Du musst nur sehen, dass du irgendwas an der Sache findest, dass es dir Spaß macht.»
«Und wenn nicht?»
Die Musch grinste, und sie hatte wirklich schlimme Zähne.
«Wenn nicht, dann nicht. Guck mich an, ich lebe auch.»
«Und du hast ein Haus und alles!»
«Das Haus ist geerbt.»
Das sagte sie gerne, dass sie es geerbt hatte. Es war alles, was sie je bekommen hatte. Es machte sie stolz.
«Ich will auch mal gerne so leben wie du.»
«Ich lebe sehr gut», sagte die Musch zufrieden.
«Ich glaub aber nicht, dass ich Spaß an Mathe finde», sagte Nadine, zog ihre Jacke an, nahm ihren Ranzen und küsste den Hund auf den Kopf.
«Soll ich uns Kaffee machen?», schlägt sie ihrem Vater vor, weil ihr nichts anderes einfällt, was sie ihm vorschlagen oder mit ihm tun könnte.
Er nickt. Er soll keinen Kaffee trinken. Er schläft so schlecht. Aber sie hat es aufgegeben, ihn mit Ermahnungen gesund zu halten. Es ist zu spät. Sie geht in die Küche. Auf dem Küchentisch steht Geschirr herum, ein trockenes halbes Brot, eine offene Dose Fisch, eine leere Bierflasche.
«Bier?», sie schreit, damit er es im Wohnzimmer hören kann.
Keuchend kommt er in seinen Pantoffeln angeschlurft, seinen immer noch großen und schweren Körper mühsam mit sich schleppend.
«Bier???» Sie hält die leere Flasche hoch, als er in der Küche angekommen ist.
«Was soll damit sein?», sagt er mürrisch.
Sie schüttet Kaffee in den Filter und stellt die Maschine an.
«Du kannst doch zu den Medikamenten kein Bier trinken! Wo kommt das überhaupt her?»
Sie öffnet den Kühlschrank. Vier Flaschen stehen nebeneinander in der Kühlschranktür.
«Was geht dich das an?»
Stöhnend lässt er sich auf einem Küchenstuhl nieder. Auf dem Stuhl liegt ein fleckiges Kissen, das verrutscht, während er sich hinsetzt. Es klemmt jetzt halb unter seinem Hintern, und halb hängt es vom Stuhl. Es stört sie, alles stört sie, aber es lässt sich nicht ändern. Der Kaffee läuft stotternd durch die Maschine. Es ist ein freundliches Geräusch. Sie räumt die Dose Fisch weg, verstaut das Brot im Brotkasten, wischt die Krümel vom Tisch und deckt Tassen auf. Sie weiß, dass er sie die ganze Zeit bei allem, was sie tut, beobachtet. Das ist, was er jetzt den ganzen Tag tut, die wenigen Menschen, die er um sich hat, beobachten.
Ist er zufrieden mit dem, was er sieht?
1982 sagte er: «Wie gehst du denn, mein Gott, Nadine, wie gehst du?» Immer wieder war ihm ihr schlechter Gang aufgefallen, aufrecht sollte sie gehen, nicht zu schnell, nicht die Arme schlenkern.
«Du gehst wie ein Mensch ohne Rückgrat. Hast du denn gar kein Selbstbewusstsein, kein Gefühl für deinen Körper? Sport müsstest du machen, du kannst doch Gymnastik machen, geh in den Sportverein!»
Er übte mit ihr auf der Auffahrt zur Garage, sie war sogar einverstanden, denn auch sie war inzwischen mit ihrem Gang unzufrieden, sie merkte, wie schwer es ihr fiel, vernünftig zu gehen, jetzt wo sie darüber nachdachte. Sie ging angestrengt und bemüht die Auffahrt auf und ab, und er sagte: «Rücken gerade, Kopf hoch, Kinn etwas runter, nicht so steif, und die Arme leicht mitschwingen, aber nicht so stark!»
Er führte es ihr vor, ganz selbstverständlich konnte er einen Fuß vor den anderen setzen. Er konnte gehen. Er konnte es einfach! Aber sie schaffte es nicht. Je mehr sie es versuchte, umso weniger gelang es ihr. Zufrieden war er nie. Zufrieden war auch sie nie. Ein unbeschwertes und natürliches Gehen blieb ihr lange verwehrt.
Wenn sie hörte, dass ihr Vater wach wurde, sprang sie auf. Sie musste ihm Sachen mitteilen. Es staute sich immer eine Menge an. Wilfried Brandt schlurfte mit dicken Augen und in Unterwäsche durch die Wohnung.
«Nadine, stell dich ab!», sagte er immer und immer wieder, denn sie hörte einfach nicht auf mit dem Geplapper. Ohne Ende redete sie, wenn man sie ließ. Sie redete und hörte nicht auf. Dabei auch noch so laut. Ein schrecklich lautes Kind war das. Konnte sich gar nicht zurücknehmen.
«Nadine, stell dich ab!»
Am Nachmittag ging Wilfried Brandt ins Café und kehrte zum Abendbrot zurück. Abends aßen sie immer zusammen. Das war die Zeit ihrer Gespräche. Da war er bereit und stellte seine Fragen.
«Wie war es in der Schule? Gab es Zensuren?»
«Thomas Fenske hat mich Fetti genannt, und jetzt sagen alle so zu mir.» Er betrachtete sie aufmerksam.
«Du musst weniger essen, Nadine!»
«Ich esse doch gar nicht viel.»
Aber das Brot in ihrem Mund war ihr viertes, rechnete sie rasch nach. Vor dem Abendbrot hatte sie Zitronenwaffeln gegessen. Eine nach der anderen hatte sie die Waffeln auseinandergepult, die Creme abgeleckt und dann die dünne, jetzt pappige Waffel gegessen. Bis die ganze Packung alle war.
«Guck dich mal im Spiegel an. Wenn man dick wird, isst man einfach zu viel.»
«Du bist auch dick.»
«Das nennt man stattlich. Das ist was anderes. Ich arbeite schwer, Nadine, und ich bin ein Mann. Frauen müssen zierlich sein.»
«Warum?»
«Warum? Das ist einfach so. Die dicken Kaliber will doch keiner haben. Guck dir die Frauen in den Filmen an oder in deinen komischen Zeitschriften, die sind alle schlank. Je kleiner, je feiner, sag ich immer, deine Mutter war gertenschlank, als ich sie kennengelernt habe, schade, dass du da nicht nach ihr kommst. Wenn du so weitermachst, kriegst du jedenfalls nie einen Mann. Glaub mir, Nadine, ich sage dir das nur zu deinem Besten und nicht, weil ich dich ärgern will.»
Sie versuchte, weniger zu essen, aber es kam irgendwie so, dass sie mehr aß. Vorher hatte sie darüber nicht nachgedacht, sie aß eben, wenn sie Lust hatte. Aber jetzt strengte sie sich so an, nicht zu essen, dass es sie traurig machte, wovon sie dann ganz schwach und hungrig wurde. Es gab ja keinen besseren Trost als etwas Süßes. Gab er ihr einen Karton voller Kuchen für die Schule mit, aß sie einen ganzen Teil davon selbst. Besonders mochte sie Fettgebäck. Es gab nichts Schöneres für sie als Hefeteig, in Öl ausgebacken und mit Zuckerguss überzogen.
Nadine gießt den Kaffee ein, setzt sich ihm gegenüber und legt ihre Hände auf den Tisch. Und bevor sie sagen kann, was sie sagen will, fragt ihr Vater: «Und was macht Mizzi?»
Er sagt es so, als hätten sie alle anderen Themen schon abgehakt. Als hätte er sich nach ihrem Leben längst erkundigt, nach dem von Frank. Und was macht denn nun Mizzi?
Sie zuckt mit den Schultern, nimmt Anlauf.
«Ja, Mizzi …»
«Ich habe sie lange nicht gesehen.»
«Sie ist tot.»
Sie hat es ganz schnell gesagt und dabei gleichzeitig Luft eingesogen, sodass sie sich verschluckt. Sie hustet.
«Was?»
Nadine nickt und müht sich, zu Atem zu kommen, aber immer noch reizt sie etwas in der Luftröhre, sie kämpft mit sich und der Luft, und Tränen stehen ihr in den Augen, die, absurderweise, wie ihr bewusst ist, nicht Tränen der Trauer sind.
«Warum ist sie tot?», fragt er schließlich, und er schnauft rasselnd, als wäre er an eine Maschine angeschlossen.
«Sie hat sich umgebracht», sagt Nadine, immer noch keuchend, und in dem Moment, wo sie es sagt, kann sie es eigentlich nicht glauben. Es sagt sich so einfach. Aber es kann doch nicht wahr sein.
Er nickt langsam, als hätte er es gewusst, schon lange oder schon immer. Als hätte es viele Warnungen gegeben, Ankündigungen von etwas, das er als Einziger wahrzunehmen in der Lage gewesen war. Aber vielleicht soll es auch nur heißen, dass er verstanden hat.
«Sie hat sich auf die Schienen gelegt», sagt Nadine, «sie ist gleich tot gewesen.»
Sie weiß es gar nicht. Sie nimmt es an. In Filmen sagen sie diesen Satz immer, um die Leute zu trösten. Sie nimmt einfach an, dass Mizzi gleich tot war. Sie sagt es für sich selbst. Sie sagt es zu ihrer eigenen Beruhigung. Es beruhigt sie kaum. Ein Dazwischen muss es gegeben haben. Eine Sekunde des Schmerzes und einen Raum der Angst.
«Sie ist gleich tot gewesen», wiederholt sie.
«Auf die Schienen? Das macht man doch nicht, andere Leute mit reinziehen», sagt ihr Vater.
Sie schlägt ihn ins Gesicht. Sein Kopf ist nachgiebig, er pendelt zur Seite, er hat keine Kraft mehr in seinem Körper.
Sie sitzen sich gegenüber und starren sich an.
Sie nimmt das trockene halbe Brot wieder aus dem Brotkasten. Sie öffnet den Kühlschrank, nimmt Butter heraus, Käse, den angefangenen Fisch. Sie hat seit zwei Tagen nichts gegessen. Sie hat sogar den widerlichen Gedanken nicht verscheuchen können, dass es alles sein Gutes hat. Es war ihr immer so schwergefallen, ihr Gewicht zu halten. All die Jahre hat sie nichts mehr gegessen. Nur Happen. Nur winzige Happen. Krumen. Bröckchen. Luft und Staub. Sie schneidet dicke Scheiben ab, schmiert sich ein Brot, isst es auf. Dann schmiert sie sich noch eines und isst auch das auf. Ihr Vater sitzt am Tisch und schweigt. Sie schmiert auch ihm ein Brot, schneidet es in kleine Stücke und schiebt es ihm hin. Sie holt zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank, öffnet alle beide und stellt ihm eine zu seinem klein geschnittenen Brot.
2008 fuhr Nadine nachts oft herum, um Mizzi zu suchen. Frank beteiligte sich nie an der Suche.
«Sie soll es selbst ausbaden», sagte er. «Sie muss die Konsequenzen ihres Handelns spüren.»
Er konnte ruhig auf dem Sofa sitzen, während Nadine in sich die Angst niederkämpfte, weil sie nicht aufhören konnte, sich zu fragen, ob es ihr gut ging. Aber vielleicht war das nicht Franks Fehler, vielleicht war das auch nicht Mizzis Fehler, sondern ganz allein ihrer. Vielleicht war sie nicht ganz normal, wie Frank manchmal sagte.
Manchmal kamen ein paar Freundinnen vorbei. Nette, harmlose Mädchen, kichernd, albern, ganz normal. Nadine stellte Kekse hin – Gekicher –, fragte nach den Eltern und der Schule. «Ja, alles gut», sagten die Mädchen und grinsten. Mizzi schämte sich, Nadine konnte es sehen. Wenn sie dann gemeinsam aus dem Haus gingen, sahen sie alle aus wie kleine Prostituierte. Wie sie sich zurechtgemacht hatten! Auch Mizzi, wie eine kleine Prostituierte, und trotzdem – so schön.
«Mein Gott, Mizzi», sagte Nadine, «willst du denn so gehen?»
«Wieso?», fragte Mizzi.
«Weil du aussiehst wie eine Nutte», sagte Frank.
«Soll ich vielleicht aussehen wie du?», antwortete Mizzi nicht Frank, sondern Nadine. Dazu sagte Nadine dann nichts mehr. Was sollte man dazu auch sagen? Dass sie sich nichts weniger wünschte, als dass ihre Tochter aussah wie sie?
Und später lag Mizzi wieder auf dem Sofa vor dem laufenden Fernseher, die Schminke verschmiert, todmüde und schlaff, keine Energie mehr, alle Lebensfreude war weg. Kein Gekicher, kein Geschwatze mehr, nur noch Müdigkeit und Überdruss.
3
Nach der Beerdigung, nach dem Kaffeetrinken im Lindenhof hält Frank an der Tankstelle. Während er tankt, geht Nadine in den Laden. Sie legt eine Packung Kartoffelchips und eine Packung Tortillachips auf den Tresen. Frank bezahlt, ohne ein Wort zu sagen. Wenn er ein Wort hätte sagen wollen, welches wäre das gewesen?
Es gehört sich nicht, denkt sie, während sie die Tankstelle verlassen. Chips zu kaufen, direkt nachdem die eigene Tochter beerdigt wurde. Appetit zu haben. Sie hat Appetit, richtige Gier, sie musste diese Chips einfach kaufen. Es gehört sich nicht. Alles, alles gehört sich jetzt nicht mehr. Man muss etwas falsch machen, es ist einfach zu viel.
Und dann ist es ja auch egal, denkt sie, zufrieden fast.
Was die Leute nicht bedenken: dass man sich vielleicht gerade dann am schlechtesten zusammenreißen kann, wenn es am meisten von einem erwartet wird. Man kann das vielleicht schon. Sie aber nicht.
Eine ganze Weile, ziemlich lange sogar, hat sie es geschafft. Den größten Teil ihres Lebens. Das muss doch auch was wert sein.
Während Frank sie langsam, sehr langsam, nach Hause fährt, gehen die Straßenlampen an. Es ist noch nicht dunkel, aber die Sonne ist weg, der Abend sitzt schon im Gebüsch, hinter den Fenstern das Fernsehprogramm, die Kinder essen ihr Abendbrot, die Alten gehen mit dem Hund. Den Hund zieht es nach Hause, er wittert schon die Nacht. Mit beiden Armen hält Nadine die Chipstüten an ihren Körper gedrückt, als wären sie ihr wichtig. Sie sind ihr wichtig. Sie sind alles, was sie hat.
Später sitzt Frank mit verschränkten Armen im Sessel, und Nadine liegt auf dem Sofa. Beide haben sie bereits ihre Trauerkleidung ausgezogen. Nadine trägt eine Jogginghose, Frank eine alte Jeans. Er schämt sich deswegen, sie weiß es. Er schämt sich, weil er es sich bequem gemacht hat. Sie schämt sich nicht. Es ist egal. Es ist alles nur Theater, denn für wen soll es gut sein, für wen sollte er seine Anzughose tragen, die ihm zu eng ist am Bauch?
Sie schaltet von Programm zu Programm. Frank sitzt im Sessel, die Arme immer noch vor der Brust gekreuzt. Es zeigt allen – ihr –, dass sie sich nie wieder öffnen werden. Um jemanden zu umarmen. Um zu klatschen. Nie wieder werden diese Arme die Hände zu einem Klatschen bewegen. Aber wann soll denn Frank einmal geklatscht haben? Nadine schüttelt den Kopf, während sie weiter die Programme umschaltet. Sie wird nichts Gutes finden, es gibt nie etwas Gutes, es ist das Beste, gleich beim ersten Programm zu bleiben, aber das kann sie nun mal nicht, sie muss immer weiterschalten.
Sie reißt die Tüte mit den Kartoffelchips auf. Ewig hat sie keine Kartoffelchips mehr gegessen. Der Duft von Öl und Paprika steigt ihr in die Nase. Sie genießt es, mit bösem Trotz dabei. Sieht sich selbst in ihrer rosa Jogginghose auf dem Sofa liegen. Sieht Frank in dem Sessel sitzen, so steif und alt und hoffnungslos. Sieht seine Abwehr. Sieht im Fernseher die Menschen lachen. Lachen einfach, als ob nicht Menschen sterben! Sie schiebt sich die ersten Chips in den Mund, kaut, ist sich des Genusses bewusst. Es ist egal.
«Was haben wir falsch gemacht?», sagt plötzlich Frank und schlägt die Beine übereinander. Fast erschreckt sie die Bewegung seiner Beine mehr als das, was er sie gefragt hat. Was hat sie falsch gemacht? Denn das ist es doch, was er von ihr wissen will? Was hat sie denn nur falsch gemacht? Darüber hat sie noch gar nicht nachgedacht. Sie hat sich doch so angestrengt. Sie hatte doch wirklich gedacht, es jetzt langsam geschafft zu haben.
Während sie sich selbst beobachtet, wie sie Chips in ihren Mund steckt, Krümel auf der Jogginghose, während sie im Fernseher schon wieder lachen und Frank so vollkommen mit sich selbst verknotet in dem Sessel sitzt, mit dieser Frage in seinen Augen, wird es ihr klar, dass sie sich geirrt haben muss.
1988 konnte Nadine schon recht gut telefonieren: «Kanzlei Hirbrich und Kolpert, mein Name ist Nadine Brandt, guten Morgen.»
So sanft konnte sie das sagen, so sanft sagte sie auch den Rest der notwendigen Sätze, außer wenn es Rechnungen einzutreiben galt, dafür gab es einen anderen Ton. Ein wenig lauter und kühler, wer nicht bezahlte, war ein Feind. Sie setzte sich aufrecht auf ihren Sitz und bekämpfte den fremden Feind mit ihrer natürlichen Stimme.
Gegenüber den Kolleginnen vermied sie das Sprechen. Es hatte sich nicht bewährt. Es lief so leicht aus dem Ruder. Sie sagte sich: Nein, Nadine, halt besser den Mund!
Sie dachte oft, warum hast du nur den Mund nicht halten können?, bevor sie daraus lernte und bevor sie dazu überging, zu denken: Nein, Nadine, halt besser den Mund! Aber sie konnte dann sehr gut in der Mittagspause auf der Metallbank vor der Apotheke sitzen und den anderen zuhören. Manchmal war es warm, und die Kolleginnen öffneten ihre Blusen und wurden vertraulich. Manchmal schlüpfte eine kleine Freude in Nadines Körper aus irgendeinem Anlass, und dann vergaß sie sich und sprach davon. «Ja», sagten sie dann, «hmh», sagten sie dann und schmunzelten und knöpften ein bisschen an sich rum und strichen sich über die Waden. Nein, Nadine, halt besser den Mund!
Das Problem war auch, dass sie nicht den richtigen Zeitpunkt fand. Die Lücke, in die man hineinsprechen konnte. Den Stichpunkt, den eine gab. Sie konnte es einfach nicht.
Und dann war es auch nicht der richtige Ton. Mit der Zeit wurde sie immer lauter. Sie konnte es nicht verhindern. Auch wenn sie sehr leise anfing, wurde sie bald schon recht laut.
Die Erregung erschöpfte die Kolleginnen. Sie wollten doch nur plauschen. Es war einfach zu viel.
Darum hörte sie einfach ganz damit auf. Es war das Einfachste.
Wenn die Kolleginnen über das Baby sprachen, die Figur, Hochzeit, Beerdigung, Krankheit, über den anstehenden oder gerade vergangenen Urlaub, dann sagte Nadine:
«Wie süß!»
«Mein Gott!»
«Sieht ja super aus!»
«Wahnsinn!»
Oder manchmal sagte sie: «Da habt ihr es ja wirklich schön gehabt!»
Dafür bekam sie etwas. Einen dankbaren Blick. Wer will es nicht von anderen wissen, dass er es schön gehabt hat?
Manchmal wollten sie sie hochnehmen, denn so, wie Nadines Überpräsenz sie gestört hatte, störte sie jetzt ihre Zurückhaltung. Wenn eine nichts sagte, dann dachte sie sich vielleicht umso mehr, und das gefiel ihnen nicht.
Sie fragten sie ganz unschuldig, als wüssten sie es nicht: «Nadine, wo bist du denn dieses Jahr im Urlaub gewesen?»
«Ich hab es mir im Garten gemütlich gemacht.»
Das war die Antwort, die sie schon lange parat hatte. Sie wusste ja schon im Garten, in dem sie gar nicht gelegen hatte, dass sie eines Tages gefragt werden würde.
Und dann sagten sie: «Zu Hause ist es doch am schönsten.»
Oder sie sagten: «Also ich könnte das nicht. Ich muss manchmal einfach raus.»
Oder sie sagten: «Ach, woanders ist es auch nicht besser.»
Und dann mussten sie doch alle zustimmen. Denn natürlich war es zu Hause am schönsten. Das hätte ja keine zugegeben, dass es in ihrem Zuhause nicht am schönsten war.
Man musste gar nicht ausführlich werden, wenn man nur die richtigen Antworten gab. Oder sie sagte einfach: «Ach, da gibt es nichts zu erzählen.»