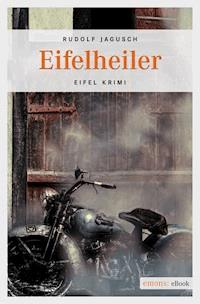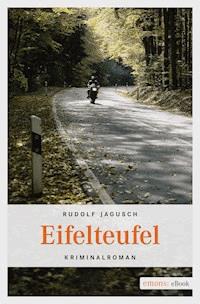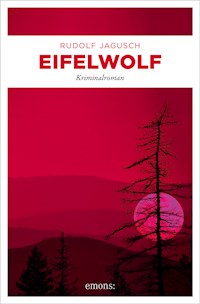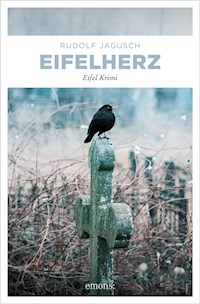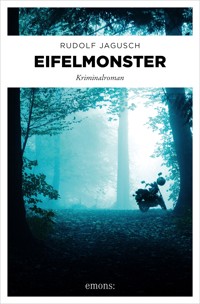
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hotte Fischbach, Jan Welscher
- Sprache: Deutsch
Alle lieben den in der Eifel ansässigen niederländischen Autohändler Peer Clerk. Warum nur wird er dann hinterhältig mit einem Scharfschützengewehr erschossen? Und wieso zielt der Täter wenig später auf die Teilnehmer einer Oldtimer-Ausfahrt? Fragen, auf die Hauptkommissar Fischbach und Jan Welscher rasch Antworten finden müssen. sonst wird Peer Clerk nicht das letzte Opfer gewesen sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rudolf Jagusch, Jahrgang 1967, studierte Verwaltungswirtschaft in Köln. 2006 erschien sein erster Krimi, weitere folgten im Jahreszyklus. Inzwischen ist er aus dem Literaturbetrieb nicht mehr wegzudenken. Er lebt und arbeitet als freier Schriftsteller mit seiner Familie im Vorgebirge am Rande der Eifel. Mehr über den Autor erfahren Sie unter: www.krimistory.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Dieser Roman wurde vermittelt durch die
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/Knuppi Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-955-4 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
»Dat jeht ävver net möt rähte Dönge zoh.«
Prolog
Spätsommer
Marek Dvorák lehnte sich in seinem Klappstuhl zurück und steckte sich eine Zigarette an. Missmutig inhalierte er tief und sah zum Stand gegenüber. Dort stritt ein geprellter Kunde lautstark mit dem vietnamesischen Verkäufer. Der Ton wurde immer ruppiger. Andere Marktbesucher mieden bereits die Gasse oder eilten hastig an Mareks Verkaufstisch vorbei. Niemand wollte in die Nähe der Streithähne geraten.
Diese Schlitzaugen machen mir mein Geschäft kaputt.
Marek holte die Wodkaflasche aus der Tasche, die über der Stuhllehne hing. Er nahm einen Schluck, doch den Ärger konnte er damit nicht runterspülen. Wenn sich das so fortsetzte, musste er die Stadt wechseln. Der Ruf des »Dragon Marktes« hier in Cheb nahe der Grenze zur Bundesrepublik verschlechterte sich. Im Internet kursierten bereits diverse Storys von abgezockten Marktbesuchern, und es wurden täglich mehr.
Vor zehn Jahren war es noch anders gewesen. Da dominierten die Einheimischen an den Ständen, redliche und lebenslustige Tschechen. Doch dann waren die Schlitzaugen gekommen. Sie organisierten sich, bildeten Clans und teilten den Markt untereinander auf. Den Tschechen, die ihnen im Weg waren, wurde in intensiven Gesprächen nahegelegt, ihr Glück woanders zu versuchen. Wer danach nicht freiwillig das Weite suchte, wurde dazu gezwungen.
Marek erinnerte sich noch gut an Svoboda, den alten Geizkragen, der seinen Stand am Ende des Ganges gehabt hatte. Weidenkörbe und Gedrechseltes hatte er angeboten, echte Handarbeit, nicht dieses Chinazeug, das man hier sonst zwischen Zigaretten, Schnaps und gefälschter Markenkleidung fand. Svoboda hatte damals in regelmäßigen Abständen schlitzäugigen Besuch erhalten. Sie bedrohten ihn, stießen seinen Stand um, klauten die Kasse und steckten Körbe in Brand. Doch je mehr sie versuchten, den alten Svoboda einzuschüchtern, desto dickköpfiger wurde der. »Ich lasse mich nicht verjagen«, hatte er gewettert, wenn Marek einen Wodka mit ihm trank. »Ich habe doch nicht den Prager Frühling überlebt, um mich jetzt von den Fidschis einschüchtern zu lassen.«
Das war ein ganzes Jahr lang gut gegangen.
Dann, eines Morgens, hatte Svoboda in aller Herrgottsfrühe den Stand abgebaut und sämtliche Sachen in seinen klapprigen Lada geräumt. Marek hatte es kaum glauben können. Als er den Alten deswegen zur Rede stellte, hielt Svoboda nur kurz inne und sah ihn mit angsterfülltem Blick an.
»Sie haben mein Enkelkind.« Seine Hand stieß vor und umklammerte Mareks Unterarm. »Sie sagen, es geschieht ihm nichts, wenn ich verschwinde. Marek, ich muss abhauen, der Kleine hat noch sein ganzes Leben vor sich. Er soll nicht zu Schaden kommen, nur weil sein Opa ein dickköpfiger Sturkopf ohne Verstand ist. Das verstehst du doch, oder?«
Er hatte Marek losgelassen und weiter seine Utensilien verstaut. Marek hatte ihm daraufhin stumm auf die Schulter geklopft und war gegangen.
Wie lang war das jetzt her? Sechs Jahre? Oder sogar sieben? Ob der Alte noch lebte?
Selbstverständlich hatten sie auch versucht, Marek zu vertreiben, sich dabei jedoch ins eigene Fleisch geschnitten. Denn er hatte nach dem Zerfall des Ostblocks Weitblick bewiesen und sich Partner gesucht, die äußerst empfindlich auf Einmischung von außen reagierten. Die beiden Schlitzaugen, die Marek kurz nach Svobodas Verschwinden in die Mangel genommen hatten, waren wenig später als Wasserleichen in der Eger aufgetaucht. Seither hatte er Ruhe.
Er nahm noch einen Schluck aus der Flasche.
Manchmal muss man ein Zeichen setzen.
Das beherzigte der Vietnamese am Stand gegenüber jetzt auch. Er zog ein Buschmesser unter dem Tisch hervor und fuchtelte damit vor den Augen seines überraschten Kunden herum. »Was soll der Scheiß denn jetzt?«, rief der Deutsche empört. »Ist das ein dummer Scherz?« Er versuchte, den Vietnamesen mit einer lässigen Geste abzuwehren. Dabei geriet er »versehentlich« an die Messerschneide. Erstaunt drehte er seine Hand vor Augen, Blut tropfte zu Boden. »Verdammte Hacke!«
Der Vietnamese stieß das Messer vor und stoppte kurz vor dem Hals des Deutschen. »Hau ab!«, knurrte er.
Der Mann lief rot an, zögerte kurz, drehte sich dann aber um und lief davon.
Marek stand auf und trat seine Zigarette aus. »Du hättest ihm einfach die Stiefel geben sollen, anstatt ihm alte Turnschuhe in die Tasche zu stopfen. Schau dich mal um. Seit einer Viertelstunde hat sich keine Kundschaft mehr blicken lassen, und bis die Ersten wieder auftauchen, vergeht noch mal mindestens die gleiche Zeit.«
Der Vietnamese wirbelte herum und richtete das Messer auf Marek. »Spar dir deine Scheißratschläge.«
Leidenschaftslos zuckte Marek mit den Schultern. Sollte ihm der kleine Giftzwerg zu nahe kommen, würde er seine CZ75 unter dem Tisch hervorziehen und ihm ein Loch in die Stirn stanzen. Fast wünschte sich Marek, die Pistole ausprobieren zu dürfen. Als späte Vergeltung für den alten Svoboda und die Ängste, die dessen Enkel ertragen musste. Eine wunderschöne Notwehrsituation. Kein Bulle würde daran etwas zu bemängeln haben.
Der Vietnamese murmelte etwas Unverständliches in seiner Landessprache, das sich anhörte wie das Zischen einer Schlange, und trollte sich hinter seinen Verkaufstisch.
Schade.
Entgegen seiner Erwartung dauerte es sogar fast eine Stunde, bis sich der Gang vor Mareks Stand wieder füllte.
Na vielen Dank auch, du Schlitzaugenpisser.
Um sich nicht weiter mit dem verpassten Umsatz auseinandersetzen zu müssen, fing er an, die Ware umzusortieren. Die Uhren legte er weiter nach vorne, dorthin, wo man sie sofort ausprobieren konnte. Dafür mussten die Zinnteller weichen. Die Dinger gingen ohnehin kaum noch über den Tisch. Die Gartenzwerge stellte er ebenfalls um. Den klassischen mit der Schubkarre hinter die barbusige Lolitazwergin. Daneben den exhibitionistischen Zwerg, der den Mantel weit aufriss und sein bestes Stück präsentierte. Obwohl schon Jahrzehnte auf dem Markt, war dieser Artikel immer noch Mareks absoluter Verkaufsschlager.
»Einen schönen guten Tag.«
Marek drehte sich um. Vor ihm stand ein Typ mit Brille, gescheitelten Haaren und listigen Augen. Er trug unauffällige Bluejeans und ein weißes T-Shirt.
»Sie wünschen?«
Der Mann nahm sich eine Uhr vom Verkaufsstand und betrachtete sie angelegentlich. »Ich habe gehört, Sie liefern auch Präzisionsgeräte.«
Marek wurde hellhörig. Das war keine normale Gesprächseröffnung. »Stimmt«, gab er zu.
Jetzt musste die Frage nach dem Herkunftsort folgen.
»Darf ich fragen, woher genau Sie Ihre Ware beziehen?«
Marek grinste. »Aus tschechischen Fabriken.«
»Česká Zbrojovka, CZ, ich verstehe.« Der Mann lachte.
»Genau. Qualität ist allerdings nie günstig.«
»Ich handle im Auftrag. Geld spielt keine Rolle. Aber nichts Registriertes.«
»Selbstverständlich.« Er rief dem Vietnamesen zu: »Eh, Reisfresser, pass mal zehn Minuten auf meine Ware auf.«
»Den Schrott will eh keiner klauen«, gab der Vietnamese mürrisch zurück.
Marek bat den Mann in den kleinen Wohnwagen hinter seinem Stand. Er zog die Vorhänge zu. »Ich muss Sie kontrollieren.«
»Selbstverständlich.« Der Mann hob die Arme. »Bitte sehr.«
Sorgsam tastete Marek ihn ab. Er war sauber. Marek nahm die Brieftasche aus der Gesäßtasche des Mannes und sah hinein. Auf dem Ausweis stand »Holger Ahrens«, eine Visitenkarte wies ihn als Privatdetektiv aus. Garantiert gefälscht, aber das war ihm egal. Bei ihm musste niemand seine wahre Identität offenlegen. Er gab die Brieftasche zurück. »Von wem haben Sie Ihre Information, Herr Ahrens?«
»Ein Name wurde nicht genannt. Ich soll Ihnen die Zahl 672456 nennen.«
Marek schickte eine SMS an diese Nummer, kurz darauf erhielt er eine Antwort. Alles in Ordnung. Seine Partner hatten den Kontakt verifiziert.
»Bitte setzen Sie sich doch«, sagte Marek und goss Wodka ein. »Was benötigen Sie?«
Ahrens beugte sich vor. »Ein Scharfschützengewehr. Ich hatte an ein CZ537 gedacht. Inklusive Zielfernrohr und Schalldämpfer.«
Marek nickte anerkennend. »Schönes Teil. Damit können Sie auf tausend Meter Entfernung einem nackten Mann die Vorhaut abschießen.« Er nannte seinen Preis, ging dabei weit über den normalen Satz. Sein Bauchgefühl sagte ihm, dass hinter diesem Ahrens eine sprudelnde Geldquelle stand.
»Kein Problem. Wie lange muss ich warten?«
»Ich denke, ein Monat sollte genügen.«
»Doch so lange?«
»Ist es eilig?«
»Nein, nicht direkt. Ich dachte nur…« Er sah sich um.
Marek lachte. »Hier gibt es keine versteckte Waffenkammer. Ich werde die Einzelteile von verschiedenen Lieferanten kaufen und dann das Gewehr montieren. So wird es fast unmöglich nachzuvollziehen, woher es stammt. Die Sekurität unserer Kunden ist mir und meinen Partnern äußerst wichtig.«
»Sekurität. Wo haben Sie denn solche Wörter gelernt?«
»Bin schon lange im Geschäft. Da schnappt man einiges auf.«
»Interessiert es Sie nicht, wofür ich das Gewehr brauche?«
»Nein, keine Spur. Ich bin nur der Lieferant. Und wenn Sie wirklich im Auftrag handeln, werden Sie es ohnehin nicht wissen.«
Lächelnd hob Ahrens das Wodkaglas und prostete Marek zu. »Also dann: Na zdraví. Auf gute Zusammenarbeit.«
1
Das Krachen ging Jan Welscher durch Mark und Bein. Das war’s, dachte er, es gibt kein Zurück mehr. Es kam ihm vor, als hätte er ein Todesurteil gesprochen. Wie ein römischer Kaiser, der mit dem gesenkten Daumen gnadenlos über den unterlegenen Gladiator richtete.
Am liebsten hätte er sich dem Ganzen hier durch Flucht entzogen. Aber es wäre ihm falsch vorgekommen, sich davor zu drücken.
Die Erinnerung an vergangene Zeiten schnürte ihm den Hals zu. Angestrengt schluckte er gegen den Kloß an und wischte sich mit dem Handrücken über die feuchten Augen.
Die erste Liebe. Gemeinsam waren sie am Mittelmeer gewesen, in Paris, eine Tour hatte sie sogar bis Madrid geführt. Fast elf Jahre lang waren sie zusammen durch dick und dünn gegangen, hatten Berge erklommen und Ebenen durchquert. Als es in den letzten Jahren nicht mehr wirklich rundlief, hatte er geduldig beide Augen zugedrückt. Mit fortschreitendem Alter waren kleine Aussetzer zu erwarten.
»Du bist ein sentimentales Weichei«, murmelte Welscher.
Scheiß Erinnerungen, sie machten die Sache erst so schmerzhaft. Andererseits würde dieses Gefühl vergehen, die schönen Zeiten dagegen waren in seinem Kopf konserviert. Die konnte ihm niemand nehmen.
Oder?
Welscher dachte an seinen an Demenz erkrankten Vater Theo. Von dessen Erinnerungen waren nicht mehr viele übrig. Sie waren dahingeschmolzen wie Schnee in der Sonne. Inzwischen erkannte Theo niemanden mehr, selbst seine Frau war für ihn eine Fremde, die er mit »Sie« ansprach. Sofern ihm überhaupt noch Wörter über die Lippen kamen. Nichts blieb übrig, wenn man von solch einer tückischen und gemeinen Krankheit heimgesucht wurde.
Kreischend schrammte Metall über Metall, Glas splitterte.
Ein Mann mit einem Zigarrenstumpen im Mundwinkel schlenderte auf Welscher zu. Die ölverschmierte Latzhose spannte über seinem fassartigen Bauch, die Ärmel seines fleckigen Arbeitshemdes hatte er hochgekrempelt. Eine Schiebermütze schirmte seine Augen von der Herbstsonne ab. Er stellte sich an Welschers Seite. »Jung, brauchst dich nicht schämen«, nuschelte er. »Bist nicht der Erste, der bei dem Anblick kriisch.«
»Danke.«
Der Mann zog ein Stofftaschentuch aus der Hose und schnäuzte sich lautstark. »Nicht lange, dann bist du froh über die Veränderung. Den da hast du bald vergessen. Wirst schon sehen.«
Welscher schüttelte den Kopf. »Einen guten Freund vergisst man nicht.«
Der Mann lächelte. »Verstehe«, sagte er und klopfte Welscher aufmunternd auf die Schulter. »Aber du wirst darüber hinwegkommen.«
Schweigend blickten sie nach vorne. Eine Hydraulik zischte, dann ertönte ein letztes Knirschen und Knacken, und Welschers geliebter roter Fiesta wurde von der Presse als kompaktes Stahlpaket wieder ausgespuckt.
Ende, dachte Welscher, aus und vorbei.
In dem Moment klingelte sein Handy. Das Display zeigte die Nummer seines Kollegen Hotte Fischbach an. Welscher hatte ihn gebeten, nur in äußerst dringenden Fällen anzurufen, damit er seinem Fiesta in Ruhe das letzte Geleit geben konnte. Mit einem unguten Gefühl nahm er das Gespräch an.
2
Der Taxifahrer lenkte den Benz durch den Kreisverkehr und nahm die dritte Ausfahrt. »So, hier haben wir die Bonner Straße«, sagte er und deutete nach vorne. Über den Dächern der Gewerbehallen prangte an einem Mast das Logo des ADAC. »Da ist das Fahrtrainingsgelände. Ich habe dort einige Kurse absolviert. Die Sicherheit meiner Kunden ist mir sehr wichtig.« Er nickte bekräftigend.
Was für ein Schwätzer, dachte Welscher. Gibt hier den Reiseführer.
»Wissen Sie, Weilerswist ist ja ansonsten nicht mein Ding. Ist ja fast schon Köln.« Er zwinkerte Welscher zu. »Da bleib ich doch lieber in meiner geschätzten Eifel.«
»Ich hätte nichts dagegen, würde sich Köln bis zur belgischen Grenze ausbreiten«, murmelte Welscher.
Der Taxifahrer stutzte, sein Lächeln verschwand. Er sah wieder nach vorne und lenkte den Wagen in eine Linkskurve. »Was ist denn hier los?«, brummte er und stoppte vor einem quer stehenden Streifenwagen. Er reckte den Hals. »Ein Unfall? Ach du Schreck, dahinten steht ein Leichenwagen. Muss ja ganz schön gekracht haben.« Er wandte sich wieder an Welscher. »Tut mir leid, die letzten paar Meter müssen Sie leider zu Fuß gehen. Sie sehen ja selbst, ich…«
»Kein Problem.« Welscher zahlte, legte ein großzügiges Trinkgeld obendrauf, steckte die Quittung ein und stieg aus.
Er ging auf den Streifenwagen zu. Die Seitenscheibe fuhr surrend nach unten. Thomas Gilles, ein Kollege von der Streife, der anscheinend immer zufällig im Dienst und zur Stelle war, wenn es Tote gab, strahlte ihn vom Fahrersitz aus an.
Für Welschers Geschmack trafen er und Gilles viel zu häufig aufeinander. Der Kollege war der Prototyp eines Machos, wenngleich er sich selbst lieber als »stattliches Mannsbild, die Spitze der Evolution« beschrieb. Solche Leute konnte Welscher leiden wie saure Milch. Die junge Kollegin, die auf dem Beifahrersitz saß, tat Welscher leid. Sicherlich musste sie unzählige dumme Sprüche von ihm wegstecken.
»Sieh an«, sagte Gilles, »der Herr Kriminaloberkommissar findet sich auch endlich ein. Wenn wir von der Streife so gemütlich arbeiten würden, wäre im Kreis Euskirchen längst der Ausnahmezustand ausgebrochen.« Gackernd lachte er und stieß die Kollegin mit dem Ellbogen an. Die verzog genervt das Gesicht.
»Wo steckt Hotte?«, fragte Welscher.
»Kannst du dir doch denken.« Mit dem Kinn deutete Gilles in Richtung der gläsernen Ausstellungshalle. »Bis die Leiche zur Rechtsmedizin kann, wird es noch dauern.«
Welscher nickte. Das hatte er sich bereits gedacht. Die grauen Transporter der Tatortgruppe standen hinter dem Leichenwagen neben einer betonierten Fläche vor der Schauhalle des Autohauses, auf der Oldtimer parkten. Große, an den Seiten offene Zelte schützten den empfindlichen Lack der Karossen vor allzu viel Sonnenlicht. Der Tatort wurde somit noch untersucht, und der Chef der Tatortgruppe, Heinz Feuersänger, war ein Einhundertzehnprozentiger. Das konnte dauern. Er würde den Rückzug erst dann einleiten, wenn sie jedes Staubkörnchen abgeklebt hatten.
»Warte, ich bringe dich zu ihm«, sagte Gilles übertrieben fürsorglich, öffnete die Fahrertür und wuchtete seinen schweren Körper aus dem Wagen. »Ich wollte mir die alten Schätzchen sowieso mal genauer anschauen. Du hältst die Stellung, Mädel«, forderte er von seiner Kollegin und stapfte los.
»Ist das nicht ein wenig pietätlos?«, fragte Welscher.
»Bekommt doch niemand mit. Wir haben den Tatort weiträumig abgesperrt.«
Sie betraten das Gelände. Fischbachs Harley, eine Night Rod Special, lehnte neben der Zufahrt auf dem Seitenständer. Bei ihrem Anblick freute sich Welscher einmal mehr darüber, dass Fischbach vor einigen Wochen den Dienst wieder aufgenommen hatte. Sie hatten bereits befürchtet, auf ihn verzichten zu müssen. Durch eine Verwicklung in ihre Ermittlungen wäre Fischbachs Mutter zu Beginn des Jahres beinahe ums Leben gekommen. Die Sorge, dass ihm emotional nahestehende Personen erneut durch seinen Beruf in Lebensgefahr gebracht werden könnten, hatte Fischbach in eine fast acht Monate andauernde Sinnkrise gestürzt. Hätte sich Fischbachs Frau Sigrid in der schweren Zeit nicht so rührend um ihren Mann gekümmert, wer weiß, ob der Dicke jemals wieder aus dem Jammertal aufgestiegen wäre.
»Durch den Haupteingang und einmal quer durch die Halle«, sagte Gilles. »Hinten rechts findest du das Büro. Dort ist der Besitzer heute Morgen von einem Angestellten gefunden worden. Links hinter dem Rolltor ist die Werkstatt. Dort arbeiten normalerweise ein Meister und drei Gesellen. Die habe ich vorhin, als sie anfangen wollten, abgefangen und nach Hause geschickt. Namen und so weiter habe ich notiert, bekommt ihr nachher per Mail.« Er wandte sich von Welscher ab und strich mit den Fingern über den Kotflügel einer grünen Limousine. Anerkennend pfiff er durch die Zähne. »EinK70. Sieht aus wie frisch aus dem Prospekt.«
»Ein selten hässlicher Wagen. Kantig wie ein Tetra Pak.«
Gilles lachte. »Besser als deine Schrottkarre, oder etwa nicht?«
»Was weißt du schon«, entgegnete Welscher betrübt und ließ Gilles stehen. Er wollte nicht an seinen Verlust erinnert werden.
Im Schauraum empfing ihn angenehme Kühle. Hier schienen die hochpreisigen Fahrzeuge zu stehen. Welschers Wissen über Oldtimer tendierte gegen null. Aber die Markensymbole von Ferrari, Porsche und Rolls-Royce erkannte er durchaus. Seiner Schätzung nach parkten auf dem edel anmutenden Hochglanzparkett einige Millionen Euro.
Eingerahmt von zwei mächtigen Elefantenfüßen, deren Blätter saftig grün glänzten, saß ein Mann an einem Schreibtisch. Er stützte den Kopf in die Hände und achtete nicht auf sein Umfeld.
Der Angestellte, der seinen Chef gefunden hatte, vermutete Welscher. Sicher wartete er auf seine Vernehmung.
Die Tatortgruppe wuselte in einem von der Halle abgetrennten Büro herum und arbeitete akribisch jeden Quadratzentimeter ab. Glas im oberen Teil der Wand ermöglichte den Blick ins Innere. Neben dem Eingang standen geöffnete Spurensicherungskoffer. Mobile Scheinwerfer leuchteten den Tatort aus, immer wieder flackerten grell Fotoblitze auf.
Das Opfer lag noch so auf dem Boden, wie es gefunden worden war. Einzelheiten konnte Welscher aus dieser Entfernung nicht erkennen. Feuersänger stand neben Fischbach außen vor der Glaswand und leitete von dort mit raumfüllenden Gesten seine Leute an wie ein durchgedrehter Dirigent.
Welscher schritt über den roten Teppich, der zum Büro führte, und stellte sich neben die beiden. »So kenne ich dich gar nicht«, sagte er und klopfte Feuersänger auf den Rücken. »Müsstest du nicht dort drinnen sein und auf dem Boden herumkriechen?«
Feuersänger warf ihm einen bösen Blick zu, widmete sich dann aber wieder dem Tatort. Das rote Feuermal, das sich über eine Gesichtshälfte bis zum Nacken ausbreitete, kontrastierte mit Feuersängers blassem Gesicht und dem weißen Schutzoverall und leuchtete dadurch noch intensiver. Schweiß perlte ihm von der Stirn.
Fischbach beugte sich hinter Feuersängers Rücken zurück, legte den Zeigefinger an die Lippen und schüttelte mit warnendem Blick den Kopf. Dann sagte er: »Gut, dass du da bist.«
Welscher runzelte die Stirn. In welches Fettnäpfchen war er gerade getreten? Feuersänger reagierte mitunter sehr empfindlich, wenn er über die Eifel lästerte. Doch heute hatte er noch gar nicht damit angefangen. »Was wissen wir?«, fragte er und hoffte, niemandem auf die Füße zu treten.
Sein Blick wanderte zum Opfer. Das lag seitlich auf dem Boden. Die Blutlache unter dem Kopf glänzte im Licht der Scheinwerfer fast schwarz. Der Mann trug einen edlen silbergrauen Anzug, dazu dunkle Lackschuhe. Eine klobige Breitling schmückte sein linkes Handgelenk. Die Designerbrille hing ihm schief auf der Stirn. Neben dem rechten Bügel, knapp über dem Ohr, klaffte ein rundes Einschussloch. Mit weit geöffneten, leblosen Augen starrte er zur Decke.
»Das ist Peer Clerk, der Besitzer des Autohauses hier. So, wie es derzeit aussieht, ist er heute am frühen Morgen ermordet worden«, erklärte Fischbach.
Im selben Moment jaulte Feuersänger auf und hämmerte mit der Faust gegen die Glaswand. »Pass auf, wo du hinläufst, verdammt noch mal!«
Einer seiner Kollegen zuckte zusammen und zog schuldbewusst den Fuß zurück. Fast wäre er in die Blutlache getreten.
Fischbach verdrehte die Augen und bedeutete Welscher, ihm zu folgen. Sie verließen die Halle und stellten sich in die Herbstsonne. Fischbach zog seine Lederjacke aus, schob seinen Zeigefinger durch die Schlaufe am Kragen und warf sie sich über die Schulter. Die Hosenträger spannten über seinem Bauch, und die Lederhose schien ihm einige Nummern zu klein zu sein. Vermutlich stammte sie aus durchtrainierten Zeiten. Also mit anderen Worten: aus Fischbachs Jugend.
Erhitzt pustete er sich eine Locke aus der Stirn. »Feuersänger ist heute ein wenig empfindlich. Vor einer halben Stunde hat er die Grätsche gemacht. Kreislaufkollaps. Wurde kalkweiß und fiel um wie ein Sack Reis. Er wird wohl zu alt für den Job.«
Deswegen die ungesunde Gesichtsfarbe.
»Armer Kerl«, meinte Welscher mitfühlend. »Aber empfindlich? Habe ich nicht bemerkt. So ist der doch immer.«
»Tu mir einen Gefallen und lass ihn heute in Ruhe, okay?« Fischbach stutzte, als er Gilles entdeckte. Der hockte in einem olivfarbenen Willys Jeep aus dem Zweiten Weltkrieg und drehte spielerisch am Lenkrad. Dabei ahmte er tief brummend ein Motorgeräusch nach. Im Geiste fuhr er bestimmt über Stock und Stein. Auf Welscher wirkte es, als hätte man Gilles den Jeep gerade zum sechsten Geburtstag geschenkt. »Was macht der denn da?«, fragte Fischbach.
Welscher grinste. »Autos sind wohl eine Leidenschaft von ihm.«
»Das gibt ihm nicht das Recht, sich hier wie ein Kasper aufzuführen. Immerhin ist das ein Tatort.« Fischbach ging auf Gilles zu. »Hör auf mit dem Quatsch. Besorg uns lieber was zu trinken.«
Gilles kletterte aus dem Jeep. »Tolle Karre«, urteilte er und klopfte auf das Blech der Motorhaube. »Wäre was für mich. Mein Opa hat mir früher oft erzählt, wie die amerikanischen Soldaten damit durch die Eifel gebrettert sind. Immer hinter den flüchtenden Deutschen her, die gar nicht wussten, wie ihnen geschieht. Bis Remagen, und dort schwupps über die Rheinbrücke.« Gilles lachte. »Was für ein Spaß.«
Welscher glaubte, sich verhört zu haben. »Spaß. Der Zweite Weltkrieg, ein Spaß?«
Irritiert sah Gilles ihn an. »Nein, der doch nicht… ich meine… ich meinte doch nur das Fahren. Die Dinger hier springen wie die Flummis… ich… äh…« Er brach ab und kratzte sich verlegen im Nacken. »Am Kreisel vor dem Gewerbegebiet ist ein Supermarkt. Ich hole ein Sixpack Wasser, wenn’s recht ist.« Ohne eine Antwort abzuwarten, steckte er die Hände tief in die Hosentaschen und stapfte los.
»Manchmal kommt er mir vor wie ein großer Junge«, sagte Fischbach. »Komm mit.« Er führte Welscher zwischen einem VWKäfer und einer Ente hindurch, die die Sicht auf eine Bank versperrt hatten.
Sie setzten sich.
Fischbach sah zur A61, die keine zweihundert Meter entfernt als graues Band die Eifel vom Vorgebirge und der Mittelrheinebene trennte. Verkehrsgeräusche drangen an- und abschwellend zu ihnen herüber, mal mehr, mal weniger aufdringlich.
»Wir haben einen Sniper.«
»Einen… was?« Welscher war von einem Raubmord ausgegangen, ein Schuss aus nächster Nähe, so wie in zig Dutzend Fällen, in denen er ermittelt hatte.
3
Der heiße Sommerwind strich über die reifen Weizenhalme. Von weit her brummte das Geräusch eines Mähdreschers zu Emelie herüber. Er stellte keine Gefahr dar. Mindestens einen Tag würde er noch auf der anderen Seite des Hügels seine Kreise ziehen, bevor er hier auftauchte.
Ihre zwei Jahre jüngere Schwester, die mit verschränkten Armen unter dem Kopf neben ihr im Feld lag, nieste. »Es kitzelt in der Nase«, rief sie. »Aber es riecht viel besser als im Krankenhaus.« Um ein erneutes Niesen zu unterdrücken, hielt sie die Luft an und strampelte mit den Beinen.
»Stimmt. Dort war es ekelig«, sagte Emelie. Der Geruch nach Desinfektionsmitteln und alkoholhaltigen Arzneien hing ihr noch in der Nase. Fünf Monate hatte sie mit ihrem mehrfach gebrochenen Bein im Streckbett ausharren müssen. Sogar ihren dreizehnten Geburtstag hatte sie dort verbringen müssen. Sie dachte an das Bild, das sie in der Zeitung gesehen hatte, und bekam eine Gänsehaut. Ihr Fahrrad, von den riesigen Reifen des Lastwagens verbogen, Striche auf dem Asphalt, ein Krankenwagen. Sie schüttelte sich, versuchte, nicht mehr daran zu denken.
Jetzt war es fast wieder wie früher. Gott hatte im letzten Moment die schützenden Hände über sie gehalten, und jeden Abend dankte sie ihm mit einem inbrünstigen Gebet dafür. Sie würde nur nie wieder so schnell laufen können wie vor dem Unfall. Ein steifes Knie hinderte sie daran. Sie humpelte wie Orry Main in der Serie »Fackeln im Sturm«, die sie und ihre Schwester so liebten.
Der Arzt sagte, dass sich das noch bessern würde. Emelie hoffte, dass er recht behielt, und übte, wann immer es ging. Ihre Schwester half ihr dabei. Sie war stets an ihrer Seite. Emelie liebte ihre Schwester mehr als ihre Eltern.
Auch der Marsch hierher, zu einem Weizenfeld fernab des Dorfes, war die Idee ihrer Schwester gewesen. Zunächst hatte Emelie protestiert, sie traute sich den weiten Weg noch nicht zu, doch ihre Schwester hatte jegliche Bedenken an sich abperlen lassen. »Übung macht den Meister«, hatte sie neunmalklug behauptet, gelacht und Emelie von der Bank vor dem Haus hochgezogen. »Vielleicht sehen wir einen Hasen.«
Emelie liebte Hasen. Obwohl sie bereits dreizehn Jahre alt war, schlief sie noch jede Nacht mit ihrem Kuschelhasen im Arm ein. So hatte sie schließlich eingewilligt.
Über ihnen malte ein Flugzeug Kondensstreifen an den blauen Himmel. Sie sahen ihm nach, bis es in der Ferne verschwunden war und die Streifen sich langsam auflösten.
Sie hatten sich fest vorgenommen, gemeinsam nach Amerika zu fliegen, sobald sie alt genug dazu waren. Sie würden sich die Südstaaten anschauen, das war ihr größter Traum. Wie Orrys Schwester Brett in einem wallenden Kleid über die Veranda oder durch den Garten von Mont Royal zu spazieren, so wie in »Fackeln im Sturm«, musste wunderbar sein.
Sie hatten sich das gegenseitig fest versprochen und freuten sich schon wahnsinnig darauf.
Emelie seufzte sehnsüchtig. »Jetzt ein Eis. Schoko. Oder nein… doch lieber was Erfrischendes. Erdbeere, mhm.«
»Oder Zitrone.«
»Ja, noch besser.« Emelie leckte sich mit der Zunge über die Lippen. »Eine Limo wäre auch schön.«
»Mama hat Eis eingekauft. Wir können auf dem Rückweg am Bach vorbeigehen. Durst habe ich auch.«
Emelie kämpfte sich in die Höhe und stand auf. Prüfend belastete sie ihr Bein. Der Schmerz schoss von der Ferse hinauf bis in die Leiste. »Au!«
»Was ist?« Ihre Schwester klang besorgt.
»Ich glaube, es war doch zu viel.«
»Und jetzt?«
Emelie lachte. »Mach nicht so ein entsetztes Gesicht.« Sie deutete zum Waldrand, der an das Feld anschloss. Vor einem steinernen Wegkreuz stand eine Bank. »Ich setze mich dort in den Schatten. Du läufst zurück und sagst Papa Bescheid. Er kann mich dann abholen.«
Ihre Schwester fasste Emelies Hand. »Es tut mir leid. So weit zu gehen, war eine blöde Idee.«
»Quatsch. Du kannst nichts dafür. Und jetzt düs los, sonst bekommen wir nie unser Eis.« Emelie lächelte aufmunternd und humpelte in Richtung Bank.
»Ich bringe Limo mit«, rief ihre Schwester, bevor sie davonrannte, um den Vater zu holen.
Zum wiederholten Mal blieb Emelie stehen und biss die Zähne aufeinander. Es dauerte fast eine halbe Minute, bis der Krampf im Bein nachließ und sie die letzten Meter bis zur Bank zurücklegen konnte. Stöhnend ließ sie sich auf dem verwitterten Holz nieder. Ihre Muskeln waren noch weit von der alten Form entfernt. Aber sie war zuversichtlich. Sie würde damit klarkommen, da hatte sie keine Zweifel. Jeden Tag ging es besser.
Mit der Hand schirmte sie die Augen ab und suchte ihre Schwester. Die hatte den kürzesten Weg durch das Feld gewählt und war nicht mehr zu sehen.
Die Ähren bewegten sich seicht im Wind, einer Meeresdünung gleich. Ein stetiges Rauschen lag in der Luft und überlagerte den Motorlärm des Mähdreschers.
In spätestens einer Dreiviertelstunde würde ihr Vater hier sein. Bestimmt war er sauer und hielt ihr eine Standpauke. Sie würde es tapfer ertragen, sie wusste ja, dass es nur seine Sorge war, die in solchen Momenten aus ihm sprach.
Emelie schloss die Augen und lehnte sich zurück. Hier im Schatten konnte sie es trotz des Durstes ohne Probleme noch eine Weile aushalten.
Das Laub der Bäume raschelte über ihrem Kopf und schläferte sie ein. Glücklich schloss sie die Augen. So konnte man den ausgehenden Sommer genießen. Das war viel mehr, als sie zu Anfang des Jahres zu hoffen gewagt hatte. Dabei war das Leben so schön, einfach phantastisch. Sie spürte in sich eine wiedergefundene Energie, die nur die untrainierten Beinmuskeln bremsen konnten. Ansonsten wäre sie stundenlang gerannt… über die Felder, am Bach entlang, den Hügel hinauf…
Ein Knacken hinter ihr ließ sie zusammenschrecken. Sie wandte sich um und spähte ins Dickicht. Was war das gewesen? Ein Reh? Ihr Herz schlug wild.
»Ist da wer?«, rief sie. »Papa?«
Nein, er konnte noch nicht hier sein, das wäre zeitlich unmöglich zu schaffen.
»Hallo?«
Keine Antwort, stattdessen ein Rascheln halb links von ihr, dort, wo die mannshohen Ginsterbüsche aufragten.
Emelie sprang auf. Sofort schmerzte ihr Bein wieder, die Muskeln verhärteten sich. »Ich habe keine Angst«, sagte sie laut. Leider klang ihre Stimme nicht so fest, wie sie es geplant hatte.
Ein Lachen war die Antwort. Dann erhob sich hinter dem Ginsterbusch ein Mann. Er kam ein paar Schritte auf sie zu.
Emelie hatte ihn noch nie gesehen, es war niemand aus dem Dorf. Er hatte ein sympathisches Gesicht, aus grünen Augen strahlte er sie an. Die gewellten dunklen Haare fielen ihm bis auf die Schultern. Allerdings wirkte seine Kleidung ein wenig abgerissen, die Jeans war ausgeblichen, das karierte Hemd faserte an den Rändern aus.
»Was machst du denn so allein hier?«, fragte er.
Kurz überlegte Emelie, trotz seines freundlichen Auftretens einfach davonzulaufen. Dass er sich angeschlichen hatte, war ihr nicht geheuer. Er hätte doch einfach den Weg nehmen können. Stattdessen zwängte er sich durch das Dickicht. Bestimmt führte er etwas im Schilde. Doch der Mann wirkte trotz eines über den Gürtel quellenden Bauches kräftig und trainiert. Er würde sie nach wenigen Metern eingeholt haben. »Ich bin nicht allein. Meine Schwester ist bei mir.«
Der Mann zuckte beinahe unmerklich zusammen und sah sich prüfend um. Dann stahl sich ein gemeines Lächeln in seine Mundwinkel.
Emelie fröstelte.
»Deine Schwester, so, so. Also, ich sehe niemanden. Spielt ihr Verstecken? Sollen wir sie mal rufen?«
»Mein Vater kommt mich gleich abholen.«
»Nur dich? Deine Schwester nicht?«
Emelie biss sich auf die Unterlippe. Sie hatte einen Fehler gemacht. »Na klar, die auch«, stieß sie hastig aus.
Der Mann machte noch einen weiteren Schritt auf sie zu. »Wie schön. Ist ja ein richtiges Familientreffen.«
Emelie wich zurück und geriet ins Straucheln. Der Länge nach fiel sie zu Boden. Schmerzhaft bohrte sich ein Stein in ihren Rücken. Ihr Puls raste. Dieser Mann war eine Gefahr, das spürte sie. Sie musste fliehen. Sie ignorierte den Schmerz und drehte sich auf den Bauch, um sich hochzustemmen. In dem Moment warf sich der Mann auf sie. Unter seinem Gewicht brach sie zusammen und stieß einen überraschten Schrei aus.
»Wirst du wohl still sein«, krächzte der Mann. Seine erhitzte Wange drückte sich an ihre. Er stank aus dem Mund.
Das Gewicht, das auf ihr lastete, verringerte sich. Der Mann riss sie herum auf den Rücken, stützte sich auf ihre Handgelenke und drückte mit seinen Knien ihre Beine auseinander.
Emelie wollte schreien, doch ihre Stimme hörte sich dünn und ängstlich an. Der Mann presste seine Hand auf ihren Mund.
Zu fest.
Sie bekam keine Luft mehr, schon nach wenigen Sekunden brannten ihre Lungen und gierten nach Sauerstoff. Panisch schlug Emelie um sich. Ihre Sinne schwanden, sie fühlte sich, als würde sie in ein dunkles Loch stürzen.
Das Letzte, was sie spürte, bevor die Schwärze sie vollkommen einhüllte, war ein heißer, heftiger Schmerz zwischen ihren Beinen.
4
»Hinter der Halle ist Brachland.« Fischbach deutete mit der Hand in die entsprechende Richtung. »Der Schuss kam von irgendwo da drüben. Freies Feld, so weit das Auge reicht. Nur wenn du dich dort in einem Busch versteckst, sieht dich niemand.« Er ließ den Arm wieder sinken, sein Magen grummelte. Er war am Morgen ohne ein ordentliches Frühstück aufgebrochen.
Welscher blickte nach rechts. »Was ist mit den Neubauten dort hinten? Von den Terrassen aus hat man einen wunderbaren Blick auf das Niemandsland, vielleicht wurde der Schütze gesehen, als er sich sein Versteck suchte oder es wieder verließ.«
»Ich habe zwei Kollegen losgeschickt, die sich bei den Anwohnern umhören sollen. Dass der Schütze beobachtet wurde, kann ich mir nicht vorstellen. In dem Fall hätte es wohl eine Meldung gegeben. Möglicherweise hat aber jemand den Schuss gehört. Dann hätten wir wenigstens den Tatzeitpunkt.«
»Der Täter wird einen Schalldämpfer verwendet haben.«
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf dem Land regt sich doch keiner über einen Schuss auf. Jeder denkt, dass ein Jäger oder Förster…«
»…oder ein Wilddieb…«
»Von mir aus auch das. Entsprechende Fälle haben die zuständigen Kollegen ja häufiger auf dem Tisch liegen. Was ich aber sagen will: Ein Schalldämpfer wäre nicht zwingend erforderlich, um ungeschoren das Weite suchen zu können. Feuersänger hat vier seiner Leute losgeschickt, um das Gelände abzusuchen. Mit ein wenig Glück finden sie die Patronenhülse. Oder Stofffasern, Schuhabdrücke und so weiter.«
»Die sprichwörtliche Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.«
»Du sagst es. Der Chef hat Verstärkung versprochen.« Fischbach sah auf die Uhr. »Die eigentlich schon hier sein sollte.«
»Ist die Fensterscheibe bei dem Schuss zu Bruch gegangen?«
Fischbach schüttelte den Kopf. »Das Fenster stand offen. Der Angestellte, der den Toten bei Arbeitsbeginn gefunden hat, hat ausgesagt, dass Clerk frische Luft und die Fernsicht liebte. Deswegen auch dieser Glasplast. Bei Autos bevorzugte er Cabriolets. Klimaanlagen waren ihm ein Gräuel, stattdessen riss er sogar im Winter die Fenster gern sperrangelweit auf.«
»Verstehe. Also freie Schussbahn.«
»Ja. Ein paradiesischer Umstand für einen Sniper.«
»Was wissen wir noch?«
»Der Name des Toten ist Peer Clerk, Baujahr 1960. Laut Aussage des Angestellten mit einer gleichaltrigen Frau glücklich verheiratet. Beide Holländer. Er…«
»Oh, du Eifelbauer. Holländer? Du meinst wohl Niederländer«, korrigierte Welscher.
»Mensch, nerv mich nicht«, fuhr ihn Fischbach an. Wenn es irgendwie ging, gab Jan gern den Großstädter, der unter hinterwäldlerischen Eiflern leben musste. Das konnte einem gehörig auf den Wecker gehen. »Also, Peer Clerk hatte die Eifel als seine Wahlheimat auserkoren. Er wohnt… wohnte… mitten in Bad Münstereifel, in einem Fachwerkhaus, dem er zu neuem Glanz verholfen hat. Keine Kinder. Mehr konnte ich bisher nicht in Erfahrung bringen. Ich will den Angestellten gleich noch mal ausführlich befragen. Frank Lux arbeitet seit zwei Jahren für Clerk. Er hat es vorhin mit den Nerven bekommen, brachte auf einmal keinen Ton mehr raus.« Fischbach hatte noch nie zuvor einen Mann derart weinen sehen. »Ich hoffe, er hat sich inzwischen etwas gefangen.«
Feuersänger kam auf sie zu. Er streckte sich und atmete tief durch. Dabei wirkte er weitaus lebendiger als noch vor ein paar Minuten. Seine Gesichtsfarbe hatte wieder einen normalen Ton angenommen. »Die Verstärkung trifft gleich ein«, sagte er. »Ich gehe sie einweisen. Ich habe auch eine 3-D-Kamera angefordert. Damit können wir die Schussbahn genauer bestimmen.«
Fischbach stand auf. »Gut. Wir kümmern uns dann mal um Lux.«
Sie gingen zurück in die Halle und setzten sich vor Lux’ Schreibtisch auf die Besucherstühle.
Clerks Mitarbeiter sah mit rot geränderten Augen auf. Sein beigefarbener Anzug war zerknittert, auf dem Stoff des weißen Hemdes zeichneten sich dunkel vergossene Tränen ab. »Wer macht so was? Ich… ich verstehe das nicht. Peer ist… war… so großherzig.«
Welscher reichte ihm ein Papiertaschentuch. »Sie können sich also niemanden als Täter vorstellen? Hatte Ihr Chef keine Feinde?«
Entrüstet richtete sich Lux auf. »Feinde? Peer doch nicht. Mit dem konnte man nicht streiten. Er fand immer einen akzeptablen Kompromiss, übervorteilte niemanden, ist… war äußerst fair.«
»Leben und leben lassen«, sagte Fischbach. Doch seine Erfahrung ließ ihn zweifeln. Je friedliebender ein Mensch charakterisiert wurde, desto schlimmer stank hinterher dessen Leiche im Keller. »Wie war die Ehe der Clerks? Können Sie dazu etwas sagen?«
Lux schnäuzte ins Taschentuch. »Lea ist in Ordnung. Die beiden verstanden sich gut.«
Fischbach fiel auf, dass Lux’ Stimme einen sachlicheren Ton angenommen hatte. »Lea Clerk? Ist das der Name der Frau?« Er wollte sein Notizbuch aus der Jackentasche ziehen, da bemerkte er, dass Welscher bereits mit flinken Fingern auf dem Display seines Smartphones herumtippte, und ließ es bleiben.
Lux nickte. »Peer hat nur Gutes über sie berichtet. Hin und wieder taucht sie hier auf, immer höflich, immer freundlich.« Er schlug wieder die Hände vors Gesicht und schluchzte. »Sie weiß es bestimmt noch nicht.«
»Darum kümmern wir uns«, sagte Fischbach. »Wie viele Angestellte arbeiten hier?«
Lux wischte sich mit dem Jackettärmel über die Augen. »In der Werkstatt sind es vier.« Er wollte die Namen aufzählen, doch Welscher stoppte ihn.
»Das ist schon geklärt. Mein Kollege hat sich darum gekümmert. Wer noch?«
»Nun, hier bei uns gibt es noch die Tanja, also Tanja Keller. Die kümmert sich um die Buchhaltung und was noch so anfällt. Sie arbeitet von zu Hause aus. Jeden Nachmittag kommt sie vorbei, lässt Peer Briefe und andere Dokumente unterschreiben, holt Nachschub und bespricht alles mit uns, was am Telefon zu umständlich zu erklären wäre. Wenn sie auftaucht, wird es lustig. Die Tanja hat den Schalk im Nacken, die lacht die ganze Zeit.« Er gab etwas über die Tastatur in seinen Computer ein und drehte den Bildschirm so, dass Fischbach und Welscher ihn sehen konnten. »Ihre Kontaktdaten«, erklärte Lux.
Welscher nahm sie in sein Smartphone auf.
»Dann arbeitet noch Jo bei uns, Jolanda Walser. Sie hält hier alles sauber. Um neunzehn Uhr fängt ihre Schicht an.« Er rief für Welscher auch ihre Adresse und Telefonnummer auf. Anschließend schob er eine Visitenkarte über den Tisch. »Meine Privatanschrift. Wie geht es denn jetzt weiter? Ohne Peer wird das Geschäft den Bach runtergehen.«
Fischbach hätte gern etwas Tröstliches geäußert. Doch was sollte man jemandem sagen, der vor einigen Stunden ein Mordopfer gefunden hatte und dessen Existenzgrundlage dadurch auf einen Schlag gefährdet war? Ihm fiel nichts ein.
Lux sah zum Fenster hinaus und kniff die Augen zusammen. »Was machen die denn da?«
Die Verstärkung war eingetroffen. Feuersänger hatte die gut zwanzig Mann in einer Reihe Aufstellung nehmen lassen und schickte sie nun über das freie Feld in die Richtung, aus der der Schuss gekommen war.
»Die suchen das Feld nach Spuren ab. Wenn dort irgendwo etwas sein sollte, werden sie es finden«, erklärte Fischbach. Er wandte sich an Welscher. »Auf nach Bad Münstereifel?«
Welscher nickte, verzog dann aber das Gesicht. »Ich habe keinen Wagen. Bin mit dem Taxi gekommen.«
Fischbach zögerte. »Ich mach das ja nicht so gern, weißt du ja, aber es geht wohl nicht anders«, sagte er dann. »Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich nehme dich auf der Harley mit.«
»Hast du denn einen zweiten Helm dabei?«
Fischbach sah Lux an. »Sie haben nicht zufällig einen hier herumliegen?«
Lux schüttelte den Kopf, hielt dann inne. »Ach, wissen Sie was?« Er zog die Schreibtischschublade auf und entnahm ihr ein durchsichtiges Mäppchen, in dem ein Wagenschlüssel schimmerte. Er reichte es Welscher. »In der Werkstatt steht unser Leihwagen, direkt vor dem Rolltor. Ich lasse Sie gleich raus.«
»Das geht doch nicht«, protestierte Welscher.
Lux winkte ab. »Als würde es darauf jetzt noch ankommen. Bringen Sie ihn einfach zurück, wenn Sie alles geklärt haben. Nur keine Hemmungen. Er wird Ihnen gefallen. Peer legte großen Wert darauf, seine Kunden bei Laune zu halten.«
Fischbach hieb sich mit den Händen auf die Oberschenkel. »Damit ist ja alles geklärt, vielen Dank, Herr Lux. Sie haben uns…«
Ein scharfer Befehlston schnitt Fischbach das Wort ab.
»Bleiben Sie endlich stehen!«
Fischbach ruckte herum.
Mit hochrotem Kopf lief Gilles hinter einem Koloss von Mann her, der eilig über den roten Teppich schritt und sich mit entschlossenem Gesichtsausdruck umsah. Der Mann trug ein eng anliegendes T-Shirt, das seine Muskelpakete betonte. Die langen blonden Haare hatte er zu einem Zopf zusammengebunden. Gilles erreichte ihn und packte den Mann an der Schulter, doch der schüttelte die Hand ab wie eine lästige Fliege. Kurz blieb sein Blick an Feuersängers Männern hängen, dann bemerkte er die Kommissare. »Was zum Teufel ist hier los?«, rief er, änderte dabei die Marschrichtung und kam direkt auf sie zu.
Fischbach und Welscher standen auf.
»Jetzt ist aber Schluss!«, schrie Gilles.
In dem Moment kam seine Kollegin durch den Eingang geschossen, rannte auf den Koloss zu, ergriff dessen Handgelenk und drehte ihm den Arm auf den Rücken.
Der Mann ging in die Knie und krümmte sich vor Schmerzen. »Hey, was soll das?«
Gilles kam ihr zur Hilfe. »Du solltest doch im Wagen bleiben. Ich hätte das schon allein geschafft.«
»Klar, weiß ich doch«, sagte sie. Der Sarkasmus in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
»Was ist hier los?«, fragte Fischbach.
Gilles zeigte anklagend auf den Muskelprotz. »Der ist einfach an mir vorbeigerannt«, erklärte er.
Welscher lachte verächtlich. »Bist du nicht Manns genug, einzuschreiten?«
Gilles lief rot an. »Ich hatte doch die Hände voll. Eure Getränke, vom Supermarkt…«
Fischbach schnitt ihm mit einer forschen Handbewegung das Wort ab. »Es reicht.« Er trat einen Schritt vor und beugte sich zu dem Mann hinunter. »Versprechen Sie mir, sich zu benehmen?«
Der Mann nickte. Er schwitzte, der Baumwollstoff seines T-Shirts war von Feuchtigkeit durchnässt. Ein säuerlicher Geruch stieg Fischbach in die Nase. Er gab der Kollegin ein Zeichen, den Griff zu lockern.
Der Mann richtete sich auf, rieb sich das Handgelenk und schnaufte durch. Er war gut und gern ein Kopf größer als Fischbach.
»Wer sind Sie? Was fällt Ihnen ein, eine Ermittlung zu behindern?«, fragte Fischbach unbeeindruckt.
Auf der Stirn des Mannes bildeten sich tiefe Furchen. »Ermittlung? Etwa Diebstahl?«
Lux räusperte sich. »Das ist Max Gutmann, ein Freund von Peer.«
»Richtig«, krächzte der Koloss. »Um genau zu sein: sein bester Freund.«
»Und warum befolgen Sie die Anweisungen eines Polizeibeamten nicht?«
»Ich habe gedacht… also…« Er warf Gilles einen vernichtenden Blick zu und ging dann in die Offensive. »Was würden Sie denn denken, wenn da ein Kerl in Uniform vor Ihnen steht, in der einen Hand ein Paket Wasser, in der anderen ein Sixpack Bitburger, und Ihnen den Zugang verwehrt? Dazu im Mund eine Schachtel Kippen. Ich habe gedacht, da erlaubt sich jemand einen Scherz, und bin einfach vorbei.«
Welscher grunzte amüsiert. »Bier?«
»Irgendwann habe ich schließlich auch mal Feierabend«, verteidigte sich Gilles halbherzig. Er schwitzte jetzt auch.
Fischbach wollte davon nichts mehr hören. Mit Gilles erlebte man so einiges, seine Überraschung hielt sich daher in Grenzen. Er bedankte sich bei der Kollegin, schob sie mit Gilles zur Tür hinaus und bat Gutmann, auf einem der Besucherstühle Platz zu nehmen.
»Peer ist tot«, sagte Lux. Tränen rannen ihm über die Wangen.
Gutmanns Augen weiteten sich. »Tot? Wie…« Er schluckte schwer und drehte sich zu Clerks Büro um. »Etwa hier?« Er wandte sich an Fischbach. »Was ist passiert?«
»Ihr Freund ist aller Wahrscheinlichkeit nach ermordet worden. Herr Lux hat ihn heute Morgen gefunden. Wissen Sie, ob Herr Clerk mit jemanden Streit oder Ärger hatte?«
»Streit? Wie… nein.« Gutmann schüttelte heftig den Kopf. »Ich meine, jeder hat mal unschöne Dinge zu klären, das war bei Peer nicht anders. Ein ärgerlicher Käufer, ein unzufriedener Mitarbeiter, so was. Aber das sind doch Nichtigkeiten. Niemand wird wegen so etwas zum Mörder.«
Welscher beugte sich vor. »Herr Gutmann, Sie würden sich wundern, was wir schon alles erlebt haben. Es gibt die kuriosesten Mordmotive.«
»Mag sein. Aber ihn mochten alle. Er hatte ein einnehmendes Wesen.« Gutmann raufte sich die Haare. »Ich fasse es nicht. Ausgerechnet Peer.«
»Was wollten Sie eigentlich von ihm?«, fragte Welscher. »Warum sind Sie hier?«
»Nächste Woche startet die ›Eifel-Klassik‹, eine Oldtimer-Ausfahrt quer durch die Eifel. Peer und ich sind im Organisationsteam. Es gibt noch ein paar Dinge zu regeln.«
»Einen Moment bitte.« Welscher stand auf, ging zum Eingang von Clerks Büro, redete kurz mit einem Tatorttechniker und kam mit einem iPad zurück. Er tippte darauf herum, dann schien er gefunden zu haben, wonach er gesucht hatte. »Hm, in Clerks Terminkalender stehen Sie nicht.«
Gutmann schnaufte verächtlich. »Als bester Freund braucht man wohl keinen Termin, oder? Und überhaupt, was soll das jetzt? Wollen Sie irgendetwas andeuten?«
Fischbach bemerkte, dass Lux sich versteifte. Der Angestellte öffnete den Mund, schloss ihn dann aber wieder und ballte die Hände zu Fäusten.
»Nein«, sagte Welscher, »ich erledige nur meinen Job. Und dazu gehört es, Fragen zu stellen und Angaben zu überprüfen.«
»Lassen Sie mich raus aus der Nummer«, knurrte Gutmann, »ich bin nicht Ihr Mann. Ich bin Dachdecker und war den ganzen Morgen auf der Baustelle. Sie können meine Gesellen fragen.«
Welscher legte Clerks iPad auf den Tisch. »Wir werden sehen.«
Fischbach stellte noch einige Fragen, um sich ein besseres Bild von Clerks sozialem Umfeld machen zu können. Dann entließ er Gutmann. Der ging mit hängenden Schultern davon.
»Jetzt aber los«, sagte Welscher. Er fummelte den Wagenschlüssel aus dem Mäppchen und bestaunte das Logo. »Ein Porsche?«
Lux reagierte nicht darauf. Er starrte Gutmann hinterher, bis dessen breiter Rücken hinter dem Leichenwagen verschwunden war. Dann krächzte er: »Gerade ist es mir wieder eingefallen: Herr Gutmann ist Sportschütze. Er muss richtig gut sein, er hat bereits einige Meisterschaften gewonnen.«
Gefolgt von Welscher trat Fischbach aus dem Autohaus. »Den Gutmann knüpfen wir uns noch mal genauer vor, sobald wir aus Bad Münstereifel zurück sind…« Die ersten Töne von »Black Betty« erklangen. Er zog sein Handy aus der Jackentasche und sah auf das Display. »Der Chef.«
Welscher grinste breit. »Ram Jam? Du Blender.«
Fischbach ignorierte ihn und nahm das Gespräch an. Welscher wusste von seiner Vorliebe für Schlagermusik und mutmaßte wohl mal wieder, er würde durch Rockmusik als Handyklingelton davon ablenken wollen. Ein bisschen stimmte das auch. Er konnte schlecht als harter Biker durchgehen, wenn er sein Handy Beatrice Eglis »Mein Herz« trällern ließ. Das ging in der Öffentlichkeit gar nicht, das gönnte er sich nur zu Hause. Nicht selten nahm Welscher ihn deswegen hoch. Was sein Kollege allerdings nicht wusste, war, dass Fischbach mit gerade mal achtzehn auf einer wilden Fete seine erste Frau kennen- und lieben gelernt hatte. Die Musik von Ram Jam, die an dem Abend ihren ersten Kuss begleitete, würde er nie vergessen.
Er spürte Trauer in sich aufsteigen und meldete sich rasch. Ablenkung war die beste Medizin. Nur nicht die bösen Geister der Vergangenheit heraufbeschwören. Es war eine blöde Idee gewesen, das Lied als Handyton auszuwählen.
»Wie schaut es bei euch aus?«, fragte Bönickhausen.
Fischbach stutzte. »Wir machen uns gerade auf den Weg zur Witwe. Soll ich dich wirklich am Telefon über den Fall informieren?«
Normalerweise bevorzugte Bönickhausen, sofern er nicht selbst am Tatort erschien, so bald wie möglich einen ausführlichen schriftlichen Bericht. Blieben Fragen offen, hakte er direkt beim zuständigen leitenden Beamten nach. Persönlich, von Angesicht zu Angesicht.
»Du hast recht«, sagte Bönickhausen. »Ist Jan bei dir?«
»Klar.«
»Er fährt zur Witwe. Du kommst zu mir.«
»Aber…« Fischbach wollte aufbegehren. Zu zweit eine Hinterbliebene zu informieren, war einfacher, als sich dieser unangenehmen Aufgabe allein zu stellen. Doch Bönickhausen schnitt ihm das Wort ab: »Ich bin in meinem Büro und erwarte dich. Bis gleich.«
5
Frau Kreuz, Bönickhausens Sekretärin, empfing Fischbach mit einem Kaffee. Ihre toupierten Haare standen heute außerordentlich aufrecht und glichen einem aufgeschichteten Heureiter. »Der Chef ist gleich so weit. Dauert bestimmt nicht mehr lange.«
Dankbar nahm Fischbach ihr die Tasse aus der Hand und wärmte seine Finger daran. In der morgendlichen Eile hatte er die Handschuhe in der Werkstatt liegen lassen, und die Herbstkälte hatte beim Fahren eisige Krallen in seine Finger geschlagen. Er schlenderte zum Vorzimmeraquarium, in dem in einer Ecke Luftblasen gurgelnd an die Oberfläche stiegen. Bunte Fische flitzten hin und her. Ein besonders vorwitziger Zwerg hing an der Scheibe und schien Fischbach aus zwei nachtschwarzen Augen heraus zu beobachten.
»Was will er denn?«, fragte Fischbach und schlürfte den Kaffee.