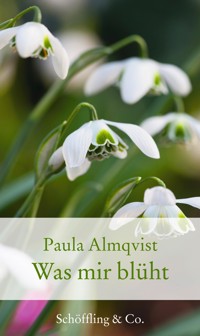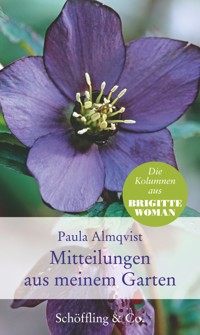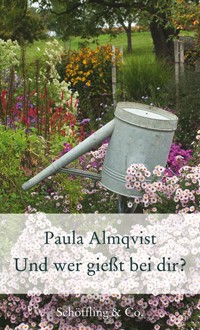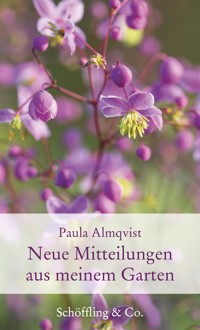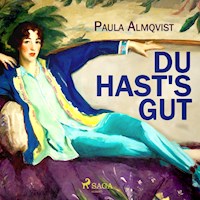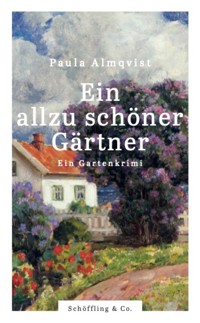
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unterwegs durch die Normandie, den wunderbaren Mont St. Michel schon vor dem inneren Auge – was könnte da weniger gelegen kommen als eine Autopanne!? Eine defekte Benzinpumpe zwingt die Erzählerin und ihren Ehemann Robert, mehrere Tage in dem Provinznest Merville zu warten. Doch der Zwischenstopp wird zum Glücksfall. Eine verwilderte Idylle aus Lorbeer und Flieder kreuzt ihren Weg, dahinter das Meer und davor ein Schild: Haus zu verkaufen. Als sie den Zuschlag erhält, macht sich die Erzählerin voller Begeisterung an die Arbeit und richtet sich im Haus und dem wunderbaren Garten ein. Das beschauliche Leben könnte beginnen – wäre nicht plötzlich die gerade neu gewonnene Freundin verschwunden. Eine fesselnde Geschichte über schöne Gärten und rätselhafte Dorfbewohner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Jeder hier in …
PERSONEN
Autor:innenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Widmung
Für Christer, Johan, Olgaund den schwedischen Volksschriftsteller Fritiof Nilsson Piraten (1895–1972), der Kritik an seinen Romanen begegnete mit den Worten: »Alles ist so passiert! Es war nur noch nie aufgeschrieben worden.«
Jeder hier in Merville hat mich mit mehr oder weniger diskreter Neugier schon mal gefragt, was eine Deutsche, nicht mehr ganz jung, ausgerechnet in ihr Provinznest am Atlantik verschlagen hat. Wahrscheinlich wollten sie eine romantische Geschichte hören. Ich war oft versucht zu erzählen, dass sich meine Eltern auf dem Campingplatz von Merville kennengelernt hätten und ich hier gezeugt worden sei und jetzt nach meinen Wurzeln suchen wollte … Oder dass mein Erbonkel auf einer Busfahrt mit der Kriegsgräberfürsorge einst hier übernachtet und mir immer von Merville vorgeschwärmt hätte. Dann rückte ich aber doch mit der Wahrheit heraus.
Der Grund war eine banale Autopanne mit allerdings weitreichenden Folgen. Robert und ich zuckelten durch die Normandie auf dem Weg zum Mont-St.-Michel. Es hatte ursprünglich eine Versöhnungsreise bis hinunter nach Biarritz werden sollen. Aber als wir an einem Freitagabend das Dorf Merville erreichten, blieb unser uralter Mercedes-Kombi einfach bockig stehen. Motor mausetot.
Es gab damals in Merville noch das kleine abgewetzte Hôtel de la Mer, kein Stern, wo wir ein Zimmer bekamen, in dem es nach Hausschwamm roch, und ganz froh über die funzelige Beleuchtung waren, weil man nicht sehen konnte, was man lieber nicht so genau wissen wollte. Dafür ging uns beim Sonnenuntergang über dem Meer das Herz auf. »Wenn bei Merville die rote Sonne im Meer versinkt …«, sang ich so vergnügt wie falsch. Und Robert stimmte ein. Rudi Schuricke drehte sich sicher in seinem Grab herum.
Der Blick aus dem Fenster zur Straßenseite war ebenfalls erfreulich: Eine Garage mit Werkstatt! Wo wir am nächsten Morgen erfuhren, dass es trotz meiner Bitten und Schmeicheleien mindestens fünf Tage dauern würde, um eine neue Benzinpumpe zu kriegen. Der junge Schrauber mit den öligen Händen lobte mein gutes Französisch – dafür wurde ich im Laufe der Zeit immer wieder mal bestaunt –, für die meisten Leute hier sind Fremdsprachen ein Buch mit sieben Siegeln. Also erklärte ich, dass ich nach dem Abitur eine Ausbildung als Übersetzerin für französische Literatur gemacht hatte. Was mir daran obendrein gefiel, war die Aussicht, nicht in irgendeinem Büro, sondern im Homeoffice zu arbeiten, was damals natürlich nicht so hieß.
Es war Robert genauso klar wie mir, dass wir nicht fünf Tage in diesem versifften Hotel sitzen konnten und den lauwarmen Kaffee trinken, den die steinalte Hotelbesitzerin aus einer Aluminiumkanne ausschenkte. Sondern aus dem Zwangsaufenthalt ein bisschen Erlebnisurlaub machen mussten. Wir zogen Turnschuhe an und beschlossen, durch sämtliche Sträßchen und Gassen zu streifen, um Merville zu erkunden. Die Hauptstraße lief parallel zum Meer und hatte außer dem Hotel und der Werkstatt noch eine Bäckerei, eine Metzgerei, eine diplomierte Krankenschwester, ein winziges Postamt und natürlich ein Bistro zu bieten. Gegenüber, die kleine Bürgermeisterei, untergebracht in einer rosigen Stuckvilla der 30er Jahre. Eine Bronzebüste erinnerte an den Erbauer, einen Textilfabrikanten aus Nordfrankreich, der Meeresbäder geliebt hatte. Zu seiner Zeit konnte man hier noch schwimmen. Inzwischen hat sich die Strömung stark verändert, so dass sich der Sandstrand in ausgedehnte Salzwiesen verwandelt hat. Zur Freude der Bauern, die hier ihre Schafe grasen lassen, weil Salzwiesen-Lämmer fast den doppelten Preis bringen. Am Ende der Hauptstraße lag ein ziemlich verwaister kleiner Hafen, in dem ein paar Freizeit-Boote im Schlick dümpelten und auf die nächste Flut warteten. Nur ein Schaukasten mit einem verblichenen Schwarz-Weiß-Foto erinnerte an die alte Grandeur: Handelsschiffe, hochgetakelte Fregatten und Schoner, die nach England oder sogar bis Neufundland zur Kabeljau-Jagd gefahren waren, hatten hier einst gelegen. Am anderen Ende der Straße gab es eine kleine Seemannskirche mit vielen Votiv-Bildern, Generationen von Matrosen gewidmet, die »auf dem Meer geblieben« waren. Es roch schön katholisch nach Weihrauch, welken Blumen und Wachskerzen.
*
Den sanften Hügel hinauf führten mehrere gewundene Wege, an deren Rand Stockmalven zwei, drei Meter hoch wuchsen. Einige dieser Würfel-Häuser aus dem Katalog, die sich in ganz Europa gleichen, altrosa gestrichen oder graubeige, was in Frankreich gern »greige« genannt wird. Aber noch viel mehr schöne alte Häuser aus Kalksteinquadern mit umfriedeten Gärten, aus denen Rittersporn, Gladiolen und Sonnenbraut grüßten und die Kletterrosen über die Mauern auf die Straße hingen. Den Ursprung der grau-gesprenkelten Kalksteine entdeckten wir am Ortsrand: Mehrere verlassene Steinbrüche, mächtige Krater, von der Vegetation grün zugedeckt. In einem weidete sogar ein Pferd. Auf dem Rückweg gingen wir über die Höhenstraße, wo es anmutige schiefergedeckte Giebelhäuser, aber auch einige kleine Bauernhöfe gab, denn dahinter beginnt die offene Landschaft mit Mais- und Getreidefeldern und Weiden voller schwarz-weißer, rotbrauner, weißer Kühe. In diesem Teil der Normandie gibt es mehr Kühe als Einwohner hatte ich im Reiseführer gelesen.
»Lies das mal!«, rief Robert plötzlich. An der Gartenpforte eines Hauses mit geschlossenen Fensterläden, die schief in den Angeln hingen, klebte eine vergilbte Plastikhülle. Darin ein liniertes Blatt, mit wackliger Hand beschrieben: »Dieses Haus ist zu verkaufen. Der Schlüssel ist beim Nachbarn in No. 33. Sie müssen durch den Garten gehen.« Robert und ich sahen uns kurz an. Ich drückte die Klinke und schon umrundeten wir ein Dickicht aus Flieder und Lorbeer. Und blieben wie angewurzelt stehen. Vor uns zog sich ein verwildertes Grundstück sanft den Hügel hinab. Dahinter glitzerte das Meer. Gerahmt von der Dorfkirche und einem verwitterten Wehrturm. Mir schoss eine englische Lebensweisheit durch den Kopf: »Kauf kein Haus, kauf einen Blick.«
*
Und so geschah es. Der Nachbar in No. 33 öffnete aufs erste Klopfen. Ein hochgewachsener Mann mit schlohweißen Haaren und gütigem Gesicht. Er griff beim Anblick der Fremden zu einem angerosteten Schlüsselbund, als hätte er nur auf uns gewartet, und führte uns zur Haustür des verwunschenen Hauses, an dem sich der Wilde Wein schon zu den Dachrinnen emporgearbeitet hatte. Martin Lelaidier stellte sich als pensionierter Lehrer aus einem Pariser Vorort vor, der hier den kollektiven Lebenstraum vieler französischer Städter verwirklichte: Planter son choux – als Rentner auf dem Land seinen eigenen Kohl zu pflanzen.
Er berichtete, das Haus stünde schon seit Monaten zum Verkauf, die Sache sei schwierig. Nach dem Tod der letzten Bewohnerin, einer im Dorf sehr beliebten kinderlosen Witwe, musste zunächst einmal lange nach rechtmäßigen Erben gesucht werden. Gefunden wurden drei Schwestern mittleren Alters, die auf einem der vielen Dauer-Campingplätze in Südfrankreich lebten. Monsieur Lelaidier erbot sich, deren Telefonnummer zu suchen. Wir könnten ruhig schon mal durchs Haus gehen, da gebe es ohnehin nichts mehr zu stehlen. Sogar die Lampenschirme und den alten Ölofen hätten die Damen aus Südfrankreich mitgenommen.
*
Das Haus hatte eine große Wohnküche mit Linoleumboden und einen eiskalten Salon mit gewagten Tapeten und einem riesigen Kamin, in dem kalte Asche lag. Eine anmutige Treppe führte nach oben zu zwei Schlafzimmern und einer salle d’eau, worunter Franzosen ein Waschbecken plus Bidet verstehen. Das Klo mit handgesägter Brille befand sich in einem kleinen Anbau im Garten. Selbst das fand ich in meiner Euphorie romantisch. Vom Obergeschoss aus erreichte man über eine Leiter zwei riesige Dachböden, in denen noch Heu aus längst vergangener Ernte lagerte.
*
Der Nachbar kehrte mit der Telefonnummer zurück und äußerte vorsichtig, dass der Preis für das Haus mit über tausend Quadratmeter schlechten Bodens vermutlich moderat wäre. Die ziemlich mittellosen Camping-Damen hofften nun schon seit einem Jahr auf den Verkauf des Hauses. Hinzu käme, Verwandte vierten Grades müssten in Frankreich derart hohe Erbschaftssteuern zahlen, dass sie oftmals lieber billig verkauften, als dem ungeliebten Staat ein kleines Vermögen in den Rachen zu schmeißen. Robert hatte den Zettel mit der Telefonnummer schon in der Hand und spurtete zum Postamt für ein längeres Gespräch mit drei Erbinnen auf einem Campingplatz.
Als er mit vor Aufregung gerötetem Gesicht zurückkam, flüsterte er mir eine Summe ins Ohr. Ich konnte es kaum glauben. Es war der Preis einer besseren Kreuzfahrt. Nur zwei Wochen später waren wir beim Notar in der Kreisstadt. Die Damen aus Südfrankreich waren gar nicht erst erschienen und hatten mit ihrer Vollmacht noch ein Bonbon geschickt: Das Haus dürfe vom Käufer sofort bewohnt werden. Wir tauften es »Rocky-Docky« nach einem Schlager aus den 50er Jahren, den meine Großmutter gern trällerte: »Das alte Haus von Rocky-Docky hat vieles schon erlebt, kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt …« Ohne juristische Formalitäten abzuwarten, holten wir die Koffer aus dem Hotel und schliefen die erste Nacht mit zwei Autodecken im Heu. Beim Aufwachen sahen wir durch die Giebelfenster das glitzernde Meer und fern am Horizont verschwammen die Konturen der englischen Kanalinseln. Unserer etwas fragilen Ehe ging es besser als seit vielen Jahren.
*
Noch im Nachthemd musste ich jetzt den Garten inspizieren oder vielmehr das, was von ihm übrig geblieben war. Erfreulich ist die 50 Meter lange dichte Hecke, die unseren Schnäppchen-Kauf vom Nachbargrundstück zur Rechten abtrennt. Mir war schon in den ersten Tagen in Merville aufgefallen, dass die Grundstücke hier fast immer von Hecken statt von Gartenzäunen eingefasst waren. Hecken sind eins der Wahrzeichen der Normandie. Seit Jahrhunderten als Windbrecher und Begrenzungen um die Felder gezogen. Unrühmlich geworden im Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten ihre verlustreichen Schlachten im schwierigen Gelände hier den »Heckenkrieg« tauften.
Unsere Hecke muss gepflanzt worden sein, lange bevor die banalen Leyland-Zypressen in Mode kamen, weil sie billig und schnellwüchsig sind. Inzwischen bin ich im Besitz einer mannshohen mattglänzenden immergrünen Hecke aus Euonymus japonicus, dem japanischen Spindelstrauch oder Pfaffenhütchen. Ich weiß so was, weil ich schon immer gern einen richtigen Garten gehabt hätte, mich aber in Hamburg mit einem schattigen Vorgarten begnügen musste und mich nach einem Versuch im Kleingarten-Milieu dort schnell wieder verabschiedet hatte, weil weder Grillabende noch Rommé-Runden zu meinen Hobbies zählen. Stattdessen trat ich einer Gartengesellschaft bei, leistete mir jedes Jahr ein bis zwei Gartenreisen und sammelte ein ganzes Regal voller hochkarätiger Gartenbücher an. Und nun hatte ich auf einmal eine riesige Spielwiese für meine Träumereien mit einer prächtigen Hecke drum herum.
Und offenbar einen neugierigen Nachbarn. Da waren nämlich eben ein kariertes Hütchen und zwei pechschwarze Augen knapp über den obersten Heckenblättern zu sehen gewesen. Jetzt knirschten Füße auf einem Kiesweg und ein kleiner rundlicher Mann verschwand um die Ecke seines Hauses. Später wurde mir zugetragen, dass dieser Nachbar sich daraufhin unverzüglich ins Bistro begeben hatte und die anwesenden morgendlichen Café-Calva-Trinker mit dem Schlachtruf »Attacke! Die Deutschen sind wieder da« erschreckt hatte. Darüber konnte ich dann nur noch lachen, als ich das hörte, denn zu dem Zeitpunkt waren Marcel Picard und seine Frau Mireille schon fast gute Freunde von uns geworden. Aber eben nur fast, weil es mich gruselt, dass er über dem kleinen Hühnerhof am Ende seines Gartens Rabenkrähen abknallt und ihre Leichname dort aufhängt. Um die Verwandtschaft dieser Vögel abzuschrecken, die ihm und seinen Hühnern angeblich den Futtermais wegfraßen. Ich glaube, dass er einfach nur gern ballert.
*
Robert, der, wie viele Ingenieure, ein begabter Heimwerker ist, war in die zehn Kilometer entfernte Kreisstadt gefahren, um den reparierten Kombi vollzuladen mit zwei Schaumstoff-Matratzen, Glühbirnen, Nägeln, Akkuschrauber, Dübeln, Hammer, Säge, Dichtungen, Schnellzement, und was sonst nötig ist, um Erste Hilfe an einem Haus zu leisten, das lange leer gestanden hatte. Eine Bratpfanne, einen Kochtopf und für mich eine kleine Espresso-Maschine wollte er auch mitbringen. Und ich gehe den Hügel hinunter, um im Bistro irgendetwas zum Abendessen aufzutreiben. Es stellt sich heraus, dass es Chez Kristelle außer Chips nichts Essbares gibt, nur Getränke, Zeitschriften und Zigaretten. Die energische, rotwangige Kristelle braucht keine Küche, die Stammgäste kommen hauptsächlich, weil die Café-Bar eine Drei-Sterne-Gerüchteküche ist, wie ich bald herausfinden sollte. Kristelle führt aber im Hinterzimmer einen klitzekleinen Gemischtwaren-Laden, wo man Konserven, Klopapier, Butter, Eier und natürlich Camembert kaufen kann.
Als ich durch den Schankraum zur Tür gehe, winkt mich ein älterer, etwas zerzauster Mann an seinen Tisch und stellt sich vor als Jean-Pierre. Er sei aus Cherbourg, wo er bis vor kurzem an der Universität tätig war. Und er habe nichts gegen die Deutschen – im Gegenteil, schon als junger Mann habe er für Marlene Dietrich geschwärmt. Ob er mich auf ein Glas Rosé einladen dürfe? Darf er. Die Tür fliegt auf und ein aufgeregter junger Mann stürmt herein. »Habt ihr’s schon gehört? Die Wirtin vom Hotel ist tot!« Mir wird etwas flau. Wahrscheinlich waren wir ihre letzten Gäste gewesen … Würden wir jetzt verhört werden? Das Geraune in der Bar schwillt an. Verebbt kurz, als eine Frau den Gastraum betritt, die meine Großmutter »eine Erscheinung« genannt hätte. Hochgewachsen, in einem blütenweißen Kleid, das teuer riecht. Die blonden Haare hochgesteckt unter einem breitkrempigen Strohhut. Kristelle eilt hinter dem Tresen hervor und säuselt: »Das Übliche, Madame de Soissy?«. Madame nickt und Kristelle sucht eilfertig die Zeitungen »Le Monde«, »Le Figaro« sowie die Glanzpostillen »Côté Ouest« und »Vogue« zusammen und legt noch eine Schachtel Marlboro Menthol drauf. Ich spüre einen kleinen Neid-Stich – das war auch meine Marke gewesen, bevor Robert mir das Rauchen abgewöhnt hatte. Madame zahlt mit Scheck und entschwindet. Ich hätte zu gern ihre Stimme gehört. Ich gehe kurz danach und entdecke auf dem Heimweg vor mir in einiger Entfernung die Frau in Weiß. Sie scheint also in meiner Nähe zu wohnen.
*
Zwei Wochen hatte die Polizei gebraucht, um einwandfrei den ganz natürlichen Alterstod der Hotelbesitzerin festzustellen. Der Glaser, den die alte Dame am Vorabend wegen einer gesprungenen Fensterscheibe bestellt hatte, fand die Eingangstür unverschlossen und hatte die Wirtin auf dem Küchenfußboden liegend gefunden. In einer Lache aus Muckefuck, die Aluminium-Kaffeekanne noch fest umklammert. Heute gab es wieder Neuigkeiten im Bistro. Jean-Pierre hatte es als Erster erfahren und genoss nun seine Rolle als Mann der Stunde, dem jeder lauschte: Der einzige Enkel der Hotelwirtin, ein Matrose aus Cherbourg, war eingetroffen, um sein Erbe anzutreten. Jean-Pierre deutete etwas von unehrenhafter Entlassung aus der Marine an, womöglich sogar vorbestraft. So genau wussten es seine Gewährsmänner aus Cherbourg allerdings auch nicht. Aber alle im Dorf könnten sich bald selbst ein Bild machen, da besagter Enkel in der Post gesichtet worden war, wo er den einzigen Fotokopierer in Merville mit Beschlag belegt hatte, um Handzettel für einen Ausverkauf des Hotel-Inventars auszudrucken. Der sollte am nächsten Sonntag stattfinden.
*
Schon aus Neugier sind wir frühzeitig zur Stelle, auch wenn wir uns nicht vorstellen können, etwa die dubiosen Matratzen oder das angeschlagene Geschirr zu kaufen. Aber das Glück verfolgt uns. Es stellt sich heraus, dass es im Hôtel de la Mer noch einen seit vielen Jahren abgesperrten großen Speisesaal gibt. Dort ergattern wir einen Satz tadelloser Thonet-Stühle, die in den übrigen Räumen des Hotels längst Plastikstühlen gewichen waren, sowie einen soliden Esstisch. Das Beste aber sind die Bilder. Sie waren zwar rahmen- und umstandslos einfach an die Wand gedübelt, hatten aber großen Charme. Durchweg Seestücke, die ein äußerst begabter Amateur gemalt haben musste. Wir fragten den Erb-Enkel, ob er den Maler kannte. »Klar, kannte ich den«, sagte er, »das war mein Opa, der früher zur See fuhr und im Ruhestand anfing zu malen. Und vor allem zu saufen, bis er tot umfiel. Das hat ihn und die Oma Jahre seiner Kapitäns-Rente gekostet. Wenn Sie die Schinken haben wollen, mache ich Ihnen einen Freundschaftspreis.« Und schon hat er den Schraubenzieher in der Hand.
Am nächsten Tag war das Hôtel de la Mer geschlossen und verrammelt und der Erb-Enkel verschwunden. Nicht ohne eine Klarsichthülle an die Tür zu heften mit dem Zettel: »Zu verkaufen!« Darunter eine Mobil-Nummer.
*
Es war jetzt Mitte August und wir hatten uns schon halbwegs nett eingerichtet; die Bilder aus dem Hôtel de la Mer lenkten wohltuend von den schmutzigen Wänden ab. Als es klopfte, stand der Nachbar Marcel Picard vor der Tür, mit einem Korb voller Salate, Mohrrüben, Bohnen, Gurken und Tomaten. »Statt Blumen – Willkommen in Merville und auf gute Nachbarschaft!«
Die fehlenden Blumen wunderten mich nicht, ich wusste von meinen diskreten Blicken über die Hecke, dass in seinem Garten ausschließlich Gemüse wächst, und zwar in schnurgeraden, völlig unkrautfreien Beeten. Manchmal sah ich ihn dort stehen mit einem Stock in der Hand, er deutete auf ein Beet und sagte zu seiner dort knienden Frau: »Mireille, dort hast du noch einen Giersch übersehen!«