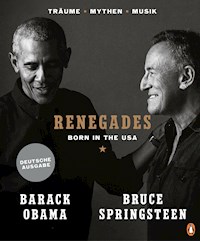Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Barack Obama – ein Vorbild auch für die nächste Generation! Sein Bestseller "Ein amerikanischer Traum" über seine Familie und Herkunft neu erzählt für junge Leserinnen und Leser Die fesselnde Auseinandersetzung Barack Obamas mit seiner Herkunft und zugleich das beeindruckende Porträt eines jungen Schwarzen Mannes, der sich und der Welt Fragen nach Selbstfindung, Menschlichkeit und Zugehörigkeit stellt. Obama wächst in bescheidenen Verhältnissen auf, doch er ist entschlossen, ein Leben voller Sinn und Wahrhaftigkeit zu führen. Als er in der Schule wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wird, weckt das seinen Ehrgeiz. Er studiert, engagiert sich in gemeinnütziger Arbeit und entwickelt Bewusstsein für Gerechtigkeit und Führung. Eine inspirierende Lebensgeschichte, die nicht nur jungen Leserinnen und Lesern die Augen dafür öffnen wird, wer sie in der Welt sein wollen und welchen Beitrag sie leisten können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Die fesselnde Auseinandersetzung Barack Obamas mit seiner Herkunft und zugleich das beeindruckende Porträt eines jungen Schwarzen Mannes, der sich und der Welt Fragen nach Selbstfindung, Menschlichkeit und Zugehörigkeit stellt. Obama wächst in bescheidenen Verhältnissen auf, doch er ist entschlossen, ein Leben voller Sinn und Wahrhaftigkeit zu führen. Als er in der Schule wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wird, weckt das seinen Ehrgeiz. Er studiert, engagiert sich in gemeinnütziger Arbeit und entwickelt Bewusstsein für Gerechtigkeit und Führung. Eine inspirierende Lebensgeschichte, die nicht nur jungen Leserinnen und Lesern die Augen dafür öffnen wird, wer sie in der Welt sein wollen und welchen Beitrag sie leisten können.
Barack Obama
Ein amerikanischer Traum
Die Geschichte meiner Herkunft, meiner Familie und meiner Identität
Aus dem Englischen von Katja Hald und Matthias Fienbork
Hanser
Denn wir sind Gäste und Fremdlinge vor dir,
wie alle unsre Väter.
1. Chron 29,15
Vorwort
Ich war Anfang dreißig, als ich Ein Amerikanischer Traum schrieb. Ich hatte mein Jurastudium abgeschlossen, Michelle und ich waren frisch verheiratet und hatten es nicht eilig damit, eine Familie zu gründen. Meine Mutter lebte noch. Und ich war noch nicht in der Politik.
Heute weiß ich, dass ich damals an einem Scheideweg stand und mir darüber klar werden musste, wer ich sein wollte und was ich vorzuweisen hatte. Ich brannte für die Bürgerrechte, fand den öffentlichen Dienst interessant, lauter vage Ideen gingen mir durch den Kopf, und ich war unsicher, welchen Weg ich einschlagen sollte. Ich hatte mehr Fragen als Antworten. War es möglich, mehr Vertrauen unter den Menschen zu schaffen und die Gräben zwischen uns zu überwinden? Konnten in einer so zerrütteten Gesellschaft auch kleine Schritte uns voranbringen — sich etwa für bessere Verhältnisse an einer Schule einzusetzen oder für eine höhere Wahlbeteiligung zu werben? Würde ich innerhalb der bestehenden Institutionen mehr erreichen oder außerhalb?
All diesen Gedanken lagen ungelöste persönliche Fragen zugrunde: Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin?
Und das brachte mich dazu, dieses Buch zu schreiben.
Ich bin schon lange überzeugt, dass man der Zukunft am besten begegnet, indem man ernsthaft versucht, die Vergangenheit zu verstehen. Deshalb lese ich gern Bücher zu verschiedenen historischen Themen, und deshalb schätze ich auch die Weisheit all jener, die schon länger auf der Welt sind als ich. Für manche Leute mag Geschichte etwas sein, das wir hinter uns gelassen haben, in Stein gemeißelte Worte und Jahreszahlen, altmodische Sachen, die man auf den Dachboden schafft. Für mich aber ist Geschichte so lebendig wie ein tiefer Wald, alt und prächtig, der in unerwartete Richtungen führt, voller Schatten und Licht. Es kommt darauf an, wie wir uns durch diesen Wald bewegen — mit welchen Ansichten und Vorstellungen und ob wir bereit sind, immer wieder dorthin zurückzukehren und zu fragen, was wir alles übersehen, welche Stimmen wir nicht gehört haben.
Dieses Buch ist der erste ernsthafte Versuch, mich meiner Vergangenheit zu stellen, die verschiedenen Stränge meines Erbes zu betrachten, um Klarheit über meine Zukunft zu gewinnen. Ich konnte mich im Leben meiner Eltern und Großeltern bewegen, in den Landschaften, Kulturen und Geschichten, in denen sie aufgewachsen sind, in den Werten und Ansichten, die sie und damit auch mich geprägt haben. Was ich dabei gelernt habe, hat mich geerdet. Auf dieser Basis konnte ich vorangehen, ich gewann das Vertrauen, dass ich meinen Kindern ein guter Vater sein könne, und den Mut, zu wissen, dass ich bereit war, die politische Bühne zu betreten.
Im Akt des Schreibens steckt eine große Kraft. Es ist eine Chance, sich selbst zu befragen, die Welt zu beobachten, seine Grenzen zu erkennen, sich in andere hineinzuversetzen und Ideen zu prüfen. Schreiben ist schwer, aber genau das ist der Punkt. Man verbringt Stunden damit, sich an den Geruch eines Klassenzimmers zu erinnern, an den Klang der Stimme des Vaters oder an die Farbe der Muscheln, die man einmal am Strand gesehen hat. Schreiben kann Orientierung geben, kann bestärken und überraschen. Wenn man lange nach dem richtigen Wort sucht, stößt man vielleicht nicht immer auf Antworten auf die großen Lebensfragen, aber man lernt sich besser kennen. So war es jedenfalls bei mir.
Der junge Mann, dem ihr in diesem Buch begegnet, ist unfertig und voller Träume, er stellt sich selbst und der Welt Fragen und lernt dabei. Heute weiß ich natürlich, dass das erst der Anfang für ihn war. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr ein langes, erfülltes Leben haben. Meine Geschichte soll euch ermutigen, ebenfalls eure Geschichte zu erzählen und die Geschichten anderer Menschen in eurer Umgebung zu achten. Es lohnt sich unbedingt, diese Reise zu unternehmen. Die Antworten auf eure Fragen werden sich schon einstellen.
Barack Obama
Juni 2021
Erster Teil
Kindheit
1. Kapitel
Ich habe meinen Vater kaum gekannt. Als er 1963 aus Hawaii wegging, war ich erst zwei Jahre alt. Ich wusste nicht, dass Kinder einen Vater haben und dieser bei seiner Familie leben sollte. Ich kannte ihn nur von den Geschichten, die meine Mutter und meine Großeltern mir erzählten.
Sie alle hatten ihre Lieblingsgeschichten. Ich weiß noch, wie Gramps, mein Großvater, sich in seinem alten Sessel zurücklehnte und lachend erzählt, wie mein Vater — der wie ich Barack Obama hieß — wegen einer Pfeife fast einen Mann von der Pali-Aussichtsplattform, einer Felsklippe nicht weit entfernt von unserem Haus in Honolulu, geworfen hätte.
»Deine Mutter und dein Vater hatten beschlossen, mit diesem Bekannten eine Besichtigungstour über die Insel zu machen — und wahrscheinlich fuhr dein Vater wieder die ganze Zeit auf der falschen Straßenseite —«
»Dein Vater war ein furchtbarer Autofahrer«, warf meine Mutter dazwischen. »Irgendwann fuhr er immer auf der linken Seite, so wie es in England üblich ist, und wenn man ihn darauf hinwies, rümpfte er nur die Nase über die idiotischen Vorschriften der Amerikaner.«
»Sie stiegen also aus, gingen zum Geländer und bewunderten die Aussicht. Dein Vater rauchte seine Pfeife, die ich ihm zum Geburtstag geschenkt hatte, und zeigte wie der Kapitän eines Dampfers mit dem Mundstück auf die verschiedenen Sehenswürdigkeiten —«
»Er war wirklich stolz auf diese Pfeife«, unterbrach ihn meine Mutter wieder.
»Willst du die Geschichte erzählen, Ann, oder darf ich weitermachen?«
»Entschuldige, Dad. Sprich weiter.«
»Also, dieser Bekannte fragt ihn, ob er die Pfeife mal probieren dürfe. Aber kaum hat er den ersten Zug gemacht, fängt er so fürchterlich an zu husten, dass ihm die Pfeife entgleitet und über das Geländer dreißig Meter in die Tiefe fällt. Daraufhin sagte dein Vater, er solle rüberklettern und sie zurückholen.«
Gramps musste so heftig lachen, dass es eine Weile dauerte, bis er weitererzählen konnte. »Der Mann wirft einen Blick nach unten und schlägt vor, ihm eine neue Pfeife zu kaufen. Aber Barack meint nur, sie wäre ein Geschenk und nicht zu ersetzen. Er packt ihn am Schlafittchen, hebt ihn hoch und macht Anstalten, ihn über das Geländer zu halten!«
Gramps lachte, und ich stellte mir vor, wie ich zu meinem Vater aufschaue, eine dunkle Gestalt vor der hellen Sonne, während der Mann panisch mit den Armen wedelt. Das Ganze erinnerte mich an eine Szene aus der Bibel — schrecklich und doch eindrucksvoll, ein König, der Gerechtigkeit übt.
Ich wollte wissen, ob er den Mann runtergeworfen hatte.
»Nein, nach einer Weile hat er ihn wieder abgesetzt«, sagte Gramps. »Dein Vater hat ihm den Rücken getätschelt und seelenruhig vorgeschlagen, irgendwo ein Bier zu trinken. Er tat, als wäre nichts passiert.«
Meine Mutter sagte, ganz so schlimm wäre es nicht gewesen, mein Vater hätte den Mann nicht weit über das Geländer gehalten.
»Du warst aber ziemlich aufgebracht, als ihr nach Hause kamt«, sagte Gramps zu meiner Mutter. »Und als du uns von dem Vorfall erzählen wolltest, schüttelte Barack bloß den Kopf und lachte. Mit seiner tiefen Stimme und seinem britischen Akzent sagte er: ›Ich wollte dem Kerl nur eine Lektion erteilen, wie man mit dem Eigentum anderer Leute umgeht.‹«
Meine Großmutter, Toot, kam aus der Küche und meinte, wie gut, dass mein Vater begriffen habe, dass die Pfeife nur aus Versehen in die Tiefe gefallen sei — wer weiß, was sonst noch passiert wäre.
Meine Mutter verdrehte die Augen. Sie hielt das alles für übertrieben. Mein Vater wäre manchmal ein bisschen dominant, aber im Grunde ein anständiger Kerl. »Wenn er sich im Recht fühlte, war er allerdings ziemlich kompromisslos«, sagte sie.
Ihr gefiel eine andere Geschichte, die Gramps über meinen Vater erzählte, besser: Einmal willigte er ein, beim Internationalen Musikfestival ein paar afrikanische Lieder zu singen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass es eine richtig große Veranstaltung werden würde. Die Frau, die vor ihm ihren Auftritt hatte, war eine professionelle Sängerin mit einer richtigen Band. »Jeder andere«, sagte Gramps, »hätte einen Rückzieher gemacht. Nicht so Barack. Er stand auf und fing an, vor all den Menschen zu singen — das ist nicht leicht, glaub’s mir —, und er war auch nicht besonders gut. Aber er trat so selbstsicher auf, dass er genauso viel Applaus bekam wie alle anderen.«
»Eine Sache kannst du von deinem Dad lernen«, erklärte er mir. »Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist das Geheimnis jeden Erfolgs.«
SO WAREN ALLE diese Geschichten — kurz, mit einer kleinen Moral. Oft verschwanden sie für eine Weile in der Versenkung, bis meine Familie sie nach Monaten, manchmal auch Jahren, wieder hervorkramte, wie alte Fotoalben. Meine Mutter hatte auch ein paar richtige Fotos von meinem Vater, aber als sie dann mit Lolo zusammen war, dem Mann, den sie später heiraten sollte, versteckte sie die Aufnahmen im Schrank. Hin und wieder fielen sie mir in die Hände, wenn ich auf der Suche nach Weihnachtsschmuck oder einer alten Taucherbrille sämtliche Schubladen durchstöberte, und dann sahen meine Mutter und ich sie uns manchmal gemeinsam an. Die Fotos zeigten meinen Vater mit dunklem, lachendem Gesicht, hoher Stirn und einer dicken Brille. »Deine kräftigen Augenbrauen hast du von mir — dein Vater hat nur diese dünnen Dinger —, aber den Verstand und deinen Charakter hast du von ihm«, sagte sie.
Ich hörte meiner Mutter gerne zu, wenn sie mir von ihm erzählte.
Mein Vater war Afrikaner, ein Kenianer vom Stamm der Luo. Geboren wurde er in Alego in der Nähe des Victoriasees. Alego war ein armes Dorf, aber der Vater meines Vaters, mein anderer Großvater, war einer der Stammesältesten und ein angesehener Medizinmann. Als Kind hütete mein Vater die Ziegen seines Vaters und ging in eine Schule, die die britischen Kolonialherren gebaut hatten, die zu jener Zeit in Kenia an der Macht waren.
Mein Großvater, der der Überzeugung war, dass Wissen Macht bedeutete, war sehr stolz, als Barack sich als vielversprechender Schüler erwies und ein Stipendium erhielt, um in der Hauptstadt Nairobi zu studieren. Etwas später wurde er von kenianischen Politikern und amerikanischen Sponsoren sogar für ein Studium in den Vereinigten Staaten ausgewählt. Kenia stand damals kurz vor der Unabhängigkeit, und die neuen Anführer schickten die besten Studenten ins Ausland, um dort Wirtschaft und Technik zu studieren. Sie hofften, dass die jungen Leute zurückkommen und dazu beitragen würden, ein modernes und erfolgreiches Afrika aufzubauen.
1959 kam mein Vater mit dreiundzwanzig Jahren als erster afrikanischer Student an die Universität von Hawaii, um Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Nach nur drei Jahren machte er als Jahrgangsbester seinen Abschluss. Er half, den Internationalen Studentenverband zu organisieren, und wurde dessen erster Präsident. In einem Russischkurs begegnete er einer schüchternen, erst achtzehnjährigen Amerikanerin, und die beiden verliebten sich. Der Name des Mädchens war Stanley Ann Dunham, aber alle nannten sie nur Ann. Sie war meine Mutter.
Ihre Eltern waren zunächst skeptisch. Mein Vater war schwarz, und sie war weiß, und damals war es nicht üblich, dass Menschen unterschiedlicher Rasse miteinander ausgingen. Aber mit seinem Charme und seiner Intelligenz konnte er die beiden schließlich für sich gewinnen. Das junge Paar heiratete, und kurz darauf wurde ich geboren.
Mein Vater erhielt ein weiteres Stipendium — dieses Mal für eine Promotion an der Universität von Harvard im über fünftausend Meilen entfernten Cambridge in Massachusetts —, aber das Geld reichte nicht, um seine Familie mitnehmen zu können. Meine Mutter und ich blieben in Hawaii. Und als mein Vater dann seine Promotion in der Tasche hatte, beschloss er, zurück nach Afrika zu gehen, »um sein Land zu einem besseren Ort zu machen«, wie meine Mutter immer sagte. Dennoch bestand sie darauf, dass sie sich stets in Liebe verbunden waren.
Vieles an dieser Geschichte habe ich damals nicht richtig verstanden. Weder wusste ich, wo Alego auf der Landkarte zu finden war, noch warum in Kenia die Briten an der Macht waren oder was »Promotion« bedeutete. Der Lebensweg meines Vaters war mir genauso rätselhaft wie die Geschichten in einem Buch, das meine Mutter mir einmal geschenkt hatte. Es hieß Origins und war eine Sammlung von Schöpfungsmythen aus aller Welt — christlich, jüdisch, griechisch und indisch —, die mich dazu anregten, mir schwierige Fragen zu stellen. Wie konnte Gott zulassen, dass eine Schlange so viel Unheil im Paradies anrichtet? Wie war es möglich, dass im Hinduismus eine Schildkröte das Gewicht der ganzen Welt auf ihrem winzigen Rücken trägt? Warum kam mein Vater nicht zurück?
Als Kind lebte ich mit meiner Mutter bei meinen Großeltern, Stanley und Madelyn Dunham, Gramps und Toot. Toot ist ein anderes Wort für Tutu, was auf Hawaiianisch »Großmutter« bedeutet. An dem Tag, an dem ich geboren wurde, entschied Toot, dass sie noch zu jung war, um »Oma« genannt zu werden.
Ich liebte Hawaii und genoss das Leben dort in vollen Zügen. Die schwüle, duftende Luft. Den leuchtend blauen Pazifik. Die von Moos überzogenen Felsen und das kühle Rauschen des Manoa-Wasserfalls. Die Ingwerblüten und hoch aufragenden Pinienbäume, die erfüllt sind vom Gesang unsichtbarer Vögel. Und die hohen, tosenden Wellen der Nordküste, die sich am Strand wie in Zeitlupe brechen.
Es gab nur ein Problem: Mein Vater fehlte mir. Und nichts, was meine Mutter oder meine Großeltern mir erzählten, konnte mich darüber hinwegtrösten. Denn ihre Geschichten verrieten mir weder, warum er uns verlassen hatte, noch wie es gewesen wäre, wenn er bei uns geblieben wäre.
Auf den Fotos war deutlich zu erkennen, dass mein Vater anders aussah als die Menschen in meiner Umgebung — er schwarz wie Pech, während meine Mutter weiß wie Milch war. Aber darüber sprachen wir nicht, weshalb es sich auch nicht auf mein Selbstverständnis auswirkte.
Tatsächlich erinnere ich mich nur an eine einzige Geschichte über meinen Vater, in der es irgendwie um die Hautfarbe ging. Nachdem er viele Stunden für sein Studium gelernt hatte, traf mein Vater sich mit meinem Großvater und anderen Freunden in einer Bar am Strand in der Nähe von Waikiki. Alle waren bester Laune, man aß und trank, jemand spielte Gitarre, als plötzlich ein Weißer — so laut, dass es jeder hören konnte — dem Barmann zurief, er wolle nicht »neben einem Nigger« sitzen. Alle verstummten und sahen zu meinem Vater. Sie erwarteten, dass er jeden Moment eine Schlägerei anfangen würde. Aber mein Vater stand auf, ging zu dem Mann und hielt ihm einen freundlichen Vortrag über die Dummheit der Intoleranz, über die Verheißungen des amerikanischen Traums und die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte.
»Als Barack mit seiner Rede fertig war«, sagte Gramps, »fühlte sich der Mann so mies, dass er in seine Tasche griff und deinem Vater hundert Dollar gab. Er hat für alle die Zeche bezahlt — und deinem Vater die restliche Monatsmiete.«
Aber als Schwarzer auf Hawaii zu leben, wo die Haut der meisten Menschen dunkler war als anderswo in den Vereinigten Staaten, war eine Sache. Als Schwarzer eine Weiße zu heiraten, war da etwas ganz anderes. Als meine Eltern 1960 vor den Traualtar traten, galt es in mehr als der Hälfte der amerikanischen Bundesstaaten noch als Verbrechen, wenn Menschen unterschiedlicher Rassen gemeinsame Kinder hatten. Selbst in den aufgeklärten Städten im Norden erntete man böse Blicke, und es wurde getuschelt. Eine weiße Frau, die damals von einem Schwarzen schwanger wurde, zog nicht selten in Erwägung, wegzugehen, bis das Baby auf der Welt war, und es dann zur Adoption freizugeben. Oder sie entschloss sich sogar, die Schwangerschaft abzubrechen.
Erst 1967 — drei Jahre, nachdem Dr. Martin Luther King Jr. den Friedensnobelpreis erhalten hatte — erklärte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, das Verbot von Mischehen im Staat Virginia verstoße gegen die amerikanische Verfassung. In diesem Jahr feierte ich bereits meinen sechsten Geburtstag.
Dass meine Großeltern die Ehe meiner Eltern guthießen, war also eher ungewöhnlich. Ich frage mich bis heute, was in ihrer Erziehung wohl dazu geführt hatte, dass sie anders waren als die meisten Menschen ihrer Generation.
MEINE GROßELTERN WUCHSEN während der Wirtschaftskrise in den 1930er-Jahren in Kansas auf, in der Mitte des Landes. Die Leute dort waren anständig und arbeiteten hart. Sie hatten noch, was man damals »Pioniergeist« nannte. Aber neben ihrer Bodenständigkeit und Entschlossenheit besaßen sie auch noch andere, weniger angenehme Eigenschaften. Sie waren misstrauisch und manchmal auch grausam gegenüber Menschen, die anders waren als sie, sodass jene, die nicht nach ihren Regeln spielten, häufig gezwungen waren, wegzuziehen.
Als Kinder lebten Gramps und Toot weniger als zwanzig Meilen voneinander entfernt, und beide liebten es, von ihrem Leben in der Provinz zu erzählen: von den Paraden am 4. Juli, vom Kino (oder »Filmtheater«) an der Wand einer Scheune, von Glühwürmchen in Einweckgläsern, vom Geschmack reifer Tomaten, so süß wie Äpfel, von Sand- und Hagelstürmen und von den Bauernjungen in der Schule, die man zu Beginn des Winters in ihre wollene Unterwäsche einnähte (die Wäsche hatte keine Knöpfe) und die nach ein paar Monaten stanken wie die Schweine. Die Wirtschaftskrise brachte harte Zeiten mit sich. Die Banken verloren viel Geld und waren gezwungen zu schließen. Viele ärmere Familien verloren ihre Farmen. Aber wenn meine Großeltern von dieser Zeit erzählten, klang es wie ein großes Abenteuer. Alle hatten mit denselben Problemen zu kämpfen, und das schweißte die Leute zusammen.
Gramps und Toot legten großen Wert darauf, mir klarzumachen, wie wichtig es war, angesehen zu sein — es gab angesehene Leute und weniger angesehene Leute. Man musste nicht reich sein, um ein gewisses Ansehen zu genießen, aber wenn man kein Geld hatte, musste man härter dafür arbeiten.
Toots Familie war angesehen. Ihre Großeltern waren schottischer und englischer Abstammung, und ihr Vater hatte die ganze Wirtschaftskrise hindurch einen festen Job bei einer großen Ölfirma. Ihre Mutter arbeitete als Lehrerin, bis die Kinder kamen. Die Familie hatte ein sauberes, ordentliches Haus und bestellte bei einem Literaturversand klassische Bücher. Als gute Methodisten lasen sie die Bibel, aber im Gegensatz zu den Baptisten, die sich gerne ereiferten und große und laute Erweckungsversammlungen in Zelten abhielten, schätzten sie Zurückhaltung und Vernunft.
Bei Gramps’ Familie war das anders. Er war bei seinen Großeltern aufgewachsen — anständigen, gottesfürchtigen Baptisten —, aber zu Hause gab es Probleme. Seine Mutter brachte sich um, als er acht Jahre alt war, und er war derjenige, der sie fand. Es ging das Gerücht, sie hätte sich das Leben genommen, weil sein Vater untreu war.
Woran es gelegen hat, ist schwer zu sagen, aber Gramps entwickelte sich zu einem jungen Rebellen. Mit fünfzehn flog er von der Schule, weil er dem Rektor eins auf die Nase gegeben hatte, und schlug sich dann drei Jahre lang mit Gelegenheitsjobs durch. Als blinder Passagier in Frachtzügen fuhr er nach Chicago oder Kalifornien, bis er sich schließlich in Wichita niederließ, wohin es auch Toots Familie verschlagen hatte.
Toots Eltern hatten so einiges über den jungen Mann gehört, der ihrer Tochter den Hof machte, und missbilligten die Beziehung zutiefst. Als Toot ihren Freund zum ersten Mal mit nach Hause brachte, warf ihr Vater nur einen Blick auf Gramps’ schwarzes, zurückgekämmtes Haar und sein überhebliches Grinsen und entschied, dass er nicht gut für seine Tochter war.
Meiner Großmutter war das egal. Sie kam gerade frisch von der Highschool, wo sie Hauswirtschaft gelernt hatte — vor allem Kochen, Haushaltsführung und Nähen —, und hatte genug von Anstand und Ehrbarkeit. Mein Großvater muss großen Eindruck auf sie gemacht haben. Manchmal stelle ich mir die beiden in diesen Jahren vor dem Krieg vor: Gramps in weiten Hosen und Unterhemd, den Hut keck in den Nacken geschoben, Toot ein smartes Mädchen mit zu viel Lippenstift, blond gefärbten Haaren und Beinen, die so hübsch waren, dass sie in Kaufhäusern Reklame für Nylonstrümpfe hätte machen können. Er erzählte ihr vom Zauber der großen Städte, und dass er den öden, staubigen Ebenen der Provinz auf jeden Fall entkommen wolle. Er würde nicht an einem Ort versauern, an dem man schon am Tag seiner Geburt weiß, wo man sterben und wer einen begraben wird, erklärte er ihr. Auf gar keinen Fall werde er so enden. Er habe andere Träume und Pläne. Und meine Großmutter ließ sich von seiner Unternehmungslust anstecken.
Sie brannten gerade rechtzeitig durch, bevor die Japaner 1941 Pearl Harbor bombardierten, und mein Großvater meldete sich zur Armee. Die beiden haben nie viel über die Kriegsjahre gesprochen. Ich weiß nur, dass meine Mutter auf dem Militärstützpunkt geboren wurde, wo mein Großvater stationiert war, dass meine Großmutter wie viele Frauen in den 1940er-Jahren in einer Bomberfabrik am Fließband arbeitete und dass Gramps unter General George S. Patton in Frankreich diente, aber nie in einen richtigen Kampf verwickelt wurde.
Nach dem Krieg zog die Familie nach Kalifornien, wo Gramps sich dank der GI-Bill — die es ehemaligen Soldaten ermöglichte, für wenig Geld zu studieren — an der Universität in Berkeley einschreiben konnte. Aber er war zu ehrgeizig und rastlos, um lange an der Uni zu bleiben. Die Familie zog weiter, zunächst zurück nach Kansas, dann durch mehrere texanische Kleinstädte, bis sie schließlich in Seattle landete, wo sie sich ein Haus kaufte und Gramps als Möbelverkäufer anfing. Meine Großeltern freuten sich über den schulischen Erfolg meiner Mutter, aber als ihr schon frühzeitig ein Studienplatz an der Universität von Chicago angeboten wurde, untersagte mein Großvater ihr, ihn anzunehmen. Er war der Ansicht, sie wäre noch zu jung, um alleine zu leben.
Hier hätte die Geschichte meiner Großeltern auch enden können — sie hatten ein Haus, eine Familie und führten ein ehrbares Leben. Aber Gramps war stets auf der Suche nach Neuem — und auf der Flucht vor dem Gewohnten. Als der Manager der Möbelfirma, bei der er arbeitete, erwähnte, dass man in Honolulu auf Hawaii, das kurz davor war, der fünfzigste Bundestaat zu werden, ein neues Geschäft eröffnen wolle, überredete Gramps seine Frau noch am selben Tag, das Haus zu verkaufen, alles zusammenzupacken und noch ein letztes Mal Richtung Westen zu ziehen, der untergehenden Sonne entgegen …
WIE VIELE AMERIKANISCHE Männer seiner Generation glaubte mein Großvater an individuelle Freiheit und war der Ansicht, jeder sollte für sich entscheiden können, was er tun will. Niemand müsse sich von irgendjemandem Vorschriften machen lassen. Für seine Zeit war er sehr weltoffen und bezeichnete sich selbst als »Freidenker«. Er schrieb hin und wieder Gedichte, hörte Jazz, und obwohl Juden und Christen damals häufig keinen Kontakt pflegten, zählten zu seinen besten Freunden auch einige Juden, die er im Möbelgeschäft kennengelernt hatte. Er trat mit seiner Familie der Unitarischen Kirche bei, weil es ihm gefiel, dass die Unitarier auch auf die Lehren anderer Religionen zurückgriffen. »Man bekommt quasi fünf Religionen zum Preis von einer«, sagte er. Meine Großmutter war von Natur aus skeptischer, durchdachte alles gründlich und holte Gramps immer wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, wenn er unrealistische Pläne schmiedete.
Als ihre Tochter dann erklärte, dass sie einen Schwarzen aus Kenia heiraten wolle, reagierten sie trotz ihrer Bedenken liebevoll und loyal und sagten den beiden ihre Unterstützung zu.
Und als ich klein war, hatte ich oft den Eindruck, es gefiel ihnen, mir zu demonstrieren, dass sie anders waren. Gramps erwähnte häufig, dass Kansas im Bürgerkrieg auf Seiten der Nordstaaten gekämpft habe und viele seiner Verwandten gegen die Sklaverei gewesen wären. Er erzählte mir von seinem Ururgroßvater Christopher Columbus Clark, der ein mit vielen Auszeichnungen geehrter Unionssoldat gewesen war, während Toot oft auf ihre Adlernase und ihre schwarzen Augen hinwies und sagte, sie hätte Cherokeeblut in den Adern.
Aber als ich dann älter wurde, fand ich heraus, dass das nicht die ganze Geschichte war. Tatsächlich hat Kansas die Sklaverei erst nach vier Jahren erbitterter Kämpfe zwischen den Befürwortern und den Gegnern der Sklaverei, den sogenannten »Freistaatlern«, gesetzlich verboten. Mir kam auch zu Ohren, dass ein Verwandter von Gramps ein Großcousin von Jefferson Davis gewesen sein soll, dem Präsidenten der für die Sklaverei kämpfenden Konföderierten. Und Toots Mutter schämte sich zutiefst dafür, dass einer ihrer Vorfahren ein amerikanischer Ureinwohner war, und hatte versucht, das geheim zu halten.
Tatsache ist, dass meine Großeltern, wie die meisten weißen Amerikaner zu jener Zeit, nie groß über Schwarze nachgedacht hatten. Die unausgesprochenen Codes, die das Leben der Weißen bestimmten, beschränkten den Kontakt zu Schwarzen auf ein Minimum. Wenn im Kansas der Erinnerungen meiner Großeltern überhaupt Schwarze auftauchten, dann nur in verschwommenen Bildern — schwarze Männer, die auf der Suche nach Arbeit manchmal auf den Ölfeldern erschienen, schwarze Frauen, die sich als Wäscherinnen oder Putzfrauen in den Häusern der Weißen verdingten. Es gab Schwarze, aber sie waren nicht wirklich präsent, wie Sam, der Klavierspieler, Beulah, das Hausmädchen, oder Amos und Andy im Radio — schemenhafte, stumme Gestalten, die weder heftige Reaktionen hervorriefen noch Angst machten.
Erst als ich anfing, mich mit der Rassenfrage näher zu beschäftigen, hörte ich auch Geschichten aus ihrer Vergangenheit, in denen Rassismus tatsächlich eine Rolle spielte.
Gleich nachdem meine Mutter mit ihren Eltern in den 1950er-Jahren nach Texas zog, erhielt Gramps ein paar freundliche Ratschläge von seinen Arbeitskollegen, wie er sich gegenüber schwarzen und mexikanischen Kunden verhalten solle. »Wenn Farbige sich Ware ansehen wollen, müssen sie nach Feierabend kommen und sich um den Transport selbst kümmern.« Toot machte später in der Bank, in der sie arbeitete, die Bekanntschaft des Hausmeisters, eines hochgewachsenen schwarzen Kriegsveteranen, an den sie sich nur als Mr Reed erinnert. Eines Tages, während die beiden in der Eingangshalle miteinander plauderten, kam eine Sekretärin herbeigelaufen und zischte Toot zu, dass sie einen »Nigger« niemals, unter keinen Umständen, mit »Mister« anreden dürfe. Wenig später fand sie Mr Reed in einer Ecke des Gebäudes, wo er still vor sich hin weinte. Auf ihre Frage, was los sei, richtete er sich auf, wischte sich die Tränen ab und antwortete mit einer Gegenfrage.
»Was haben wir eigentlich getan, dass man uns so schlecht behandelt?«
Meine Großmutter wusste an jenem Tag keine Antwort, aber die Frage ließ sie nicht mehr los, und zuweilen, nachdem meine Mutter zu Bett gegangen war, diskutierte sie darüber mit Gramps.
Laut Toot existierte das Wort Rassismus damals nicht in ihrem Vokabular. »Dein Großvater und ich waren einfach der Ansicht, dass man Menschen anständig behandeln sollte, Bar«, erklärte sie mir. »Nichts weiter.« Sie beschlossen, dass Toot den Mann auch weiterhin mit Mister Reed anreden würde. Aber von da an blieb der Hausmeister auf Distanz, wenn sie einander im Flur begegneten. Er fürchtete um sie beide. Gramps hingegen waren die rassistischen Äußerungen seiner Arbeitskollegen so unangenehm, dass er Einladungen auf ein Bier immer häufiger ausschlug, mit der Ausrede, dass er nach Hause müsse. Toot und er fingen an, sich in ihrer eigenen Stadt wie Fremde zu fühlen.
Meine Mutter litt unter dieser unguten Atmosphäre am meisten. Sie war elf oder zwölf, ein Einzelkind, das sich gerade von einer schweren Asthmaerkrankung zu erholen begann. Durch die Krankheit und die vielen Umzüge von einer Stadt in die andere war sie zu einer Außenseiterin geworden. Sie war fröhlich und umgänglich, vergrub sich aber meist in ein Buch oder unternahm einsame Spaziergänge. An ihrer neuen Schule fand meine Mutter kaum Freunde. Wegen ihres Namens Stanley Ann (eine von Gramps’ verrückten Ideen — er hatte sich einen Sohn gewünscht) wurde sie oft gehänselt. »Stanley Steamer«, sagten sie zu ihr. »Stan the Man«. Wenn Toot von der Arbeit nach Hause kam, fand sie ihre Tochter meist allein. Sie saß auf der Veranda und ließ die Beine baumeln oder lag vor dem Haus auf dem Rasen, zurückgezogen in ihre eigene Welt.
Aber einmal, es war ein heißer, windstiller Tag, hatte sich vor dem Gartenzaun eine Horde Kinder versammelt. Als Toot näher kam, hörte sie gehässiges Lachen und sah die von Wut und Abscheu verzerrten Kindergesichter. Mit ihren hohen Stimmen riefen sie abwechselnd:
»Niggerfreundin!«
»Drecksyankee!«
»Niggerfreundin!«
Als sie Toot erblickten, liefen sie auseinander, aber vorher warf ein Junge noch einen Stein über den Zaun. Toot verfolgte die Flugbahn des Geschosses, das an einem Baumstamm landete, und entdeckte dort den Grund für die ganze Aufregung. Ihre Tochter und ein etwa gleichaltriges schwarzes Mädchen lagen bäuchlings mit aufgestützten Ellbogen und hochgerutschtem Rocksaum nebeneinander im Gras, die Zehen in die Erde gebohrt, vor sich ein Buch. Von Weitem machten die beiden einen ganz entspannten Eindruck. Erst als Toot das Tor öffnete und näher trat, sah sie, dass das schwarze Mädchen zitterte und ihrer Tochter Tränen in den Augen standen. Die beiden lagen unbeweglich da, wie gelähmt vor Angst, bis Toot sich hinunterbeugte und ihnen die Hände auf die Köpfe legte. »Wenn ihr beiden spielen wollt«, sagte sie, »dann geht um Himmels willen ins Haus. Los, rein mit euch.« Sie zog ihre Tochter hoch und streckte die Hand nach dem anderen Mädchen aus, doch da war es schon aufgesprungen und rannte mit langen, spindeldürren Beinen die Straße entlang.
Gramps war außer sich, als er hörte, was passiert war. Er fragte meine Mutter nach den Namen der Kinder und schrieb sie alle auf. Am nächsten Vormittag nahm er sich frei, um mit dem Schuldirektor zu sprechen. Ein paar der Eltern der Kinder, die die Mädchen beleidigt hatten, rief er sogar persönlich an, um ihnen die Meinung zu sagen. Aber von jedem Erwachsenen, mit dem er sprach, bekam er dasselbe zu hören: »Reden Sie besser mit Ihrer Tochter, Mr Dunham. In unserer Stadt spielen weiße Mädchen nicht mit Farbigen.«
SZENEN WIE DIESE waren zwar nicht der Hauptgrund, weshalb meine Großeltern aus Texas wegzogen, aber sie hinterließen ihre Spuren. Noch Jahre später habe ich mich gefragt, was meinen Großvater an diesem Tag so wütend gemacht hatte. Vielleicht glaubte er, zu verstehen, wie Schwarze sich fühlten, weil er ohne Eltern und an einem Ort aufgewachsen war, an dem Tratsch und schiefe Blicke ihn zum Außenseiter gemacht hatten.
Als dann meine Mutter Jahre später eines Tages nach Hause kam und von einem Freund erzählte, einem afrikanischen Studenten namens Barack, den sie an der Universität von Hawaii kennengelernt hatte, luden meine Großeltern ihn, ohne lange nachzudenken, zum Essen ein.
Was sie wohl dachten, als sie diese Einladung aussprachen? Gramps sagte wahrscheinlich: »Der arme Junge ist sicher einsam, so weit weg von zu Hause.« Und Toot war bestimmt skeptisch und wollte erst einmal einen Blick auf ihn werfen. Aber wie reagierten sie, als Barack dann tatsächlich vor ihrer Tür stand? So wie ich meinen Großvater kenne, war er fasziniert von der Ähnlichkeit meines Vaters mit dem Sänger Nat King Cole, und Toot war bestimmt charmant und zuvorkommend, unabhängig davon, was sie sich insgeheim dachte. Am Ende des Abends merkten wahrscheinlich beide an, wie intelligent der junge Mann wirkte — und so würdevoll mit seinem britisch klingenden Akzent!
Aber was hielten sie davon, dass ihre Tochter einen Schwarzen heiraten wollte? Ich weiß nicht, wie sie auf die Verlobung reagiert haben, und auch nicht, wie die Hochzeit war. Es gibt keinerlei Bilder von der Feier, der Torte, den Ringen oder davon, wie die Braut an den Bräutigam übergeben wurde, nur Belege für eine kleine standesamtliche Trauung vor dem Friedensrichter.
Dennoch haben meine Großeltern sich sicher große Sorgen gemacht. In vielen Südstaaten hätte man meinen Vater damals umgebracht, bloß weil er mit meiner Mutter flirtete. Aber vielleicht haben sie auch nichts gesagt, weil sie dachten, die Ehe würde ohnehin nicht lange halten.
Wenn dem tatsächlich so war, hatten sie die stille Entschlossenheit meiner Mutter unterschätzt, denn kurz darauf kam das Baby: gut sieben Pfund schwer, mit zehn Zehen und zehn Fingern und immerzu hungrig. Was zum Kuckuck sollten sie also machen?
Vieles im Land war damals im Umbruch begriffen, und mein Großvater wollte auf keinen Fall hinterherhinken. Er hörte seinem neuen Schwiegersohn zu, wie er über Politik oder Wirtschaft sprach, über ferne Orte wie das britische Parlament oder den Kreml, und malte sich eine Welt aus, die ganz anders war als die, die er kannte. Er fing an, die Zeitung aufmerksamer zu lesen, und interessierte sich insbesondere für Artikel über Bürgerrechte und Integration. Er war davon überzeugt, dass die Welt kurz davor war, Martin Luther Kings großen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
Er begann, sich zu fragen, wie ein technisch so fortschrittliches Land wie Amerika, das Männer ins All schickte, gleichzeitig moralisch so rückständig sein konnte, dass es seinen schwarzen Bürgern nicht dieselben Rechte zugestand wie allen anderen? Gramps war davon überzeugt, dass die Welt sich veränderte, und wir — eine Familie, die vor Kurzem noch in Wichita gelebt hatte — waren an vorderster Front mit dabei. Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört, wie ich auf den Schultern meines Großvaters sitzend die Rückkehr der Astronauten einer Apollo-Mission auf dem Luftwaffenstützpunkt Hickam beobachtete. Die Raumfahrer mit ihren Piloten-Sonnenbrillen waren so weit entfernt, dass sie kaum zu erkennen waren. Aber Gramps schwor, dass einer von ihnen mir zugewinkt hatte — mir persönlich —, und ich hatte zurückgewinkt. Auch das gehörte zu der Geschichte, die er sich zurechtlegte. Mit einem schwarzen Schwiegersohn und einem dunkelhäutigen Enkel war er im Zeitalter der Raumfahrt angekommen.
Und Hawaii, der jüngste Bundesstaat des Landes, schien ihm der sicherste Ort zu sein, um in dieses neue Abenteuer aufzubrechen. Dass auch die Geschichte Hawaiis vor Unrecht nur so strotzte, hatten offenbar alle vergessen. Auch dort waren Verträge geschlossen und dann gebrochen worden. Männer und Frauen, sogenannte Missionare, die die Hawaiianer zu Christen konvertieren wollten, hatten Krankheiten mitgebracht, die es auf Hawaii zuvor nicht gegeben hatte und die für viele den Tod bedeuteten. Amerikanische Firmen teilten den fruchtbaren Boden untereinander auf, um Ananas und Zuckerrohr anzubauen, und japanische, chinesische und philippinische Einwanderer schufteten für einen Hungerlohn von früh bis spät auf den Plantagen. Nach dem Angriff Japans auf die Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg wurden viele japanischstämmige Amerikaner auf Hawaii in Lagern interniert und dort wie Gefangene behandelt. All das war jüngste Geschichte, und doch schien dieses Unrecht aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden zu sein, als meine Familie dort 1959 ankam. Hawaii war zum »Schmelztiegel« der Nation erklärt worden, zu einem Experiment in Sachen Rassenharmonie.
Meine Großeltern verschrieben sich diesem Experiment aus voller Überzeugung und wollten mit allen dort Freundschaft schließen. Mein Großvater besaß sogar ein altes Exemplar von Dale Carnegies berühmtem Buch Wie man Freunde gewinnt. Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden, in dem erklärt wurde, wie man sich verhalten muss, damit andere einen mochten — oder einem etwas abkauften. Gramps entwickelte einen unbeschwerten Plauderton, den er im Umgang mit Kunden wohl für besonders hilfreich hielt. Wildfremden Leuten zeigte er Fotos von seiner Familie und breitete sein Leben vor ihnen aus. Er schüttelte dem Postboten herzlich die Hand und erzählte den Kellnerinnen im Restaurant anzügliche Witze.
Mir selbst war das manchmal peinlich, aber vielen Leuten gefiel es, dass er so aufgeschlossen war, und so hatte er bald einen großen Freundeskreis. Ein japanischstämmiger Amerikaner, der einen kleinen Laden in der Nähe besaß, legte uns die allerfeinsten Fischstücke für Sashimi auf die Seite, und mir schenkte er immer Bonbons, die in essbarem Reispapier eingewickelt waren. Die Hawaiianer, die als Lieferfahrer in Großvaters Möbelgeschäft arbeiteten, luden uns zu Poi und Schweinebraten ein, und Gramps langte herzhaft zu (während meine Großmutter lieber wartete, bis wir wieder zu Hause waren und sie sich ein paar Spiegeleier machen konnte).
Manchmal begleitete ich Gramps auch in den Ali’i Park, wo er mit alten Filipinos Schach spielte — Männern, die billige Zigarren rauchten und Betelnüsse kauten, deren roter Saft aussah wie Blut. Und ich weiß noch, wie ein Portugiese, dem Großvater ein Sofa zu einem sehr günstigen Preis verkauft hatte, eines Morgens noch vor Sonnenaufgang mit uns zum Speerfischen zur Kailua Bay fuhr. Im Steuerhaus des Boots hing eine Gaslaterne, in deren Licht ich beobachtete, wie die Männer in das tintenschwarze Wasser eintauchten und der Schein ihrer Taschenlampen sich unter der Wasseroberfläche bewegte. Als sie wieder auftauchten, zuckte ein großer, schimmernder Fisch an einem ihrer Speere. Gramps nannte mir den hawaiianischen Namen — Humu-Humu-Nuku-Nuku-Apuaa —, und auf dem gesamten Rückweg wiederholten wir ihn immer wieder.
In diesem Umfeld hatten meine Großeltern mit meiner Hautfarbe kaum Schwierigkeiten, und es ärgerte sie, wenn Leute, die zu Besuch kamen, darauf zu sprechen kamen. Wenn Gramps sah, wie Touristen mich beim Spielen am Strand beobachteten, trat er manchmal zu ihnen und flüsterte, ich sei der Urenkel König Kamehamehas, des ersten Herrschers von Hawaii. Natürlich veräppelte er sie, dennoch fragte ich mich, ob er sich manchmal nicht insgeheim wünschte, es wäre wahr. Es war so viel einfacher, als zu sagen: »Seine Mutter ist weiß und sein Vater schwarz.«
Es gab auch Situationen, in denen er es sich nicht verkneifen konnte, den Leuten klarzumachen, wie falsch ihre Sichtweise war. Einmal beobachtete mich ein Tourist beim Schwimmen und war tief beeindruckt. »Das Schwimmen liegt hawaiianischen Kindern wahrscheinlich einfach im Blut«, sagte er. Worauf Gramps erwiderte, dass dies nicht unbedingt der Fall sein müsse. »Dieser Junge dort ist zufällig mein Enkel«, sagte er. »Seine Mutter stammt aus Kansas, sein Vater ist aus dem kenianischen Binnenland, und beide Orte sind weit von einem Ozean entfernt.« Für Gramps war Rassismus nichts, worüber man sich noch Sorgen machen müsste, und wenn andere das nicht so sahen, nun ja, dann würden sie es auch bald begreifen.
Der Lebensweg meines Großvaters erzählt wahrscheinlich genauso viel über die Zeit, in der er lebte, wie über ihn selbst. Er wollte Teil der Aufbruchsstimmung sein, die die Nation damals für kurze Zeit ergriffen hatte. Sie war 1960 mit der Wahl des jungen und hoffnungsvollen John F. Kennedy zum Präsidenten der Vereinigten Staaten aufgekommen und hielt an, bis 1965 der Voting Rights Act verabschiedet wurde, der den Schwarzen das Wählen erlaubte. Viele glaubten damals, es wäre die Geburtsstunde einer strahlenden neuen Welt, frei von Engstirnigkeit und Vorurteilen. Natürlich würde es immer noch Unterschiede geben, aber anstatt einander zu hassen und zu fürchten, könnte man über die Unterschiede lachen und von der Kultur der anderen lernen.
Die Geschichten, die meine Mutter und Großeltern mir über meinen Vater erzählten, waren Teil ihres Traums von einer gerechten Welt, in der Rassenschranken nicht mehr existierten — eines Traums, dessen Zauber sie alle erlegen waren.
Doch als der Bann schließlich gebrochen wurde und die Welten, von denen sie glaubten, sie hätten sie hinter sich gelassen, sie wieder einholten, platzte auch ihr Traum, und alles, was davon übrig blieb, war ich.
2. Kapitel
Eines Tages, ich war sechs Jahre alt, nahm meine Mutter mich beiseite, um mir zu sagen, dass sie wieder heiraten werde und wir sehr weit wegziehen würden.
Der Name des Mannes war Lolo. Sie war mit ihm zusammen, seit ich vier war, daher kannte ich ihn gut. Er studierte (wie mein Vater) an der Universität von Hawaii und kam aus Indonesien, einem Land in Südostasien. Lolo bedeutet auf Hawaiianisch »verrückt«, worüber Gramps sich immer kaputtlachte. Aber der Name passte gar nicht zu Lolo, der sehr höflich und umgänglich war. Er war klein mit einem dunklen Teint und hatte dichtes schwarzes Haar, ein gut aussehender Mann, der ausgezeichnet Tennis spielte. In den letzten zwei Jahren hatte er geduldig mit Gramps stundenlang Schach gespielt und Ringkämpfe mit mir ausgetragen.
Ich hatte nichts dagegen. Allerdings fragte ich meine Mutter, ob sie Lolo wirklich liebte — denn inzwischen wusste ich, dass solche Dinge wichtig waren. Das Kinn meiner Mutter bebte, und sie sah aus, als würde sie gleich weinen. Dann nahm sie mich so fest in die Arme, dass ich mir sehr tapfer vorkam, auch wenn ich nicht wusste, weshalb.
Kurz danach reiste Lolo sehr plötzlich ab, um uns in Indonesien ein Haus zu suchen und die nötigen Vorbereitungen zu treffen, während meine Mutter und ich die nächsten Monate unseren Umzug in die Wege leiteten. Wir brauchten Pässe, Visa, Flugtickets, Hotelreservierungen und unzählige Impfungen. Während wir packten, schlug Gramps den Atlas auf und zeigte mir, wo ich leben würde. Indonesien ist eine Inselkette mit mehr als siebentausend Inseln, von denen jedoch nur ungefähr sechstausend bewohnt sind. Gramps zählte mir die bekanntesten auf: Java, Borneo, Sumatra, Bali. Als er so alt war wie ich, hießen diese Inseln noch Gewürzinseln — geheimnisvolle, sagenumwobene Orte.
»Hier steht, dass es dort noch Tiger gibt«, sagte er. »Und Orang-Utans.« Mit weit aufgerissenen Augen schaute er vom Buch auf. »Sogar Kopfjäger soll es dort geben!«
Die Regierung Indonesiens war erst vor Kurzem von einer neuen politischen Gruppierung gestürzt worden, aber in den amerikanischen Nachrichten berichteten sie, es habe kaum Gewaltausbrüche gegeben. Toot rief dennoch sofort im Außenministerium an, um herauszufinden, ob Indonesien sicher sei. Man beruhigte sie, dass die Lage »unter Kontrolle« sei, trotzdem bestand sie darauf, dass wir für den Notfall mehrere Kartons mit Lebensmitteln mitnahmen — Instantgetränkepulver, Milchpulver, Sardinenbüchsen. »Man weiß nie, was diese Leute essen«, sagte sie. Meine Mutter stöhnte, aber Toot steckte mir mehrere Packungen mit Süßigkeiten zu und zog mich damit auf ihre Seite.
Meine Mutter warnte mich, dass Indonesien ein sehr armes Land sei. Wir könnten uns dort die Ruhr einfangen, sagte sie — eine von Bakterien ausgelöste Krankheit, die Durchfall verursachte —, und ich müsste mich daran gewöhnen, kalt zu duschen, und dass manchmal der Strom ausfallen würde. Aber laut meiner Mutter waren das nur kleine Unannehmlichkeiten. Es war nicht zu übersehen, wie aufgeregt sie war, etwas Neues und Wichtiges zu beginnen. Sie wollte gemeinsam mit ihrem Mann dazu beitragen, das Land wiederaufzubauen, aber vor allem war sie froh, von ihren Eltern wegzukommen, auch wenn sie diese sehr liebte.
Endlich gingen wir an Bord des Flugzeugs, das uns auf die andere Seite des Globus brachte. Ich trug ein langärmeliges weißes Hemd mit grauer Krawatte und wurde von den Stewardessen mit Puzzles, einer Extraportion Erdnüsse und Piloten-Anstecknadeln verwöhnt. Als wir in Jakarta, der Landeshauptstadt, aus dem Flugzeug stiegen, war es heiß wie in einem Backofen. Ich nahm meine Mutter bei der Hand, fest entschlossen, sie zu beschützen, was auch kommen mochte.
Lolo, der ein paar Pfund zugelegt hatte und jetzt einen buschigen Schnurrbart trug, war da, um uns abzuholen. Er umarmte meine Mutter, hob mich hoch und sagte, wir sollten einem kleinen, drahtigen Mann folgen, der unser Gepäck an der langen Schlange am Zoll vorbei zu einem wartenden Auto brachte. Meine Mutter sagte etwas zu dem Mann, der lachte und nickte, aber es war klar, dass er kein Wort Englisch verstand. Um uns herum wuselte es von Menschen, die eine mir unverständliche Sprache sprachen und fremdartig rochen.
Das Auto sei nur geliehen, erklärte Lolo, aber er habe sich ein nagelneues Motorrad gekauft, und das neue Haus sei bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig. Ich sei schon an einer Schule angemeldet, und seine Eltern, Verwandten und Freunde würden sich freuen, uns kennenzulernen. Während er und meine Mutter sich auf der Fahrt unterhielten, steckte ich den Kopf aus dem Fenster, betrachtete die braungrüne Landschaft und sog den Geruch von Diesel und brennendem Holz ein. Männer und Frauen stapften wie Kraniche durch Reisfelder, die Gesichter unter großen Strohhüten verborgen. Ein Junge, nass und glitschig wie ein Otter, hockte auf einem gleichmütig dreinschauenden Wasserbüffel und schlug mit einem Bambusstock auf ihn ein. Dann belebten sich die Straßen, kleine Läden tauchten auf und Männer, deren Karren mit Kies und Holz beladen waren. Die Häuser wurden größer, so wie die auf Hawaii.
»Dort drüben ist das Hotel Indonesia«, sagte Lolo. »Ganz modern. Und dort das neue Einkaufszentrum.« Aber nur wenige der Gebäude überragten die extrem hohen Bäume, die nun die Straße säumten.
Als wir an einer Reihe neuer Häuser vorbeikamen, mit hohen Hecken und Wachposten, sagte meine Mutter etwas, was ich nicht richtig verstand. Es hatte mit der Regierung zu tun und einem gewissen Sukarno.
»Wer ist Sukarno?«, rief ich von hinten, aber Lolo tat, als habe er die Frage nicht gehört. Er legte die Hand auf meinen Arm und machte mich auf etwas aufmerksam. »Schau«, sagte er. Vor uns stand am Straßenrand eine riesige Statue, mindestens zehn Stockwerke hoch. Sie hatte den Körper eines Menschen und das Gesicht eines Affen.
»Das ist Hanuman, der Affengott«, sagte Lolo.
Wie gebannt starrte ich die Figur an, die sich dunkel gegen die Sonne abhob, als wollte sie jeden Moment in den Himmel aufsteigen, um dem chaotischen Verkehr zu ihren Füßen zu entfliehen. »Hanuman ist ein großer Krieger«, sagte Lolo. »Stark wie hundert Mann. Im Kampf gegen die Dämonen verliert er nie.«
Unser Haus lag in einem Neubauviertel am Stadtrand. Die Straße führte über eine schmale Brücke über einen breiten braunen Fluss, in dem Leute badeten und Wäsche wuschen. Dann verwandelte sich die Asphaltstraße in eine Piste, gesäumt von kleinen Läden und weiß getünchten Bungalows, und mündete schließlich in einem schmalen Fußpfad, der auf unser Grundstück führte. Das Haus selbst war einfach, mit Gipsputz und roten Dachziegeln, aber offen und luftig. Im Vorgarten stand ein großer Mangobaum.
Beim Hineingehen meinte Lolo, er habe eine Überraschung für mich, und im selben Moment war aus dem Baum ein ohrenbetäubendes Geschrei zu hören. Meine Mutter und ich wichen erschrocken zurück. Dann sahen wir ein großes, pelziges Geschöpf mit einem kleinen, flachen Kopf und langen, bedrohlich wirkenden Armen auf einem der unteren Äste landen.
»Ein Affe!«, rief ich.
»Ein Menschenaffe«, korrigierte mich meine Mutter.
Lolo holte eine Erdnuss aus der Tasche, die sich das Tier mit seinen langen Fingern angelte. »Er heißt Tata«, sagte er. »Ich habe ihn dir aus Neuguinea mitgebracht.«
Ich machte ein paar Schritte in seine Richtung, um ihn mir näher anzusehen, doch Tata, die tief liegenden Augen wild und misstrauisch, machte Anstalten, sich auf mich zu stürzen. Ich beschloss, keinen Schritt weiterzugehen.
»Keine Sorge«, sagte Lolo und drückte Tata eine zweite Erdnuss in die Hand. »Er ist angebunden. Komm, es gibt noch mehr zu sehen.«
Ich schaute zu meiner Mutter, die mir zaghaft zulächelte.
Hinter dem Haus befand sich ein kleiner Zoo. Hühner und Enten liefen durcheinander, es gab einen großen gelben Hund, der böse knurrte, zwei Paradiesvögel, einen weißen Kakadu und zwei kleine Krokodile, die in einem umzäunten Teich halb unter Wasser trieben.
Lolo sah zu den Krokodilen. »Es waren mal drei«, sagte er, »aber das größte ist durch ein Loch im Zaun auf das Reisfeld des Nachbarn entwischt und hat dort eine seiner Enten gefressen. Wir mussten ihm mit Taschenlampen nachjagen.«
Obwohl es nicht mehr sehr hell war, machten wir noch einen kleinen Spaziergang durchs Dorf. Gruppen kichernder Kinder winkten uns zu, und ein paar barfüßige alte Männer kamen zu uns, um uns die Hand zu schütteln. Auf der »Gemeindewiese« in der Dorfmitte, wo einer von Lolos Bekannten seine Ziegen weiden ließ, machten wir Halt. Ein kleiner Junge stellte sich neben mich, der an einem Faden eine fliegende Libelle mit sich führte.
Als wir wieder zu Hause waren, stand im Hof der Mann, der unser Gepäck getragen hatte. Unter seinem Arm klemmte ein rostbraunes Huhn, und in der rechten Hand hielt er ein langes Messer. Er sagte etwas zu Lolo, der nickte und meine Mutter und mich zu sich rief. Meine Mutter sagte, ich solle bleiben, wo ich bin, und warf Lolo einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Findest du nicht, dass er dafür noch zu jung ist?«, fragte sie ihn.
Lolo zuckte mit den Schultern und sah mich an. »Der Junge sollte wissen, woher sein Abendessen kommt. Oder was meinst du, Barry?«
Mein Blick wanderte von meiner Mutter zu dem Mann mit dem Huhn. Dann nickte Lolo, und ich sah zu, wie der Mann den Vogel absetzte, mit dem Knie festhielt und seinen Hals über eine schmale Rinne legte. Das Tier wehrte sich noch eine Weile, flatterte mit den Flügeln, und ein paar Federn wirbelten durch die Luft. Dann wurde es ganz still. Der Mann zog ihm in einer raschen Bewegung die Klinge über den Hals. In einem langen roten Strahl schoss das Blut heraus. Der Mann stand auf, hielt das Huhn mit ausgestrecktem Arm vor sich und schleuderte es in die Luft. Mit einem dumpfen Geräusch landete es auf der Erde, rappelte sich mit grotesk herabhängendem Kopf wieder auf und torkelte wie benommen im Kreis herum. Ich sah zu, wie der Kreis allmählich kleiner wurde und das Blut schließlich nur noch in einem dünnen Rinnsal austrat. Dann brach der Vogel zusammen und lag leblos im Gras.
Lolo strich mir über den Kopf und sagte, wir sollten uns vor dem Essen waschen. Wir aßen zu dritt unter einer trüben Glühbirne — Huhn mit Reis und zum Nachtisch rote, pelzige Früchte, die so süß waren, dass ich erst aufhören konnte, als ich Bauchweh hatte. Später, als ich allein unter einem Moskitonetz lag, dem Zirpen der Grillen im Mondlicht lauschte und an den Todeskampf des Huhns dachte, konnte ich mein Glück kaum fassen.
NICHT LANGE, NACHDEM