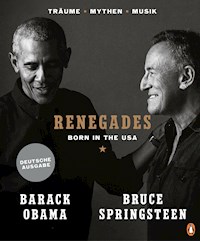9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es sind die Themen unserer Zeit: Klimawandel, Migration, Terrorismus, Atomwaffen, rassistische Gewalt. Es sind die Themen, die Barack Obama in acht Jahren als US-Präsident wie kein anderer Staatsmann verfolgt hat. In seinen Reden zieht er unaufgeregt und konzentriert Lehren aus einer fehlgeleiteten Politik der Vergangenheit und richtet den Blick auf die Zukunft.
Barack Obama ist aber nicht nur ein scharfsinniger Politiker, er ist einer der Menschen, die sich nicht scheuen, Mitgefühl zu zeigen, Verzweiflung und Trauer. Unvergessen seine Rede beim Begräbnis von Nelson Mandela oder seine spontane Äußerung zu dem Attentat in Orlando. Auf seinen Reden gründet sich sein Vermächtnis, Ideale auch angesichts einer schwierigen Realität nicht zu verraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Es sind die Themen unserer Zeit: Klimawandel, Migration, Terrorismus, Atomwaffen, rassistische Gewalt. Es sind die Themen, die Barack Obama in acht Jahren als US-Präsident wie kein anderer Staatsmann verfolgt hat. In seinen Reden zieht er unaufgeregt und konzentriert Lehren aus einer fehlgeleiteten Politik der Vergangenheit und richtet den Blick auf die Zukunft.
Barack Obama ist aber nicht nur ein scharfsinniger Politiker, er ist einer der Menschen, die sich nicht scheuen, Mitgefühl zu zeigen, Verzweiflung und Trauer. Unvergessen seine Rede beim Begräbnis von Nelson Mandela oder seine spontane Äußerung zu dem Attentat in Orlando. Auf seinen Reden gründet sich sein Vermächtnis, Ideale auch angesichts einer schwierigen Realität nicht zu verraten.
Ergänzt wird diese Auswahl seiner wichtigsten Reden um die schon jetzt legendäre Rede seiner Frau Michelle Obama vom 13. Oktober 2016 anlässlich der frauenfeindlichen Äußerungen Donald Trumps während des Präsidentschaftswahlkampfs.
Barack Obama, geboren am 4. August 1961 in Honolulu auf Hawaii, ist der 44. Präsident der USA und Friedensnobelpreisträger. Er ist der erste Afroamerikaner, der in das höchste Regierungsamt der USA gewählt wurde.
Birgit Schmitz, geboren 1971, studierte Geschichte, Germanistik und Soziologie in Köln. Sie arbeitet seit 15 Jahren im Verlagswesen.
Barack Obama
Worte müssen etwas bedeuten
Seine großen Reden
Herausgegeben von Birgit Schmitz
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabedes suhrkamp taschenbuchs 4797
© dieser Zusammenstellung: Suhrkamp Verlag Berlin 2017
© Alle Reden by US-Botschaft Berlin/Amerika Dienst
der folgenden Übersetzungen: © Das Wagnis der Hoffnung; Yes, We Can; Ein vollkommener Bund; Newtown, du bist nicht allein; Michelle Obama, Wenn die anderen ihre schlechteste Seite zeigen, zeigen wir unsere beste by Birgit Schmitz
Suhrkamp Taschenbuch Verlag
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: Al Drago/NYT/Redux/laif
eISBN 978-3-518-75132-9
Inhalt
Das Wagnis der Hoffnung –2004
Yes, We Can –2008
Ein vollkommener Bund –2008
Jetzt ist unsere Zeit –2008
Unsere Geschichten sind einzigartig, unser Schicksal aber ist ein gemeinsames –2008
Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir uns für Hoffnung anstelle von Angst entschieden haben –2009
Das menschliche Schicksal wird immer das sein, was wir daraus machen –2009
Ein Neuanfang –2009
Diese Orte haben über die Zeit nichts von ihrer Grausamkeit verloren –2009
Wir müssen damit beginnen, die schwere Wahrheit anzunehmen –2009
Das ist die Realität, der wir uns stellen müssen –2010
Schlechte Dinge geschehen, und wir müssen uns danach vor einfachen Erklärungen hüten –2011
Das ist die Zukunft, die wir uns erhoffen –2012
Newtown, du bist nicht allein –2012
Ein Mensch, dessen Leben wie kein zweites war –2013
Die Folgen des sorglosen Nichtstuns sind nichts Abstraktes –2014
Denn wir sind aus dem Wandel geboren –2015
Hier habe ich Afrika getroffen, das Afrika, an das ich immer geglaubt habe –2015
Die Kritiker haben sich geirrt –2015
Hier können wir zeigen, was möglich ist –2015
Es ist Zeit, das Embargo aufzuheben –2016
In Hiroshima veränderte sich die Welt für immer –2016
Dies ist eine ernüchternde Mahnung –2016
Ich habe schon zu viele Familien umarmt –2016
Eine Prüfung für unsere gemeinsame Menschlichkeit –2016
Michelle Obama, Wenn die anderen ihre schlechteste Seite zeigen,zeigen wir unsere beste –2016
Das Wagnis der Hoffnung
Grundsatzrede beim Nominierungsparteitagder Demokratischen Partei
Boston, 27. Juli 2004
… Der heutige Abend ist eine besondere Ehre für mich, denn seien wir ehrlich: Es war ziemlich unwahrscheinlich, dass ich einmal auf dieser Bühne stehen würde. Mein Vater war ein Austauschstudent, geboren und aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Kenia. Er hütete Ziegen und ging in einer Wellblechhüte zur Schule. Sein Vater – mein Großvater – war Koch und Hausdiener bei den Briten.
Aber mein Großvater hatte große Träume für seinen Sohn. Durch harte Arbeit und Beharrlichkeit erhielt mein Vater ein Stipendium, um an einem magischen Ort zu studieren: Amerika, das als Leuchtturm für Freiheit und Chancen schon vielen Menschen zuvor den Weg hierher gewiesen hat.
Während er hier studierte, lernte mein Vater meine Mutter kennen. Sie war in einer Stadt am anderen Ende der Welt geboren worden, in Kansas. Ihr Vater arbeitete während der Great Depression auf Ölfeldern und Farmen. Am Tag nach Pearl Harbor meldete sich mein Großvater zum Militär, kam zu Pattons Armee und marschierte mit ihr quer durch Europa. Zu Hause zog meine Großmutter derweil das Baby auf und ging in einer Flugzeugfabrik des Militärs zur Arbeit. Nach dem Krieg ermöglichte es ihnen der »G.I. Bill« zu studieren, mit Hilfe eines F.H.A.-Kredits kauften sie sich ein Haus und zogen später auf der Suche nach Arbeit nach Westen – bis nach Hawaii. Und auch sie hatten große Träume für ihre Tochter. Ein gemeinsamer Traum, geboren auf zwei Kontinenten.
Meine Eltern teilten nicht nur eine unwahrscheinliche Liebe, sie teilten auch den beständigen Glauben an die Möglichkeiten dieser Nation. So gaben sie mir einen afrikanischen Namen, Barack, oder »Gesegnet«, im Glauben daran, dass in einem toleranten Amerika ein Name kein Hindernis für Erfolg sein würde. Sie stellten sich vor, dass ich auf die besten Schulen des Landes gehen würde, obwohl sie nicht reich waren, weil man im großzügigen Amerika nicht reich sein muss, um seine Ziele zu erreichen. Sie beide sind inzwischen verstorben. Aber ich weiß, dass sie in dieser Nacht mit großem Stolz auf mich herunterschauen.
Sie stehen hier mit mir, und ich stehe hier heute, dankbar für die Vielfalt meines Erbes und mir darüber bewusst, dass die Träume meiner Eltern in meinen beiden kostbaren Töchtern weiterleben. Ich stehe hier in dem Wissen, dass meine Geschichte ein Teil der größeren amerikanischen Geschichte ist, dass ich jenen etwas schulde, die vor mir kamen, und dass in keinem anderen Land auf dieser Erde meine Geschichte überhaupt möglich gewesen wäre.
Heute Abend haben wir uns hier versammelt, um die Großartigkeit unserer Nation zu unterstreichen – nicht wegen der Höhe unserer Wolkenkratzer oder der Macht unseres Militärs oder der Größe unserer Wirtschaft. Unser Stolz basiert auf der sehr einfachen Annahme, zusammengefasst in einer Erklärung, die vor über 200 Jahren gemacht wurde:
»Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.«
Das ist das wahre Genie Amerikas, der Glaube – der Glaube an einfache Träume, das Bestehen darauf, dass kleine Wunder möglich sind; dass wir unsere Kinder abends zudecken und wissen, dass sie Nahrung und Kleidung haben und ihnen kein Schaden droht; dass wir sagen können, was wir denken, schreiben, was wir denken, ohne ein plötzliches Klopfen an der Tür zu hören; dass wir eine Idee haben und unser eigenes Geschäft eröffnen können, ohne Schmiergeld zu bezahlen; dass wir ohne Furcht vor Strafe an einem politischen Prozess teilnehmen können und dass unsere Stimmen zählen werden – jedenfalls meistens.
Dieses Jahr, bei dieser Wahl, sind wir dazu aufgerufen, uns noch einmal unserer Werte und Verpflichtungen zu versichern, sie gegen die harte Realität zu verteidigen und so dem Vermächtnis unserer Vorfahren und dem Versprechen für zukünftige Generationen gerecht zu werden.
Heute sage ich Ihnen, amerikanische Mitbürger, Demokraten, Republikaner und Unabhängige: Wir müssen mehr tun – mehr tun für die Arbeiter, die ich in Galesburg, Illinois, getroffen haben, die ihre Jobs bei Maytag verloren haben, weil man diese nach Mexiko verlegt hat, und nun konkurrieren sie mit ihren eigenen Kindern um Jobs für sieben Dollar die Stunde. Wir müssen mehr für den Vater tun, den ich getroffen habe und der seine Arbeit verloren hat, der seine Tränen kaum zurückhalten konnte, weil er nun nicht mehr krankenversichert ist und nicht weiß, wie er die 4500 Dollar für die Medikamente seines Sohnes aufbringen soll. Mehr tun auch für die junge Frau aus East St. Louis und viele Tausende andere wie sie, die gute Schulnoten, den Elan und Willen haben, aber nicht das Geld, um aufs College zu gehen.
Verstehen Sie mich nicht falsch, die Menschen, die ich treffe – in kleinen und großen Städten, in Restaurants und Büros –, erwarten nicht, dass die Regierung all ihre Probleme löst. Sie wissen, dass sie selber hart arbeiten müssen, um voranzukommen, und sie wollen das auch. … Doch sie ahnen, dass ein paar geringfügige Veränderungen bezüglich der Prioritäten sicherstellen können, dass jedes Kind in Amerika eine faire Chance hat und die Türen für alle offen bleiben …
Auch jetzt, in diesem Moment, wo wir hier sprechen, gibt es jene, die sich darauf vorbereiten, uns zu spalten … Ich sage Ihnen heute Abend: Es gibt nicht ein liberales Amerika und ein konservatives Amerika – es gibt die Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt nicht ein schwarzes Amerika und ein weißes Amerika und nicht ein Amerika der Hispanics und eines der Asiaten – es gibt nur die Vereinigten Staaten von Amerika.
Die Experten möchten unser Land in rote und blaue Staaten zerteilen, rote Staaten für die Republikaner, blaue Staaten für die Demokraten. Aber für die habe ich Neuigkeiten. Wir beten zu einem Ehrfurcht gebietenden Gott in den blauen Staaten, und in den roten Staaten mögen wir keine Geheimdienstler, die unsere Bibliotheken durchsuchen. Wir trainieren die Little League in den blauen Staaten, und ja, wir haben einige schwule Freunde in den roten Staaten. Es gab Patrioten, die gegen den Krieg im Irak waren, und es gab Patrioten, die den Krieg im Irak unterstützt haben. Wir sind alle ein Volk, wir alle schwören Treue auf die Fahne, wir alle verteidigen die Vereinigten Staaten von Amerika.
Am Ende geht es bei dieser Wahl genau darum. Wirken wir mit an einer Politik des Zynismus, oder beteiligen wir uns an einer Politik der Hoffnung? …
Ich spreche nicht von blindem Optimismus – es ist schon willentliche Dummheit, zu glauben, dass Arbeitslosigkeit einfach dadurch verschwindet, dass wir nicht darüber nachdenken, oder die Krise des Gesundheitssystems gelöst wird, indem wir sie ignorieren. Das ist nicht, worüber ich spreche. Ich spreche über etwas viel Substanzielleres. Es ist die Hoffnung der Sklaven, die um ein Feuer sitzend Freiheitslieder singen; die Hoffnung der Einwanderer, die sich zu fernen Küsten aufmachen; die Hoffnung eines jungen Marineleutnants, der mutig im Mekong-Delta patrouilliert; die Hoffnung des Sohns eines Stahlarbeiters, der allen Widrigkeiten die Stirn bietet; die Hoffnung eines mageren Kindes mit einem lustigen Namen darauf, dass es auch für dieses Kind in Amerika einen Platz gibt.
Hoffnung angesichts von Schwierigkeiten. Hoffnung angesichts von Unsicherheit. Das Wagnis der Hoffnung eingehen. …
Yes, We Can
Rede nach den Vorwahlen in New Hampshire
Nashua, 8. Januar 2008
… Sie wissen, vor wenigen Wochen hatte sich niemand vorgestellt, was wir heute Abend in New Hampshire erreicht haben. Niemand konnte sich das vorstellen.
Die meiste Zeit lagen wir im Wahlkampf hinten. Wir wussten immer, dass ein steiler Weg vor uns liegen würde. Aber ihr seid in sagenhafter Zahl gekommen und habt euch für den Wandel ausgesprochen. Mit euren Stimmen und eurer Wahl habt ihr klargemacht, dass in diesem Moment, bei dieser Wahl, in Amerika etwas geschieht.
Es geschieht dort, wo Männer und Frauen in Des Moines und Davenport, in Lebanon und Concord ihr Haus verlassen und sich im Januarschnee in eine Warteschlange einreihen, die sich rund um den Block erstreckt, weil sie daran glauben, was dieses Land alles sein kann.
Es geschieht dort, wo Amerikaner, die jungen und die junggebliebenen, die sich vorher niemals an Politik beteiligt hatten, in so hoher Zahl erschienen sind, wie wir es niemals zuvor erlebt haben, weil sie tief in ihrem Herzen wussten, dass es dieses Mal anders sein muss. Es geschieht dort, wo Leute abstimmen – und nicht einfach für die Partei, der sie angehören, sondern für die Hoffnungen, die wir alle gemeinsam haben.
Und ob wir nun reich oder arm, schwarz oder weiß, Hispanics oder Asiaten sind, ob wir aus Iowa oder New Hampshire, Nevada oder South Carolina stammen, wir sind bereit, dieses Land in eine grundlegend neue Richtung zu führen.
Das ist es, was gerade in Amerika geschieht, ein Wandel geschieht in Amerika.
Ihr alle, die ihr heute Abend hier seid, die ihr so viel Herzblut und Arbeit in diesen Wahlkampf gesteckt habt, ihr könnt die neue Mehrheit sein, die diese Nation aus der langen politischen Dunkelheit führt.
Demokraten, Unabhängige und Republikaner, sie alle sind müde von der Spaltung und dem Gezerre, die Washington verdunkeln, sie wissen, dass wir nicht immer einer Meinung sein können. Sie verstehen, wenn wir unsere Stimme erheben, um das Geld und den Einfluss herauszufordern, die uns im Weg stehen. Sie verstehen, dass wir uns auch selbst herausfordern, etwas Besseres zu erreichen, und sie wissen, dass es kein Problem gibt, das nicht gelöst werden kann; dass es kein Schicksal gibt, das wir nicht meistern können. Unsere neue amerikanische Mehrheit kann die Schande einer Gesundheitsversorgung, die man sich nicht leisten kann, die nicht vorhanden ist, beenden. Wir können Ärzte und Patienten, Arbeiter und Unternehmen, Demokraten und Republikaner an einen Tisch bringen, und wir können der Pharma- und der Versicherungsindustrie sagen, dass sie nicht jeden Platz an diesem Tisch kaufen können, nicht dieses Mal, nicht jetzt.
Unsere neue Mehrheit kann die Steuervergünstigungen für Unternehmen streichen, die Arbeitsplätze nach Übersee schaffen. Arbeitende Amerikaner verdienen es, dass durch Steuererleichterungen für die Mittelklasse etwas zurück in ihre Taschen fließt.
Wir können damit aufhören, unsere Kinder in Schulen zu schicken, auf deren Gängen die Scham vorherrscht, und beginnen, sie auf den Weg des Erfolgs zu bringen.
Wir können aufhören, darüber zu reden, wie großartig Lehrer sind, und anfangen, sie für ihre Großartigkeit zu belohnen, indem wir ihnen mehr Gehalt zahlen und sie mehr unterstützen. Wir können das mit unserer neuen Mehrheit tun.
Wir können uns den Einfallsreichtum von Landwirten und Wissenschaftlern, Bürgern und Unternehmern zunutze machen, um diese Nation von der Tyrannei des Öls zu befreien und unseren Planeten zu retten, bevor es kein Zurück mehr gibt.
Und wenn ich Präsident der Vereinigten Staaten bin, werden wir den Krieg im Irak beenden und unsere Truppen nach Hause bringen. Wir werden in Afghanistan den Kampf gegen Al-Qaida beenden. Wir werden uns um die Kriegsveteranen kümmern. Wir werden unser moralisches Ansehen auf dieser Welt wiederherstellen. Und wir werden niemals mehr den 11. September dazu nutzen, um Wählerstimmen zu mobilisieren, weil das keine Taktik ist, um eine Wahl zu gewinnen. Es ist vielmehr eine Herausforderung, die Amerika und die Welt einen sollte, um gegen die verbreiteten Bedrohungen des 21. Jahrhunderts anzukämpfen: Terrorismus und Atomwaffen, Klimawandel und Armut, Völkermord und Krankheiten. …
Man hat uns aufgefordert, eine Pause einzulegen, um zu überprüfen, ob das alles überhaupt realistisch ist. Man hat uns davor gewarnt, den Menschen dieser Nation falsche Hoffnungen zu machen. Aber in der unwahrscheinlichen Geschichte Amerikas war es niemals falsch, Hoffnung zu haben.
Wann immer man uns vor unüberwindbare Hindernisse gestellt hat, wann immer man uns gesagt hat, dass wir noch nicht so weit sind oder dass wir es nicht versuchen sollten oder dass wir es nicht können, haben Generationen von Amerikanern darauf mit einer simplen Überzeugung, die die Haltung der Menschen zusammenfasst, geantwortet:
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Es war ein Glaubensbekenntnis, aufgeschrieben in den Gründungsdokumenten, die das Schicksal der Nation bestimmten: Yes, we can.
Es wurde geflüstert von Sklaven und von Sklavenbefreiern, als sie sich den Weg zur Freiheit durch die dunkelste Nacht bahnten: Yes, we can.
Es wurde gesungen von den Einwanderern, als sie sich von fernen Küsten auf den Weg machten, und von den Pionieren, die westwärts einer erbarmungslosen Wildnis entgegenzogen: Yes, we can.
Es war der Ruf der Arbeiter, die sich organisierten, der Frauen, die das Wahlrecht erstritten, eines Präsidenten, der als New Frontier den Mond wählte, und eines Königs, der uns auf den Berggipfel führte und uns den Weg ins Gelobte Land wies:
Yes, we can – für Gerechtigkeit und Gleichheit.
Yes, we can – für Chancen und Wachstum.
Yes, we can – diese Nation heilen.
Yes, we can – diese Welt reparieren.
Yes, we can.
… Wir werden uns daran erinnern, dass in Amerika etwas geschieht, dass wir nicht so gespalten sind, wie unsere Politiker uns glauben machen wollen, dass wir ein Volk sind, dass wir eine Nation sind. Zusammen werden wir ein neues großes Kapitel der amerikanischen Geschichte aufschlagen, mit drei Worten, die von Küste zu Küste erschallen werden, from sea to shining sea: Yes, we can.
Ein vollkommener Bund
Rede über Rassismus in Amerika
Philadelphia, 18. März 2008
… »Wir, das Volk, von der Absicht geleitet, unseren Bund zu vervollkommnen …« Vor 221 Jahren hat sich eine Gruppe von Männern in einem Saal – den es auf der gegenüberliegenden Straßenseite immer noch gibt – versammelt und mit diesen einfachen Worten Amerikas unwahrscheinliches Experiment in Sachen Demokratie begonnen. Bauern und Gelehrte, Staatsmänner und Patrioten, die den Ozean überquert hatten, um Tyrannei und Verfolgung zu entkommen, ließen schließlich ihre Unabhängigkeitserklärung auf dem Konvent in Philadelphia, der das ganz Frühjahr 1787 dauerte, Wirklichkeit werden.
Das Dokument, das sie verabschiedeten, war zwar unterschrieben, aber nicht abgeschlossen. Es war befleckt von der Erbsünde dieser Nation: der Sklaverei. Eine Frage, die die Kolonien spaltete und auch den Konvent zum Stillstand brachte, bis die Gründerväter schließlich beschlossen, den Sklavenhandel weitere 20 Jahre zu erlauben und eine Lösung einer zukünftigen Generation zu überlassen. Dabei enthielt die Verfassung bereits die Antwort auf die Frage der Sklaverei – eine Verfassung, in deren Mittelpunkt das Ideal der Gleichheit aller Bürger und Bürgerinnen vor dem Gesetz stand; eine Verfassung, die ihrem Volk Freiheit und Gerechtigkeit versprach und einen Bund, der sich mit der Zeit vervollkommnen sollte.
Doch die Worte auf dem Pergament reichten nicht aus, um die Sklaven von ihren Fesseln zu befreien oder Männern und Frauen unabhängig von ihrer Hautfarbe und Religion die vollen Bürgerrechte der Vereinigten Staaten zu verschaffen.
Es bedurfte vieler Amerikaner, die in jeder Generation bereit waren, durch Protest und Kampf auf den Straßen und in den Gerichtssälen, durch Bürgerkrieg und zivilen Ungehorsam und immer unter großem Risiko die Lücke zwischen den Versprechen unserer Ideale und der Realität ihrer Zeit zu schließen.
Es war eine der Aufgaben, die wir uns zu Beginn des aktuellen Wahlkampfes stellten: den langen Marsch derer fortzusetzen, die sich vor uns aufgemacht haben; den Marsch in ein gerechteres, gleicheres, freieres, sozialeres und wohlhabenderes Amerika. Ich habe mich entschieden, zu diesem historischen Zeitpunkt für das Präsidentenamt zu kandidieren, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir den Herausforderungen unserer Zeit nicht begegnen können, wenn wir es nicht gemeinsam tun. Unser Bund wird dann vollkommen sein, wenn wir begreifen, dass unsere Geschichten unterschiedlich sein mögen, wir aber dieselben Hoffnungen teilen; dass wir vielleicht verschieden aussehen und unterschiedlicher Herkunft sind, aber das Gleiche wollen: eine bessere Zukunft für unsere Kinder und Enkel …
Doch die Äußerungen, die jetzt diesen Sturm entfesselt haben, waren nicht bloß kontrovers. Sie lassen sich nicht abtun als der Versuch eines Kirchenvertreters [Pastor Jeremiah Wright, dessen Kirche Obama in Chicago besuchte und der u.a. die US-Regierung für Aids und den 11. September verantwortlich machte], sich gegen offensichtliche Ungerechtigkeit aufzulehnen. Im Gegenteil, sie sind der Ausdruck einer völlig verzerrten Sicht auf dieses Land; einer Sicht, die den weißen Rassismus für endemisch hält und Amerikas Mängel höher veranschlagt als alles, was wir an Amerika schätzen; einer Sicht, der zufolge die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten primär auf das Verhalten treuer Verbündeter wie Israel zurückzuführen sind und nicht etwa aus den perversen, hasserfüllten Ideologien des radikalen Islams hervorgehen.
Insofern waren Pastor Wrights Bemerkungen nicht nur falsch, sondern stiften Uneinigkeit in einer Zeit, wo Einigkeit nötig ist; sie waren aufgeladen mit rassischen Vorurteilen in einer Zeit, in der wir zusammenfinden müssen, um eine Reihe großer Probleme zu lösen – zwei Kriege, die Terrorismusgefahr, eine wankende Volkswirtschaft, die chronische Krise im Gesundheitswesen und einen Klimawandel mit womöglich verheerenden Folgen; lauter Probleme, die weder nur Schwarze noch Weiße, weder nur Asiaten noch Hispanics betreffen, sondern Probleme, die uns alle angehen. …
Ich glaube nicht, dass dieses Land es sich in diesem Moment leisten kann, die Rassenfrage zu ignorieren. …
Um die gegenwärtige Situation zu verstehen, ist es notwendig, uns daran zu erinnern, wie wir zu diesem Punkt gelangt sind. William Faulkner schrieb einmal: »Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen.« An dieser Stelle muss nicht noch einmal die Geschichte rassischen Unrechts in diesem Lande wiedergegeben werden. Aber wir sollten nicht vergessen, dass viele der Gegensätze, die es heute zwischen der afroamerikanischen Gemeinde und der übrigen amerikanischen Gesellschaft gibt, auf die Ungleichheiten zurückzuführen sind, die frühere Generationen erleiden mussten: das brutale Erbe der Sklaverei und eine gesetzlich verankerte Rassendiskriminierung.
Schulen nur für Schwarze waren und sind schlechtere Schulen, und selbst über 50 Jahre nach Brown versus Board of Education [der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 1954, die gesetzliche Rassentrennung aufzuheben] haben wir dieses Problem immer noch nicht gelöst. Die schlechtere Ausbildung, die man dort damals wie heute erhält, erklärt die fortwährende Diskrepanz zwischen den Lernerfolgen schwarzer und weißer Schüler und Studenten.
Gesetzlich abgesicherte Diskriminierung – als Schwarze daran gehindert wurden, Eigentum zu erwerben, und dies oft mit Gewalt; afroamerikanische Firmeninhaber keine Kredite erhielten; schwarze Hausbesitzer keine Hypotheken bei der Federal Housing Administration aufnehmen durften; Schwarze keine Gewerkschaftsmitglieder werden durften, keine Polizisten oder Feuerwehrleute – führte dazu, dass schwarze Familien nicht in der Lage waren, ein Vermögen zu erwirtschaften, das an die nächste Generation vererbt werden konnte. Diese Geschichte hilft, das Wohlstands- und Einkommensgefälle zwischen Schwarz und Weiß zu erklären sowie das Fortbestehen von Armenvierteln, die es bis heute in so vielen städtischen und ländlichen Gemeinden gibt.
Das Fehlen wirtschaftlicher Erfolgschancen für schwarze Männer sowie Scham und Frustration darüber, die eigene Familie nicht ernähren zu können, trugen zur Zerrüttung vieler schwarzer Familien bei – ein Problem, das durch Sozialhilfeleistungen möglicherweise noch verschlimmert wurde. Auch das Fehlen einer öffentlichen Infrastruktur in so vielen schwarzen Stadtvierteln – Kinderspielplätze, Polizeistreifen, regelmäßige Müllabfuhr und Bauaufsicht – hat dazu beigetragen, dass ein Teufelskreis aus Gewalttätigkeit, Passivität und Vernachlässigung entstand, den wir bis heute nicht durchbrechen konnten. …
Bemerkenswert ist nicht, wie viele angesichts der Diskriminierungen scheiterten, sondern vielmehr, wie viele Männer und Frauen diese Schwierigkeiten überwanden; wie viele es geschafft haben, Wege aus der Ausweglosigkeit zu finden – für diejenigen, die wie ich nach ihnen kommen würden.
Wenn es auch vielen mit Zähnen und Klauen gelang, sich wenigstens ein Stück vom American Dream zu erkämpfen – andere haben es nicht geschafft: Viele sind der Diskriminierung letztlich auf die eine oder andere Weise erlegen. Das Erbe dieser Niederlage lastet auf nachfolgenden Generationen, auf jenen jungen Männern und zunehmend auch jungen Frauen, die wir an Straßenecken herumlungern sehen oder die in unseren Gefängnissen dahinsiechen, ohne Hoffnung und Zukunftsaussichten. Selbst bei jenen Schwarzen, die es geschafft haben, prägt die Rassen- und Rassismusfrage von Grund auf ihre Sicht auf die Welt. Für die Männer und Frauen dieser Generation, der Pastor Wright angehört, sind weder die Erinnerungen an Demütigung, Zweifel und Angst noch der Zorn und die Bitterkeit jener Jahre einfach verschwunden.
Dieser Zorn wird vielleicht nicht öffentlich geäußert, in Gegenwart weißer Mitarbeiter oder Freunde. Aber beim Friseur oder am Küchentisch kommt er zu Wort. Manchmal wird dieser Zorn von Politikern ausgenutzt, die Rassenunterschiede hochspielen, um Stimmen zu gewinnen oder von eigenen Fehlleistungen abzulenken. Und manchmal äußert er sich am Sonntagmorgen in der Kirche, auf der Kanzel und in den Bankreihen. Dass so viele Leute überrascht sind, diesem Zorn in einigen der Predigten von Pastor Wright zu begegnen, erinnert uns an einen alten Allgemeinplatz: Am Sonntagmorgen findet man die von der Rassentrennung am meisten geprägte Stunde im amerikanischen Leben. Dieser Zorn ist nicht immer produktiv; oft lenkt er von der Lösung echter Probleme ab. Er hält uns davon ab, zu erkennen, welchen Anteil wir selbst an unserer Situation haben, und er hält die afroamerikanische Gemeinde davon ab, die Bündnisse zu schmieden, die es für einen echten Wandel braucht. Aber der Zorn ist real; er ist stark; und wenn man versucht, ihn einfach wegzuwünschen, ihn verdammt, ohne zu begreifen, woraus er erwächst, führt das nur dazu, die tiefe Kluft der Missverständnisse zwischen den Rassen noch zu vertiefen.
In Teilen der weißen Gemeinden gibt es eine ähnliche Wut. Viele weiße Amerikaner aus der Arbeiterklasse und der Mittelschicht haben nicht das Gefühl, aufgrund ihrer Hautfarbe besonders bevorzugt zu sein. Ihre Erfahrungen sind Erfahrungen von Einwanderern. Aus ihrer Sicht ist ihnen nie etwas geschenkt worden, sie haben alle bei null angefangen. Ihr Leben lang haben sie hart gearbeitet, nur um immer wieder zu erleben, wie ihre Arbeitsplätze ins Ausland verlegt werden oder nach all den Arbeitsjahren ihre Renten gekürzt wurden. Sie haben Angst vor der Zukunft und spüren, wie ihre Träume platzen. In einem Zeitalter stagnierender Löhne und globaler Konkurrenz scheinen sich Chancen in ein Nullsummenspiel verwandelt zu haben: Deine Träume gehen auf meine Kosten. Wenn man ihnen dann sagt, sie sollen ihre Kinder mit dem Bus in die Schule am anderen Ende der Stadt schicken; wenn sie hören, dass ein Afroamerikaner bevorzugt wird und einen guten Job oder einen Studienplatz in einem guten College bekommt, zum Ausgleich für Unrecht, das sie selbst gar nicht begangen haben; wenn man ihnen sagt, ihre Angst vor der Kriminalität im Viertel beruhe auf Vorurteilen, dann staut sich mit der Zeit Verbitterung auf.
Genau wie der Zorn innerhalb der schwarzen Gemeinde werden auch diese Ressentiments in einer zivilisierten Runde nicht offen geäußert. Aber seit mindestens einer Generation haben sie die politische Landschaft entscheidend mitgestaltet. Verärgerung über die Sozialhilfepolitik und den Affirmative Action halfen dabei, die Reagan-Koalition zu schmieden. Die Angst vor Kriminalität wird von Politikern gewohnheitsmäßig zu Wahlkampfzwecken genutzt. Manche Talkshow-Moderatoren und konservative Kommentatoren haben ihre Karriere darauf aufgebaut, indem sie unberechtigte Rassismusvorwürfe entlarvten und gleichzeitig berechtigte Kritik an rassenbedingter Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung als Political Correctness oder umgekehrten Rassismus abtaten.
Ebenso wie der schwarze Zorn sich oft als kontraproduktiv erwies, haben auch diese weißen Ressentiments davon abgelenkt, wer Schuld am Niedergang der Mittelschicht hat: eine Unternehmenskultur, in der Insidergeschäfte um sich greifen, fragwürdige Buchhaltungspraktiken, kurzfristige Gier; ein Washington, das von Lobbyisten und Partikularinteressen beherrscht ist; eine Wirtschaftspolitik, welche die wenigen gegenüber der Mehrheit begünstigt. Jetzt die weißen Ressentiments zu verdammen, sie irregeleitet oder gar rassistisch zu nennen, ohne anzuerkennen, dass sie aus berechtigten Sorgen erwachsen sind, vertieft ebenfalls die Spaltung zwischen den Rassen und blockiert den Pfad zur Verständigung.
Genau an diesem Punkt stehen wir jetzt. Seit Jahren stecken wir in einem »Patt« zwischen den Rassen fest. Anders als einige meiner Kritiker, schwarze wie weiße, behaupten, war ich nie so naiv zu glauben, wir könnten unsere Rassengegensätze im Zuge eines einzigen Wahlkampfes oder durch einen einzigen Kandidaten überwinden – zumal wenn die Kandidatur so wenig perfekt ist wie meine.
Aber ich stehe zu meiner festen Überzeugung – einer Überzeugung, die in meinem Glauben an Gott und in meinem Glauben an das amerikanische Volk wurzelt: Wenn wir zusammenarbeiten, können wir über einige unserer alten Wunden aus der Rassenspaltung hinwegkommen, und letztlich haben wir keine andere Wahl – keine andere Wahl, wenn wir dem Weg zu einem vollkommeneren Bund weiter folgen.
Dieser Weg bedeutet für die afroamerikanische Gemeinde, die Bürde der Vergangenheit auf sich zu nehmen, ohne ein Opfer der Vergangenheit zu sein. Er bedeutet weiter, darauf zu bestehen, dass Gerechtigkeit auf jeden Aspekt des amerikanischen Lebens angewandt wird. Aber er bedeutet auch, dass wir unsere spezifischen Sorgen – bessere Gesundheitsversorgung, bessere Schulen und bessere Jobs – mit den weiter reichenden Bestrebungen aller Amerikaner in Einklang bringen: mit denen der weißen Frau, die versucht, die »gläserne Decke« zu durchbrechen; mit denen eines weißen Mannes, der seine Arbeit verloren hat; eines Einwanderers, der seine Familie zu ernähren versucht. Und er bedeutet, dass wir die volle Verantwortung für unser Leben übernehmen. Indem wir mehr von Vätern verlangen, mit unseren Kindern mehr Zeit verbringen, ihnen vorlesen und ihnen vermitteln, dass sie, wenn sie selbst Schwierigkeiten und Diskriminierungen erleben, niemals verzweifeln oder dem Zynismus verfallen dürfen. Sie müssen stets an der Zuversicht festhalten, dass sie ihr Schicksal selbst bestimmen können.
Paradoxerweise entspricht das der uramerikanischen – und, in der Tat, konservativen – Idee der Selbsthilfe, die in den Predigten von Pastor Wright so häufig zum Ausdruck kommt. Allerdings sieht mein früherer Pastor häufig nicht, dass der eingeschlagene Weg der Selbsthilfeprogramme voraussetzt, dass man auch an die Wandlungsfähigkeit einer Gesellschaft glaubt.
Der grundlegende Fehler in Pastor Wrights Predigten besteht nicht darin, dass er den Rassismus in unserer Gesellschaft angesprochen hat. Der Fehler besteht darin, dass er so sprach, als ob unsere Gesellschaft statisch wäre, als hätte es keinen Fortschritt gegeben, als wäre dieses Land – ein Land, das es einem seiner eigenen Gemeindemitglieder ermöglicht hat, sich um das höchste Amt im Staate zu bewerben und eine Koalition aus Weiß und Schwarz zu schmieden, aus Hispanics und Asiaten, Reich und Arm, Jung und Alt – als wäre dieses Land dennoch unwiderruflich einer tragischen Vergangenheit verhaftet. Was wir aber wissen und was wir gesehen haben: Amerika kann sich wandeln.
Das ist das wahre Genie dieser Nation. Was wir schon erreicht haben, gibt uns Hoffnung – das Wagnis der Hoffnung – für all das, was wir morgen erreichen können und müssen.
Der Weg hin zu einem vollkommeneren Bund bedeutet für die weiße Gemeinde anzuerkennen, dass die Schmerzen der afroamerikanischen Gemeinde nicht nur in den Köpfen der Schwarzen existieren; dass das Erbe der Diskriminierung gegenwärtig ist – bis heute gibt es Fälle von Diskriminierung, wenn auch weniger offen –, dass diese Dinge real sind und offen angesprochen werden müssen. Nicht nur in Worten, sondern in Taten – durch Investitionen in unsere Schulen und unsere Gemeinden; durch konsequente Anwendung unserer Bürgerrechtsgesetze und eine faire Strafjustiz; dass dieser Generation Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet werden, die es für frühere Generationen nicht gab. Es erfordert, dass alle Amerikaner begreifen: Deine Träume müssen nicht auf Kosten meiner Träume gehen. Investitionen ins Gesundheitswesen, das Sozialsystem und in die Bildung für schwarze, braune und weiße Kinder kommen letztlich ganz Amerika zugute.
Letzten Endes geht es also um nicht mehr und nicht weniger als um das, was alle großen Weltreligionen fordern: dass wir andere so behandeln, wie wir selbst von ihnen behandelt werden möchten. Lasst uns unseres Bruders Hüter sein, wie die Heilige Schrift lehrt. Seien wir die Hüter unserer Schwester. Lasst uns uns aufeinander verlassen und dafür sorgen, dass dieser Geist auch die Politik erfüllt. …
Hier fangen wir an. Hier wird unser Bund stärker. Und wie im Laufe der 221 Jahre, seitdem einige Patrioten in Philadelphia jenes Dokument unterzeichneten, so viele Generationen erfahren haben: Hier beginnt der Weg der Vervollkommnung.
Jetzt ist unsere Zeit
Rede über die Zusammenarbeit zwischen Europa und Amerika
Berlin, 24. Juli 2008
… Ich weiß, dass ich nicht so aussehe wie die Amerikaner, die vor mir in dieser großartigen Stadt Reden gehalten haben. Eigentlich war es unwahrscheinlich, dass ich jemals hierher reisen würde. Meine Mutter wurde zwar im Herzen Amerikas geboren, aber mein Vater wuchs als Ziegenhirte in Kenia auf. Sein Vater – mein Großvater – war Koch und Hausdiener bei den Briten.
Mitten im Kalten Krieg wurde mein Vater – wie so viele andere in den vergessenen Winkeln der Welt – von einer Sehnsucht ergriffen und träumte von Freiheit und Entwicklungsmöglichkeiten, wie sie nur der Westen versprach. Und so schrieb er einen Brief nach dem anderen an Universitäten in ganz Amerika, bis eines Tages jemand sein Gebet für ein besseres Leben erhörte.
Darum bin ich heute hier. Und Sie sind hier, weil auch Sie diese Sehnsucht kennen. Diese Stadt verkörpert den Traum von der Freiheit besser als alle anderen Städte. Und Sie alle wissen, dass wir nur deshalb heute Abend hier versammelt sind, weil Männer und Frauen unserer beiden Nationen für dieses bessere Leben gemeinsam gearbeitet, gekämpft und sich aufgeopfert haben.
Genau genommen begann unsere Partnerschaft im Sommer vor 60 Jahren, an dem Tag, als das erste amerikanische Flugzeug in Tempelhof landete.
An diesem Tag lag ein Großteil dieses Kontinents noch in Trümmern. Der Schutt dieser Stadt war noch nicht zu einer Mauer geworden. Der Schatten der Sowjets legte sich auf Osteuropa, während im Westen Amerika, Großbritannien und Frankreich ihre Verluste zählten und überlegten, wie die Welt wiederhergestellt werden könnte.
Hier, an diesem Ort, trafen die beiden Seiten aufeinander. Am 24. Juni 1948 entschieden sich die Kommunisten, den Westteil der Stadt zu blockieren. In dem Versuch, die letzte Flamme der Freiheit in Berlin zu ersticken, schnitten sie mehr als zwei Millionen Deutsche von Nahrung und sonstiger Versorgung ab.
Unsere Streitkräfte waren nicht stark genug, um gegen die viel größere Sowjetarmee aufzumarschieren. Ein Rückzug hätte den Kommunisten jedoch den Weg nach Europa geöffnet. Wo der letzte Krieg geendet hatte, hätte leicht ein neuer Weltkrieg entstehen können. Nur Berlin stand damals im Weg. In dieser Situation entstand die Luftbrücke, die mit der größten und unwahrscheinlichsten Rettungsaktion der Geschichte den Menschen dieser Stadt Nahrung und Hoffnung brachte. Alles sprach gegen einen Erfolg. Im Winter lag dichter Nebel über der Stadt, und viele Flugzeuge mussten umkehren, ohne die dringend benötigten Vorräte entladen zu können. Durch die Straßen, in denen wir jetzt stehen, liefen hungernde Familien, die keinen Schutz vor der Kälte hatten.
Aber auch in den dunkelsten Stunden ließen die Menschen in Berlin die Flamme der Hoffnung nicht erlöschen. Das Volk von Berlin weigerte sich aufzugeben. Und an einem Herbsttag kamen Hunderttausende Berliner hier in den Tiergarten und hörten dem Bürgermeister der Stadt zu, als er die Welt beschwor, die Freiheit nicht aufzugeben: »Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle«, sagte er, »gemeinsam so lange zusammenzustehen, bis dieser Kampf gewonnen ist. … Das Volk von Berlin hat gesprochen. Wir haben unsere Pflicht getan, und wir werden unsere Pflicht weiter tun. Völker der Welt: Tut auch ihr eure Pflicht … Völker der Welt, schaut auf Berlin!«
Schaut auf Berlin, wo Deutsche und Amerikaner lernten, zusammenzuarbeiten und einander zu trauen – weniger als drei Jahre nachdem sie einander auf dem Schlachtfeld gegenübergestanden hatten.
Schaut auf Berlin, wo die Entschlossenheit eines Volkes auf die Großzügigkeit des Marshallplans traf und das Wirtschaftswunder ermöglichte, wo der Sieg über eine Tyrannei die NATO, die großartigste Allianz, die je zur Verteidigung unserer gemeinsamen Sicherheit geschaffen wurde, entstehen ließ.
Schaut auf Berlin, wo die Einschusslöcher in den Gebäuden, den dunklen Steinen und in den Säulen nahe dem Brandenburger Tor uns immer daran erinnern, unsere gemeinsame Menschlichkeit nie mehr zu vergessen.
Völker der Welt – schaut auf Berlin, wo eine Mauer gefallen ist und ein Kontinent vereinigt wurde und wo die Geschichte uns den Nachweis geliefert hat, dass für eine Welt, die zusammenhält, keine Herausforderung zu groß ist.
60 Jahre nach der Luftbrücke sind wir wieder gefordert. Die Geschichte hat uns an einen neuen Scheideweg geführt – mit neuen Perspektiven und neuen Risiken. Als das deutsche Volk diese Mauer niederriss – eine Mauer, die Ost und West, Freiheit und Tyrannei, Angst und Hoffnung trennte –, stürzten auf der ganzen Welt Mauern ein. Von Kiew bis Kapstadt wurden Gefangenenlager geschlossen und Türen zur Demokratie geöffnet. Auch Märkte öffneten sich, und die Verbreitung von Informationen und Technologien beseitigte Hindernisse auf dem Weg zu Entwicklung und Wohlstand. Während uns das 20. Jahrhundert lehrte, dass wir ein gemeinsames Schicksal teilen, müssen wir im 21. Jahrhundert erkennen, dass die Welt so verflochten ist wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit.
Der Fall der Berliner Mauer weckte neue Hoffnungen. Aber die große Nähe ließ auch neue Gefahren entstehen – Gefahren, die weder innerhalb der Grenzen eines einzelnen Landes eingedämmt noch durch die Weite eines Ozeans begrenzt werden können. Die Terroristen des 11. Septembers verschworen sich in Hamburg und trainierten in Kandahar und Karatschi, bevor sie auf amerikanischem Boden Tausende von Menschen aus allen Teilen der Welt töteten.
Während ich hier stehe, lassen die Abgase der Autos in Boston und der Fabriken in Peking die Eiskappe der Arktis schmelzen, überflutet der Atlantik weite Küstengebiete und leiden Farmen von Kansas bis Kenia unter Trockenheit.
Das schlecht gesicherte nukleare Material aus der früheren Sowjetunion oder geheime Baupläne eines Naturwissenschaftlers aus Pakistan könnten den Bau einer Bombe ermöglichen, die in Paris explodiert. Aus den Mohnfeldern in Afghanistan wird das Heroin für Berlin gewonnen. Armut und Gewalt in Somalia zeugen die Terroristen von morgen. Der Völkermord in Darfur belastet unser aller Gewissen.
In dieser neuen Welt haben sich gefährliche Strömungen viel schneller ausgebreitet als unsere Anstrengungen, sie einzudämmen. Deshalb können wir es uns nicht leisten, gespalten zu sein. Keine Nation – gleichgültig wie groß und mächtig sie auch sei – kann diese Herausforderungen allein bewältigen. Niemand von uns kann die Bedrohungen leugnen oder sich der Verantwortung entziehen, ihnen zu begegnen. Weil die sowjetischen Panzer und eine schreckliche Mauer verschwunden sind, lässt man sich leicht täuschen und vergisst diese Wahrheiten. Und wenn wir ehrlich miteinander sind, müssen wir eingestehen, dass wir manchmal auf beiden Seiten des Atlantiks auseinandergedriftet sind und unser gemeinsames Schicksal vergessen haben.