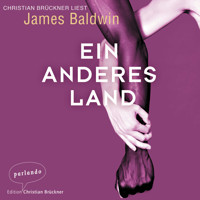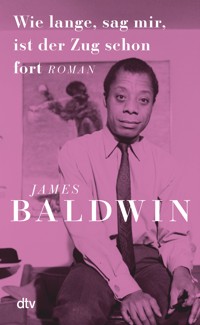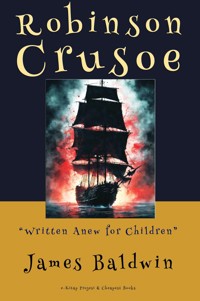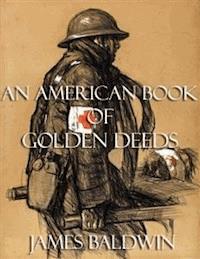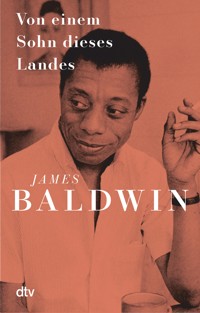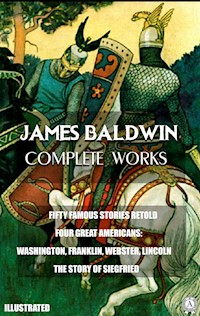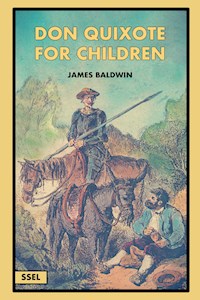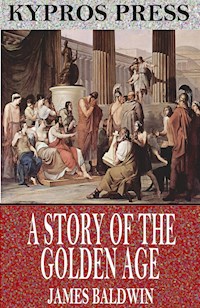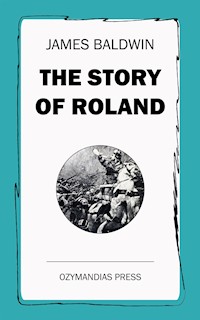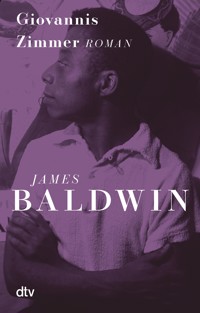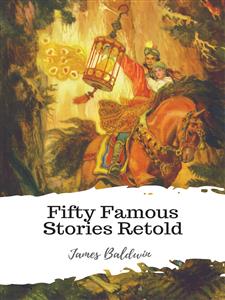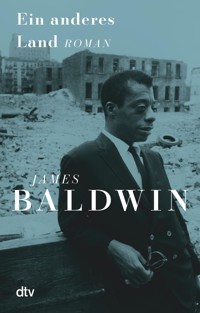
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Baldwins explizitester, leidenschaftlichster Roman Warum hat Rufus Scott – ein begnadeter schwarzer Jazzer aus Harlem – sich das Leben genommen? Wegen seiner Amour fou mit der weißen Leona, einer Liebe, die nicht sein durfte? Verzweifelt sucht Rufus' Schwester Ida nach einer Erklärung. Aber sie findet nur Wahrheiten, die neue Wunden schlagen, – auch über sich selbst. Wie ihr Bruder war Ida lange bereit, sich selbst zu verleugnen, um ihren Traum zu verwirklichen, den Traum, Sängerin zu werden. Wie ihr Bruder hat sie ihre Wut auf die Weißen, die sie diskriminieren. Bis jetzt. Baldwin verwickelt uns in ein gefährliches Spiel von Liebe und Hass – vor der Kulisse eines Amerikas, das sich selbst in Trümmer legt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Nach dem Tod ihres Bruders Rufus sucht seine Schwester Ida verzweifelt nach Antworten: Warum hat sich Rufus das Leben genommen? Wegen seiner Amour fou zur weißen Leona, einer Liebe, die nicht sein durfte? Ida stößt auf Wahrheiten über sich selbst und über Rufus' Freunde, die weißen Bohemiens aus Greenwich Village. Ida bewegt sich bald in ihren Kreisen, singt in den Bars, in denen einst Rufus spielte, und die Wut auf die weiße Umwelt, an der ihr Bruder zugrunde ging, lässt sich nicht mehr unterdrücken.
Baldwin verwickelt die Leser:innen in ein gefährliches Spiel von Liebe und Hass – vor der Kulisse eines Amerika, das sich selbst in Trümmer legt. Ein anderes Land avancierte 1962 gleich nach Erscheinen zum Bestseller. Heute gilt das Buch als Baldwins explizitester und leidenschaftlichster Roman.
Von James Baldwin ist bei dtv außerdem lieferbar:
Von dieser Welt
Beale Street Blues
Nach der Flut das Feuer
Giovannis Zimmer
Von einem Sohn dieses Landes
James Baldwin
Ein anderes Land
Roman
Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow
Mit einem Nachwort von René Aguigah und einer Nachbemerkung der Übersetzerin
Für Mary S. Painter
Sie erwecken vornehmlich den Eindruck, als gäben sie mit keinerlei jemals von menschlichem Gebrauch geheiligten Mitteln über sich selbst Auskunft; so stellen sie als Gemeinschaft ein wohl beispielloses Monument der Sprachlosigkeit dar; unergründlich das Rätsel, was sie denken, was sie fühlen, was sie wünschen, was sie zu sagen meinen.
Henry James
Erstes BuchEASY RIDER
I told him, easy riders
Got to stay away,
So he had to vamp it,
But the hike ain’t far.
W.C. Handy
1
Er stand am Times Square, vor sich die Seventh Avenue. Es war nach Mitternacht, und er hatte seit zwei Uhr nachmittags im Kino gesessen, in der letzten Reihe im Rang. Zwei Mal hatten ihn die hitzigen Stimmen des italienischen Films geweckt, ein Mal der Platzanweiser, und zwei Mal war er von Raupenfingern zwischen seinen Schenkeln wach geworden. Er war so müde, er war so tief gesunken, dass er nicht mal die Energie aufbrachte, wütend zu werden; er gehörte sich nicht mehr – you took the best, so why not take the rest? Aber geknurrt hatte er im Schlaf, die weißen Zähne in seinem dunklen Gesicht gefletscht und die Beine übergeschlagen. Dann hatte sich der Rang geleert, der italienische Film steuerte auf einen Höhepunkt zu, und er war die endlosen Stufen hinunter zur Straße gewankt. Er hatte Hunger, einen pelzigen Geschmack im Mund. Auf dem Weg durch die Tür, zu spät, merkte er, dass er mal musste. Und er war pleite. Und er wusste nicht, wohin.
Ein Polizist ging misstrauisch an ihm vorbei. Rufus drehte sich um, schlug den Kragen seiner Lederjacke hoch, als der Wind sich genüsslich durch seine Sommerhose nagte, und wandte sich auf der Seventh Avenue nach Norden. Er hatte überlegt, Richtung Downtown zu gehen und Vivaldo zu wecken – den einzigen Freund, den er noch hatte in der Stadt oder vielleicht sogar auf der Welt –, dann aber beschlossen, zu einer Jazzbar hochzulaufen. Vielleicht erkannte ihn dort jemand, vielleicht ließ einer was springen, für eine Mahlzeit oder zumindest für die Subway. Gleichzeitig hoffte er, nicht erkannt zu werden.
Die Avenue lag still, die meisten Lichter waren aus. Hier und da ging eine Frau vorbei, hier und da ein Mann; selten ein Paar. An Straßenecken, unter den Laternen, nahe den Drugstores standen schnatternd Weiße beisammen, lächelten aufeinander ein, pfiffen nach Taxis und eilten davon, verschwanden in Läden oder dunklen Seitenstraßen. Zeitungskioske hielten, wie kleine schwarze Spielsteine auf einem Brett, Ecken der Bürgersteige besetzt, davor stampften Polizisten, Taxifahrer und andere, die schwer einzuordnen waren, mit den Füßen und wechselten wenige vertraute Worte mit dem eingemummten Verkäufer. Eine Leuchtreklame warb für Kaugummi, der Lockerheit und Lächeln garantierte. Der riesige Neon-Name eines Hotels forderte den sternlosen Himmel heraus, ebenso die Namen von Filmstars und Theatergrößen, die derzeit oder demnächst am Broadway zu bewundern waren, neben den meilenhohen Namenszügen jener Inszenierungen, die sie in die Unsterblichkeit befördern würden. Lichtlose hohe Gebäude, stumpf wie ein Phallus oder spitz wie ein Speer, bewachten die Stadt, die niemals schlief.
Unten ging Rufus, einer der Gefallenen – das Gewicht dieser Stadt war mörderisch –, einer von denen, die erdrückt wurden an jenem Tag, an jedem Tag, da die Türme fielen. So allein, dass er daran zugrunde ging, gehörte er zu einer nie dagewesenen Masse. Junge Männer und Frauen, die an den Tresen der Drugstores vor ihrem Kaffee saßen, waren von Rufus’ Schicksal nur durch einen Hauch getrennt, der so vergänglich war wie ihre verglühenden Zigaretten. Das zu wissen ertrugen sie kaum, auch Rufus’ Anblick hätten sie nicht ertragen, aber sie wussten, warum er heute Nacht auf der Straße war, warum er die ganze Nacht Subway fuhr, warum sein Magen knurrte, sein Haar verfilzt war, seine Achseln miefig, Hose und Schuhe zu dünn; und warum er sich nicht zum Pinkeln reintraute.
Jetzt stand er vor dem diesigen Eingang des Jazzclubs, spähte hinein und sah, ohne wirklich etwas zu erkennen, die entrückten schwarzen Musiker auf der Bühne und die arglose gemischte Menge an der Bar. Die Musik war laut und leer und wurde der Menge entgegengeschleudert wie ein Fluch, an den nicht mal die Hasserfülltesten noch glaubten. Die Musiker wussten, dass keiner zuhörte, dass man blutleere Menschen nicht bluten lassen kann. Also bliesen sie, was alle schon gehört hatten, und versicherten allen, dass nichts Schlimmes geschah. An den Tischen überbrüllten die Menschen zufrieden diese famose Bestätigung, und an der Bar gingen die Menschen im Schutz des Lärms, ohne den sie kaum hätten leben können, ihren Geschäften nach. Er wollte reingehen und die Toilette benutzen, aber er schämte sich, so gesehen zu werden. Er versteckte sich schon fast einen Monat lang. Und jetzt, als er draußen dastand, sah er sich selbst durch diese Menge zum Klo schlurfen und wieder rauskriechen, während man ihm voller Mitleid, Verachtung oder Hohn nachblickte. Irgendjemand würde bestimmt flüstern: Ist das nicht Rufus Scott? Irgendjemand würde ihn entsetzt ansehen und sich mit einem mitleidig gedehnten Mann! wieder seinen Angelegenheiten zuwenden. Er schaffte es nicht – er tänzelte von einem Fuß auf den anderen, und Tränen traten ihm in die Augen.
Ein weißes Pärchen kam lachend aus dem Club und bemerkte ihn im Vorbeigehen kaum. Die Wärme, der Geruch von Menschen, Whiskey, Bier und Rauch, die ihm durch die offene Tür entgegenschlugen, ließen ihn beinahe laut aufheulen, und sein leerer Magen knurrte wieder.
Er erinnerte sich an Tage und Nächte, Tage und Nächte, da er dort drinnen gewesen war, auf der Bühne oder in der Menge, cool und geliebt, wie er bei Frauen und auf Partys landete, sich betrank oder high mit den Musikern alberte, die seine Freunde waren, die ihn respektierten. Und irgendwann bei sich zu Hause die Tür zumachte, die Schuhe auszog, sich vielleicht was einschenkte, vielleicht Platten hörte, sich auf dem Bett ausstreckte, vielleicht eine Frau anrief. Die Unterwäsche wechselte, seine Socken und das Hemd, sich rasierte, duschte und nach Harlem fuhr zum Friseur und um seine Mutter und seinen Vater zu besuchen und seine Schwester Ida zu ärgern und um zu essen: Spareribs oder Porkchops oder Gemüse oder Maisbrot oder Yams oder Biscuits. Kurz war ihm, als würde er ohnmächtig vor Hunger, und er stützte sich an einer Mauer ab. Eiskalter Schweiß stand ihm auf der Stirn. Das muss aufhören, Rufus, dachte er. Diese Scheiße muss aufhören. Vor Überdruss und Leichtsinn, da niemand auf der Straße war und hoffentlich auch keiner zur Tür rauskam, ließ er seinen Urin aufs steinkalte Pflaster prasseln, dass leichter Dampf aufstieg.
Er erinnerte sich an Leona. Oder wurde plötzlich von einer kalten, vertrauten Übelkeit ergriffen und wusste, dass er sich an Leona erinnerte. Langsam entfernte er sich von der Musik, die Hände in den Taschen, mit gesenktem Kopf. Die Kälte spürte er nicht mehr.
Sich an Leona zu erinnern hieß irgendwie auch, sich an die Augen seiner Mutter zu erinnern, den Zorn seines Vaters, die Schönheit seiner Schwester. Hieß, sich an die Straßen von Harlem zu erinnern, die Jungs auf den Eingangsstufen, die Mädchen hinter den Feuertreppen und auf den Dächern, an den weißen Polizisten, der ihn das Hassen gelehrt hatte, die Stickball-Spiele auf der Straße, die Frauen, die im Fensterrahmen lehnten, die Zahlen, auf die sie täglich tippten in der Hoffnung auf jenen Jackpot, den sein Vater nie geknackt hatte. Hieß, sich an die Jukebox zu erinnern, das Flirten, das Tanzen, den Steifen, Gangfights und Orgien, sein erstes Schlagzeug – ein Geschenk seines Vaters –, seinen ersten Zug Marihuana, seine erste Nase Heroin. Ja: und an die Jungs, die zu weit gegangen waren und sich auf den Stufen ein Klappmesser einfingen, an den einen, der auf dem schneebedeckten Dach an einer Überdosis starb. Es hieß, sich an den Beat zu erinnern: Ein Nigger, sagte sein Vater, lebt sein ganzes Leben nach einem Beat, lebt und stirbt nach diesem Beat, Scheiße, fickt nach diesem Beat, und das Baby, das er da reinschießt, das hüpft danach, und neun Monate später kommt es raus wie ein verdammtes Tamburin. Der Beat: Hände, Füße, Tamburin, Drums, Piano, Lachen, Fluchen, Rasierklingen; der Mann wird hart mit einem Lachen, einem Brummen, einem Schnurren, die Frau wird feucht und weich mit einem Flüstern, einem Seufzen, einem Schrei. Der Beat – im Sommer konnte man ihn fast sehen in Harlem, über dem Asphalt, über den Dächern.
Rufus war vor diesem Beat geflohen, so dachte er, vor dem Beat von Harlem, der doch nur der Schlag seines eigenen Herzens war. In die Rekrutenausbildung im Süden und raus aufs offene Meer.
Noch während seiner Zeit in der Navy hatte er Ida von einer seiner Reisen einen indischen Schal mitgebracht. Er hatte ihn irgendwo in England gekauft. An dem Tag, als er ihn ihr gab und sie ihn anprobierte, rührte sich etwas in ihm: Noch nie hatte er die Schönheit schwarzer Menschen wahrgenommen. Doch als Ida vor diesem Küchenfenster in Harlem stand und er in ihr nicht mehr nur die kleine Schwester sah, sondern ein Mädchen, das bald schon zur Frau würde, verschmolz sie mit den Farben des Schals, den Farben der Sonne, mit einem Glanz, der so unermesslich viel älter war als der graue Stein jener Insel, auf der sie geboren waren. Vielleicht würde dieser Glanz eines Tages in die Welt zurückkehren, in die Welt, die sie kannten. Vor Ewigkeiten war Ida nicht bloß ein Abkömmling von Sklaven gewesen. In ihrem dunklen Gesicht, von der Sonne beschienen und von dem prachtvollen Schal sanft beschattet, erkannte er jetzt, dass sie einst eine Herrscherin gewesen war. Er sah aus dem Fenster, in den Luftschacht, und dachte plötzlich an die Huren der Seventh Avenue. Er dachte an die weißen Polizisten und das Geld, das sie mit schwarzem Fleisch verdienten, das Geld, das die ganze Welt verdiente.
Er sah wieder seine Schwester an. Lächelnd drehte sie an ihrem schlanken kleinen Finger den rubinäugigen Schlangenring, den er ihr von einer anderen Reise mitgebracht hatte.
»Wenn du so weitermachst«, sagte sie, »bin ich bald das bestgekleidete Mädchen vom ganzen Block.«
Zum Glück konnte Ida ihn jetzt, hier auf der Straße, nicht sehen. Mein Gott, Rufus, hätte sie gesagt, du hast kein Recht, so rumzulaufen. Weißt du nicht, dass wir auf dich zählen?
Vor sieben Monaten, eine Ewigkeit her, hatte er in einem der neuen, von einem schwarzen Inhaber geführten Harlemer Clubs einen Gig gespielt. Es war ihr letzter Abend gewesen, ein guter Abend, alle waren gut drauf. Nach dem Gig würden die meisten von ihnen noch weiterziehen, zu einem berühmten schwarzen Sänger nach Hause, der es gerade in einen Film geschafft hatte. Weil der Laden neu war, platzte er aus allen Nähten. In letzter Zeit, hatte Rufus gehört, lief er nicht mehr so gut. Alle möglichen Leute waren da, weiß und schwarz, reich und arm, Leute, die gekommen waren, um die Musik zu hören, und Leute, die aus anderen Gründen ihr Leben in Bars und Clubs zubrachten. Ein paar Nerze waren dabei, ein paar unechte auch und Gott weiß was für Geglitzer an Handgelenken und Ohren und Hälsen und Haar. Die Schwarzen fühlten sich wohl, weil sie aus welchem Grund auch immer die Menge hinter sich wussten, und die Weißen fühlten sich wohl, weil niemand ihnen vorwarf, weiß zu sein. ›The Joint is Jumping‹, hätte Fats Waller gesagt.
Pot machte die Runde, und Rufus war schon ein bisschen high. Er fühlte sich blendend. Und im letzten Set wurde er hellwach. Der Saxophonist, der schon den ganzen Abend in anderen Sphären spielte, legte ein Wahnsinnssolo hin. Der Junge war ungefähr in Rufus’ Alter und stammte aus einem abseitigen Kaff wie Jersey City oder Syracuse, hatte aber irgendwann erkannt, dass er das, was er sagen wollte, mit seinem Saxophon sagen konnte. Und das war eine Menge. Breitbeinig stand er da mit seinen paarundzwanzig Jahren, zitternd in seinen Klamotten, und trieb es mit der Luft, blies seine breite Brust auf und brüllte durchs Saxophon: Liebt ihr mich? Liebt ihr mich? Liebt ihr mich? Und noch mal: Liebt ihr mich? Liebt ihr mich? Liebt ihr mich? Das jedenfalls war die Frage, die Rufus hörte, der immergleiche Satz, unerträglich, unendlich, in etlichen Variationen, mit der ganzen Kraft, die in dem jungen Mann steckte. Stille senkte sich scharf auf die Zuhörer, jähe Aufmerksamkeit; Zigaretten wurden ausgedrückt, Drinks stehen gelassen, und alle Gesichter, selbst die ganz stumpfen und verlebten, leuchteten neugierig auf, wachsam. Die Zuhörer wurden attackiert von einem Saxophonisten, der ihre Liebe vielleicht gar nicht mehr wollte und ihnen nur noch seinen Zorn entgegenschleuderte, mit demselben verächtlichen, gottlosen Stolz, mit dem er die Luft bestieg. Und doch war die Frage furchtbar und echt; der Junge blies mit Lunge und Bauch aus seiner kurzen Vergangenheit heraus – irgendwo in dieser Vergangenheit, in der Gosse, in Gangfights oder Gangsex, im ranzigen Zimmer, auf den spermasteifen Laken, hinter Marihuana oder Nadel, unter dem Pissegestank im Keller des Polizeireviers war in ihm der Druck entstanden, den er nie wieder loswerden würde, und das wollte ihm keiner glauben. Liebt ihr mich? Liebt ihr mich? Liebt ihr mich? Die Männer auf der Bühne blieben bei ihm, unbeirrt und leicht zurückgenommen, fügten an, fragten nach, stimmten zu, fingen ihn auf mit spöttischer Selbstironie, so gut sie konnten; doch wusste jeder von ihnen, dass der Junge für sie alle blies. Am Ende des Sets waren sie schweißnass. Rufus roch seinen Körper und die der anderen Männer; »das war’s«, sagte der Bassist. Die Menge brüllte nach einer Zugabe, doch nach dem Schlussthema ging das Licht an. Und Rufus hatte das letzte Set seines letzten Gigs gespielt.
Bis Montagnachmittag würde er sein Drumset stehen lassen. Als er von der Bühne trat, stand ihm eine sehr schlicht gekleidete blonde Frau gegenüber.
»Was läuft, Baby?«, fragte er. Um sie herum waren alle damit beschäftigt, in Richtung Party weiterzuziehen. Es war Frühling, etwas lag in der Luft.
»Was läuft bei dir?«, gab sie zurück, aber nur, weil sie ganz offensichtlich nicht wusste, was sie sonst sagen sollte.
Sie hatte genug gesagt. Sie stammte aus dem Süden. Und Rufus durchzuckte es, als er ihr farbloses klammes Gesicht betrachtete, das Gesicht der armen weißen Südstaatlerin, und ihr bleiches glattes Haar. Sie war deutlich älter als er, über dreißig vermutlich, und hatte einen zu dürren Körper. Dennoch wurde er auf der Stelle zum aufregendsten Körper, den er seit Langem gesehen hatte.
»Honeychild«, sagte er mit seinem schiefen Lächeln, »bist du nicht elend weit weg von zu Hause?«
»Allerdings«, sagte sie, »und nie wieder geh ich dorthin zurück.«
Beide lachten. »Na schön, Miss Anne«, sagte er, »wenn bei dir dasselbe läuft wie bei mir, gehen wir doch zusammen auf die Party.«
Er nahm ihren Arm, sodass sein Handrücken ihre Brust streifte, und fragte: »Du heißt gar nicht Anne, oder?«
»Nein«, sagte sie, »Leona.«
»Leona?« Er lächelte wieder. Sein Lächeln konnte sehr einnehmend sein. »Was für ein schöner Name.«
»Und wie heißt du?«
»Ich? Rufus Scott.«
Er fragte sich, was sie in diesem Laden machte, was sie in Harlem machte. Sie wirkte nicht so, als würde sie sich für Jazz interessieren, und schon gar nicht so, als würde sie normalerweise allein in Bars gehen. Sie trug einen leichten Frühlingsmantel, ihr langes Haar war zurückgekämmt und hinten festgesteckt; von einer Spur Lippenstift abgesehen war sie ungeschminkt.
»Komm«, sagte er, »schnappen wir uns ein Taxi.«
»Ist es auch wirklich in Ordnung, wenn ich mitkomme?«
Er atmete scharf ein. »Sonst würde ich dich nicht mitnehmen. Wenn ich sage, es ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung.«
»Na gut«, sagte sie mit einem Lachen, »in Ordnung.«
Sie folgten der Menge, die mit vielen Unterbrechungen, mit viel Reden und Lachen und erotischem Gewühl auf die Straße strömte. Es war drei Uhr morgens, und ringsum pfiff das schicke Glitzervolk alle verfügbaren Taxis heran. Andere, deutlich weniger schicke – sie befanden sich am westlichen Ende der 125th Street – standen pulkweise an der Straße und wippten, schlurften oder stolzierten vorüber mit verstohlenen oder offenen Blicken, die eher berechnend waren als neugierig. Polizisten schlenderten vorbei; unauffällig ließen sie durchblicken, dass diese Schwarzen, obwohl so spät noch auf der Straße und mehrheitlich betrunken, nicht auf die übliche Weise zu behandeln waren und die Weißen in ihrer Begleitung auch nicht. Rufus wurde auf einmal klar, dass Leona demnächst weit und breit die einzige Weiße sein würde. Das beunruhigte ihn, und seine Unruhe war ihm lästig. Leona winkte ein leeres Taxi heran.
Der weiße Fahrer schien ohne Zögern für sie anzuhalten.
»Musst du morgen arbeiten?«, fragte Rufus Leona. Jetzt, da sie allein waren, wurde er etwas verlegen.
»Nein«, sagte sie, »morgen ist Sonntag.«
»Ach ja.« Das gefiel ihm. Eigentlich hatte er seine Familie besuchen wollen, aber was für ein Fest wäre es, den Tag mit Leona im Bett zu verbringen. Er warf ihr einen Blick zu; sie war zwar zierlich, aber offenbar sehr gut gebaut. Was ihr wohl durch den Kopf ging? Er bot ihr eine Zigarette an und legte dabei flüchtig seine Hand auf ihre; sie lehnte ab.
»Rauchst du nicht?«
»Doch, manchmal. Wenn ich trinke.«
»Und kommt das oft vor?«
Sie lachte. »Nein. Ich trink nicht gern alleine.«
»Also, heute Abend trinkst du auch nicht mehr alleine.«
Sie antwortete nicht, sie wirkte angespannt im Dunkeln, als würde sie rot. Sie sah aus dem Fenster.
»Wie gut«, sagte er, »dass ich mir keinen Kopf drum machen muss, wie ich dich heute rechtzeitig nach Hause bringe.«
»Musst du so oder so nicht. Ich bin ein großes Mädchen.«
»Honey«, sagte er, »du bist kaum größer als eine Maus.«
Sie seufzte. »Eine Maus kann ganz schön mächtig sein.«
Er beschloss, nicht weiter nachzufragen, was sie damit meinte. »Das ist wahr«, antwortete er mit vielsagendem Blick, aber das schien nicht zu ihr durchzudringen.
Sie waren jetzt auf dem Riverside Drive, fast am Ziel. Zu ihrer Linken betonten lieblose fahle Lichter das tiefe Schwarz am Ufer von New Jersey. Rufus lehnte sich zurück, lehnte sich ein wenig an Leona und ließ Lichter und Schwärze vorbeirollen. Dann wendete das Taxi; flüchtig sah er die Brücke, die in der Ferne leuchtete wie in den Himmel geschrieben. Auf der Suche nach der Hausnummer wurde der Fahrer langsamer. Vor ihnen hatte ein Taxi gerade eine ganze Gruppe ausgespuckt und verschwand jetzt die Straße hinunter. »Wir sind da«, sagte Rufus. »Sieht ja nach einer schicken Party aus«, sagte der Taxifahrer zwinkernd. Rufus antwortete nicht. Er zahlte, stieg aus und betrat die Vorhalle, die groß und hässlich war, voller Spiegel und Stühle. Der Aufzug fuhr gerade nach oben, sie hörten noch die Stimmen darin.
»Was wolltest du eigentlich so ganz allein in dem Club, Leona?«, fragte Rufus.
»Keine Ahnung«, sagte sie etwas erstaunt. »Ich wollte einfach mal Harlem sehen, und dann bin ich zufällig an diesem Club vorbeigekommen und hab die Musik gehört, da bin ich eben rein, und dann bin ich dageblieben. Die Musik hat mir gefallen.« Sie bedachte ihn mit einem spöttischen Blick. »Ist das in Ordnung?«
Er lachte nur.
Sie wandte sich von ihm ab, als oben die Fahrstuhltüren zugingen. Das Scheppern hallte durch den Schacht, und jetzt hörten sie das Summen der Drahtseile. Leona blickte auf die geschlossenen Türen, als hinge ihr Leben davon ab.
»Bist du zum ersten Mal in New York?«
Ja, aber es sei schon immer ihr Traum gewesen, sagte sie mit einem kleinen Lächeln in seine Richtung. Sie hatte etwas Zaghaftes an sich, das ihn sehr berührte. Sie war wie ein wildes Tier, das nicht wusste, ob es auf die ausgestreckte Hand zugehen oder fliehen sollte, und dabei immer wieder kleine verschreckte Vorstöße wagte, erst hierhin, dann dorthin.
»Ich bin hier geboren.« Er sah sie an.
»Ich weiß«, sagte sie, »darum wirkt es auf dich bestimmt auch nicht so schön wie auf mich.«
Er lachte wieder. Und erinnerte sich plötzlich an seine Grundausbildung im Süden, spürte erneut den Stiefel eines weißen Offiziers auf seinem Mund. In seiner weißen Uniform lag Rufus im staubigen roten Lehm. Einige seiner schwarzen Kameraden hielten ihn fest, brüllten ihm ins Ohr, halfen ihm auf. Der weiße Offizier hatte sich fluchend davongemacht, für immer außer Reichweite seiner Rache. Sein Gesicht war verschmiert von Lehm, Tränen und Blut; er hatte rotes Blut in den roten Staub gespuckt.
Der Aufzug hielt, und die Türen gingen auf. Beim Einsteigen nahm er Leonas Arm und drückte ihn an seine Brust. »Ich finde dich ganz reizend.«
»Du bist auch nett«, sagte sie. Im engen Aufzug klang ihre Stimme seltsam zittrig, und auch ihr Körper zitterte – ganz leicht, wie vom sanften Frühlingswind umspielt.
Er drückte ihren Arm fester. »Hat man dich zu Hause gar nicht vor den schwarzen Männern gewarnt, die dich im Norden erwarten?«
Sie holte tief Luft. »Bisher ist mir noch keiner von ihnen blöd gekommen. Menschen sind Menschen, meine Meinung.«
Und Möse ist Möse, meine Meinung, dachte Rufus – war aber trotzdem dankbar für den Ton, den sie anschlug. So konnte er sich ein wenig fassen. Denn auch er zitterte leicht.
»Was hat dich eigentlich in den Norden verschlagen?«
Er fragte sich, ob er den nächsten Schritt machen oder darauf warten sollte, dass sie ihn machte. Betteln konnte er nicht. Aber sie vielleicht. Die Haare im Schritt fingen an zu jucken. Der schreckliche Muskel unten an seinem Bauch wurde langsam heiß und hart.
Sie stiegen aus dem Fahrstuhl und gingen durch einen langen Flur auf eine halb offene Tür zu.
»Ich hab’s wohl einfach nicht mehr ausgehalten da unten«, sagte sie. »Ich war verheiratet, aber dann hab ich mich von meinem Mann getrennt und sie haben mir meinen Sohn weggenommen – nicht mal sehen darf ich ihn –, und da hab ich mir gedacht, bevor ich da im Süden rumsitze und durchdrehe, versuch ich’s hier mit einem neuen Leben.«
Für einen kurzen Moment regte sich ein Gedanke in ihm. Leona war ein Mensch mit einer eigenen Geschichte, und alle Geschichten bedeuteten Ärger. Er schüttelte den Gedanken ab. So weit würde es gar nicht kommen, dass ihre Geschichte ihn kratzen könnte. Er wollte Leona nur für heute Nacht.
Er klopfte an die Tür und trat ein, ohne auf Antwort zu warten. Geradeaus, in dem großen Wohnraum, der in offenen Fenstertüren und einen Balkon mündete, tummelten sich mehr als hundert Leute, einige in Abendgarderobe, andere in Hose und Pullover. Hoch oben hing eine große Silberkugel, die unerwartete Winkel des Zimmers spiegelte und sich so in ihrer ganz eigenen Art abfällig über die Menschen darin äußerte. Es herrschte ein solches Kommen und Gehen, so viel Schmuck, Gläser und Zigaretten blitzten auf, dass die schwere Kugel beinahe lebendig wirkte.
Der Gastgeber – den er kaum kannte – war nirgends zu sehen. Rechts lagen drei Zimmer, im ersten türmten sich Capes und Mäntel.
Charlie Parkers Saxophon, das aus der Stereoanlage drang, legte sich über die Stimmen im Raum.
»Zieh du deinen Mantel aus«, sagte er zu Leona, »und ich seh mal nach, ob ich hier irgendwen kenne.«
»Ach«, sagte sie, »bestimmt kennst du hier alle.«
»Na los.« Mit einem Lächeln schob er sie sanft ins andere Zimmer. »Tu, was ich dir sage.«
Während sie ihren Mantel ablegte – und sich wahrscheinlich die Nase puderte –, fiel ihm ein, dass er versprochen hatte, Vivaldo anzurufen. Auf der Suche nach einem einigermaßen abgeschiedenen Telefon landete er in der Küche.
Er wählte Vivaldos Nummer.
»Hallo, Baby. Wie geht’s?«
»Ach, so ganz gut. Was ist los? Ich dachte, du rufst früher an. Ich hatte dich fast schon abgeschrieben.«
»Bin gerade erst angekommen.« Rufus senkte die Stimme, als ein Paar in die Küche kam, eine blonde Frau mit verwuscheltem Pagenschnitt und ein großer Schwarzer. Die Frau lehnte sich an die Spüle, der Mann stand vor ihr und strich ihr langsam über die Oberschenkel. Rufus würdigten sie kaum eines Blickes. »Jede Menge elegante Spießer, weißt schon.«
»Klar«, sagte Vivaldo und schwieg. »Meinst du, es lohnt sich?«
»Keine Ahnung. Wenn du was Besseres vorhast …«
»Jane ist hier«, sagte Vivaldo schnell. Wahrscheinlich lag sie auf dem Bett und hörte zu.
»Ach, wenn deine Großmutter bei dir ist, kannst du dir das hier ja schenken.« Er mochte Jane nicht, sie war etwas älter als Vivaldo und frühzeitig ergraut. »Hier ist keine alt genug für dich.«
»Das reicht, du Wichser.« Er hörte die beiden tuscheln, verstand aber nicht, was sie sagten. Dann war wieder Vivaldo an seinem Ohr. »Ich glaube, ich passe.«
»Ist wohl besser. Wir sehen uns morgen.«
»Soll ich bei dir vorbeikommen?«
»Okay. Und lass dich von Grandma nicht fertigmachen; man sagt, Frauen in ihrem Alter sind echte Furien.«
»Für mich können sie gar nicht furios genug sein, mein Freund.«
Rufus lachte. »Versuch gar nicht erst, mit mir mitzuhalten, das schaffst du sowieso nicht. Bis dann.«
»Bis dann.«
Lächelnd legte Rufus auf und ging Leona suchen. Sie stand verloren im Flur und sah zu, wie einige Gäste verabschiedet wurden.
»Dachtest du, ich hätte dich im Stich gelassen?«, fragte er sie.
»Nein. So was würdest du doch nie tun.«
Er stupste ihr mit der Faust ans Kinn. Der Gastgeber wandte sich von der Tür ab und kam auf sie zu.
»Rein mit euch, ihr Lieben, holt euch was zu trinken«, sagte der Gastgeber. »Na los, stürzt euch ins Vergnügen.« Er war ein großer, gut aussehender, raumgreifender Mann, älter und skrupelloser, als er aussah; er hatte sich nach diversen härteren Jobs wie Boxen und Zuhälterei im Showbusiness nach ganz oben gekämpft. Den Ruhm verdankte er eher seinem Temperament und seinem Aussehen als seiner Stimme, und das wusste er. Er war kein Mensch, der sich selbst was vormachte, und Rufus mochte ihn, weil er raubeinig war, gutmütig und großzügig. Aber ein bisschen Angst hatte er auch vor ihm; trotz seines Charmes hatte der Mann etwas an sich, das keine Nähe duldete. Bei Frauen, die er mit tiefer, zärtlicher Verachtung behandelte, hatte er einen gewaltigen Schlag, und inzwischen war er bei seiner vierten Ehe angelangt.
Er nahm Leona und Rufus am Arm und zog sie ein Stück beiseite. »Hier wird’s vielleicht auch noch richtig nett, wenn die Spießer mal weg sind«, sagte er. »Geduld.«
Rufus grinste. »Wie fühlt man sich eigentlich, so anständig?«
»Scheiße, ich bin schon mein ganzes Leben lang anständig. Den Dreck am Stecken haben doch die anständigen Motherfucker, die uns Schwarze ausgezogen haben bis auf die Unterhose. Und immer schön unterstützt von unsereins.« Er lachte. »Wenn die mit ihren fetten Schecks ankommen, also, jedes Mal denk ich mir, damit geben sie mir nur einen winzigen Teil von dem zurück, was sie geklaut haben die ganzen Jahre, weißt du, wie ich meine?« Er klopfte Rufus auf den Rücken. »Sorg dafür, dass die kleine Eva sich gut amüsiert.«
Die Menge lichtete sich bereits, die meisten Spießer wanderten ab. Waren die erst mal weg, bekam die Party ein anderes Gesicht, würde angenehm, ruhig und intim. Das Licht würde gedimmt, die Musik sanfter werden, die Gespräche sporadischer und ernsthafter. Vielleicht sang jemand oder spielte Klavier. Vielleicht erzählten sie sich Geschichten über Spaß, den sie miteinander gehabt, und Gigs, die sie zusammen gespielt hatten, über Riffs, an die sie sich erinnerten, und das Leid, das sie nicht vergaßen. Vielleicht hatte jemand Pot dabei und ließ es langsam rumgehen wie eine Friedenspfeife. Zusammengerollt auf einem Teppich in der Zimmerecke würde jemand anfangen zu schnarchen. Wer tanzte, würde sich nun dabei räkeln und endlich loslassen. Die Schatten im Zimmer würden lebendig. Gegen Ende, wenn der Morgen anbrach und das brutale Getöse der Stadt durch die breiten Fenstertüren bei ihnen eindrang, ging irgendjemand in die Küche und machte Kaffee. Dann würden sie den Eisschrank plündern und nach Hause gehen. Die Gastgeber konnten endlich unter die Decke kriechen und den ganzen Tag im Bett bleiben.
Ab und zu blickte Rufus zur Silberkugel hinauf, und immer verpasste er sich und Leona in ihrer Spiegelung.
»Gehen wir auf den Balkon«, sagte er.
Sie hielt ihm ihr Glas hin. »Mit Nachschub?« Ihre Augen waren jetzt so hell und verschmitzt, dass sie aussah wie ein kleines Mädchen.
Er ging zum Tisch, schenkte ihnen beiden kräftig nach und ging wieder zu ihr. »Wollen wir?«
Mit dem Glas trat sie durch die Fenstertür.
»Sorg dafür, dass die kleine Eva sich nicht erkältet!«, rief der Gastgeber.
»Sie wird vielleicht brennen, Baby, aber erfrieren wird sie ganz bestimmt nicht«, rief Rufus zurück.
Vor ihnen in der Ferne breiteten sich die Lichter am Ufer von New Jersey aus. Rufus meinte, ein leises Murmeln vom Wasser aufsteigen zu hören.
Als Kind hatte er am östlichen Rand von Harlem gewohnt, einen Block vom Harlem River entfernt. Mit den anderen Kindern war er vom zugemüllten Ufer ins Wasser gewatet oder hier und da von verrottenden Vorsprüngen gesprungen und eingetaucht. In einem Sommer war dort ein Junge ertrunken. Von den Eingangsstufen seines Hauses aus hatte Rufus gesehen, wie eine kleine Gruppe unter den schweren Schatten der Bahngleise die Park Avenue überquerte und in die Sonne trat, in der Mitte ein Mann, der Vater des Jungen, mit dem unglaublichen Gewicht des zugedeckten Jungen im Arm. Nie würde Rufus die Rundung seiner Schultern und die entsetzte Neigung seines Kopfes vergessen. Ein großes Schreien hatte sich am anderen Ende des Blocks erhoben, und die Mutter des Jungen war im Bademantel, den Kopf umwickelt, stolpernd wie eine Betrunkene auf die schweigende Gruppe zugelaufen.
Rufus straffte die Schultern, als würde er eine Last abwerfen, und trat zu Leona an die Brüstung. Sie blickte den Fluss hinauf zur George Washington Bridge.
»Das ist echt schön«, sagte sie, »das ist echt so schön.«
»New York scheint dir zu gefallen.«
Sie drehte sich zu ihm, nippte an ihrem Drink. »Allerdings. Kann ich jetzt eine Zigarette haben?«
Er reichte ihr eine Zigarette und gab ihr Feuer, dann zündete er sich selbst eine an. »Wie kommst du hier über die Runden?«
»Geht schon«, sagte sie. »Ich arbeite in einem Restaurant downtown als Kellnerin, ganz unten bei der Wall Street, das ist echt ’ne hübsche Ecke, und ich wohne mit zwei andern Frauen zusammen« – also konnten sie nicht zu ihr gehen! –, »und ja, ach, geht schon.« Sie sah zu ihm auf mit ihrem traurig herzigen Armeweißelächeln.
Erneut mahnte ihn ein Gefühl, es sein zu lassen, dieses arme Mädchen in Ruhe zu lassen, aber dass er sie im Geiste ein armes Mädchen nannte, entlockte ihm zugleich ein Lächeln aufrichtiger Zuneigung. »Du hast echt Mumm, Leona«, sagte er.
»Geht nicht anders, so seh ich das«, sagte sie. »Manchmal würde ich am liebsten aufgeben. Aber – wie gibt man denn auf?«
Sie sah so verloren und komisch aus, dass er laut auflachte, und kurz darauf lachte auch sie.
»Wenn mein Mann mich jetzt sehen könnte«, kicherte sie, »ach du je.«
»Wieso, was würde dein Mann denn sagen?«
»Wieso, keine Ahnung.« Diesmal lachte sie nicht. Sie sah ihn an, als würde sie langsam aus einem Traum erwachen. »Ob ich wohl noch einen Drink bekommen könnte?«
»Klar.« Er nahm ihr Glas, und ihre Hände und ihre Körper berührten sich kurz. Sie senkte den Blick. »Bin gleich zurück«, sagte er und tauchte ein in den jetzt dämmrigen Raum. Jemand spielte Klavier.
»Na, wie kommst du voran mit deiner Eva?«, fragte der Gastgeber.
»Gut, gut, wir trinken uns warm.«
»Kannst du vergessen. Du musst Little Eva mit Pot einheizen. Dass sie einen richtigen Kick kriegt.«
»Die kriegt schon noch ihren Kick.«
»Der alte Rufus hat sie draußen stehen lassen, Mann, dass sie das Empire State Building anbetet«, sagte der junge Saxophonist und lachte.
»Gib mal her«, sagte Rufus, jemand reichte ihm einen Joint, und er nahm ein paar Züge.
»Kannst du behalten, Mann, das Zeug ist astrein.«
Er füllte die Gläser und blieb einen Augenblick im Zimmer stehen, rauchte und lauschte dem Klavier. Er fühlte sich gut, sauber, auf der Höhe und hatte einen milden Rausch, als er wieder auf den Balkon trat.
»Sind alle schon weg?«, fragte sie nervös. »Es ist so still da drin.«
»Nein, die sitzen bloß rum.« Sie sah auf einmal hübscher aus, weicher, und die Lichter über dem Fluss schlossen sich hinter ihr wie ein Vorhang. Der Vorhang schien sich mit ihr zu bewegen, schwer, schillernd und unschätzbar. »Ich wusste gar nicht, dass du eine Prinzessin bist.«
Er gab ihr den Drink, und ihre Hände berührten sich wieder. »Jetzt weiß ich, dass du betrunken bist«, sagte sie fröhlich, und über den Glasrand hinweg lockte ihn nun unmissverständlich ihr Blick.
Er wartete. Alles schien jetzt sehr einfach. Er spielte mit ihren Fingern. »Hast du irgendwas gesehen, seit du in New York bist, das du haben willst?«
»Ach«, sagte sie, »ich will alles!«
»Hast du irgendwas gesehen, das du jetzt auf der Stelle haben willst?«
Ihre Finger spannten sich leicht, aber er hielt sie fest. »Na los. Kannst du mir ruhig sagen. Keine Angst.« Die Worte hallten in seinem Kopf wider. Das hatte er schon mal gesagt, vor Jahren, zu jemand anders. Der Wind frischte kurz auf, umwehte seinen Körper und zerzauste ihre Haare. Dann legte er sich wieder.
»Und du?«, fragte sie zaghaft.
»Was ich?«
»Hast du was gesehen, was du haben willst?«
Er merkte, dass er high war, so hatten sich seine Finger mit ihren verschränkt, so starrte er ihren Hals an. Er wollte daran saugen und ihn langsam grün und blau knabbern. Aber er merkte auch, wie hoch sie über der Stadt waren, wie die Lichter unten ihn zu locken schienen. Er trat an die Brüstung. Als er direkt hinuntersah, meinte er auf einer Klippe in der Wildnis zu stehen und ein Königreich und einen Fluss zu sehen, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Das alles konnte ihm gehören, jeder Fußbreit des Gebiets, das sich unter ihm und um ihn herum erstreckte. Unbewusst fing er an, eine Melodie zu pfeifen, und sein Fuß suchte nach dem Pedal seines Schlagzeugs. Er stellte sein Glas vorsichtig auf den Balkonboden und trommelte ein Riff auf der steinernen Brüstung.
»Du hast meine Frage noch nicht beantwortet.«
»Welche?«
Er drehte sich zu Leona um. Sie hielt ihr Glas in den hohlen Händen, runzelte fragend die Stirn über den verzagten Augen und dem herzigen Lächeln.
»Du hast meine noch nicht beantwortet.«
»Doch.« Sie klang so wehmütig wie noch nie. »Ich hab gesagt, ich will alles.«
Er nahm ihr das Glas ab, trank es halb aus, gab es ihr zurück und zog sich in den dunkelsten Winkel des Balkons zurück.
»Na schön«, flüsterte er, »dann hol’s dir.«
Mit dem Glas vor der Brust ging sie auf ihn zu. Im allerletzten Moment flüsterte sie zornig und verwirrt: »Was hast du vor mit mir?«
»Honey«, entgegnete er, »ich bin schon dabei«, und zog sie, so heftig er konnte, zu sich heran. Auf ihren Widerstand war er gefasst gewesen, und sie wehrte sich, hielt das Glas zwischen ihnen fest und versuchte verzweifelt, sich seiner Berührung zu entziehen. Er schlug ihr das Glas aus der Hand, dass es dumpf auf den Balkonboden fiel und von ihnen wegrollte. Nur zu, dachte er amüsiert; würde ich dich jetzt loslassen, wärst du so fertig, du würdest vom Balkon fliegen, höchstwahrscheinlich. »Nur zu«, flüsterte er, »wehr dich, das gefällt mir. Macht man das so bei euch im Süden?«
»O Gott«, murmelte sie und fing an zu weinen. Und hörte auf zu kämpfen. Ihre Hände tasteten nach seinem Gesicht, als wäre sie blind. Dann schlang sie die Arme um seinen Hals und klammerte sich, noch immer zitternd, an ihn. Mit Lippen und Zähnen war er an ihren Ohren und ihrem Hals, und er sagte: »Honey, noch gibt es nichts zu weinen.«
Ja, er war high; er sah sich selbst zu bei allem, was er tat, und eine unerwartete Zärtlichkeit für Leona regte sich in ihm. Er wollte sich freisprechen für das, was er tat – was er ihr antat. Es schien alles sehr lange zu dauern. Er verlor sich in ihren Brüsten, die sich vorwölbten wie gelbe Cremehügel, und den harten, braunen, köstlichen Nippeln, er spielte, nuckelte, knabberte, während sie stöhnte und wimmerte und ihre Knie nachgaben. Behutsam nahm er sie mit auf den Boden, zog sie auf sich. Hielt sie fest an Hüfte und Schulter. Ein wenig sorgte er sich um die Gastgeber und die anderen da drinnen, aber er konnte diesen Irrsinn nicht mehr aufhalten. Ihre Finger knöpften sein Hemd auf bis zum Nabel, ihre Zunge brannte sich in seinen Hals und seine Brust; seine Hände schoben ihren Rock hoch und streichelten die Innenseiten ihrer Schenkel. Nach einer rauschhaften Weile, in der ihn jedes Beben ihres Körpers, schneller und immer schneller, erschauern ließ, drückte er sie unter sich und drang in sie ein. Einen Moment lang dachte er, sie würde schreien, so eng war sie, so scharf atmete sie ein, so sehr spannte sie sich an. Doch dann stöhnte sie auf und bewegte sich unter ihm. Aus der Mitte seines aufziehenden Sturms machte er sich ganz langsam und bedacht an die lange Heimreise.
Und sie trug ihn, wie das Meer ein Boot trägt: in einem langsamen, wogenden Auf und Ab, das kaum die gewaltige Tiefe ahnen ließ. Sie murmelten und schluchzten auf dieser Reise, er fluchte leise und inständig. Beide kämpften darum, in einen Hafen einzulaufen, und es konnte keine Ruhe geben, bis das Wogen unerträglich schneller wurde durch die Wucht, die in ihnen beiden wuchs. Rufus öffnete kurz die Augen und betrachtete ihr Gesicht, von Schmerz verklärt und in der Dunkelheit glänzend wie Alabaster. Tränen standen in ihren Augenwinkeln, und das Haar klebte ihr an der Stirn. Sie atmete mit Stöhnen und kurzen Schreien, mit Wörtern, die er nicht verstand, und er bewegte sich schneller und drang tiefer in sie ein, er konnte nicht anders. Er wollte, dass sie ihn für alle Tage in Erinnerung behielt. Wenig später hätte ihn nichts mehr aufhalten können, nicht der weiße Gott persönlich und kein Lynchmob aus den Lüften. Halblaut verfluchte er die milchweiße Schlampe und stieß ihr stöhnend seine Waffe zwischen die Schenkel. Sie fing an zu weinen. Hab ich dir doch gesagt, stöhnte er, ich geb dir noch was zu weinen, und auf einmal hatte er das Gefühl zu ersticken, als müsste er platzen oder sterben. Ein Stöhnen, ein Fluchen durchfuhren ihn, während er mit all seiner Kraft auf sie eindrosch und das Gift aus sich herausschießen fühlte, ausreichend für hundert schwarz-weiße Babys.
Keuchend lag er auf dem Rücken. Er hörte Musik aus dem Zimmer und ein Pfeifen vom Fluss. Er hatte Angst und eine trockene Kehle. Die Luft strich kalt über seine feuchten Stellen.
Als sie ihn anfasste, zuckte er zusammen. Mit einiger Überwindung drehte er sich zu ihr und sah ihr in die Augen. Sie waren noch feucht, tief und dunkel, und ihr zitternder Mund bog sich leicht zu einem triumphierenden scheuen Lächeln. Er zog sie zu sich heran, hätte sich gern ausgeruht. Er hoffte, sie würde nichts sagen. »War das schön«, sagte sie und küsste ihn. Und diese Worte, die zwar keine Zärtlichkeit in ihm auslösten und ihm nicht die rätselhafte dumpfe Furcht nahmen, weckten in ihm neues Verlangen.
Er setzte sich auf. »Was bist du für eine komische kleine Südfrucht«, sagte er und betrachtete sie. »Keine Ahnung, wie du das deinem Mann erklärst, wenn du mit einem kleinen schwarzen Baby nach Hause kommst.«
»Ich krieg überhaupt keine Babys mehr«, sagte sie, »mach dir da mal keine Sorgen.« Mehr sagte sie nicht, aber sie hatte noch so viel zu sagen. »Das hat er auch aus mir rausgeprügelt«, setzte sie schließlich hinzu.
Er wollte ihre Geschichte hören, und er wollte nichts mehr über sie wissen.
»Wir gehen besser rein und machen uns frisch«, sagte er.
Sie legte den Kopf an seine Brust. »Ich hab Angst, da jetzt reinzugehen.«
Lachend strich er ihr über den Kopf. Die Zärtlichkeit kam zurück. »Du hast aber nicht vor, die ganze Nacht hier draußen zu bleiben, oder?«
»Was werden deine Freunde denken?«
»Also, zunächst mal, Leona, holen sie nicht die Polizei.« Er küsste sie. »Gar nichts werden sie denken, Honey.«
»Kommst du mit rein?«
»Natürlich komm ich mit rein.« Er hielt sie auf Armeslänge von sich. »Du musst nur irgendwie deine Sachen zurechtzupfen« – er streichelte sie, sah ihr in die Augen – »und dir irgendwie durch die Haare fahren, so« – und er strich ihr die Haare aus der Stirn. Sie betrachtete ihn. »Magst du mich?«, hörte er sich fragen.
Sie schluckte. Er betrachtete die pochende Ader an ihrem Hals. »Ja«, sagte sie und senkte den Blick. »Rufus, ich mag dich wirklich, tu mir bitte nicht weh.«
»Warum sollte ich dir wehtun wollen, Leona?« Er streichelte ihr den Hals und sah sie ernst an. »Wie kommst du darauf, dass ich dir wehtun will?«
»Menschen tun sich nun mal gegenseitig weh«, sagte sie nach einer Weile.
»Hat dir jemand wehgetan, Leona?«
Sie schwieg, legte ihr Gesicht in seine Hand. »Mein Mann«, sagte sie leise. »Ich dachte, er liebt mich, aber das stimmte nicht – ich wusste, dass er grob ist, aber ich dachte nicht, dass er böse ist. Und geliebt haben kann er mich nicht, weil er hat mir mein Kind weggenommen, er ist irgendwohin, wo ich es gar nicht mehr sehen kann.« Mit Tränen in den Augen blickte sie zu Rufus hoch. »Er hat gesagt, ich bin keine gute Mutter, weil – ich – zu viel trinke. Das stimmt auch, anders hab ich ihn nicht ausgehalten, aber für mein Kind wär ich gestorben, ich hätte doch nie zugelassen, dass ihm was passiert.«
Er schwieg. Ihre Tränen fielen auf seine dunkle Faust. »Er ist immer noch da unten«, sagte sie, »mein Mann, meine ich. Er und meine Mutter und mein Bruder halten zusammen wie Pech und Schwefel. Die finden, ich bin nie zu was gut gewesen. Teufel noch mal, wenn dir alle ständig sagen, du bist zu nichts gut« – sie versuchte zu lachen –, »dann wird man am Ende ganz schön schlecht.«
Er schob all die Fragen von sich, die er ihr stellen wollte. Auf dem Balkon wurde es langsam kalt, er hatte Hunger, er brauchte einen Drink, und er wollte nach Hause ins Bett. »Also«, sagte er schließlich, »ich werde dir nicht wehtun«, stand auf und trat an die Brüstung. Seine Boxershorts hingen ihm wie ein Seil zwischen den Beinen, er zog sie hoch und hatte das Gefühl, darin festzukleben. Er machte den Reißverschluss zu, stand breitbeinig da. Der Himmel war ins Violett geblichen, die Sterne waren verschwunden und die Lichter am Jersey-Ufer waren aus. Ein Kohlenkahn fuhr langsam den Fluss hinunter.
»Wie sehe ich aus?«, fragte sie.
»Gut«, sagte er und meinte es ernst. Sie sah aus wie ein müdes Kind. »Willst du mit zu mir kommen?«
»Wenn du willst.«
»Ja, genau das will ich.« Er fragte sich, warum er an ihr festhielt.
Vivaldo kam am späten Nachmittag vorbei, als Rufus noch im Bett lag und Leona in der Küche Frühstück machte.
Leona öffnete ihm die Tür. Rufus beobachtete entzückt das schleichende Entsetzen auf Vivaldos Gesicht, wie er von Leona, eingehüllt in Rufus’ Bademantel, zu Rufus blickte, der nackt unter der Decke saß.
Soll der aufgeklärte weiße Wichser sich ruhig mal ein bisschen winden, dachte er.
»Hi, Baby«, rief er, »komm rein. Du bist gerade rechtzeitig zum Frühstück.«
»Also, ich hab schon gefrühstückt«, sagte Vivaldo, »aber ihr seid ja noch nicht mal angezogen. Ich komm einfach später wieder.«
»Scheiße, Mann, komm rein jetzt. Das hier ist Leona, und das ist mein Freund Vivaldo. Kurzform. Eigentlich heißt er Daniel Vivaldo Moore und ist ein irischer Spaghettifresser.«
»Rufus hat Vorurteile gegen alles und jeden«, sagte Leona lächelnd. »Komm rein.«
Vivaldo machte beklommen die Tür hinter sich zu und setzte sich auf die Bettkante. Immer wenn ihm unbehaglich war – was häufig vorkam –, schienen seine Arme und Beine ins Unermessliche zu wachsen, und er trug sie mit verwirrter Abscheu, als wäre er gerade erst mit ihnen geschlagen.
»Ich hoffe, du kannst wenigstens ein bisschen was essen«, sagte Leona. »Es gibt reichlich, und es ist gleich fertig.«
»Ich trink einen Kaffee mit euch«, sagte Vivaldo, »es sei denn, ihr habt Bier.« Dann sah er Rufus an. »Muss eine tolle Party gewesen sein.«
Rufus grinste. »Nicht schlecht, nicht schlecht.«
Leona machte ein Bier auf und brachte es Vivaldo in einem Glas. Er nahm es mit seinem Verschwörergrinsen entgegen, wobei etwas Bier auf seinen Fuß schwappte.
»Du auch, Rufus?«
»Nein, mein Schatz, erst mal was essen.«
Leona ging in die Küche zurück.
»Ist sie nicht ein Prachtexemplar?«, fragte Rufus. »Im Süden bringen sie ihren Weibsbildern noch bei, uns zu Diensten zu sein.«
Aus der Küche hörten sie Leonas Lachen. »Was anderes bringen sie uns jedenfalls nicht bei.«
»Honey, solange du einen Mann so glücklich machen kannst wie mich jetzt, musst du auch nichts anderes können.«
Rufus und Vivaldo sahen sich an. Dann grinste Vivaldo. »Und, Rufus, kriegst du deinen Arsch noch mal raus aus diesem Bett?«
Rufus schlug die Decke zurück und sprang auf. Er reckte die Arme, gähnte und streckte sich.
»Eine beeindruckende Vorstellung, die du hier abgibst«, sagte Vivaldo und warf ihm ein Paar Boxershorts zu.
Rufus zog sie an, dazu eine alte graue Hose und ein ausgeblichenes grünes Poloshirt. »Du hättest doch noch auf die Party kommen sollen«, sagte er. »Da ging Pot rum, das hast du noch nicht gesehen.«
»Tja, war ein schwieriger Abend gestern.«
»Jane und du? Das Übliche?«
»Ach, sie war betrunken und hat wieder so eine Scheiße abgezogen, weißt schon. Sie ist krank, sie kann nichts dafür.«
»Dass sie krank ist, weiß ich, aber was ist mit dir?«
»Wahrscheinlich krieg ich einfach gern eins übergebraten.« Sie gingen zum Tisch. »Bist du zum ersten Mal im Village, Leona?«
»Nein, rumgelaufen bin ich hier schon. Aber man kennt einen Ort ja erst, wenn man die Menschen kennt.«
»Uns kennst du jetzt«, sagte Vivaldo, »und zusammen kennen wir so ungefähr jeden. Wir zeigen dir unser Viertel.«
Die Art, wie Vivaldo das sagte, irritierte Rufus. Seine Beschwingtheit verflog; galliger Argwohn erfüllte ihn. Verstohlen blickte er zu Vivaldo, der sein Bier trank und Leona mit einem undurchdringlichen Lächeln betrachtete – undurchdringlich eben deshalb, weil es so offen und wohlwollend wirkte. Dann sah Rufus wieder Leona an. Zumindest jetzt, wie sie da in seinem Bademantel ertrank, das Haar auf dem Kopf aufgetürmt und das Gesicht gänzlich ungeschminkt, konnte man sie nicht wirklich hübsch nennen. Vielleicht verachtete Vivaldo sie, weil sie so gewöhnlich war – was bedeutete, dass Vivaldo ihn verachtete. Vielleicht flirtete er aber auch mit ihr, weil sie so zugänglich und verfügbar wirkte, wobei sich ihre Verfügbarkeit schon daran zeigte, dass sie überhaupt in Rufus’ Wohnung war.
Dann sah Leona ihn über den Tisch hinweg an und lächelte. Ein Ruck ging ihm durch Herz und Bauch. Rufus erinnerte sich an die Heftigkeit, an die Zärtlichkeit, die sie miteinander erlebt hatten, und dachte, zum Teufel mit Vivaldo. Er hatte hier etwas, an das Vivaldo nie herankommen würde.
Er beugte sich über den Tisch und küsste Leona.
»Krieg ich noch ein Bier?«, fragte Vivaldo schmunzelnd.
»Du weißt ja, wo es steht«, antwortete Rufus.
Leona nahm Vivaldos Glas und ging in die Küche, und Rufus streckte Vivaldo, der mit leichtem Spott die Stirn runzelte, die Zunge raus.
Leona stellte Vivaldo sein Bier hin. »Ihr Jungs macht hier fertig, ich zieh mich an.« Sie sammelte ihre Kleider ein und verschwand im Bad.
Eine Weile herrschte Schweigen.
»Wohnt sie jetzt bei dir?«, fragte Vivaldo.
»Weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, sie würde gern …«
»Na, das ist wohl offensichtlich. Aber ist die Wohnung nicht ein bisschen klein für zwei?«
»Vielleicht finden wir was Größeres. Aber – ich bin ja auch nicht so viel zu Hause.«
Vivaldo schien darüber nachzudenken. »Ich hoffe, du weißt, was du tust, mein Lieber«, sagte er dann. »Ich weiß, es geht mich nichts an, aber –«
»Magst du sie nicht?«
»Klar mag ich sie. Sie ist reizend.« Er nahm einen Schluck. »Die Frage ist: Wie sehr magst du sie?«
»Merkt man das nicht?« Rufus grinste.
»Also, ehrlich gesagt, nein, ich nicht. Ich meine, klar magst du sie. Aber … ach, ich weiß auch nicht.«
Dann wieder Schweigen. Vivaldo senkte den Blick.
»Kein Grund zur Sorge, ich bin ein großer Junge.«
»Das hier ist auch eine ziemlich große Welt, mein Lieber. Ich hoffe, das hast du bedacht.«
»Hab ich bedacht.«
»Ach, ich bin einfach viel zu fürsorglich, du Scheißkerl.«
»Das ist immer das Problem mit euch weißen Wichsern.«
Die große Welt kam ihnen entgegen, als sie auf die sonntäglichen Straßen hinaustraten. Durch die Augen der Passanten starrte sie die drei abweisend an, und Rufus begriff, dass er diese Welt und ihre Macht, zu hassen und zu zerstören, ganz und gar nicht bedacht hatte. Er hatte nicht an seine Zukunft mit Leona gedacht, schlicht und ergreifend, weil er so etwas nie für möglich gehalten hatte. Und doch war Leona hier und hatte fest vor zu bleiben, wenn er sie haben wollte. Aber der Preis war hoch: Ärger mit dem Vermieter, den Nachbarn, mit all den Jugendlichen im Village und all jenen, die am Wochenende herkamen. Und seine Familie würde einen Anfall kriegen. Bei seinen Eltern machte das nicht so viel – ihr Anfall dauerte schon ein Leben lang an und war inzwischen nur noch ein Reflex. Aber Ida würde Leona bestimmt vom Fleck weg verabscheuen. Sie hatte hohe Erwartungen an Rufus und war sehr politisch. Dieses Mädel hättest du doch gar nicht erst angeguckt, wenn sie schwarz wäre, würde sie sagen. Aber das weiße Pack gabelst du auf, bloß weil es weiß ist. Was ist los mit dir – schämst du dich, dass du schwarz bist?
Zum ersten Mal in seinem Leben stellte er selbst sich diese Frage – oder, besser gesagt, klopfte sie an und zog sich sofort wieder entschuldigend zurück. Er betrachtete Leona von der Seite. Jetzt war sie ziemlich hübsch. Sie hatte sich die Haare geflochten und die Zöpfe hochgesteckt, so sah sie sehr altmodisch aus und viel jünger, als sie eigentlich war.
Ein junges Paar kam ihnen entgegen, die Sonntagszeitung unterm Arm. Rufus beobachtete, wie der Mann Leona ansah, dann blickten der Mann und die Frau beide von Vivaldo zu Rufus, als wollten sie ermitteln, wer von ihnen der Liebhaber war. Da sie sich in Greenwich Village befanden – Zentrum von Freiheit und Gleichberechtigung –, schloss Rufus aus dem flüchtigen, beinahe verlegenen Blick, den ihnen der Mann im Vorbeigehen zuwarf, dass er Rufus und Leona als Paar ausgemacht hatte. Das Gesicht seiner Frau hingegen blieb fest verschlossen, wie eine Pforte.
Sie erreichten den Park. Heruntergekommene alte Frauen aus den Slums und von der East Side saßen auf Bänken, meist allein, manchmal neben klapperdürren ergrauten Männern. Damen aus den großen Apartmenthäusern der Fifth Avenue, von unbestimmter, verzweifelter Eleganz, führten im Park ihre Hunde spazieren, und schwarze Kindermädchen summten, mit versteinerten Mienen die Welt der Erwachsenen ausblendend, nervös in Kinderwagen hinein. Die italienischen Arbeiter und Ladenbesitzer flanierten mit ihren Familien oder saßen plaudernd unter Bäumen; einige spielten Schach oder lasen L’Espresso. Die übrigen Village-Bewohner saßen auf den Bänken: lesend – Kierkegaard war der Name, der laut auf dem Buchumschlag einer kurzhaarigen Frau in Jeans prangte –, zerstreut Abstraktes erörternd, tratschend oder lachend; oder still, und das mit einer ungeheuren, unsichtbaren Anstrengung, unter der Bänke und Bäume zu brechen drohten, oder mit einer Schlaffheit, die ahnen ließ, dass sie sich nie wieder bewegen würden.
Rufus und Vivaldo – vor allem Vivaldo – kannten viele von ihnen und waren mit vielen von ihnen intim gewesen, vor so langer Zeit, dass es sich anfühlte wie ein anderes Leben. Der Anblick alter Freunde, alter Lieben, die unerklärlich auf der Strecke geblieben waren, hatte etwas Beängstigendes. Wie ein Krebs, der die ganze Zeit unsichtbar in ihnen gewuchert hatte und nun vielleicht auch in einem selbst wuchs. Viele waren verschwunden, waren in die Nester zurückgekehrt, aus denen sie gekommen waren, viele andere waren noch da, hatten sich in Säufer oder Junkies verwandelt oder auf die nervenzehrende Jagd nach dem perfekten Psychiater begeben, waren rachsüchtig verheiratet, fruchtbar und fett, träumten dieselben Träume wie vor zehn Jahren und hüllten sie in dieselben Argumente, zitierten dieselben Meister – und verströmten in ihrer schauerlichen Einbildung noch denselben Charme, den sie besessen hatten, bevor ihnen Zähne und Haare ausfielen. Sie waren feindseliger als früher, nur das machte ihre Stimme lauter und ihren Blick noch lebendig.
Schließlich wurde Vivaldo von einer freundlichen, großen Frau angehalten, die nicht ganz nüchtern war. Rufus und Leona blieben stehen und warteten.
»Dein Freund ist total nett«, sagte Leona. »So natürlich, ich hab das Gefühl, wir kennen uns schon ewig.«
Jetzt, da Vivaldo nicht bei ihnen war, veränderten sich die Blicke der anderen. Leute aus dem Village, gebunden oder frei, taxierten sie, als stünden sie auf dem Versteigerungspodest oder in einem Zuchtgestüt. Die fahle Frühlingssonne schien Rufus heiß auf Nacken und Stirn. Leona hingegen strahlte und schien nichts und niemanden wahrzunehmen. Sollte irgendjemand Zweifel am Wesen ihrer Beziehung haben, wurden sie durch diesen Blick zerstreut. Wenn sie so entspannt ist, dachte er, wenn sie nichts mitkriegt, was stimmt dann nicht mit mir? Vielleicht bildete er sich alles bloß ein, vielleicht scherte ihre Verbindung überhaupt niemanden. Als er aufblickte, sah er in die Augen eines halbwüchsigen Italieners. Der Junge war ins Sonnenlicht getaucht, das durch die Bäume fiel, und sah ihn hasserfüllt an; sein Blick flackerte über Leona hinweg, als wäre sie eine Hure. Dann senkte er langsam den Blick und stolzierte weiter, nur um Rufus selbst mit dem Rücken noch anzuknurren.
»Blöde Schwuchtel«, murmelte Rufus.
Da überraschte ihn Leona. »Meinst du den Jungen da? Der hat doch nur Langeweile, der ist einsam und weiß es nicht besser. Wahrscheinlich würdet ihr euch sogar gut verstehen.«
Er lachte.
»Das ist doch das Problem mit den meisten Menschen«, klagte Leona, »dass sie niemanden haben. Das macht sie so böse. Junge, im Ernst, ich kenn mich da aus.«
»Nenn mich nicht Junge.«
»Nein«, sagte sie erschrocken, »das war nicht so gemeint, mein Schatz.« Sie nahm seinen Arm, und gemeinsam drehten sie sich zu Vivaldo um. Die große Frau hatte ihn am Kragen gepackt, und er versuchte, ihr zu entkommen – und lachte dabei.
»Dieser Vivaldo«, amüsierte sich Rufus, »der hat dauernd Ärger mit Frauen.«
»Aber es gefällt ihm«, sagte Leona. »Ihr scheinbar auch.«
Die große Frau hatte ihn gerade losgelassen und brach mitten auf dem Weg förmlich zusammen vor Lachen. Nachsichtig lächelnd blickten die Leute von ihren Bänken auf, von der Wiese, von ihren Büchern, auf zwei kernige Village-Bewohner.
Und auf einmal hatte Rufus von allen die Nase voll. Ob Leona und er es wagen würden, sich in aller Öffentlichkeit so eine Szene zu liefern, ob für sie dieser Tag jemals kam? Egal mit welcher Frau er unterwegs war, niemand würde Vivaldo so ansehen, wie sie Rufus ansahen, noch würden sie jemals die Frau so ansehen wie jetzt Leona. Die schäbigste Hure von Manhattan war sicher, solange sie Vivaldo am Arm hatte. Denn Vivaldo war weiß.
Rufus erinnerte sich an einen regnerischen Abend im vergangenen Winter. Gerade zurück von einem Gig in Boston, war er mit Vivaldo und Jane ausgegangen. Er hatte nie ganz verstanden, was Vivaldo an Jane fand, sie war zu alt für ihn, zänkisch und schmutzig. Ihre grauen Haare waren immer ungekämmt, ihre Pullover, von denen sie Tausende zu besitzen schien, alle gleichermaßen schlabbrig und ausgefranst, und ihre Jeans waren ausgebeult und voller Farbkleckse. »Die läuft rum wie ein Mannweib«, hatte er einmal zu Vivaldo gesagt und dann über Vivaldos entsetzte Miene gelacht. Sein Gesicht hatte sich zerknautscht, als hätte gerade jemand ein faules Ei aufgeschlagen. Aber gehasst hatte er Jane vor dieser Regennacht nicht.
Es war ein schrecklicher Abend gewesen, es schüttete wie aus Kübeln, der Regen erfüllte die Luft mit tosendem, heulendem Geprassel und verflüssigte Lichter, Straßen und Häuser. Er trommelte und strömte gegen die Fenster der stinkenden Armeleutekneipe, in die Jane sie geschleppt hatte, einer Kneipe, in der sie niemanden kannten. Dort wimmelte es von unförmigen, ungepflegten Frauen, mit denen Jane offenbar manchmal tagsüber trank, und bleichen, unordentlichen, mürrischen Männern, die im Hafen arbeiteten und ihn hier nicht gern sahen. Er wollte wieder gehen und wartete nur darauf, dass der Regen etwas nachließ. Janes Gefasel über ihre Malerei langweilte ihn zu Tode, und er schämte sich für den geduldigen Vivaldo. Wie hatte der Streit angefangen? In seinen Augen war Jane schuld. Um nicht einzuschlafen, hatte Rufus angefangen, sie ein wenig auf die Schippe zu nehmen. Natürlich ließ er damit durchblicken, was er wirklich von ihr hielt, und das begriff sie ziemlich schnell. Vivaldo beobachtete beide mit einem wachsamen Lächeln. Er langweilte sich auch und fand Janes Dünkel unerträglich.
»Na ja«, sagte Jane, »du bist halt kein Künstler, wie solltest du da meine Arbeit beurteilen können …«
»Ach, hör doch auf«, sagte Vivaldo. »Weißt du eigentlich, wie lächerlich du dich anhörst? Du malst also nur für diese paar Möchtegernpinsler hier unten?«
»Ach, komm, lass sie doch.« Rufus fand langsam Gefallen an der Sache. Mit einem Grinsen, lüstern und hämisch zugleich, beugte er sich vor. »Die Puppe ist einfach zu hoch für uns, Mann, wir können ihr Zeug gar nicht kapieren.«
»Ihr seid hier die Snobs«, sagte sie, »nicht ich. Ich hab hier in dieser Bar schon mehr Leute erreicht, ehrliche, hart arbeitende, ungebildete Leute, als ihr je erreichen werdet. Die Leute, mit denen ihr euch abgebt, sind tot, Mann – die hier leben wenigstens noch.«
Rufus lachte. »Dacht ich mir doch, dass es komisch riecht hier drin. Das ist es also. Scheiße. Das ist das Leben, hm?«
Er merkte, dass sie langsam Aufmerksamkeit erregten. Er sah aus dem Fenster in den strömenden Regen und sagte sich, okay, Rufus, reiß dich zusammen. Er lehnte sich in der Nische zurück, in der er Jane und Vivaldo gegenübersaß.
Er hatte sie getroffen, und sie schlug mit der einzigen Waffe zurück, die sie besaß und die früher einmal Zorn gewesen sein mochte. »Hier drin riecht es auch nicht übler als da, wo du herkommst, Süßer.«
Vivaldo und Rufus sahen sich an. Vivaldos Lippen waren bleich geworden. »Noch ein Wort, Baby«, sagte er, »und ich schlag dir die Zähne in den Rachen, alle beide.«
Sie war begeistert. Auf der Stelle verwandelte sie sich in Bette Davis und schrie, so laut sie konnte: »Willst du mir etwa drohen?«
Alle drehten sich um.
»Scheiße«, sagte Rufus, »komm, gehen wir.«
»Ja, bloß raus hier«, sagte Vivaldo. »Los, aus dem Weg, du dreckige Schlampe.«
Sie beugte sich vor und nahm Rufus’ Hand. »Ich hab’s doch nicht so gemeint.« Er wollte seine Hand wegziehen, aber sie hielt sie fest, und er wollte nicht, dass es so aussah, als würde er mit ihr ringen, also entspannte er sich. Jetzt war sie Joan Fontaine. »Bitte, Rufus, du musst mir glauben!«