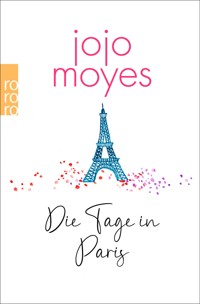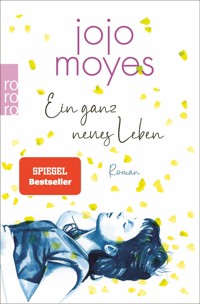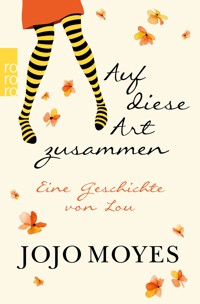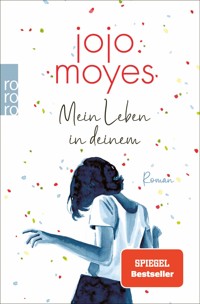14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau, die nach ihren Wurzeln sucht. Ein Café, das zu einem Zuhause wird. Eine Liebe gegen jede Wahrscheinlichkeit. Warum fällt es uns manchmal so verdammt schwer, glücklich zu sein?Das fragt sich Suzanna Peacock oft. Eigentlich ist alles gut: Gerade ist sie zurück in ihr Heimatstädtchen gezogen, in die Nähe ihrer Familie. Ihr Mann Neil wünscht sich sehnlich Kinder und eine gemeinsame Zukunft. Doch etwas scheint immer zu fehlen in Suzannas Leben. Da ist zum einen ihre leibliche Mutter, die sie nie kennengelernt hat. Und zum anderen die nagende Frage, ob sie Neil wirklich liebt. Suzanna fühlt sich nirgends richtig zu Hause, bis sie das Peacock Emporium gründet. Das Café und Ladengeschäft wird schnell zu einem ganz besonderen Ort, nicht nur für Suzanna. Hier findet sie zum ersten Mal in ihrem Leben echte Freunde und ein Gefühl von Zugehörigkeit. Auch zu dem gut aussehenden, rätselhaften Alejandro … Die bezaubernde Wiederentdeckung der Bestsellerautorin – zum ersten Mal als E-Book! Typisch Jojo Moyes: wunderbare Figuren, eine berührende Liebesgeschichte, dramatische Wendungen – und ganz viel Gefühl! Dies ist die Neuausgabe von «Suzannas Coffeeshop».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jojo Moyes
Ein ganz besonderer Ort
Roman
Über dieses Buch
Der Traum vom Glück
Warum fällt es uns manchmal so verdammt schwer, glücklich zu sein? Das fragt sich Suzanna Peacock oft. Eigentlich ist alles gut: Gerade ist sie zurück in ihr Heimatstädtchen gezogen, in die Nähe ihrer Familie. Ihr Mann Neil wünscht sich sehnlich Kinder und eine gemeinsame Zukunft. Doch etwas scheint immer zu fehlen in Suzannas Leben. Da ist zum einen ihre leibliche Mutter, die sie nie kennengelernt hat. Und zum anderen die nagende Frage, ob sie Neil wirklich liebt. Suzanna fühlt sich nirgends richtig zu Hause, bis sie das Peacock Emporium gründet. Das Café und Ladengeschäft wird schnell zu einem ganz besonderen Ort, nicht nur für Suzanna. Hier findet sie zum ersten Mal in ihrem Leben echte Freunde und ein Gefühl von Zugehörigkeit. Auch zu dem gut aussehenden, rätselhaften Alejandro …
Vita
Jojo Moyes, geboren 1969, hat Journalistik studiert und für die Sunday Morning Post in Hongkong und den Independent in London gearbeitet. «Ein ganzes halbes Jahr» machte sie international zur Bestsellerautorin. Zahlreiche weitere Nr.-1-Romane folgten. Jojo Moyes hat drei Kinder und lebt in London.
Karolina Fell hat schon viele große Autor:innen ins Deutsche übertragen, neben Jojo Moyes u.a. Bernard Cornwell und Kristin Hannah.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel «The Peacock Emporium» bei Hodder & Stoughton/Hachette UK, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 unter dem Titel «Suzannas Coffee-Shop» im Wunderlich Verlag, Reinbek bei Hamburg.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2005 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Peacock Emporium» Copyright © 2004 by Jojo’s Mojo Limited
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Covergestaltung SO YEAH DESIGN, Gabi Braun
Coverabbildung Silke Schmidt
ISBN 978-3-644-51091-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Mutter und meinen Vater,
Lizzie Sanders und Jim Moyes.
In Liebe und Dankbarkeit.
Erster Teil
Kapitel Eins
Zum dritten Mal innerhalb einer Woche war die Klimaanlage im Hospital de Clínicas ausgefallen, und die Hitze war so drückend, dass die Krankenschwestern den Patienten auf der Intensivstation inzwischen mit kleinen, batteriebetriebenen Plastikventilatoren Kühlung verschafften. Ein Paket mit dreihundert Stück davon war angekommen, das Geschenk eines dankbaren Schlaganfall-Überlebenden aus der Import-Export-Branche. Er war einer der wenigen Patienten des staatlichen Krankenhauses, die noch reich genug waren, um etwas zu verschenken.
Die blauen Ventilatoren stellten sich als nahezu ebenso belastbar heraus wie die Versprechungen des großzügigen Spenders von weiteren Medikamenten und medizinischem Gerät. Während die Luft in der lärmerfüllten Hitze des Sommers in Buenos Aires flimmerte, konnte man im gesamten Krankenhaus das unvermittelte «¡Hija de puta!» der Pflegeschwestern hören – sogar von den normalerweise streng religiösen –, wenn sie versuchten, die Ventilatoren durch Schütteln wieder zum Laufen zu bringen.
Ich spürte die Hitze nicht. Ich zitterte vor Angst, wie sie alle frisch Ausgebildeten in der Geburtshilfe empfinden, wenn ihnen gerade mitgeteilt wurde, dass sie gleich ihrem ersten Baby auf die Welt helfen werden. Beatriz, die leitende Hebamme, verkündete mir das mit einem kräftigen Klaps auf meine Schulter, während sie sich auf den Weg zur Geriatrie machte, um festzustellen, ob sie dort etwas zum Essen für die frischgebackenen Mütter abzweigen konnte. «Sie sind in der Zwei», sagte sie und deutete auf den Kreißsaal. «Sie hat schon drei Kinder, aber dieses will einfach nicht herauskommen. Kann man ihm nicht zum Vorwurf machen, oder?» Sie lachte trocken und schob mich zu der Tür. «Ich bin in ein paar Minuten zurück.» Dann, als sie mich an der Tür zögern sah, weil ich die unterdrückten Schmerzenslaute von drinnen hörte, sagte sie: «Na los, Alejandro, es gibt nur ein Ende, an dem es rauskommen kann.»
Als ich den Kreißsaal betrat, hatte ich noch das Gelächter der anderen Hebammen in den Ohren.
Ich hatte vorgehabt, mich mit einer gewissen Autorität vorzustellen, um mich ebenso zu beruhigen wie meine Patientin, doch die Frau kniete auf dem Boden, drückte ihrem Mann mit weiß hervortretenden Fingerknöcheln eine Hand ins Gesicht und stöhnte so erbärmlich, dass ich eine Begrüßung mit Handschlag für unpassend hielt.
«Sie braucht ein Schmerzmittel, Doktor», sagte der Vater, so gut er es mit der Handfläche an seinem Kinn vermochte. Seine Stimme, wurde mir bewusst, klang genauso respektvoll wie meine, wenn ich meine Vorgesetzten im Krankenhaus ansprach.
«Oh mein Gott, warum dauert das so lange?» Ihr T-Shirt war schweißgetränkt, und ihr Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz zusammengenommen hatte, war so feucht, dass stellenweise die helle Kopfhaut durchschimmerte.
«Unsere letzten beiden waren sehr schnell da», sagte er und strich ihr übers Haar. «Ich verstehe nicht, warum es nicht kommen will.»
Ich nahm das Berichtsblatt vom Ende des Betts. Sie hatte seit beinahe achtzehn Stunden Wehen, was schon für ein erstes Kind lang war, ganz zu schweigen von einem vierten. Ich unterdrückte den Impuls, nach Beatriz zu rufen. Stattdessen starrte ich den Bericht an, bemühte mich, kompetent zu wirken, und versuchte gleichzeitig, mir bei dem Stöhnen der Frau die medizinische Checkliste ins Gedächtnis zu rufen. Unten auf der Straße ließ jemand in voller Lautstärke Cumbia-Musik im Auto laufen. Ich dachte daran, das Fenster zu schließen, aber die Vorstellung, dass es in dem düsteren kleinen Raum noch heißer werden würde, war unerträglich. «Können Sie mir helfen, sie aufs Bett zu legen?», fragte ich den Ehemann, als ich nicht länger auf den Bericht starren konnte.
Als wir sie hochgehievt hatten, maß ich ihren Blutdruck, und während sie sich in meine Haare krallte, stoppte ich ihre Wehenabstände und tastete ihren Bauch ab. Dann befragte ich den Ehemann nach ihrer Vorgeschichte, erfuhr jedoch nichts, was mir einen Hinweis geben konnte. Ich warf einen Blick zur Tür und wünschte mir Beatriz herbei. «Kein Grund zur Sorge», sagte ich, wischte mir übers Gesicht und hoffte, dass es so war.
In diesem Moment sah ich das andere Paar, das wie erstarrt in der Ecke beim Fenster stand. Die beiden sahen nicht aus wie die üblichen Besucher in einem staatlichen Krankenhaus. Mit ihrer hellen, teuren Kleidung hätten sie eher in die Schweizer Klinik auf der anderen Seite des Platzes gepasst. Das Haar der Frau war kostspielig gefärbt und zu einem eleganten Knoten zurückgenommen, doch ihr Make-up vertrug die Gluthitze von vierzig Grad nicht, sammelte sich um ihre Augen und lief ihr das verschwitzte Gesicht hinab. Sie hielt sich am Arm ihres Mannes fest und starrte angespannt auf die Szene, die sie vor sich hatten. «Braucht sie Medikamente?», fragte sie an mich gewandt. «Eric könnte ihr Medikamente besorgen.»
Sie wirkt zu jung, um die Mutter der Frau zu sein, dachte ich abwesend. «Für Medikamente ist sie schon viel zu weit», sagte ich und versuchte, selbstsicher zu klingen.
Alle sahen mich erwartungsvoll an. Keine Spur von Beatriz.
«Ich sehe mir das mal an», sagte ich. Niemand erweckte den Anschein, als wollte er mich aufhalten, also blieb mir nichts anderes übrig, als eine Untersuchung zu machen.
Ich schob die Fersen der Frau an ihr Gesäß und spreizte ihre Beine. Dann wartete ich ihre nächste Wehe ab und tastete so behutsam wie möglich den äußeren Muttermund ab. Das konnte bei fortgeschrittenen Wehen schmerzhaft sein, aber sie war so erschöpft, dass sie kaum stöhnte. Ich überlegte eine Weile, um mir ein Urteil zu bilden. Der Gebärmutterhals war vollständig erweitert, doch ich konnte den Kopf des Babys nicht ertasten. Plötzlich bekam ich einen Adrenalinschub, denn mir wurde klar, was nicht stimmte. Ich lächelte alle beruhigend an und ging zum Instrumentenschrank, hoffend, dass das, was ich suchte, noch nicht von einer anderen Station geplündert worden war. Aber da war er – wie eine kleine Häkelnadel aus Stahl: mein Zauberstab. Als ich ihn in der Hand hielt, überkam mich so etwas wie Euphorie bei dem Gedanken daran, was geschehen würde – was ich geschehen lassen würde.
Ein neuerlicher Schmerzensschrei zerriss die Luft. Ich fürchtete mich ein wenig davor, mein Vorhaben allein durchzuführen, aber es war nicht vertretbar, noch länger zu warten. Und weil der Überwachungsmonitor für die Herzschläge des Fötus nicht mehr funktionierte, hatte ich keine Möglichkeit festzustellen, ob das Baby gefährdet war.
«Halten Sie sie fest, bitte», sagte ich zu dem Ehemann, dann passte ich sorgfältig den Wehenabstand ab und kerbte mit dem Haken in die Fruchtwasserblase, die, wie ich erkannt hatte, noch nicht geplatzt war und das Weiterkommen des Babys behinderte. Selbst über das Stöhnen der Frau und den Verkehrslärm hinweg hörte ich das schöne Knallgeräusch, mit dem die weiche Membran nachgab. Unvermittelt schoss ein Schwall Flüssigkeit hervor, und die Frau setzte sich auf und sagte einigermaßen überrascht und sehr eindringlich: «Ich muss pressen.»
Ich weiß noch, dass ich gleich darauf den verblüffend dichten schwarzen Haarschopf sah und dann die Hand der Frau nahm und sie darauflegte, damit sie neuen Mut fasste. Auch erinnere ich mich daran, dass ich sie anwies, weiter zu pressen, und dass ich, als das Baby langsam zum Vorschein kam, vor Erleichterung und Schreck und Freude so laut schrie wie beim Besuch von Fußballspielen mit meinem Vater. Und ich erinnere mich an den Anblick dieses wunderschönen Mädchens, als es in meine Hände glitt, an seine blaumarmorierte Haut, die sich so schnell wie bei einem Chamäleon rosa färbte, bevor es einen willkommenen kräftigen Schrei der Empörung über seinen verzögerten Eintritt in die Welt ausstieß.
Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den Kopf abwenden musste, denn als ich die Nabelschnur durchtrennte und das Kind auf die Brust seiner Mutter legte, wurde mir bewusst, dass ich angefangen hatte zu weinen, und ich wollte den anderen Hebammen keinen weiteren Grund liefern, mich auszulachen.
Beatriz tauchte neben mir auf, wischte sich über die Stirn und deutete hinter sich. «Wenn du fertig bist», sagte sie leise, «gehe ich kurz nach oben und schaue, ob ich Doktor Cardenas finde. Sie hat eine Menge Blut verloren, und ich möchte nicht, dass sie sich bewegt, bevor er einen Blick auf sie geworfen hat.» Ich bekam kaum mit, was sie sagte, und das wusste sie auch. Sie trat mir leicht an den Knöchel. «Nicht schlecht, Ale», sagte sie mit einem Grinsen. «Nächstes Mal denkst du vielleicht sogar daran, das Baby zu wiegen.»
Ich wollte ihr gerade in demselben flapsigen Ton antworten, als mir bewusst wurde, dass sich die Atmosphäre im Raum verändert hatte. Beatriz bemerkte es auch und blieb stehen. Statt des üblichen verzückten Gurrens der Mutter und des sanften Murmelns bewundernder Verwandtschaft war nur ein leises Flehen zu hören. «Diego, nein, Diego, bitte …»
Das elegant gekleidete Paar war ans Bett getreten. Die blonde Frau zitterte, und auf ihrem Gesicht lag ein seltsames Halblächeln, als sie ihre Hand zögernd nach dem Baby ausstreckte.
Die Mutter drückte mit geschlossenen Augen das Kind an ihre Brust und murmelte ihrem Ehemann zu: «Diego, nein. Nein, das kann ich nicht tun.»
Ihr Mann streichelte ihr übers Gesicht. «Luisa, wir waren uns einig. Du weißt, dass wir uns einig waren. Wir können es uns so schon kaum leisten, unsere Kinder zu ernähren, geschweige denn noch eins.»
Sie öffnete die Augen nicht. «Es wird alles besser werden, Diego. Du wirst mehr Arbeit bekommen. Bitte, amor, bitte nicht …»
Diegos Gesicht verzog sich. Er streckte die Hand aus und begann langsam, die Finger seiner Frau von dem Baby zu lösen, einen nach dem anderen. Sie schluchzte inzwischen. «Nein. Nein, Diego, bitte!»
Die Freude über die Geburt war verflogen, und mir wurde übel, als mir klar wurde, was gerade geschah. Ich wollte eingreifen, doch Beatriz neben mir schüttelte mit untypisch grimmiger Miene den Kopf. «Das dritte dieses Jahr», murmelte sie.
Diego war es gelungen, das Baby zu nehmen. Er hielt es eng an seiner Brust, ohne es anzusehen, und dann streckte er es, nun selbst mit geschlossenen Augen, von sich weg. Die blonde Frau war vorgetreten. «Wir werden sie so sehr lieben», sagte sie, und ihr näselnder Reiche-Leute-Ton schwankte, weil ihr selbst die Tränen kamen. «Wir haben so lange darauf gewartet …»
Die Mutter begann zu toben, wollte aufstehen, und Beatriz war mit einem Schritt bei ihr und hielt sie fest. «Sie darf sich nicht bewegen», sagte sie und klang scharf aufgrund ihrer unfreiwilligen Mittäterschaft. «Sie müssen dafür sorgen, dass sie sich nicht bewegt, bis der Arzt hier ist, das ist sehr wichtig.»
Diego schlang die Arme um seine Frau. Es war schwer zu sagen, ob er sie tröstete oder fixierte. «Sie wird bei ihnen alles haben, Luisa, und das Geld wird uns bei der Versorgung unserer Kinder helfen. Du musst an Paola denken, an Salvador … daran, wie alles war …»
«Mein Baby!», schrie die Mutter, ohne ihn zu hören, zerkratzte ihrem Mann das Gesicht, machtlos gegenüber dem Gewicht von Beatriz, die sie niederhielt. «Sie können sie nicht mitnehmen.» Ihre Fingernägel hinterließen einen blutigen Striemen, aber ich glaube nicht, dass er etwas davon mitbekam. Ich stand am Waschbecken, als sich das Paar zur Tür zurückzog, hatte Tränen in den Augen und in den Ohren den Klang unsäglichen Leids, der bis heute in mir nachhallt.
Ich habe keine einzige schöne Erinnerung bei dem Gedanken an das erste Baby, dem ich auf die Welt geholfen habe. Ich erinnere mich nur an die Schreie dieser Mutter, den Ausdruck des Leids, der sich in ihr Gesicht gegraben hatte, eines Leids, das wusste ich sogar trotz meiner mangelnden Erfahrung, das niemals gelindert werden würde. Und ich erinnere mich an diese blonde Frau, die traumatisiert war und dennoch entschlossen, als sie davonschlich und leise sagte: «Sie wird geliebt werden.»
Sie muss es hundert Mal gesagt haben, obwohl ihr niemand zuhörte.
«Sie wird geliebt werden.»
Kapitel Zwei
Der Zug hatte zwischen Norwich und Framlington sechs außerplanmäßige Stopps eingelegt, und der eisblaue Himmel verdunkelte sich, obwohl noch nicht einmal Teezeit war. Mehrere Male hatte Vivi die Schaffner mit Schaufeln vom Zug springen sehen, um Schneeverwehungen von den Gleisen zu beseitigen, und ihre Ungeduld aufgrund der Verspätung wurde mittlerweile von einer merkwürdigen Befriedigung aufgewogen.
«Ich hoffe, wer immer uns abholt, hat Schneeketten aufgezogen», sagte sie. Durch ihren Atem beschlug das Waggonfenster, sodass sie mit einem behandschuhten Finger ein Sichtloch hineinreiben musste. «Ich habe keine Lust darauf, ein Auto durch dieses Wetter zu schieben.»
«Du müsstest nicht schieben», sagte Douglas hinter seiner Zeitung. «Die Männer werden schieben.»
«Es wird schrecklich glatt sein.»
«In Stiefeln wie deinen ganz bestimmt.»
Vivi sah zu ihren neuen Courrèges hinunter und freute sich im Stillen darüber, dass er sie bemerkt hatte. Vollkommen ungeeignet für dieses Wetter, hatte ihre Mutter gesagt und in Richtung ihres Vaters betrübt hinzugefügt, dass man im Moment «absolut nicht mit ihr reden» könne. Vivi, die normalerweise stets einlenkte, hatte bei ihrer Weigerung, Gummistiefel zu tragen, eine untypische Entschlossenheit an den Tag gelegt. Es war der erste richtige Ball, zu dem sie ging, und sie wollte bei ihrer Ankunft nicht aussehen wie eine Zwölfjährige. Das war nicht der einzige Kampf gewesen: Ihr Haar, das zu einem kunstvollen Lockengebilde hochgesteckt war, ließ es nicht zu, dass sie eine Wollmütze trug, und ihre Mutter war hin- und hergerissen bei der Frage, ob die Mühe, die sie beim Frisieren aufgewendet hatte, das Risiko aufwog, dass sich ihre einzige Tochter nur mit einem Schal um den Hals in das schlimmste Winterwetter seit Beginn der Aufzeichnungen hinauswagte.
«Ich werde nicht frieren», hatte Vivi gelogen, «ich werde mich fühlen wie ein warmes Toastbrot.» Doch nun war sie insgeheim dankbar, dass Douglas nichts von den knielangen Unterhosen ahnen konnte, die sie unter ihrem Rock trug.
Sie saßen inzwischen seit beinahe zwei Stunden im Zug, eine davon ohne Heizung. Eigentlich hatten sie vorgehabt, bei Frederica Marshalls Mutter im Auto mitzufahren, doch dann hatte Frederica Drüsenfieber bekommen (das nicht umsonst «Kusskrankheit» genannt wird, wie Vivis Mutter trocken angemerkt hatte), und deshalb hatten sie ihre Eltern widerstrebend mit dem Zug fahren lassen, begleitet von zahlreichen eindringlichen Ermahnungen dazu, wie wichtig es war, dass Douglas «auf sie aufpasste». Im Lauf der Jahre war Douglas häufig beauftragt worden, auf Vivi aufzupassen – aber die Vorstellung, dass Vivi bei einem der gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres allein sein könnte, hatte offenbar für besondere Beunruhigung gesorgt.
«Macht es dir etwas aus, dass ich mit dir fahre, D?», fragte sie leicht kokett.
«Sei nicht albern.» Douglas hatte seinem Vater noch nicht verziehen, dass er ihm seinen Vauxhall Victor nicht leihen wollte.
«Ich verstehe einfach nicht, warum mich meine Eltern nicht alleine fahren lassen wollen. Sie sind dermaßen altmodisch.»
Bei Douglas wäre sie gut aufgehoben, hatte ihr Vater beruhigend gesagt. Er ist wie ein großer Bruder. Und damit hatte er recht, hatte Vivi leicht verzweifelt gedacht.
Sie hob ein Bein und legte den Fuß im Stiefel auf den Platz neben Douglas. Er trug einen dicken Wollmantel, und an seinen Schuhen war ein heller Rand aus Schneematsch. «Wie es aussieht, sind heute Abend Gott und die Welt dort», sagte sie. «Eine Menge Leute, die eine Einladung haben wollten, haben keine bekommen.»
«Sie hätten meine haben können.»
«Anscheinend ist auch diese Athene Forster dort. Das ist die, die frech zum Duke of Edinburgh war. Hast du sie schon mal irgendwo gesehen, wo du eingeladen warst?»
«Nö.»
«Die muss schrecklich sein. Mummy hat Bilder von ihr in den Klatschblättern gesehen und gemeint, dass man sich mit Geld keine gute Kinderstube kaufen kann.» Sie rieb sich über die Nase. «Fredericas Mutter meint, dass es bald keine Debütantinnenbälle mehr geben wird. Sie sagt, Mädchen wie Athene ruinieren sie und dass man sie deshalb die letzte Debütantin nennt.»
Douglas schnaubte, ohne von seiner Zeitung aufzusehen. «Die letzte Debütantin. Was für ein Blödsinn. Die ganze sogenannte Season mit ihren Dinnerpartys, Tanzabenden und Wohltätigkeitsveranstaltungen ist ein Vorwand. Das ist schon so, seit die Queen die Vorstellung der Debütantinnen bei Hof abgeschafft hat.»
«Aber es ist immer noch eine nette Art, Leute kennenzulernen.»
«Eine nette Art, nette Jungs und Mädchen mit geeignetem Ehematerial zu versorgen.» Douglas schlug die Zeitung zu und legte sie neben sich auf den Sitz. Dann lehnte er sich zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. «Die Zeiten ändern sich, Vee. In zehn Jahren wird es keine Jagdbälle wie den heute mehr geben. Und auch keine piekfeinen Gehröcke und Fräcke.»
Vivi war nicht ganz sicher, dachte aber, dass diese Bemerkung mit Douglas’ Besessenheit von der «Sozialreform», wie er es nannte, zusammenhängen könnte, die alles von George Cadburys Bildung für die Arbeiterklasse bis zum russischen Kommunismus umfasste. «Und wie lernen sich die Leute dann kennen?»
«Jeder wird die Freiheit haben, alle kennenzulernen, die er will, ganz egal welcher Herkunft. Es wird eine klassenlose Gesellschaft sein.»
Aus seinem Ton war schwer zu schließen, ob er das für gut hielt oder ob er eine Warnung aussprach. Also gab Vivi, die selten Zeitung las und sich eigentlich keine eigene Meinung zu irgendetwas erlaubte, ein zustimmendes Geräusch von sich und sah wieder aus dem Fenster. Sie hoffte, dass ihre Frisur den Abend überstehen würde. Der Quickstep und der Gay Gordons wären wohl unproblematische Tänze, hatte ihre Mutter gesagt, nur beim Dashing White Sergeant müsse sie ein wenig aufpassen. «Douglas, tust du mir einen Gefallen?»
«Welchen?»
«Ich weiß, dass du eigentlich nicht hinwolltest …»
«Das macht mir nichts aus.»
«Und ich weiß, dass du Tanzen hasst, aber wenn ein paar Titel gelaufen sind, ohne dass mich jemand aufgefordert hat, versprichst du mir dann einen Tanz? Ich glaube, ich könnte es nicht ertragen, den ganzen Abend das Mauerblümchen zu sein.» Sie zog kurz die Hände aus der relativen Wärme ihrer Taschen. Ihre Nägel schillerten von dem Perlmuttlack, den sie aufgetragen hatte. «Ich habe unheimlich viel geübt. Ich werde dich nicht blamieren.»
Jetzt lächelte er, und trotz der Kälte in dem Waggon wurde es Vivi wärmer. «Du wirst kein Mauerblümchen sein», sagte er und legte einen Fuß auf den Sitz neben sie. «Aber ja, Dummchen. Natürlich tanze ich mit dir.»
Framlington Hall war kein Juwel im architektonischen Erbe Englands. Der erste Eindruck von Altertümlichkeit täuschte: Wer auch nur über Grundkenntnisse von Architektur verfügte, erkannte schnell, dass diese gotischen Türmchen nicht recht auf die klassizistischen Säulen passten und dass das unruhige Rot der Ziegelsteine durch kaum mehr als eine Handvoll Jahre verwittert war. Es war eine Kreuzung aus den schlimmsten nostalgischen Sehnsüchten nach einer mythischen Vergangenheit.
Der Garten des Anwesens, sofern er nicht unter hohem Schnee begraben lag, war streng formalistisch angelegt, die Rasenflächen waren sorgfältig gepflegt und so dicht wie ein luxuriöser Teppich, und der Rosengarten war keine verspielte Wildnis, sondern bestand aus Reihen von brutal zurechtgestutzten identischen Büschen mit Blüten in einem blutroten Farbton, der akribisch in holländischen oder französischen Laboratorien herangezüchtet oder veredelt worden war. Es war weniger ein Garten, wie ein Besucher einmal bemerkt hatte, sondern eine Art Landschaftskaserne.
Nicht dass derartige Betrachtungen den steten Zustrom von Gästen störten, der sich, Übernachtungstaschen in der Hand, über die geschwungene, mit Salz gestreute Auffahrt schlängelte. Einige waren von den Bloombergs, die das Herrenhaus selbst entworfen hatten, persönlich eingeladen worden, andere mit ausdrücklicher Erlaubnis durch bessergestellte Freunde der Bloombergs, damit für die richtige Atmosphäre gesorgt war. Und ein paar waren einfach so aufgetaucht, weil sie clever genug waren, um davon auszugehen, dass ein paar zusätzliche Statisten mit dem richtigen Aussehen und passender Ausdrucksweise niemanden stören würden. Die Bloombergs waren vor nicht allzu langer Zeit zu Geld gekommen und fest entschlossen, die Tradition der Debütantinnenbälle für ihre Zwillingstöchter hochzuhalten. Sie waren als großzügige Gastgeber bekannt, außerdem ging inzwischen alles entspannter zu – niemand würde irgendjemanden bei diesem Schnee aus dem Haus werfen.
Darüber hatte Vivi ausführlich nachgedacht, als sie in ihrem Gästezimmer saß (Handtücher, Toilettenartikel und ein Föhn standen zur Verfügung), das weit entfernt von Douglas’ Zimmer lag. Sie gehörte dank der Geschäftsbeziehung von Douglas’ Vater mit David Bloomberg zu den Glücklichen, die ein Zimmer im Haus bekommen hatten. Die meisten Mädchen waren in einem Hotel einige Meilen weit weg einquartiert worden, doch Vivi hatte ein Zimmer für sich allein, das mindestens dreimal so groß war wie ihr eigenes zu Hause und doppelt so luxuriös.
Lena Bloomberg, hochgewachsen und elegant, die den erschöpften Eindruck derjenigen Frauen machte, die seit Langem wussten, dass ihr Mann sie vor allem aus finanziellen Gründen attraktiv fand, hatte bei seiner eher übertriebenen Begrüßung die Augenbrauen gehoben und erklärt, es gäbe im Salon Tee und Suppe für diejenigen, die sich aufwärmen wollten, und dass sich Vivi, falls sie irgendetwas brauchte, jederzeit melden solle – allerdings wohl nicht bei Mrs. Bloomberg. Dann hatte sie einen Bediensteten beauftragt, Vivi ihr Zimmer zu zeigen – die Männer waren in einem anderen Flügel des Gebäudes untergebracht –, und Vivi hatte, nachdem sie jeden Cremetiegel getestet und an jeder Shampooflasche geschnuppert hatte, eine Weile nur dagesessen, bevor sie sich umzog, ihre unerwartete Freiheit genossen und sich gefragt, wie es sein musste, jeden Tag so zu leben.
Während sie ihr Kleid überstreifte (enges, miederartiges Oberteil, langer lilafarbener Rock, von ihrer Mutter nach einem Butterick-Schnittmuster genäht) und ihre Stiefel gegen Tanzschuhe tauschte, hörte sie auf dem Flur Stimmengemurmel, als Leute an ihrer Tür vorbeigingen. Sie hatte sich seit Wochen auf den Ball gefreut. Jetzt, wo es so weit war, erfüllte sie dasselbe diffuse Angstgefühl wie vor einem Zahnarztbesuch. Nicht nur, weil die einzige Person, die sie wahrscheinlich kennen würde, Douglas war oder weil sie sich, nachdem sie sich im Zug unheimlich befreit und mondän gefühlt hatte, nun sehr jung vorkam, sondern, weil sie im Vergleich zu den anderen jungen Frauen, die gertenschlank in ihrer Abendgarderobe strahlten, plötzlich plump und unzulänglich wirkte. Glamourös zu erscheinen, fiel Veronica Newton nicht leicht. Trotz der weiblichen Requisiten wie Lockenwicklern und Mieder musste sie sich eingestehen, dass sie immer nur Durchschnitt sein würde. Sie hatte Kurven in einer Zeit, in der Schlankheit das Schönheitsideal war. Sie hatte eine gesunde Gesichtsfarbe, wo doch Blässe und große Augen angesagt waren. Sie trug immer noch Trägerröcke und Hemdblusenkleider, obwohl die Mode Schnitte mit A-Linie vorschrieb. Selbst ihr gewelltes naturblondes Haar war widerspenstig und strohig, weigerte sich, wie ein glatter Vorhang herabzuhängen wie bei den Mannequins in den Zeitschriften, und umrahmte stattdessen in einzelnen Strähnen fedrig ihr Gesicht. Heute, zusammengeschweißt zu unnatürlichen Locken, sah es steif und rebellisch aus statt wie die honigartige Drapierung, die sie sich vorgestellt hatte. Um alles noch schlimmer zu machen, hatten ihre Eltern ihr in einem untypischen Anfall von Fantasie den Spitznamen Vivi gegeben, der zur Folge hatte, dass die Leute enttäuscht wirkten, wenn sie ihnen vorgestellt wurde, so als ob dieser Name eine Exotik verhieß, die sie nicht besaß. «Nicht jede kann die Ballkönigin sein», hatte ihre Mutter beruhigend gesagt. «Aber du wirst für jemanden eine entzückende Ehefrau sein.»
Ich will nicht die entzückende Ehefrau von irgendjemandem sein, dachte Vivi, während sie ihr Spiegelbild ansah und die vertraute Unzufriedenheit in ihr aufstieg. Ich will einfach Douglas’ Leidenschaft sein. Sie gestattete sich kurz eine Wiederholung ihrer Fantasie, die inzwischen so abgegriffen war wie die Seiten eines Lieblingsbuchs – die Fantasie, in der Douglas, fassungslos angesichts ihrer überraschenden Schönheit in ihrem Ballkleid, mit ihr über die Tanzfläche wirbelte und sie herumschwang, bis ihr schwindelig wurde, seine starke Hand fest auf ihrem Rücken liegend, seine Wange an ihre gelegt … (Diese Träumerei hatte ziemlich viel von Cinderella, musste sie zugeben. Und noch mehr, weil nach dem Kuss alles ein bisschen verschwommen wurde.) Seit ihrer Ankunft hier wurden ihre Tagträume immer wieder von schlanken, geheimnisvoll wirkenden Jean-Shrimpton-Doppelgängerinnen unterbrochen, die Douglas mit wissendem Lächeln und Sobranie-Zigaretten weglockten. Also hatte sie eine neue Fantasie entwickelt, in der Douglas sie nach dem Abend in dieses riesige Schlafzimmer begleitete, sehnsüchtig an der Tür stehen blieb und sie schließlich sanft zum Fenster hinüberführte, ihr vom Mondlicht beschienenes Gesicht betrachtete, und …
«Vee? Bist du angezogen?» Vivi fuhr schuldbewusst zusammen, als Douglas an die Tür klopfte. «Dachte, wir könnten ein bisschen früher runtergehen. Ich habe einen alten Schulfreund getroffen, und er reserviert uns zwei Gläser Champagner. Bist du bald fertig?»
«Zwei Sekunden», rief sie, trug Wimperntusche auf und betete, dass heute der Abend war, an dem er gezwungen sein würde, sie mit anderen Augen zu sehen. «Ich bin gleich so weit.»
Er bot natürlich die perfekte Erscheinung in seinem Smoking. Er wirkte größer und aufrechter, seine Schultern sahen vollkommen gerade aus in dem festen Jackettstoff. Als sie ihm sagte, dass er gut aussah, und dabei einen witzelnden Ton anschlug, um das heftige Verlangen zu überspielen, das sein Anblick in ihr ausgelöst hatte, lachte er schroff und erwiderte, er fühle sich wie ein dressierter Narr. Dann, als wäre es ihm peinlich, dass er es vergessen hatte, machte er ihr ebenfalls ein Kompliment. «Du hast dich ganz schön rausgeputzt, altes Mädchen», sagte er, legte seinen Arm um sie und drückte sie brüderlich an sich. Er verhielt sich nicht gerade wie ein Traumprinz, aber seine Berührung elektrisierte sie trotzdem.
«Wusstest du, dass wir jetzt offiziell eingeschneit sind?»
Alexander, der blasse, sommersprossige Schulfreund von Douglas, hatte ihr noch einen Drink gebracht. Es war ihr drittes Glas Champagner, und die Lähmung, die sie anfänglich beim Anblick all der glamourösen Gäste befallen hatte, war verschwunden. «Wie bitte?», sagte sie.
Er beugte sich vor, damit sie ihn über die Musik der Band hinweg hören konnte. «Der Schnee. Es hat wieder angefangen zu schneien. Anscheinend kommt niemand mehr durch, bis sie morgen Streusalz bringen.» Er trug, wie viele der Männer, den traditionellen Jagdrock, also ein rotes Jackett, und sein Aftershave roch furchtbar stark, als hätte er nicht genau gewusst, wie viel er verwenden sollte.
«Wo übernachtest du?», fragte Vivi ihn. Sie hatte plötzlich ein Bild von Tausenden Körpern vor sich, die auf dem Fußboden des Ballsaals kampierten.
«Oh, für mich ist gesorgt. Ich übernachte im Haus, genau wie du. Was die anderen machen werden, weiß ich allerdings nicht. Feiern vielleicht durch. Ein paar von diesen Knaben hätten das sowieso getan.»
Im Gegensatz zu Vivi sahen die meisten Leute um sie herum aus, als würde es sich von selbst verstehen, dass sie bis zum Hellwerden aufblieben. Sie wirkten alle so selbstsicher und souverän, unbeeindruckt von der prachtvollen Umgebung. Ihr Gebaren und ihr Geplauder legten nahe, dass es für sie nichts Besonderes war, sich in diesem imposanten Anwesen aufzuhalten. Die Frauen trugen ihre Kleider mit der unbekümmerten Sorglosigkeit derer, denen elegante Abendgarderobe so vertraut war wie ein ganz normaler Mantel.
Obwohl es nicht zu der Eleganz des Ballsaals passte, die irgendwie an eine Hochzeitstorte erinnerte, war die Band dazu übergegangen, statt ihrer traditionellen Tänze etwas Moderneres zu spielen. Bei einer Instrumentalversion von «I Want to Hold Your Hand» waren viele junge Frauen begeistert auf die Tanzfläche geeilt und hatten mit ihren kunstvoll frisierten Köpfen und den Hüften gewackelt, sodass die Matronen am Rand der Tanzfläche ihre Köpfe missbilligend schüttelten und Vivi betrübt zu dem Schluss kam, dass es wohl kaum zu ihrem Walzer mit Douglas kommen würde.
Allerdings war sie auch nicht sicher, dass er sich überhaupt an sein Versprechen erinnerte. Er schien abgelenkt, seit sie in den Ballsaal gekommen waren. Tatsächlich wirkte er überhaupt nicht wie er selbst, rauchte Zigarren mit seinen Freunden und riss mit ihnen Witze, die sie nicht verstand. Sie war ziemlich sicher, dass er nicht über den bevorstehenden Zusammenbruch des Klassensystems sprach – stattdessen schien er sich inmitten der Fräcke und roten Jagdröcke beunruhigend zu Hause zu fühlen. Sie hatte mehrere Male versucht, etwas zu sagen, um ihre Verbundenheit wiederherzustellen. Einmal hatte sie sogar ganz offen einen Witz darüber gemacht, dass er Zigarre rauchte, doch er hatte nicht besonders interessiert gewirkt – hatte nur «mit halbem Ohr» zugehört, wie ihre Mutter gesagt hätte. Und dann hatte er sich so höflich wie möglich wieder dem anderen Gespräch zugewandt.
Sie war sich langsam dumm vorgekommen und beinahe dankbar gewesen, als Alexander ihr seine Aufmerksamkeit widmete. «Lust auf einen Twist?», hatte er gefragt, und sie hatte zugeben müssen, dass sie nur die klassischen Tänze beherrschte. «Das ist ganz einfach», sagte er und führte sie auf die Tanzfläche. «Als ob man eine Zigarette mit der Fußspitze austritt und sich mit einem Handtuch den Allerwertesten abreibt. Kapiert?» Er hatte bei seiner Demonstration so komisch ausgesehen, dass sie laut auflachte und dann einen Blick über die Schulter warf, um festzustellen, ob Douglas etwas davon mitbekommen hatte. Aber Douglas war, nicht zum ersten Mal an diesem Abend, verschwunden.
Um acht Uhr verkündete ein Moderator, dass das Büfett eröffnet war, und Vivi, etwas beschwipster als bei ihrer Ankunft, reihte sich in die lange Schlange der Leute ein, die für Seezunge Veronique oder Bœuf Bourgignon anstanden, und fragte sich, wie sie ihren Riesenhunger mit dem Wissen in Einklang bringen sollte, dass keine der anderen Frauen mehr aß als ein paar verkochte Karottensticks.
Unvermittelt stand sie inmitten einer Gruppe von Alexanders Freunden. Er hatte sie auf eine leicht besitzergreifende Art vorgestellt, und Vivi hatte ihr Miederoberteil hochgezerrt, weil ihr bewusst war, dass sie ein ziemlich beträchtliches Dekolleté zeigte.
«Warst du mal im Ronnie Scott’s?», fragte einer und beugte sich so dicht zu ihr, dass sie ihren Teller von sich weghalten musste.
«Den kenne ich nicht. Tut mir leid.»
«Das ist ein Jazz-Club. Du solltest Xander dazu bringen, dich dorthin mitzunehmen.»
«Ich weiß nicht recht …» Vivi trat einen Schritt zurück und entschuldigte sich, als sie an das Glas von jemandem stieß.
«Gott, ich bin am Verhungern. Letzte Woche war ich bei den Atwoods auf der Party, und dort gab es nur Lachsmousse und Rinderbrühe. Ich musste den Mädels ihre Portion abkaufen. Dachte, ich werde ohnmächtig vor Hunger.»
«Es gibt nichts Mieseres als ein mieses Büfett.»
Vivi begann sich unbehaglich zu fühlen, weil Xanders Hand mehrere Male «versehentlich» ihren Hintern gestreift hatte.
«Hat jemand Douglas gesehen?»
«Der unterhält sich mit einer Blondine in der Gemäldegalerie.»
«Noch ein Tänzchen, Vivi?» Alexander streckte die Hand aus, um sie wieder zur Tanzfläche zu führen.
«Ich glaube, den lasse ich aus.» Sie fasste sich ans Haar und stellte erschrocken fest, dass sich ihre Locken nicht mehr weich und rund anfühlten, sondern in sich zusammengefallen waren.
Vor dem Badezimmer im Erdgeschoss stand eine Schlange, und Vivi reihte sich ein, während das Geplauder und der Lärm um sie herumwogten. Als sie endlich am Anfang der Schlange war, musste sie wirklich auf die Toilette. Plötzlich schob sich jemand vor sie und rief: «Vivi! Schätzchen! Ich bin’s, Isabel. Izzy! Von Mrs. de Montfort? Du siehst sagenhaft aus!»
Eine junge Frau, an die sich Vivi nur vage erinnerte, hob mit einer Hand unelegant ihren langen rosafarbenen Rock an und pflanzte einen Kuss knapp hinter Vivis Ohr. «Schätzchen, könntest du mich kurz vorlassen, ja? Es ist ein absoluter Notfall. Sonst passiert mir gleich was total Peinliches. Super.» Die Tür schwang vor ihnen auf, Isabel verschwand nach drinnen, und Vivi presste ihre Beine zusammen, denn ihr schwaches Bedürfnis verwandelte sich in ein unangenehm dringendes.
«Dämliche Kuh», sagte eine Stimme hinter ihr. Vivi errötete, dachte, die Worte würden ihr gelten. «Sie und diese Forster-Tusse haben Toby Duckworth und die Gardeoffiziere den ganzen Abend mit Beschlag belegt.»
«Athene Forster mag Toby Duckworth nicht mal. Sie zieht nur eine Show ab, weil sie weiß, dass er sich in sie verknallen wird.»
«Er und die halbe Kaserne von Kensington.»
«Ich verstehe nicht, wieso sie Athene nicht durchschauen.»
«Aber zu sehen bekommen sie bestimmt genug von ihr.» In der Schlange hinter Vivi wurde gelacht, und Vivi nahm ihren Mut zusammen, um einen Blick über die Schulter zu werfen.
«Ihre Eltern sprechen kaum noch mit ihr, habe ich gehört.»
«Wundert dich das? Bei dem Ruf, den sie inzwischen hat?»
«Weißt du, dass man sich von ihr erzählt …»
Die Stimmen hinter Vivi senkten sich zu einem Flüstern, und sie wandte sich wieder der Tür zu, damit niemand dachte, sie würde lauschen. Sie versuchte erfolglos, nicht an ihre Blase zu denken. Dann versuchte sie, noch erfolgloser, nicht daran zu denken, wo Douglas sein mochte. Sie hatte ihn den ganzen Abend lang kaum gesehen, und wenn doch, hatte er gewirkt wie ein unzugänglicher Fremder, überhaupt nicht wie ihr Douglas.
«Gehst du rein?» Die junge Frau hinter ihr deutete auf die offene Tür. Isabel war wortlos abgerauscht. Verärgert ging Vivi hinein.
Sie benutzte die Toilette, zupfte dann frustriert an ihrem Haar herum, puderte sich das schweißglänzende Gesicht und versuchte ungeschickt, ihre bereits an Spinnenbeine erinnernden Wimpern nachzutuschen. Es war inzwischen nichts Märchenhaftes mehr an ihrem Aussehen, dachte sie. Es sei denn, man bezog Cinderellas hässliche Stiefschwestern mit ein.
Das ungeduldige Klopfen an der Tür wurde zu beharrlich, um es weiter zu ignorieren. Vivi trat auf den Flur, bereit, sich zu entschuldigen, doch niemand beachtete sie.
Alle schauten in Richtung Spielzimmer, wo es offensichtlich Wirbel gab. Vivi folgte den anderen, während sie spürte, dass es plötzlich kühler wurde. Sie hörte einen gequetschten Hornklang und dachte, dass der Wettbewerb im Jagdhornblasen, von dem ihr Xander erzählt hatte, begonnen haben musste. Doch mit Können hatte dieser Klang nichts zu tun, die Luft wurde stoßweise in das Horn geblasen, als wäre jemand atemlos oder würde lachen.
Vivi blieb hinter einer Gruppe Männer an der Tür des Spielzimmers stehen. Auf der gegenüberliegenden Seite des riesenhaften Raumes hatte irgendwer die Terrassentüren geöffnet, sodass Schneeflocken hereinwehten. Sie schlang die Arme um sich, spürte, dass sie Gänsehaut bekam. Ihr wurde bewusst, dass sie jemandem auf den Fuß getreten war, doch der Mann bemerkte es nicht. Er starrte einfach geradeaus, den Mund leicht geöffnet, als könne er in seiner alkoholisierten Benommenheit nicht glauben, was er da sah.
Denn dort, zwischen dem Roulette- und dem Blackjack-Tisch war ein enorm großer Schimmel, der mit aufgeblähten Nüstern und rollenden Augen nervös vor und zurück trabte, die Hufe noch schneebedeckt, und umgeben von einem Meer Gesichter, deren Ausdruck zwischen Schreck und Vergnügen schwankte. Auf dem Rücken des Pferdes saß die blasseste junge Frau, die Vivi je gesehen hatte. Ihr Kleid war hochgezogen und enthüllte lange, alabasterweiße Beine, ihre Füße steckten in paillettenbesetzten Tanzschuhen und langes, dunkles Haar fiel ihr über den Rücken. Sie hatte den einen bloßen Arm angehoben und lenkte das Tier gekonnt an den Zügeln zwischen den Tischen hindurch, während sie mit dem anderen Arm ein Messinghorn an ihre Lippen hielt. Vivi registrierte abwesend, dass die Reiterin im Gegensatz zu ihren eigenen schon vor Kälte marmorierten Armen nicht im Geringsten zu frieren schien.
«Beute gesichtet!» Einer der jungen Männer in den roten Jagdröcken blies in sein Horn. Zwei andere waren auf Tische gestiegen, um einen besseren Ausblick zu haben.
«Das glaub ich einfach nicht.»
«Spring über den Roulette-Tisch!»
Vivi sah Alexander in der Ecke stehen, der lachend sein Glas hob wie zu einem Ehrensalut. Neben ihm wechselten ein paar matronenhafte Anstandsdamen ängstliche Kommentare und gestikulierten dabei in die Mitte des Raums.
«Darf ich den Fuchs spielen? Ich lasse mich auch von dir fangen …»
«Ekelhaft. Diese Person würde alles tun, um Aufmerksamkeit zu erregen.»
Vivi erkannte bei dem abfälligen Ton die Stimme der Frau aus der Schlange vor der Toilette wieder. Aber sie war, wie alle anderen, von dem unwahrscheinlichen Anblick gebannt. Athene Forster hatte das Pferd zum Stehen gebracht, beugte sich über seinen Hals und sagte mit kehliger Stimme zu einer Gruppe Männer: «Hat irgendwer was zu trinken für mich, ihr Lieben?»
Ihre Stimme hatte einen wissenden Beiklang, einen Anflug von Traurigkeit, der vielleicht selbst in Athenes fröhlichsten Momenten mitschwang. Ein Meer von Gläsern wurde ihr entgegengehalten, glitzerte unter der wattstarken Brillanz des Kronleuchters. Sie ließ ihr Horn los, hob ein Glas und leerte es unter Beifall in einem Zug. «Und wer von euch Schätzchen hat eine Zigarette für mich? Ich habe meine verloren, als ich über die Rosenhecke gesprungen bin.»
«Athene, hast du womöglich vor, für uns die Lady Godiva zu geben?»
Lachen brandete bei der Vorstellung der nackten Reiterin Godiva aus der Legende auf. Doch es verstummte abrupt. Ebenso wie das Spiel der Band, und Vivi drehte sich um, als in ihrer Nähe aufgeregt geflüstert wurde.
«Was in aller Welt tun Sie da?» Lena Bloomberg stand in der Mitte des Raums dem tänzelnden Pferd gegenüber, die Hände mit weißen Fingerknöcheln in die Hüften gestemmt. Ihr Gesicht war rot vor unterdrückter Wut, und ihre Augen blitzten wie die Diamanten um ihren Hals. Vivis Magen zog sich vor gespannter Erwartung zusammen.
«Haben Sie mich gehört?»
Athene Forster wirkte nicht im Mindesten eingeschüchtert. «Das ist ein Jagdball. Der alte Forester hier hat sich ein bisschen ausgeschlossen gefühlt.»
Erneut brandete Gelächter auf.
«Sie haben kein Recht …»
«So wie ich es sehe, hat Forester ein größeres Recht, hier zu sein, als Sie, Mrs. Bloomberg. Mr. B. hat mir erzählt, dass Sie nicht einmal jagen.»
Der Mann neben Vivi stieß einen leisen, bewundernden Fluch aus.
Mrs. Bloomberg öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch Athene winkte lässig ab. «Forester und ich dachten, wir könnten diesen Ball ein bisschen … authentischer gestalten.» Athene beugte sich vor, um ein weiteres Glas Champagner entgegenzunehmen, trank es in einem Zug aus und fügte leise hinzu: «Im Gegensatz zu diesem Haus.»
«Steigen Sie … steigen Sie auf der Stelle vom Pferd meines Mannes ab! Wie können Sie es wagen, unsere Gastfreundschaft derart zu missbrauchen?» Lena Bloomberg gab schon normalerweise eine imposante Erscheinung ab; durch ihre Körpergröße zusammen mit dem Einfluss, den sie aufgrund ihres enormen Reichtums besaß, fehlte ihr offenbar die Erfahrung, dass man sich ihr widersetzen konnte. Nun aber hatte ihre unterdrückte Wut jede verbliebene Heiterkeit im Raum verfliegen lassen. Die Leute wechselten beklommene Blicke, fragten sich, wer von beiden zuerst nachgeben würde.
Quälende Stille breitete sich aus.
Es schien Athene zu sein. Sie musterte Mrs. Bloomberg eine kleine Ewigkeit lang, dann lenkte sie das Pferd langsam zwischen den Tischen zurück und hielt nur an, um sich eine Zigarette geben zu lassen.
Die Stimme der älteren Frau durchschnitt die Stille. «Man hatte mich davor gewarnt, Sie einzuladen, aber Ihre Eltern haben mir versichert, dass Sie ein bisschen erwachsener geworden sind. Sie haben sich offenkundig geirrt, und ich werde sie das unmissverständlich wissenlassen.»
«Armer Forester», gurrte Athene über den Hals des Pferdes gebeugt. «Er hatte sich so auf eine Partie Poker gefreut.»
«Sie können sich glücklich schätzen, dass das Wetter es nicht zulässt, Sie hochkant hinauszuwerfen, junge Dame.» Mrs. Bloombergs eisige Worte folgten Athene, während sie das Pferd durch die Terrassentüren nach draußen lenkte.
«Oh, machen Sie sich keine Sorgen um mich, Mrs. Bloomberg.» Athene drehte sich mit einem trägen, charmanten Lächeln um. «Ich bin schon aus weitaus stilvolleren Anwesen als diesem hinausgeworfen worden.» Nach einem Fersentritt ihrer paillettenbesetzten Schuhe setzte das Pferd über die kleine Treppe hinweg und trabte beinahe lautlos in die verschneite Dunkelheit.
Einen Moment lang herrschte lastende Stille, dann begann die Band auf Anweisung der unbeugsamen Gastgeberin wieder zu spielen. Die Gäste kommentierten lautstark das Geschehen und deuteten in Richtung der schneeigen Hufabdrücke auf dem schimmernden Holzboden, während der Ball langsam wieder in die Gänge kam. Der Moderator verkündete, dass der Wettbewerb im Hornblasen in fünf Minuten im Großen Saal stattfinden würde und dass im Speisesaal weiterhin das Abendessen serviert wurde. Innerhalb von Minuten war von Athenes Auftritt nichts weiter geblieben als ein geisterhafter Eindruck – der bereits durch die Aussicht auf die nächste Unterhaltungseinlage verblasste – und ein paar Pfützen geschmolzenen Schnees auf dem Fußboden.
Vivi sah zu Douglas hinüber. Er stand bei dem imposanten Kamin und hatte den Blick nicht von den inzwischen geschlossenen Terrassentüren abgewandt, ebenso wenig wie er Athene Forster aus den Augen gelassen hatte, als sie ein paar Schritte von ihm entfernt auf dem riesigen Pferd saß. Während die anderen um ihn herum erschrocken in nervöses Gekicher ausgebrochen waren, hatte in Douglas Fairley-Hulmes Miene ein anderer Ausdruck gelegen. Etwas Entrücktes und Hingerissenes. Etwas, das Vivi Angst machte. «Douglas?», sagte sie, als sie auf ihn zuging und dabei versuchte, nicht auf dem nassen Boden auszurutschen.
Er schien sie nicht zu hören.
«Douglas? Du hast mir einen Tanz versprochen.»
Er brauchte mehrere Sekunden, um sie wahrzunehmen. «Wie? Oh, Vee. Ja, stimmt.» Er schaute immer noch zu den Terrassentüren. «Ich … Ich muss nur vorher etwas trinken. Ich bringe dir etwas mit. Bin gleich wieder da.»
Das war der Moment, wie Vivi später erkannte, in dem sie hätte einsehen müssen, dass ihr Abend kein märchenhaftes Ende nehmen würde. Douglas war nicht mit den Getränken zurückgekommen. Sie hatte mit einem vagen Lächeln beinahe vierzig Minuten am Kamin gestanden und versucht, selbstbewusst auszusehen und nicht wie jemand, den man einfach hatte stehenlassen. Als sie mitbekam, dass Leute sie ansahen und derselbe Kellner drei Mal vorbeigekommen war, um schließlich zu fragen, ob alles in Ordnung war, nahm sie Alexanders zweite Aufforderung zum Tanz an.
Um Mitternacht hatte es einen Toast gegeben und ein merkwürdiges, improvisiertes Spiel, bei dem ein junger Mann mit einem Fuchsschwanz am Jackett von seinen Freunden in roten Jagdröcken mit Jagdhörnern durchs Haus verfolgt wurde. Einer war auf dem gebohnerten Boden ausgerutscht, an das Treppengeländer geprallt und ohnmächtig geworden. Doch ein anderer hatte ihm einen Drink eingeflößt, und er war hustend wieder zu Bewusstsein gekommen, hatte sich aufgerappelt und die Verfolgungsjagd wieder aufgenommen, als sei nichts gewesen. Um ein Uhr, als Vivi am liebsten in ihr Zimmer gegangen wäre, begleitete sie Alexander zum Blackjack-Tisch, wo er überraschend sieben Pfund gewann. In einem Anfall von Überschwänglichkeit erklärte er ihr, sie solle das Geld behalten. Die Art, auf die er sagte, sie sei sein «Glücksbringer», rief leichte Übelkeit in ihr hervor – aber vielleicht lag das auch an all dem Champagner, den sie getrunken hatte.
Um zwei Uhr wurde Vivi endgültig bewusst, dass Douglas sein Versprechen nicht halten würde, dass sie sich nicht in seiner sanften Umarmung wiederfinden würde und dass es den langersehnten Kuss am Ende des Abends nicht geben würde. Inmitten von all dem Chaos, den kreischenden jungen Frauen, deren Gesichter nun gerötet und übernächtigt waren, den jungen Männern, die betrunken auf den Sofas lagen oder unverständlich herumkrakeelten, wollte sie nur noch allein sein und weinen.
«Xander, ich glaube, ich gehe in mein Zimmer.»
Sein Arm lag lässig um ihre Taille, während er mit einem seiner Freunde sprach. Überrascht wandte er sich ihr zu. «Was?»
«Ich bin wirklich müde. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich hatte einen wundervollen Abend, vielen Dank.»
«Du kannst jetzt nicht schlafen gehen.» Er schwankte theatralisch rückwärts. «Die Party fängt doch gerade erst richtig an.» Seine Ohren waren knallrot, und er konnte seine Augen nicht mehr ganz offen halten.
«Tut mir leid. Du warst sehr nett. Falls du Douglas über den Weg läufst, würdest du ihm sagen, dass ich mich zurückgezogen habe?»
Eine Stimme hinter Alexander bellte: «Douglas? Ich glaube nicht, dass ihm das besonders viel ausmachen wird.» Mehrere Männer wechselten Blicke und brachen in schallendes Gelächter aus.
Sie fühlte sich jämmerlich, als sie mit vor der Brust verschränkten Armen das Spielzimmer verließ. Es kümmerte sie nicht mehr, wie sie aussah. Die Leute um sie herum waren ohnehin zu betrunken, um sie zu beachten. Die Band machte Pause, und über die Lautsprecher ertönte ein melancholischer Song von Dusty Springfield, bei dem Vivi gegen aufsteigende Tränen kämpfen musste.
«Vivi, du kannst noch nicht nach oben gehen.» Alexander war ihr gefolgt. Er streckte die Arme aus und drehte sie an den Schultern herum. Der schräge Winkel, in dem er seinen Kopf hielt, sagte ihr alles über seinen Alkoholkonsum.
«Es tut mir wirklich leid, Alexander. Ehrlich, es war super. Aber ich bin müde.»
«Komm … iss mal was. Im Frühstücksraum gibt es gleich Kedgeree.» Er hatte sie am Arm gepackt, und sein Griff war unangenehm fest. «Weißt du … du siehst sehr hübsch aus in deinem … deinem Kleid.» Seine Augen waren jetzt auf ihre Rundungen gerichtet, und der Alkohol hatte jede Spur von Zurückhaltung aus seinem Blick verschwinden lassen. «Sehr schön», sagte er. Und dann, nur für den Fall, dass sie es nicht mitbekommen hatte: «Sehr, sehr schön.»
«Xander, vielleicht können wir uns morgen zum Frühstück treffen.»
Er schien sie nicht gehört zu haben. «Das Problem mit dünnen Frauen», sagte er in Richtung ihrer Brust, «und es gibt heutzutage so verdammt viele dünne Frauen …»
«Xander?»
«… ist, dass sie keine Brüste haben. Keine Brüste, die der Rede wert sind.» Während er sprach, hob er zögernd eine Hand in Richtung ihres Busens.
«Oh! Du …» Vivis Erziehung hatte ihr keine angemessene Antwort an die Hand gegeben. Sie drehte sich um und verließ eilig den Raum.
Sie musste Douglas finden. Vorher würde sie nicht schlafen können. Sie musste sich davon überzeugen, dass er – ganz gleich wie unerreichbar er an diesem Abend gewesen war – wieder ihr Douglas sein würde, wenn sie erst einmal hier weg wären. Der freundliche, ernsthafte Douglas, der ihr den platten Reifen an ihrem ersten Fahrrad repariert hatte, der, wie ihr Vater sagte, ein «durch und durch anständiger junger Mann» war, und der sie zwei Mal zu Tom Jones ins Kino mitgenommen hatte. Sie wollte ihm von Alexanders grässlichem Benehmen erzählen und hegte die neu aufkeimende Hoffnung, dass es Douglas dazu bringen konnte, seine wahren Gefühle für sie zu erkennen.
Es war jetzt einfacher, ihn zu suchen, weil die unübersichtliche Menge der Gäste nun in kleinen Gruppen beisammensaß. Von draußen war ein Traktor zu hören, der versuchte, eine Schneise durch den Schnee zu schlagen. Douglas war nicht im Spielzimmer, nicht im Ballsaal, nicht in dem anschließenden Flur, nicht unter der Freitreppe und er trank auch nicht mit den Rotröcken in der Reynard Bar. Niemand beachtete sie mehr, die fortgeschrittene Uhrzeit und der Alkoholpegel ließen sie unsichtbar werden. Aber es schien, als sei auch Douglas unsichtbar geworden. Ein paarmal fragte sie sich, erschöpft, wie sie war, ob er sich in Anbetracht seiner Abneigung gegen solche pompösen, von Standesdünkel beherrschten Einladungen einfach auf den Nachhauseweg gemacht hatte. Vivi schniefte unglücklich, als ihr bewusst wurde, dass sie, weil sie sich derart in ihre Fantasie davon hineingesteigert hatte, er würde sie in ihr Zimmer begleiten, überhaupt nicht daran gedacht hatte, danach zu fragen, wo sein Zimmer lag. Ich suche Mrs. Bloomberg, sie wird es mir sagen, überlegte sie. Oder ich klopfe einfach an jeder Tür in dem anderen Gebäudetrakt, bis mir jemand sagen kann, wo er ist.
Sie ging an der Haupttreppe vorbei, auf der mehrere Paare saßen. Müde durchquerte sie die Ahnengalerie mit ihren so gar nicht vom Alter verblassten Bildern und verdächtig hell schimmernden Goldrahmen. Auf dem dicken roten Teppich lagen achtlos ausgetretene Zigarettenkippen und Servietten. Vor der Küche, aus der jetzt der Geruch von frisch gebackenem Brot drang, kam sie an Isabel vorbei, die lachend an der Schulter eines jungen Mannes lehnte. Sie schien Vivi nicht mehr zu erkennen.
Am Ende des Flurs angekommen, warf Vivi einen Blick über die Schulter, um sich zu versichern, dass niemand sie sah, und gähnte herzhaft. Sie bückte sich, um ihre Schuhe auszuziehen, die schon seit einigen Stunden drückten.
Sie hörte es, als sie sich wieder aufrichtete: ein Geräusch wie von einer Balgerei, dazu ein gelegentliches Ächzen, als wäre draußen jemand betrunken hingefallen und würde versuchen, wieder aufzustehen. Sie starrte die Tür an, durch die das Geräusch gekommen war, und sah, dass sie einen Spalt aufstand. Sie führte offenbar nach draußen. Ein Hauch arktisch kalter Luft strich herein. Vivi drückte die Tür leise auf und spähte an der Hausfassade entlang.
Zuerst dachte sie, die Frau müsse hingefallen sein, denn er schien sie in dem Versuch zu stützen, sich an der Hauswand aufzurichten. Sie überlegte, ob sie ihre Hilfe anbieten sollte. Dann begriff sie mit einem Schlag, dass die rhythmischen Geräusche, die sie gehört hatte, von diesen Leuten kamen. Dass die langen, blassen Beine der Frau nicht die schlaffen Glieder einer Betrunkenen waren, sondern fest um den Mann geschlungen. Während sich Vivis Augen an die Dunkelheit gewöhnten, erkannte sie mit einem Schreck die langen, dunklen Haare, die der Frau wirr ins Gesicht hingen, und den Paillettenschuh an ihrem Fuß, auf den Schneeflocken niederrieselten.
Vivi war abgestoßen und gebannt zugleich, starrte mehrere Sekunden hin, bis sie voller Scham begriff, was sie sah. Sie richtete sich auf, lehnte sich an die halb offene Tür, und die Geräusche hallten grotesk in ihren Ohren wider, bildeten einen misstönenden Gegensatz zum Klopfen ihres Herzens.
Sie wollte sich bewegen, doch je länger sie dort stand, desto mehr erstarrte sie, obwohl ihre Arme von der Kälte fleckig wurden und ihr die Zähne klapperten. Statt wegzulaufen, lehnte sie an der kühlen Eichentür und spürte, wie ihre Beine unter ihr nachgeben wollten: Sie kannte die Stimme des Mannes; auch sein Hinterkopf, seine leicht geröteten Ohren, die scharfe Kante, an der sein Haar auf seinen Kragen traf, waren ihr vertraut: so vertraut wie vor zwölf Jahren, als sie sich in ihn verliebt hatte.
Kapitel Drei
Sie mochte nicht zur Debütantin des Jahres gekürt worden sein (über die Gründe dafür sprach niemand mehr, nachdem sie nun «solide» geworden war), dennoch gab es kaum einen Society-Reporter, der bezweifelte, dass die Hochzeit von Athene Forster, die mit Letzte Debütantin und It-Girl tituliert wurde – und von weniger nachsichtigen Matronen mit wesentlich unschmeichelhafteren Bezeichnungen –, und Douglas Fairley-Hulme, Spross des Suffolk-Zweigs der Gutsbesitzerdynastie Fairley-Hulme, die Hochzeit des Jahres genannt werden konnte.
Die Gästeliste wies genügend altes Geld und Doppelnamen auf, um dem Ereignis einen prominenten Platz in den Klatschspalten zu sichern. Der Empfang fand in einem der besseren Gentlemen’s Clubs in Piccadilly statt, dessen üblicherweise von Tabakrauch durchzogener Pomp vorübergehend von Frühlingsblumen und weißen Seidendraperien überdeckt wurde.
Da war der Bräutigam, der allgemein als «guter Fang» galt und mit seinem seriösen Auftreten, seinen klaren Gesichtszügen und seinem Familienvermögen bei potenziellen Schwiegermüttern in nah und fern für gebrochene Herzen gesorgt hatte. Sogar wenn er einfach nur dastand, förmlich und steif in seinem Cutaway, den gewichtigen Anlass beinahe sichtbar auf seinen breiten Schultern tragend, blitzte immer wieder sein offenkundiges Glück auf, zeigte sich in den sanften Blicken, die er quer durch den Raum auf seine Braut warf. Und genauso eindeutig war es, dass er, trotz der Anwesenheit seiner Familie, seiner besten Freunde und hundert anderer, die ihm alle von Herzen gratulieren wollten, am liebsten mit ihr allein gewesen wäre.
Und dann war da die Braut. Ihr seelenvoller Blick und ihr schräg geschnittenes Kleid hatten selbst ihre erbittertsten Kritiker dazu gebracht anzuerkennen, dass sie – ganz gleich, welche Eigenschaften sie sonst noch hatte (und dazu gab es reichlich Meinungen) – eine große Schönheit war. Ihr Haar, das normalerweise ungebändigt über ihren Rücken fiel, war gezähmt worden, glänzte majestätisch hochgesteckt auf ihrem Kopf, und wurde von einem Diadem aus echten Diamanten umrahmt. Die Haut anderer Frauen hätte durch die weiße Seide fahl wirken können, doch ihr Teint spiegelte ihre marmorne Glätte wider. Ihre hellen, aquamarinfarbenen Augen waren professionell geschminkt worden und schimmerten unter silbernem Lidschatten. Ihr Mund formte ein kleines, geheimnisvolles Lächeln, das keine Zähne sehen ließ, es sei denn, sie drehte sich mit einem breiten, unbefangenen Grinsen zu ihrem Ehemann um, oder bevor sie gelegentlich in einen so leidenschaftlichen Kuss versanken, dass die Umstehenden nervös lachten und wegschauten.
Justine Forster saß mit einem kämpferischen Lächeln am Ehrentisch. Nachdem sie versucht hatte zu ignorieren, dass sich ihr cholerischer Ehemann noch immer ärgerte, weil durch den Hochzeitstermin seine jährliche Veteranenfahrt nach Ypern unterbrochen worden war, was er bislang nicht weniger als drei Mal erwähnt hatte (einmal während seiner Tischrede!), versuchte sie nun zu ignorieren, dass ihre Tochter, die zwei Plätze entfernt saß, ihrem frischgebackenen Ehemann einen wortgetreuen Bericht von dem «Frauengespräch» gab, das sie unklugerweise am Vorabend mit ihr geführt hatte.
«Sie hält die Pille für unmoralisch, Liebling», flüsterte Athene und prustete vor Lachen. «Sie meint, wenn wir zu Dr. Harcourt gehen, um uns ein Rezept zu holen, klingelt bei dem neuen Papst sofort das rote Telefon und wir werden ins Fegefeuer geworfen.»
Douglas, noch immer nicht an derart freimütige Diskussionen von Schlafzimmerangelegenheiten gewöhnt, tat sein Bestes, um gelassen zu bleiben, während er einen mittlerweile vertrauten Anfall von körperlichem Verlangen nach der Frau an seiner Seite unterdrückte.
«Ich habe ihr erklärt, dass der Papst vermutlich zu beschäftigt ist, um sich ausgerechnet darüber Sorgen zu machen, dass ich die Pille nehme, aber das sieht sie überhaupt nicht so. Echt, als ob Paul VI. – oder der VIII., oder welcher es jetzt ist – alles wüsste. Ob wir schmutzige Gedanken haben, ob wir nur zum Vergnügen miteinander schlafen wollen und ob wir genügend Geld in den Klingelbeutel werfen.» Sie beugte sich zu ihrem Mann und sagte in einem Flüstern, das gerade laut genug war, damit ihre Mutter es hören konnte: «Douglas, Liebling, er weiß wahrscheinlich sogar, wo du gerade deine Hand hast.»
Douglas hörte ein ersticktes Husten von rechts und versuchte vergeblich, seine Frau zum Schweigen zu bringen, dann fragte er seine Schwiegermutter – beide Hände gut sichtbar –, ob er ihr Wasser einschenken dürfe.
Douglas’ Verlegenheit hielt nicht lange an. Er war schnell zu dem Schluss gekommen, dass er Athenes Unbändigkeit liebte, ihren sorglosen Umgang mit den Sitten und Einschränkungen, die ihr Leben bisher bestimmt hatten. Athene teilte seine aufkeimende Überzeugung, dass die sogenannten besseren Kreise zunehmend ihre Bedeutung verloren, dass sie Pioniere sein könnten, die reden und tun konnten, was sie wollten, ohne jede Rücksicht auf Konventionen. Er musste das alles mit seiner Arbeit auf dem Anwesen seines Vaters in Einklang bringen, aber Athene war glücklich darüber, ihr eigenes Ding machen zu können. Sie hatte kein besonderes Interesse daran, ihr neues Haus einzurichten – «Unsere Mütter sind bei so was viel besser» –, aber sie mochte es, mit ihrem neuen Pferd auszureiten (sein Brautgeschenk an sie), lesend vor dem Kamin zu liegen, mit ihm zum Tanzen oder ins Kino nach London zu fahren, und vor allem anderen wollte sie so viel Zeit wie möglich mit ihm im Bett verbringen.
Douglas hatte nicht gewusst, dass man sich so fühlen konnte. Er verbrachte seine Tage in einer Art halbbewusster Dauererektion, war zum ersten Mal in seinem Leben außerstande, sich auf seine Arbeit, die familiären Pflichten und seine Rolle als Nachwuchs-Chef zu konzentrieren. Stattdessen waren seine Antennen auf sanfte Kurven, dünne Stoffe und Gerüche ausgerichtet. Sosehr er es versuchte, es gelang ihm nicht, Energie für seine einstigen Interessen aufzubringen oder sich weiter um das Fehlverhalten der herrschenden Klasse zu sorgen. Nichts erschien ihm relevant oder so fesselnd wie zuvor. Jedenfalls nicht im Vergleich zu den körperlichen Freuden mit seiner Braut. Der junge Mann, der stets eine skeptische Distanz zu dem Chaos einer ausgewachsenen Liebesgeschichte gewahrt hatte, befand sich plötzlich im luftleeren Raum der … was war es? Begierde? Besessenheit? Worte schienen irgendwie unzureichend für die blinde Gedankenlosigkeit des Ganzen, das Hautkontakt-Bedürfnis, die grandiose, gierige Wollust. Das harte Stoßen …
«Gönnst du dem alten Mädchen einen Quickie?»
«Was?» Errötend starrte Douglas seinen Vater an, der plötzlich neben ihm aufgetaucht war. Seine kleine, drahtige Gestalt hielt sich typisch aufrecht in seinem Cutaway, seine wettergegerbte, wachsame Miene war durch Alkohol und Stolz weicher geworden.
«Deiner Mutter. Du hast ihr einen Tanz versprochen. Sie würde gern ein bisschen herumwirbeln, wenn ich die Band dazu bringen kann, einen Quickstep zu spielen. Du musst deine Verpflichtungen erfüllen, mein Junge. Dein Wagen wird bald da sein.»
«Oh. Richtig. Natürlich.» Douglas stand auf und versuchte, sich zu konzentrieren. «Athene, Liebling, würdest du mich entschuldigen?»
«Nur, wenn dein großartiger Vater auch mir altem Mädchen einen Quickie gönnt.» Bei dem Lächeln, das sie zu ihrem Unschuldsblick aufsetzte, zuckte Douglas zusammen.
«Mit dem größten Vergnügen, meine Liebe. Lass dich einfach nicht davon stören, dass ich ein paarmal mit dir an dem alten Dickie Bentall vorbeitanzen werde. Ich möchte ihm demonstrieren, dass ich noch Saft in den alten Knochen habe.»
«Ich gehe dann, Mummy.»
Serena Newton sah von ihrem Wiener Schnitzel auf und blickte ihre Tochter überrascht an. «Aber du kannst nicht gehen, solange sie noch da sind, Liebling. Es wurde noch nicht einmal ihr Auto vorgefahren.»
«Ich habe Mrs. Thesiger versprochen, heute Abend auf ihr Kind aufzupassen. Also muss ich jetzt nach London, damit ich mich noch umziehen kann.»
«Aber davon hast du überhaupt nichts gesagt. Ich dachte, du kommst mit Daddy und mir nach Hause.»
«Nicht dieses Wochenende, Mummy. Ich verspreche, dass ich in einer oder zwei Wochen wiederkomme. Es war wirklich schön, euch zu sehen.»
Hinter ihr gab es Applaus, als der frischgebackene Ehemann seine Braut auf die Tanzfläche führte. Vivi wandte sich mit unbewegter Miene von dem prüfenden Blick ihrer Mutter ab. Sie war in den letzten Monaten ziemlich gut darin geworden, ihre Gefühle zu verbergen.
Ihre Mutter streckte die Hand aus. «Du warst praktisch seit einer Ewigkeit nicht zu Hause. Ich kann nicht glauben, dass du jetzt schon wieder weglaufen willst.»
«Ich laufe nicht weg. Ich hab’s dir doch gesagt, Mummy. Ich muss heute Abend babysitten.» Sie verzog das Gesicht zu einem breiten, beruhigenden Lächeln.
Mrs. Newton beugte sich vor, legte eine Hand auf Vivis Knie und senkte ihre Stimme. «Ich weiß, dass das schrecklich schwer für dich war, Liebling.»
«Was?» Unwillkürlich wurde Vivi rot.
«Ich war auch einmal jung, weißt du.»
«Ganz bestimmt, Mummy. Aber ich muss wirklich los.» Mit dem Versprechen, dass sie anrufen würde, und leichten Schuldgefühlen angesichts der verletzten Miene ihrer Mutter drehte sich Vivi um und durchquerte, den Blick auf die Tür fixiert, den Raum. Sie verstand die Besorgnis ihrer Mutter. Sie wirkte jetzt älter. Der Verlust hatte ihrer Miene einen neuen, wissenden Ausdruck verliehen, der Kummer ihre einst molligen Konturen abgeschliffen. Es war wirklich paradox, dachte sie, dass sie nun die Erscheinung, die sie sich so gewünscht hatte – Schlankheit und eine Art ermattete Erfahrenheit –, durch den Verlust genau des Mannes gewann, für den sie sich diese Erscheinung gewünscht hatte.
Und obwohl Vivi normalerweise sehr heimatverbunden war, hatte sie in den vergangenen Monaten alles getan, um so selten wie möglich zu ihrer Familie zu fahren. Sie hatte die Telefonate kurz gehalten, jede Anspielung auf Personen außerhalb der Familie vermieden, den Kontakt zu ihren Eltern lieber durch kurze, lustige Nachrichten auf Postkarten gehalten und ein ums andere Mal versichert, dass sie unmöglich zu Daddys