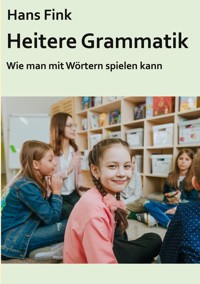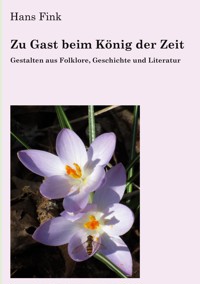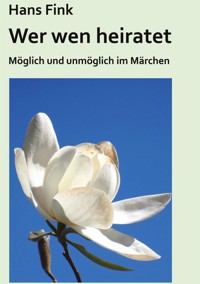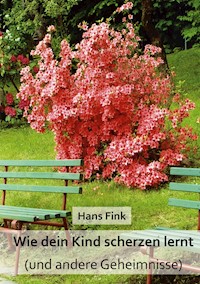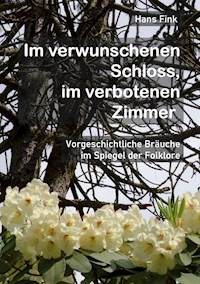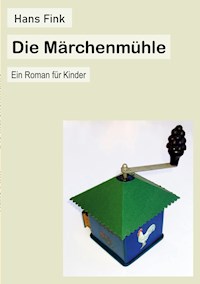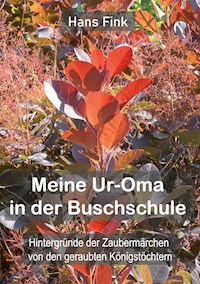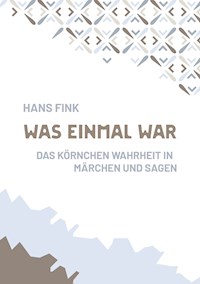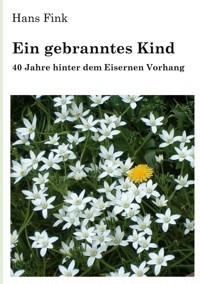
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Verfasser beschreibt die sozialen und politischen Verhältnisse in Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg, unter der Besatzungsmacht Sowjetunion. Auch in Rumänien entwickelte sich bald die Nomenklatura, eine neue Ausbeuterklasse, bestehend aus Funktionären von Partei und staatlicher Verwaltung. Das Buch zeigt erstmalig für Rumänien, wie und in welchem Maße die Mitglieder der Nomenklatura ihre Vorrechte wahrnahmen. Dem Diktator Nicolae Ceausescu sind mehrere Abschnitte gewidmet. Der Aufstand, der zu seinem Sturz führte (die sogenannte Revolution), traf die Bevölkerung unvorbereitet. Gut vernetzte Mitglieder aus der zweiten Reihe der Nomenklatura rissen sich danach Teile des Volksvermögens unter den Nagel. Heute sind die Vermögensunterschiede in Rumänien größer als vor dem Krieg. Der Text ist gewürzt mit politischen Witzen, für die der Verfasser seinerzeit eingesperrt worden wäre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Vorwort
Prominente Zeugen
1. In der jungen Sowjetunion entsteht eine neue Ausbeuterklasse/
2. Die Privilegien der Funktionäre in der Sowjetunion
Schein und Sein
1. Die Partei regiert im Namen des Volkes, aber ohne das Volk und gegen das Volk
2. Hintergründe der Diktatur
3. Ein „Export von Revolution“
4. Die Securitate als Staat im Staat
5. Geschäfte mit dem Westen
6. Vorgetäuschte Demokratie, vorgetäuschte Erfolge
7. Die Verfassung als Geheimdokument
8. Zum Heucheln erzogen
Nach sowjetischem Muster
Rumänien kopiert die Politik des „großen Bruders“
Unsere Nomenklatura
1. Manager mit Kastendünkel
2. Die Privilegien der Funktionäre in Rumänien
Rumänische Besonderheiten
1. Handel mit aller Welt
2. Ceauşescus Gigantomanie
3. Die Geburtenregelung
4. Zwei Gesichter der Nationalitätenpolitik
5. Der Personenkult
Vierzig Jahre Indoktrination
1. Verwirrspiele der Nomenklatura
2. Ein totalitärer Staat
3. Die Irreführung der Öffentlichkeit
4. Die politischen Witze
5. Wie die Lehre von Marx und Engels verfälscht worden ist
Der sozialistische Realismus
Not kennt kein Gebot
„Der Diebstahl war die mit Abstand bedeutendste Oppositionsform im Kommunismus“
Die deutsche Minderheit
1. Das kommunistische Regime verlängert ihre Existenz um zwei Generationen
2. Vorbehalte gegen deutsche Parteimitglieder
3. In der Redaktion „Neuer Weg“
4. Die verhagelte kulturelle Blüte
Der Unrechtstaat
Moderne Leibeigene und Möchtegern-Kapitalisten
Hunger, Kälte, Dunkelheit
Das Fußvolk bezahlt Ceauşescus Fehlspekulationen
Die sogenannte Revolution
1. Der Offene Brief
2. Als der Maisbrei explodierte
Ein trüber Morgen
1. Die Proklamation von Temeswar
2. Die Arbeiter
3. Die Bauern
Ohne die Maske
Die Chefs der Nomenklatura als Wendehälse
Schluss
Ausklang
Zeittafel
Verzeichnis der Ortsnamen deutsch-rumänisch
Bibliografie
Das Vorwort
Ich bin im Mai 1942 geboren, mitten im bisher größten Krieg. Dessen wahre Geschichte hat mir niemand erzählt, als ich schon verständig genug war, um sie zu begreifen. Die erwachsenen Familienmitglieder, die jene Geschichte auch nur bruchstückweise kannten, hielten sich zurück, damit wir Kinder nicht vielleicht politisch bedenkliche Einzelheiten ausplaudern. Und in der Schule wurde eine aus dem Blickwinkel der Rumänischen Kommunistischen Partei zurechtgeschneiderte (übrigens auffällig kurze) Version mitgeteilt. Mehr durften die Lehrer nicht sagen.
Dass die Deutschen nach dem 23. August 1944 aus Rumänien vertrieben werden sollten (wie die Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei) und nachher, als das nicht gelang, übers ganze Land verstreut werden sollten, kam selbstverständlich nicht zur Sprache. Diese zwei Vorhaben waren längst tabuisiert.
Als Stadtkind ohne nahe Verwandte auf dem Lande wusste ich lange Zeit nichts von dem vielgestaltigen Elend der deutschen Dorfbevölkerung: Die abenteuerliche Flucht vor der Roten Armee. – Die erzwungene Rückkehr unter erniedrigenden Bedingungen. – Ihre Enteignung durch die Bodenreform. – Die Einquartierung von sogenannten Kolonisten, die sich als Herren aufführten. – Die Unterkunft in ausgeplünderten, z.T. zerstörten Häusern.
Ich bin ein gebranntes Kind, weil ich vierzig Jahre lang im kommunistisch regierten Rumänien gelebt habe, in einer als Demokratie ausgegebenen Diktatur, nämlich vom Jahre 1948 an, als ich eingeschult wurde, bis zum Jahre 1989, als die sogenannte Revolution stattfand, die bei Licht besehen ein Staatsstreich war. Zudem gehörte ich der deutschen Minderheit an, einer sogenannten mitwohnenden Nationalität. Davon gab es offiziell sechzehn. Die Fibel wurde ursprünglich in mehr als einem Dutzend Sprachen gedruckt. Die Erklärung für dieses Phänomen liegt auf der Hand: Der Schüler Rumänien hat die Nationalitätenpolitik vom Lehrer Sowjetunion übernommen. Es dürfte aber auch eine Rolle gespielt haben, dass die bis zum August 1944 illegale Rumänische Kommunistische Partei zu ihren Mitgliedern zahlreiche Nicht-Rumänen zählte. (Im Jahre 1933 setzte sie sich wie folgt zusammen: 440 Ungarn, 375 Rumänen, 300 Juden, 140 Bulgaren, 100 Russen, 70 „Moldauer“, 70 Ukrainer und 170 Personen anderer Herkunft.1) Im Jahre 1948 waren die Ungarn und die Juden in den Führungsgremien der RKP stark vertreten. Die Ungarn – Angehörige der offiziell größten, aber nach dem Ersten Weltkrieg stark benachteiligten Minderheit. Die Juden – Angehörige einer mehrsprachigen, verleumdeten, während des Krieges der Ausrottung preisgegebenen Minderheit.
Nur für die in mehrere Stämme zersplitterten Zigeuner, ebenfalls eine umfangreiche Minderheit, gab es keine Fibel, weil sie keine Schriftsprache besaßen.
Zur allgemeinen Überraschung wurden auch Kindergärten und Schulen mit deutscher Unterrichtssprache eingerichtet, von der Grundschule bis zum Lyzeum2. Für die Deutschen? Die den Krieg begonnen haben? Die Mörder sind? Die man enteignet hat? Die keine staatsbürgerlichen Rechte mehr besitzen? Viele Rumänen legten den Finger an die Stirn.
Wahr ist, dass ein Teil der Rumäniendeutschen sich von der Nazi-Ideologie hatte anstecken lassen, ja: sich frenetisch zu ihr bekannt hatte. Im faschistischen rumänischen Staat unter der Fuchtel von Marschall Antonescu war die von Berlin aus gesteuerte Deutsche Volksgruppe ab 1940 die einzige zugelassene politische Organisation. Die meisten deutschen Männer hatten als Soldaten der Waffen-SS am Krieg teilgenommen und waren – ob sie wollten oder nicht – an schrecklichen Gräueltaten beteiligt gewesen, beginnend mit den Kämpfen in Jugoslawien. Wie sollte man die weißen Schafe von den schwarzen unterscheiden? Zunächst war das gar nicht beabsichtigt. Die Kommunistische Partei machte zunächst keinen Unterschied zwischen a) den aktiven Nazis, b) den Mitläufern, die betrogen und erpresst worden waren, c) den Verweigerern und d) den aktiven Gegnern des Regimes, die für ihre Haltung eingekerkert und misshandelt worden waren. Am Vorabend der Aushebung der Deutschen für die Deportation zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion im Januar 1945 überbrachte der neugebackene KP-Kreis-Sekretär Mihai Dalea den im Reschitzaer Arbeiterheim versammelten deutschen Antifaschisten (von denen viele erst paar Monate vorher aus der politischen Haft entlassen worden waren) folgende Weisung des Zentralkomitees: „Ihr geht. Alle. Und als Erste. Drüben sagt ihr dann den anderen: Seht euch das an. Das haben wir gemacht. Was wir zerstört haben, müssen wir jetzt aufbauen.“3 Als ob die Antifaschisten der Volksgruppe angehört hätten! Eine groteske Szene!
Ebenso wenig wurde zwei Monate später, bei der Agrarreform im März 1945, ein Unterschied gemacht, als die Regierung die deutschen Bauern von Feld, Haus und Hof enteignete. Die Regierung konnte sich auf das Volksgruppen-Gesetz vom November 1940 berufen: Laut offizieller Lesart gehörten der Deutschen Volksgruppe sämtliche rumänischen Staatsbürger deutscher Nationalität an (weil damals auch keiner gefragt worden ist). Das Volksgruppen-Gesetz diente den rumänischen Politikern als Handhabe, um praktisch alle Deutschen als Kollaborateure einzustufen. Von der Enteignung wurden nur Familien ausgenommen, deren Oberhaupt nachweislich nicht Mitglied der Deutschen Volksgruppe war oder nach dem 23. August 1944 in der rumänischen Armee gekämpft hat.
Aus der Sicht eines Teils der Mehrheitsbevölkerung blieben die deutschen Mitbürger für immer Faschisten bzw. Hitleristen. Als Ministerpräsident Ion Gheorghe Maurer in den fünfziger Jahren seinen Sohn Jean in die Bukarester Deutsche Schule einschreiben ließ (die offiziell anders hieß), soll Parteichef Gheorghiu-Dej ihn gefragt haben: „Warum schickst du deinen Sohn zu den Faschisten?“ Worauf Maurer geantwortet haben soll: „Damit sie ihm Disziplin beibringen.“4 – Mein Freund Rudolf Kastel, geboren 1940, wurde als Student der Temeswarer Maschinenbaufakultät von manchen rumänischen Kollegen als Hitlerist angesprochen: „Ce faci, hitleristule?“ [„Was machst du noch, du Hitlerist?“] Im großen Amphitheater Saal 115 hieß die Bank an der Fensterseite ganz links, in der die fünf deutschen Studenten seines Jahrgangs zu sitzen pflegten, die Bank der Hitleristen.5 – Als die Geheimpolizei im Herbst 1975 Mitglieder der „Aktionsgruppe Banat“ verhaftete, die davon träumten, den real existierenden Sozialismus zu reformieren, hat sie diese als Faschisten beschimpft.6
Die deutsche Minderheit bestand aus mehreren, über das Landesgebiet verstreuten Gruppen. Die größten davon waren die Siebenbürger Sachsen, deren Vorfahren ab dem 12. Jahrhundert ins Siebenbürgische Hochland eingewandert sind, als jenes Gebiet zum Königreich Ungarn gehörte, und die Banater Schwaben, deren Vorfahren im 18. Jahrhundert von den Wiener Kaisern im Süden der Theißebene angesiedelt wurden, nachdem deren Heere die Türken zurückgedrängt hatten.
Inzwischen sind die Rumäniendeutschen von der Bühne abgetreten. Nach der sogenannten Revolution des Jahres 1989 nahmen die meisten der noch im Lande weilenden deutschen Familien, noch etwa 200.000 Seelen, die Gelegenheit wahr, um in die Bundesrepublik auszureisen. Vorher hatte der rumänische Geheimdienst auf Anweisung des Diktators Nicolae Ceauşescu im Laufe von zwanzig Jahren (1968-1989) nach und nach 226.000 Personen an die Bundesrepublik verkauft – d.h. gegen eine immer wieder neu verhandelte Abfindungssumme ausreisen lassen.7 Im Rahmen der seit 1958 laufenden Aussiedlung (die unter der Bezeichnung Familienzusammenführung stattfand) konnten bis zum Sturz Ceauşescus 242.326 Rumäniendeutsche in der Bundesrepublik Aufnahme finden.8 Wer die Geduld verlor und Mumm in den Knochen hatte, versuchte sein Glück an der sogenannten grünen Grenze. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 1970 wurden an der rumänisch-jugoslawischen Demarkationslinie 51 deutsche Jugendliche beim Versuch des illegalen Grenzübertritts verhaftet.9
Die Rumäniendeutschen waren praktisch bereits in den Kulissen der Geschichte verschwunden, als Herta Müller sie mit dem Roman „Atemschaukel“ im Jahre 2009 auf die Bühne zurückholte. Herta Müller, 1953 im Banat geboren und dort aufgewachsen, 1987 in die Bundesrepublik ausgereist, wurde im selben Jahr 2009 mit dem Nobel-Preis ausgezeichnet, dadurch rückte der Roman „Atemschaukel“ weltweit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Es wird geschildert, was der junge Siebenbürger Sachse Leopold Auberg, der zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert worden ist, im Laufe von fünf Jahren erlebt. Die Autorin hatte den Stoff in Gesprächen mit dem Lyriker Oskar Pastior und anderen Überlebenden gesammelt. Auch ihre eigene Mutter war verschleppt. Im Jahre 2004 waren Oskar Pastior, Herta Müller und der Schriftsteller Ernest Wichner mit Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung an Orte ehemaliger Zwangsarbeitslager in die Ukraine gereist.
Für diesen Roman verziehen die Banater Schwaben Herta Müller die satirische Skizze „Das schwäbische Bad“, die Nikolaus Berwanger im Mai 1981 in der „Neuen Banater Zeitung“ veröffentlicht hatte.10
Tatsächlich haben früher auf dem Lande und in der Vorstadt mit wenigen Ausnahmen alle so gebadet, nämlich in einem Bottich oder in einer Wanne aus Holz oder Blech: erst die Kinder, dann die Eltern, zuletzt die Großeltern, wobei wiederholt Seifenschaum abgeschöpft und heißes Wasser nachgegossen wurde. (So geschehen, bis – Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre – das große Badezimmer-Bauen begann.) In der von Herta Müller verfassten Skizze wird weder Seifenschaum abgeschöpft noch heißes Wasser nachgegossen, und eine Woge der Empörung schwappte über die Dörfer, schwappte über die vielen Temeswarer Fabriken, in denen deutsche Pendler arbeiteten.
Berwanger? Wer war Nikolaus Berwanger? Viele Banater Landsleute wurden nicht klug aus ihm. Dieser Mann, Chefredakteur einer Zeitung des Kreisparteikomitees, sogar Mitglied im Büro jenes Komitees, unterstützte das Temeswarer Deutsche Staatstheater und den Literaturzirkel „Adam Müller-Guttenbrunn“, in dem auch nonkonformistische Texte diskutiert wurden – gründete den Schubert-Chor – förderte die Herausgabe von deutschen Büchern im örtlichen „Facla“-Verlag – setzte sich für die Erhaltung von deutschen Schulen ein. Andererseits ließ dieser Kerl, der ein Macher war, eine Art Halbgott, jeden wortlos stehen, der ihn heimlich um Hilfe bei der Ausreise ersuchte. Wie sollte man das verstehen?
Nikolaus Berwanger (1935-1989) besaß einen scharfen Blick für das, was unter den gegebenen Umständen machbar war. Wäre er inmitten eines nordeurasischen Volkes aufgewachsen, dann wäre er Schamane geworden. Berwanger machte aus der „Neuen Banater Zeitung“, die er 1969 übernahm, ein lesbares Blatt. Die NBZ hatte dann zwei Hälften so wie die in Bukarest herausgegebene Tageszeitung „Neuer Weg“, für die Berwanger siebzehn Jahre lang als Korrespondent gearbeitet hatte. In der einen Hälfte, im Vordergrund, die Bekanntmachungen und Forderungen der Partei. In der anderen (man darf sagen: größeren Hälfte) die aus Sicht einer großzügig ausgelegten Parteipolitik redigierten Sonderseiten, von denen manche regelmäßig, andere gelegentlich erschienen. Regelmäßig die Seiten für die Banater Städte Arad, Großsanktnikolaus, Lugosch, Hatzfeld und Reschitz wie auch die Seiten für die dortigen Lyzeen, ferner der „Kulturbote“, die „Pipatsch“-Seite11 mit Beiträgen in Mundart und die Sport-Seite. Zum Inventar gehörten noch die Seite „Universitas“ für die Studenten sowie die Seite „Thalia“ mit Texten betreffend das Temeswarer Deutsche Staatstheater. Binnen eines Jahres kletterte die Zahl der Abonnenten von 3.000 auf 7.000, dann nach und nach auf unglaubliche 20.000 …12
In der Enzyklopädie WIKIPEDIA steht, dass Berwanger im Herbst 1984 von einer Reise in die Bundesrepublik Deutschland nicht nach Rumänien zurückkehrte. Warum das geschah, wird nicht vermerkt. Zum Grund für seine Entscheidung zirkulierten mehrere Erklärungen; mir gefällt die folgende am besten. Er hat damals in Bukarest an einer Veranstaltung für Parteifunktionäre teilgenommen. Nach Abschluss der Tagung wurden die Teilnehmer vom Partei- und Staatschef Nicolae Ceauşescu mit einem Händedruck verabschiedet, seiner Gattin sollten sie die Hand küssen. Das machten sie auch – alle, alle mit Ausnahme von Nikolaus Berwanger. Das war ein unverzeihlicher Affront, eine Geste mit unabsehbaren fatalen Folgen. Er reiste sofort nachhause, packte zwei Koffer und überquerte die rumänisch-ungarische Grenze, bevor ihm der Geheimdienst den Pass abnehmen konnte.
Der Historiker Lucian Boia hat im Jahre 2016 einen ätzenden Text über das kommunistische Kapitel in der Geschichte Rumäniens veröffentlicht.13 Er beschimpft Marx.14 Nicht einmal dieser belesene Gelehrte wusste, dass Karl Marx und Friedrich Engels zwei Bedingungen für den Übergang zur neuen Gesellschaftsordnung formuliert hatten:
1. Voraussetzung: Der Kapitalismus steht auf einer hohen wirtschaftlichen Stufe, und die materiellen Bedingungen für seine Ersetzung durch den Sozialismus sind vorhanden.
2. Voraussetzung: Die Widersprüche zwischen dem wirtschaftlich-technischen Stand der Entwicklung (Produktivkräfte) auf der einen Seite und den sozialen Beziehungen (Produktionsverhältnissen) auf der anderen Seite müssen sich in einem solchen Grad verschärft haben, dass eine radikale Veränderung des wirtschaftlichen, sozialen und politischen Systems unumgänglich notwendig geworden ist. [Mit anderen Worten: Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist mit dem Übergang zu einer neuen Gesellschaftsordnung einverstanden.]
Eine sozialistische Revolution kann daher nicht auf Wunsch propagiert oder „gemacht“ werden, sondern wird möglich unter Bedingungen, die vom Willen einzelner politischer Parteien, Klassen und Personen völlig unabhängig sind.15
Diese zwei Bedingungen waren 1917 in Russland nicht erfüllt, ebenso wenig 1918 in Deutschland, ebenso wenig 1919 in Ungarn, … 1947 in Rumänien, … 1959 in Kuba. In der Tschechoslowakei soll die Zahl der Kommunisten im Jahre 1948 rund 80.000 betragen haben16, aber auch das war nur ein Tropfen bei einer Bevölkerung von zwölf Millionen.
Marx und Engels haben vorausgesehen, dass dort, wo ein Umsturz vorangetrieben wird, obwohl die zwei Bedingungen nicht erfüllt sind, eine neue herrschende Schicht oder Klasse entstehen wird, eine neue Form der Ausbeutung, und damit neue soziale Kämpfe ausbrechen werden, neue Aufstände und Revolutionen der sozial Unterdrückten.17
„Aus begreiflichen Gründen“, vermerkt Wolfgang Leonhard, „werden diese wichtigen Hinweise von Marx und Engels in keinem sowjetischen ideologischen Lehrbuch erwähnt.“ Natürlich sind sie auch aus den in Rumänien gedruckten Werken der zwei Klassiker sorgfältig entfernt worden. Ebenso in Ungarn, in Polen, in der Tschechoslowakei und in der DDR – sonst hätten die zweifellos gebildeten Witze-Sammler György Dalos, Alexander Drozdzynski, Ján L. Kalina und Clement de Wroblewsky nicht über die Lehre von Marx gelästert.
Tatsächlich hat sich zunächst in der Sowjetunion, dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, auch in den anderen Ostblockstaaten, aus der Schicht der Parteifunktionäre eine neue Ausbeuterklasse entwickelt, die nach einem in der Sowjetunion gebräuchlichen Ausdruck Nomenklatura heißt. Den Mitgliedern der Nomenklatura wurden gutbezahlte Posten und vorzüglich ausgestattete Wohnungen vorbehalten, sie hatten Zugang zu Sonderläden, luxuriösen Ferienhäusern, eigenen Kliniken und Spitälern. Ihre Sprösslinge besuchten bestausgestattete Schulen und durften im Ausland studieren.18
In der Sowjetunion und in ihren Satellitenstaaten wurde die Lehre von Marx und Engels zielstrebig verfälscht, um die Diktatur der Nomenklatura zu rechtfertigen. Im sogenannten Westen wird das Scheitern des Versuchs, eine neue Gesellschaftsordnung zu errichten, mit dem Bescheid abgetan, dass Marx sich geirrt hat. Ich fiel fast vom Stuhl, als ich während einer von Maybrit Illner moderierten Talkshow zum Thema „Kommunismus“, an der Politiker und Wissenschaftler teilnahmen (am 13. Januar 2011) unwidersprochen diese Meinung vernahm.
Die willfährigen Handlanger der Nomenklatura bearbeiteten nicht nur die Werke von Marx und Engels, sondern auch ihre Biografien. Diese wurden idealisiert, denn auf die Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus durfte kein Schatten fallen. Der aus der Sowjetunion geflohene Historiker Michael Sergejewitsch Voslensky (1920-1997) zitiert zahlreiche Stellen aus dem Briefwechsel zwischen Marx und Engels, die ein anderes Bild ergeben.
Marx konnte nicht mit Geld umgehen, es zerrann ihm zwischen den Fingern, das ist eine erstaunliche, aber verzeihliche Schwäche. (Er lag seinem Busenfreund Engels auf der Tasche.) Dagegen stoßen uns die von Voslensky aufgedeckten Verhaltensweisen ab: Wie gemein sich beide über ihre Eltern äußerten. – Wie schäbig sie sich über Mitarbeiter und Führer der Arbeiterbewegung äußerten. – Ihre Korrespondenz war gespickt mit antisemitischen Bemerkungen. – Marx verschwieg die Namen der Forscher, die seine Vorläufer waren.19
Voslensky leitet aus den Sünden der zwei Klassiker ab, dass sie zu den „Lehrmeistern der Nomenklatura“ gehören, aber das ist ein falscher Vorwurf. Gemäß den Stellen, die Wolfgang Leonhard aus ihren Werken zitiert, handelt es sich um eine irreführende Behauptung.
1. Anmerkung. Im vorliegenden Buch haben das Wort kommunistisch und seine Verwandten je nach dem Kontext eine andere Bedeutung. Die ursprüngliche Bedeutung wurde im 19. Jahrhundert von Marx und Engels definiert. Unter dem Eindruck der Wirklichkeit in der Sowjetunion und in den nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen sogenannten volksdemokratischen Staaten nahmen diese Wörter eine negative Bedeutung an. Jedes seriöse Nachschlagewerk – BROCKHAUS, MEYER, ZEIT-Lexikon, WIKIPEDIA – erläutert die Bedeutungsverschiebung. Sie ist längst nicht allen Menschen bewusst.
2. Anmerkung. Ich verwende die Bezeichnung Zigeuner für das Volk der Sinti und Roma, weil sie mir aus mehreren international anerkannten Büchern vertraut ist:
WALTHER AICHELE und MARTIN BLOCK (Hg.): Zigeunermärchen. Düsseldorf-Köln: Diederichs, 1962.
HEINZ MODE unter Mitarbeit von MILENA HÜBSCHMANNOVÁ (Hg.): Zigeunermärchen aus aller Welt. Leipzig: Insel-Verlag Anton Kippenberg, 1983.
PAUL SCHUSTER: Fünf Liter Zuika. 2 Bde. Bukarest: Kriterion, 1961-1963. – Graz: Styria, 1968. – Berlin/West: edition „der 2“, 1975. – Aachen: Rimbaud, 2002.
ZAHARIA STANCU: Şatra (1968). In deutscher Übersetzung: Solange das Feuer brennt. Ein Zigeunerroman. Berlin/Ost: Volk und Welt, 1971.
FRANZ REMMEL: Die Fremden aus Indien. Nicht die Hoffnung stirbt zuletzt. Reschitza: Banatul Montan, 2010.
Der Zigeunerforscher Franz Remmel (1931-2019) war ein Vertrauter des Großen Bulibascha von Hermannstadt, des späteren Königs Ioan Cioaba I. Er baute in mehreren Buchveröffentlichungen Klischees und Vorurteile ab. Ich lernte Remmel als Korrespondenten der Tageszeitung „Neuer Weg“ kennen und wurde sein Duzfreund.
Prominente Zeugen
1. In der jungen Sowjetunion entsteht eine neue Ausbeuterklasse
Lange vor meiner Zeit haben aufmerksame Beobachter den Charakter der sowjetischen Gesellschaft durchschaut. Unter ihnen war auch ein Rumäne, Panait Istrati (18841935). Sein Enthüllungsbuch „Auf falscher Bahn“ entdeckte ich in Deutschland auf einem Flohmarkt.
Der linksorientierte Schriftsteller Istrati hat seine Beobachtungen über das Leben in der Sowjetunion 1930 veröffentlicht. Er war 1927 zur Festveranstaltung anlässlich des zehnten Jahrestags der Oktoberrevolution mit Hunderten anderen Künstlern in die Sowjetunion eingeladen worden und war anschließend 16 Monate lang kreuz und quer durch das Land gereist. Dabei stellte er viel früher als andere fest, dass sich aus den Parteifunktionären eine soziale Klasse etabliert hatte, die zusammenhielt wie Pech und Schwefel und den Rest der Bevölkerung kujonierte – einschließlich der Arbeiter und der armen Bauern. Die Revolutionäre der Vorkriegszeit wurden kaltgestellt, eben schickte Stalin seinen Rivalen Trotzki in die Verbannung.
Istrati lebte zeitweilig in Frankreich und veröffentlichte viel in französischer Sprache. Im kommunistisch regierten Rumänien wurden seine belletristischen Werke in den Literatur-Vorlesungen erwähnt, seine Erkenntnisse über die Zustände in der Sowjetunion jedoch verschwiegen. Merkwürdig: Sein Auge erfasste 1928, was Lion Feuchtwanger neun Jahre später nicht erkannte, was Pablo Neruda zwanzig Jahre später, was Alberto Moravia dreißig Jahre später nicht sah oder nicht sehen wollte. Feuchtwanger hat sich blenden, täuschen und von Stalin um den Finger wickeln lassen.20 Pablo Neruda wurde bei seinen Reisen in der Sowjetunion von Ilja Ehrenburg zugelabert.21 Obwohl Moravia von einem Kritiker als der unbestechlichste Autor des modernen Italiens gerühmt worden ist, erkannte er die neue Klassenstruktur der sowjetischen Gesellschaft nicht. Wenn seine Darstellungen nicht sehr zurückhaltend sind, dann sind sie naiv.22
Istrati hat, als er Gorki besuchte, die ihn verstörenden Zustände angesprochen, doch jener hüllte sich in Schweigen.
Im selben Jahr 1930 veröffentlichte der russische Revolutionär Leo Trotzki (1879-1940) im Exil die Schrift „Die wirkliche Lage in Russland“. In ihr ging er auf die Existenz einer neuen Bourgeoisie in Russland ein. (Bei der Bücherverbrennung 1933 in Deutschland wurde diese Schrift mit verbrannt.)
Unabhängig von Istrati und Trotzki gelangten auch andere Beobachter zur selben Erkenntnis, nur hat man es nicht gewusst oder – nicht weiter beachtet.
Der Franzose M. Yvon kehrte nach elf Jahren Aufenthalt in der Sowjetunion 1934 nach Frankreich zurück. In der Sowjetunion war er vom Arbeiter in einem Moskauer Flugzeugwerk zum Direktor einer Fabrik in Wladiwostok aufgerückt, hatte der Regierung als Berater für die Industrialisierung gedient und als Französisch-Lehrer an der Moskauer „Kommunistischen Universität der Völker des Ostens“ unterrichtet.23 Nach der Rückkehr hielt er Vorträge über seine Erfahrungen, die auch im Druck erschienen sind. Er entlarvte die Scheindemokratie, die rücksichtslose Diktatur einer neuen Klasse von Ausbeutern, die er Spezialisten nennt, Stalins Machtpolitik und den Personenkult um Stalin.24 Seine klare, systematische Darstellung nahm die Analyse von Milovan Djilas vorweg.
Jack Scott stammte aus den Vereinigten Staaten, seine Eltern waren gebildete Kommunisten. Er arbeitete zunächst als Schweißer, dann als Chemotechniker in Magnitogorsk und führte ein Tagebuch.25 Scott nahm aus Begeisterung am Aufbau einer vermeintlich neuen Gesellschaft teil, aber nach acht Jahren Bekanntschaft mit dem real existierenden Sozialismus (1932-1940) verlor er seine Illusionen und wandte sich vom Kommunismus ab. Er gehört zu den Begründern des Rundfunksenders „Radio Liberty“, der 1953 den Betrieb aufnahm und zunächst Sendungen in russischer Sprache ausstrahlte.
Karl Eska wurde 1939 aus dem oberschlesischpolnischen Grenzland in die Sowjetunion deportiert und lebte anschließend fünf Jahre in Transkaspien, in der Stadt Aschchabad. Seine Erlebnisse inspirierten ihn zu dem erschütternden Roman „Fünf Jahreszeiten“ [Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Hunger], erschienen 1952 in Stuttgart. Er schildert das Leben der Turkmenen im real existierenden Sozialismus.
Milovan Djilas (1911-1995) war ursprünglich ein Weggefährte und Kampfgenosse von Josip Broz Tito, mit dem zusammen er das kommunistische Jugoslawien einrichtete. Als Abgesandter Titos hat er sich zeitweilig in der Sowjetunion aufgehalten und Stalin aus nächster Nähe beobachtet. Als er sich von den realen Ergebnissen der kommunistischen Diktatur distanzierte, stieß ihn die übrige Parteiführung aus allen Ämtern und ließ ihn zuletzt einsperren. Sein Buch „Die neue Klasse“ entstand 1956. Er scheute sich nicht, deren Mitglieder als Ausbeuter zu brandmarken. Nach der Veröffentlichung in New York 1957 wurde der Autor wegen „Verleumdung und feindseliger Propaganda“ zu (weiteren) sieben Jahren Haft verurteilt. Im kommunistisch regierten Rumänien konnte man über dieses Buch nur hinter vorgehaltener Hand sprechen.
Der deutsche Arzt Joseph Scholmer (1913-1995) opponierte in der DDR gegen den Stalinismus und wurde von einem sowjetischen Gericht zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Er verbrachte vier Jahre in den Arbeitslagern von Workuta. Dort wurde die politische Lage von den Mitgliedern einer russischen Untergrund-Organisation und von Intellektuellen anderer Nationalitäten aufmerksam analysiert. Scholmer hat in seinem Bericht über Workuta in den Jahren 1950-1954 Einsichten festgehalten, die jenen von Djilas gleichen wie ein Tropfen dem anderen.26 Seine Dokumentation ist 1954 in deutscher Sprache erschienen, also drei Jahre vor dem Werk „Die neue Klasse“, welches dank der politischen Laufbahn seines Verfassers weltweit Aufsehen erregte. Was Djilas als neue Klasse bezeichnet, heißt bei Scholmer Oberschicht – das ist gehupft wie gesprungen.
Um dieselbe Zeit, als Djilas in Jugoslawien gegen die herrschende Ideologie rebellierte, veröffentlichte der lutherische Geistliche Aurel von Jüchen in Stuttgart das Buch „Was die Hunde heulen“ (1958), eine umfassende, scharfsinnige, schonungslose Analyse des real existierenden Sozialismus in der Sowjetunion aus marxistischer Sicht. Djilas hatte seine Gefängnisjahre noch vor sich, von Jülich aber schon hinter sich. Als eine dem jungen DDR-Regime unbequeme Person war er im März 1950 vom NKWD27 verschleppt worden und nach Workuta gelangt, wo er so wie Joseph Scholmer die Haftzeit für intensive soziologische Studien nützte. Nur in einem Punkt hat er nicht Recht. Marx hätte sich während einer Reise durch die Sowjetunion nicht gewundert, weil er davor gewarnt hatte, mit der sozialistischen Revolution zu beginnen, wenn die Zeit für sie noch nicht reif ist, sprich: die sozialen Voraussetzungen für sie nicht vorhanden sind. Das kann man bei Wolfgang Leonhard nachlesen.
Im genannten Buch findet sich die Lösung des Rätsels, das Jorge Semprún im Buchenwald-Roman „Was für ein schöner Sonntag!“ erwähnt: warum die Organisation der sowjetischen KP im dortigen KZ winzig war – warum sie bei der Masse der russischen Häftlinge kein Ansehen genoss – warum die meisten Russen den politischen Problemen gleichgültig gegenüberstanden – warum sie sich in der Lagerwelt von Buchenwald nicht fremd zu fühlen schienen.28 Zum Unterschied von den Kommunisten im Westen hatten die aus der Sowjetunion stammenden Häftlinge am eigenen Leib erfahren, dass in der sowjetischen Wirklichkeit zwischen Theorie und Praxis ein Unterschied besteht wie zwischen Himmel und Hölle.
Meine Auflistung wäre unvollständig ohne das Buch „Der verratene Sozialismus“ von Karl I. Albrecht (1897-1969), der zehn Jahre lang in der Sowjetunion lebte (1924-1934), wobei er die letzten zwei Jahre in Gefängnissen verbrachte. Das Buch umfasst mehr als 600 Seiten. Dank seiner beruflichen Kompetenz als Spezialist für Forstwirtschaft durfte Albrecht an Sitzungen der obersten Organe der UdSSR teilnehmen: an Sitzungen des Politbüros – des Präsidiums der Zentralen Kontrollkommission – des Plenums des Zentralkomitees der Partei – des Rates der Volkskommissare [d.h. der Regierung] – des Rates für Arbeit und Verteidigung. Er beobachtete hautnah, wie sich unter Stalins Regie die Diktatur einer Minderheit festigt, und verlor den Glauben, dass in der Sowjetunion der Sozialismus errichtet wird.
Sein Buch wurde in Nazi-Deutschland zu Propagandazwecken in hohen Auflagen gedruckt.29 In Deutschland wechselte er seine Gesinnung und mutierte zum Anhänger des NS-Regimes.
Die Theorie von Djilas diente als ein Ausgangspunkt für das Werk „Nomenklatura“ (1980) von Michael S. Voslensky, mit 550 Seiten ein Lexikon. Mit dem Spürsinn eines Meisterdetektivs und auf ungeheures Quellenmaterial gestützt, nimmt Voslensky Begriffe auseinander, die man meiner Generation als unverrückbare Bausteine des Marxismus-Leninismus vorgestellt hat. Er identifiziert die von Lenin geleitete Organisation der Berufsrevolutionäre, die sich als Meister der Kommunistischen Partei begriff, als den Embryo einer neuen herrschenden Klasse.30 Im Kapitel „Die Klassenherrschaft“ zitiert er die Urteile über die Sowjetgesellschaft von Beobachtern in vielen Ländern und in der Sowjetunion selbst.31 Der Gedanke, dass in der Sowjetunion eine neue bürokratische Klassenherrschaft besteht, wurde im Westen lange vor dem Erscheinen des Buches von Djilas geäußert. Er wurde aber nicht allgemein anerkannt.32
Von Voslensky wird die Nomenklatura als Klasse der Deklassierten gebrandmarkt. Im Folgenden eine Leseprobe aus dem Kapitel „Die Klasse der Deklassierten“.
Im Dritten Reich wurde die arische Abstammung geschätzt, in der Sowjetunion die proletarische. Die Sowjetpropagandisten bemühten sich nicht wenig darum, Beweise für die nicht-arische Abstammung der Naziführer zu entdecken. Die Bemühungen blieben erfolglos. Die gleichen Propagandisten bemühten sich noch mehr darum, Beweise für die proletarische Abstammung der Sowjetführer zu entdecken. Auch diese Bemühungen hatten keinen Erfolg: trotz aller Versuche der Führer, sich als erbliche Proletarier auszugeben, hatten die meisten nie manuelle Arbeit verrichtet.
Daran ist nichts Erstaunliches. Wie wir gesehen haben, hatte auch Lenin, als er den Embryo der Nomenklatura, die Organisation der Berufsrevolutionäre, schuf, nicht die Absicht, sie aus Arbeitern zu bilden. Die Karrieristen, die sich später in die Stalinʼsche Nomenklatura drängten, waren auch nicht unbedingt Abkömmlinge von Arbeitern.
Aber es war außerordentlich schwer, das offen zuzugeben. Die Partei bezeichnete sich als „Vortrupp der Arbeiterklasse“, als „organisierter Trupp der Arbeiterklasse“, als „höchste Form der Klassenorganisation des Proletariats“ (Stalin).
Eine Legende gebar die andere. Es wurde verkündet, dass die Führung und der Apparat der Partei im ganzen zur Arbeiterklasse gehörten. So schrieben denn Parteiapparatschiks, die in ihrem Leben noch nicht eine einzige Stunde in einer Fabrik gearbeitet hatten, mit ihren gepflegten Händen in die Rubrik des Fragebogens „soziale Herkunft“ das Wort „Arbeiter“. Die Lächerlichkeit dieser Prozedur lag auf der Hand: ein Seufzer der Erleichterung ging durch die Nomenklatura-Büros, als die KPdSU zu einer „Volkspartei“ erklärt wurde.
Trotzdem kann man auch heute noch Prahlereien hören, daß der eine oder andere Nomenklaturist sein Berufsleben als Arbeiter begonnen habe. Man glaubt dadurch zu beweisen, in der Sowjetunion befänden sich Vertreter der Arbeiterklasse an der Macht, die auf diese Weise ihre führende Rolle in der Sowjetgesellschaft verwirkliche. Nur ist die Tatsache, daß der langjährige Sekretär eines Gebietskomitees der KPdSU vor vierzig Jahren ein Jahr lang als Arbeiter tätig war, kein Beweis dafür, daß er auch jetzt noch ein Vertreter der Arbeiterklasse ist. Während des Krieges wurden wir Studenten der Universität in der Landwirtschaft eingesetzt, so daß ich mein Berufsleben als Arbeiter in einer Sowchose begann; deswegen bin ich trotzdem heute kein Proletarier. Daß ein derartiger „ehemaliger Arbeiter“ auf dem Posten eines Partei-Gebietssekretärs sitzt, ist kein Beweis dafür, daß die Arbeiterklasse das Land regiert. Nicht wenige amerikanische Milliardäre der älteren Generation begannen ihre Laufbahn bekanntlich als Stiefelputzer oder Zeitungsausträger; das heißt aber nicht, daß im Kapitalismus die Stiefelputzer oder Zeitungsausträger die regierende Klasse der USA sind.33
Stalin gelang es, die Solidarität der Arbeiter zu torpedieren, indem er die Entstehung einer Arbeiter-Aristokratie förderte. Die folgenden Einzelheiten stammen aus dem Buch „Anmerkungen zu Stalin“ von Wolfgang Leonhard.
Im Jahre 1928 – also vor Stalins berühmter Rede gegen die „Gleichmacherei“ – betrug das Verhältnis zwischen dem Arbeitslohn der niedrigsten und der höchsten Kategorie 1:2,8. Im Jahr 1938 dagegen war der Spitzenlohn eines Arbeiters auf 3.549 Rubel monatlich angestiegen. Der offizielle monatliche Durchschnittslohn belief sich auf 280 Rubel – der Spitzenlohn lag also fast dreizehnmal höher. Nur zwei Jahre später war der Spitzenlohn mit 10.600 Rubeln über dreißigmal so hoch wie der Durchschnittslohn.
Die tatsächlichen Unterschiede in der Lebenshaltung einer kleinen privilegierten Schicht von Arbeitern und der großen Masse der Durchschnittsarbeiter waren jedoch noch größer. Die privilegierten Arbeiterkategorien erhielten neben den höheren Löhnen nämlich noch eine Reihe zusätzlicher Vergünstigungen, etwa besondere Verpflegung und Bekleidung, begehrte Erholungsmöglichkeiten oder häufige Befreiung von der praktischen Arbeit durch Feiern und Kongresse.
Diese Maßnahmen hatten zweifelsohne allein den Zweck, eine Art „Arbeiteraristokratie“ herauszubilden. Stalin operierte also innerhalb der Arbeiterschaft mit ähnlichen Prinzipien wie in der Parteiführung. Während er den Betroffenen faktisch alle Selbständigkeit entzog, schuf er zugleich Strukturen, die es den Mitgliedern des Politbüros genauso wie den Arbeitern kaum noch ermöglichten, gemeinsame Interessen zu vertreten. Im Falle der Arbeiter sorgte er durch die Einführung von Lohnskalen für eine reale Ungleichheit, die Solidarität verhinderte. Stattdessen wurde ein Konkurrenzdenken in Gang gesetzt […].34
Voslenskys Ausführungen werden von dem ehemaligen sowjetischen Diplomaten Arkadij Nikolajewitsch Schewtschenko im Enthüllungsbuch „Mein Bruch mit Moskau“ (1985) umfassend bestätigt. An einer Stelle listet Schewtschenko in konzentrierter Form die Privilegien der Nomenklatura auf.35 Einsichten in den unglaublichen Lebensstil der rumänischen Spitzenpolitiker gewährt das Enthüllungsbuch „Rote Horizonte“ (1987) des ehemaligen Securitate-Generals Ion Mihai Pacepa (1928-2021).36
Pacepa war Generalleutnant der Securitate und Stellvertretender Chef des Auslandsgeheimdienstes, als er im Juli 1978 zum Geheimdienst CIA überlief und von Präsident Jimmy Carter politisches Asyl erhielt. In einem offenen Brief an seine Tochter gab er den Grund für seine Flucht an: Er hatte Befehl erhalten, die Ermordung von Noël Bernard zu organisieren, damals Direktor des Rumänischen Programms beim Sender „Freies Europa“. Pacepa vermittelte der CIA Einblicke in die Methoden, Netzwerke und Operationen der Spionage-Organisationen des Ostblocks.
Der Publizist Robert Jungk vermerkte im November 1946 in einem Zeitungsartikel im Zusammenhang mit dem Abtransport deutscher Facharbeiter nach Russland:
Heute ist der Sowjetstaat im Wettbewerb mit anderen Staaten Großunternehmer, Überkapitalist, und zwingt einheimischen wie ausländischen Arbeitern gnadenlos jene Kondition auf, die er durch die Revolution von 1917 gerade abzuschaffen hoffte. Weder Schokolade noch Zucker werden den nach Osten abgeschobenen deutschen Facharbeitern die bittere Pille des Zwanges – ob ihn nun die Geheimpolizei oder das Gespenst drohender Arbeitslosigkeit ausübt, ist nur im Grade verschieden – versüßen.37
Der ungarische Schriftsteller István Eörsi stellt im Essay über seine Haftzeit 1956-1960 fest: „Der Sozialismus ist schön und gut, schade nur, dass wir nicht ihn aufgebaut haben, sondern eine neue Klassengesellschaft.“38 Eörsi war wegen Teilnahme am Volksaufstand 1956 verurteilt worden.
Der US-amerikanische Journalist Robert G. Kaiser