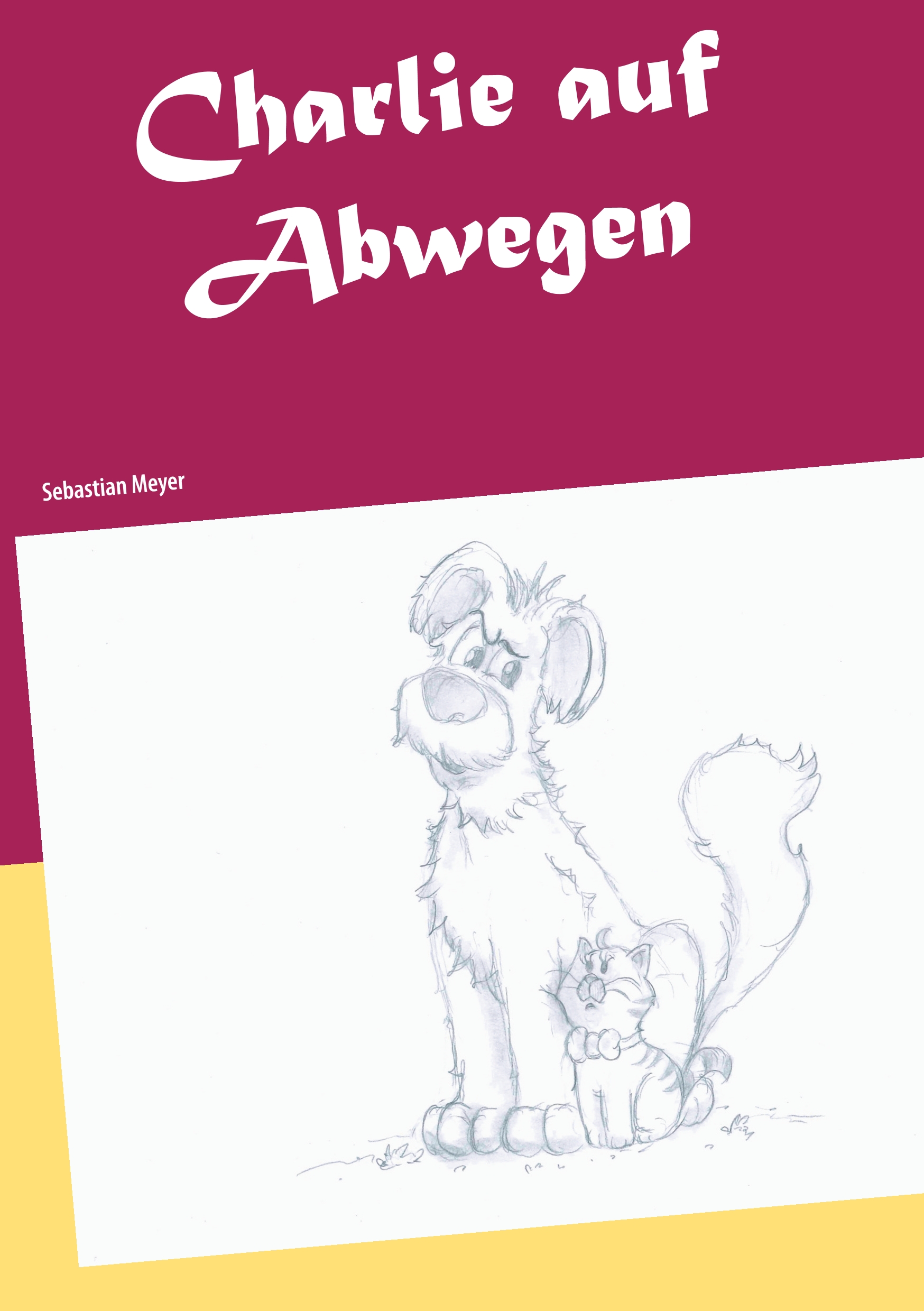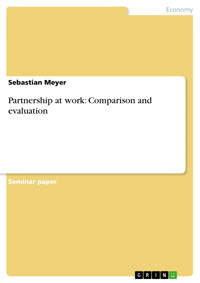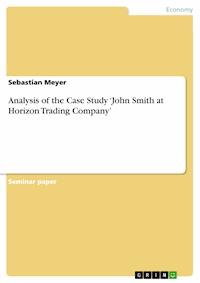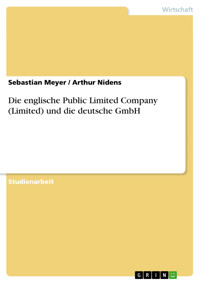Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Langquaider Bürgermeister Joseph Münsterer hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, für den Bau der Bahntrasse zwischen Langquaid und Eggmühl zu kämpfen. Trotz Hindernisse aus Politik und Bevölkerung setzt er sich für das Wohlergehen seines Marktes ein. Der ärmliche Bauernjunge Franz leidet unter den Schikanen seiner Mitschüler und auch den anderen Gemeindemitgliedern, die ihn für etwas büßen lassen, was sein Vater vor vielen Jahren zu verantworten hatte. Franz und Münsterers Wege kreuzen sich, als der Bürgermeister sich des Jungen annimmt und ihn schließlich in seiner Brauerei anstellt. Franz versucht dem Geheimnis seines Vaters auf die Spur zu kommen, um dessen Ruf wiederherzustellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen Eltern gewidmet
A railroad is 95 percent men and 5 percent iron (Eine Eisenbahn besteht zu 95 Prozent aus Menschen und zu 5 Prozent aus Eisen)
Adam Smith (1723 – 1790)
Inhaltsverzeichnis
Teil 1 1896
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Teil 2 1898
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil 3 1900
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Teil 4 1903
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Teil 1
1896
1
Montag, am 13. Januar 1896
Ein frostiger Winterwind fegte über den historischen Wittelsbacher Marktplatz in Langquaid, als soeben Bürgermeister Joseph Münsterer die Straße auf dem Weg zu seiner Brauerei überquerte. Seinen Hut hielt er tief ins Gesicht gezogen, damit er nicht fortgeweht wurde. Mit der anderen Hand griff er in die Seitentasche seines Wollmantels und fischte einen schweren Schlüsselbund heraus. Vor der Eingangstür der Brauerei blieb er stehen, suchte nach dem passenden Schlüssel und sperrte schließlich die schwere Holztür auf. Die Tür klemmte wieder mal. Münsterer stemmte sich mit seinem massigen Körper dagegen, woraufhin sie sofort nachgab und den Eingang freigab.
„Muss unbedingt dem Schreiner Niedermayr sagen, dass er die alte Tür endlich richten soll“, grummelte er vor sich hin und hängte seinen Mantel und den Hut auf den Haken.
Es war halb sechs am Morgen und Münsterer war, wie immer, der erste in der Brauerei. Die Gesellen und Helfer würden erst zum Sonnenaufgang auf der Arbeit erscheinen. Erst dann hatten sie ausreichend Licht zur Verfügung, um ihrer Arbeit nachgehen zu können.
Münsterers erste Tätigkeit bestand darin, den großen Holzofen anzuheizen, der in der Mitte des ausladenden Raumes stand und für mollige Wärme sorgen sollte. Münsterer selbst spendete der Ofen genügend Licht, um die Qualität des Hopfens und der Gerste zu überprüfen. Er legte großen Wert auf die Beschaffenheit seiner Zutaten. Das Bier aus seiner Brauerei war als das Beste in der Gemeinde bekannt und diesem Ruf wollte er gerecht werden. Er öffnete im Lager wahllos einen Sack und ließ die Gerste über seine Hand gleiten. Er roch daran, nickte zufrieden und klopfte die Hand an seiner Hose ab. Die Gerste kam vom Bauer Brehm. Er war bekannt für seine Zuverlässigkeit und der Spitzenqualität seiner Erzeugnisse. Münsterer war froh, sich langfristig an ihn gebunden zu haben.
Nach der Überprüfung der Ware, setzte er sich in eine kleine Nische an seinem Schreibpult. Für das Lesen seiner Unterlagen reichte das Licht des Ofens nicht aus, so dass er die Kerze auf dem Tisch anzünden musste. Er machte sich an die Abrechnung des gestrigen Tages. Hierfür brauchte er seine Ruhe und wollte nicht gestört werden, daher war das die ideale Tätigkeit frühmorgens, bevor die Arbeiter begannen, ihr Tagwerk zu verrichten.
Dennoch klopfte es an der Tür. Münsterer erschrak und drehte sich in Richtung Tür, als könnte er den Besucher erkennen, der vor der Tür stand. Es klopft erneut und Münsterer erhob sich schwerfällig von seinem Stuhl. Wenigstens muss ich hernach nicht nochmal aufstehen, um Holz nachzulegen, grummelte er in Gedanken. „Ich bin gleich da!“, rief er, als das Klopfen bereits energischer wurde. Wer könnte schon so früh am Morgen vor der Tür stehen und was könnte der Besucher nur wollen? Vor dem Tageslicht ließ sich in der Regel niemand hier sehen. Münsterer öffnete schließlich die knarzende Tür und erkannte wegen der Dunkelheit den Gast nicht. „Komm herein“, sagte er dennoch und machte eine einladende Geste. Der Besucher trat an dem Bürgermeister vorbei und stellte sich direkt vor den Ofen. Er breitete seine Handflächen aus, um sie zu wärmen. Das fackelnde Licht ließ Münsterer das Gesicht des Besuchers erkennen. „Du?“, rief er überrascht aus. Der Besucher drehte sich nicht zu ihm um, sondern schaute weiter den züngelnden Flammen im Ofenfenster zu. „Es ist lange her seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, gell, Herr Bürgermeister?“ „Viel zu lange“, bestätigte das Marktoberhaupt. „Was führt dich zu mir?“
„Ich habe deine Kartoffeln dabei.“
Jetzt erst erkannte Münsterer, dass der Besucher einen Sack in der Hand hielt. Er lächelte.
„Und ich dachte schon, ich müsse mich anderweitig umschauen. Auf dich ist eben doch Verlass.“
„Freilich. Du kennst mich doch.“
„Nimmst du dein Fassl gleich mit?“
Der Besucher schüttelte den Kopf. „Ich bin zu Fuß hier.“
„Dann lass ich es heute Nachmittag zu dir nach Hause liefern.“
Der Besucher trat nun näher an die Lichtquelle und erst jetzt erkannte Münsterer wie zerfurcht und alt sein Gast geworden war.
„Das Geschehene nimmt dich noch ganz schön mit, hab' ich recht?“
„Darüber will ich nicht reden“, sagte der Besucher kurz angebunden. Münsterer nickte. „Das verstehe ich durchaus. Lass es mich wissen, wenn ich dir in irgendeiner Weise helfen kann.“
„Du tust schon genug für mich, Joseph.“
„Wie geht es deiner Frau und den Kindern?“
„Passt alles“, tat der Besucher schulterzuckend ab. „Brauchst du sonst noch was von mir?“
„Wenn du mal wieder ein gutes Fleisch hast, dann nehme ich es dir gerne ab.“
Der Besucher nickte und sagte dann: „Es wird hell und die ersten Arbeiter sind unterwegs. Ich muss jetzt los.“
Münsterer nickte. „Lass bald wieder von dir hören. Du weißt, ich bin da, wenn du Hilfe brauchst.“
2
Es war noch dunkel draußen als Franz von seinem Vater Alois Gruber geweckt wurde. Er hämmerte gegen die geschlossene Zimmertür und knurrte etwas, das sich wie „Aufstehen!“ anhörte und stampfte hinüber in die Küche.
Mühsam richtete sich der Sohn im Bett auf und rieb sich das Gesicht. Er hatte keine Uhr im Zimmer, aber Franz schätzte die Zeit auf etwa fünf Uhr morgens. Selbst der Hahn draußen schien noch zu schlafen. Bevor er sich aus dem warmen Bett schälte, betrachtete er mit Staunen die Eisblumen an seinem Fenster. Schade, dass diese Boten des Winters bald wieder verschwinden würden. Zu gerne hätte er sie aufbewahrt, um sie jeden Morgen betrachten zu können.
Gestern war sein zwölfter Geburtstag und diesen feierte er zusammen mit seinem Vater draußen im Wald. Sie haben Holz für den kommenden Winter geschlagen. Es war eine beschwerliche und mühsame Arbeit. Die bis zu fünfzig Zentimeter umfassenden Stämme musste von Hand mit der Axt geschlagen werden. Franz rieb sich die Hände und konnte die Folgen spüren. Beide Hände waren übersät mit aufgeplatzten Blasen. Gestern Abend noch, hielt er sie in eine Schüssel mit warmem Wasser, um die Haut etwas zu beruhigen. Es half nur wenig.
Nach getaner Arbeit mussten die schweren Stämme noch auf den Wagen geladen werden. Da hierfür kein spezieller Anhänger zur Verfügung stand, musste der eigentlich als Mistwagen dienende Anhänger umgebaut werden. Die Umwandung an den Seiten und am Hinterteil wurden entfernt und stattdessen kurze Stecken in die Seiten gesteckt, damit die Baumstämme nicht herunterrollen konnten. Franz' Vater sicherte die Stämme zudem mit Ketten. Der Wagen stand jetzt noch im Hof und wartete darauf entladen zu werden. Franz befürchtete, dass diese Arbeit heute Nachmittag nach dem Besuch in der Schule auf ihn warten würde.
Alois widmete sich bereits dem Frühstück, während seine Mutter noch Eier in der Pfanne briet. Er fand ein paar Reste der Eierschalen auf seinem Teller, was ihn zwar verärgerte, aber nicht weiter erwähnte. Schlaftrunken setzte Franz sich an den Tisch und wartete auf seine Spiegeleier. Mutter füllte seinen und ihren Teller und setzte sich dazu. Als Franz zu essen anfangen wollte, entdeckte auch er ein großes Stück Schale in seinem Ei. Er schaute zu seinem Vater hinüber, der seinen Blick auffing und nur dezent mit dem Kopf schüttelte. Franz verstand sofort. Mutter hat wieder einen ihrer schlechten Tage. Franz fingerte die Schale umständlich heraus und stierte zu seiner Mutter hinüber. Die saß nur stumm da und betrachtete das Ei auf ihrem Teller.
„Sie wird hernach schon noch essen“, sagte Alois. Franz nickte. Natürlich wird sie das, wie auch schon die letzten Tage. Vielleicht aß sie sogar mal wieder den ganzen Teller auf, so wie an ihren „guten Tagen“. Wenn sie wieder lachen und arbeiten kann. Seit Monaten hat Mutter jetzt schon immer wieder ihre „schlechten Tage“. Anfangs noch spärlicher, so dass es kaum aufgefallen war, aber in letzter Zeit deutlich häufiger, und auch längere Zeit anhaltender. Mutter war dann nicht fähig zu arbeiten und so musste Franz an ihrer Stelle die Hausarbeiten verrichten. Zusätzlich zu seinen eigentlichen Arbeiten auf dem Hof. Einmal ließ Alois wegen Mutters Zustand einen Doktor kommen, aber der wusste selbst nicht weiter und hat nur einen Brenneseltee verordnet.
Es war mitten im Winter und trotz der klirrenden Kälte hat es in diesem Jahr noch nicht geschneit. Franz war froh darüber. So brauchte er nicht erst den Schnee auf dem Weg zum Stall hinüber beiseite räumen. Die tägliche Stallarbeit am Morgen gehörte zu den Pflichten, die er übernehmen musste, seit er zehn war. Anfangs war er noch stolz darauf diese Arbeit verrichten zu dürfen, schließlich waren die Rinder mit das Wichtigste Gut auf dem elterlichen Hof. Dank den Tieren hatten sie täglich ihre Milch, konnten Butter herstellen und sonntags, sowie zu ganz besonderen Anlässen durfte er sich deren Fleisch schmecken lassen. Sogar für die Haut hatten sie noch Verwendung und ließen daraus Leder herstellen. Franz war durchaus bewusst, wie wichtig die Rinder für den Hof waren, entsprechend gut wurde für sie gesorgt.
Der Alltag wurde von den Tieren diktiert. Es folgte jeden Tag das gleiche Procedere: Zuerst hieß es für Franz, ausmisten. Anschließend mussten die Kühe gemolken werden. Wenn Kälber da waren, mussten auch diese umsorgt werden. Zu guter Letzt gab es für die Tiere frisches Futter, Klee und Zuckerrüben. In den Sommermonaten mussten sie zeitig von der Feldarbeit heimkehren, um sich wieder dem Vieh zu widmen. Die Mittagspause auf dem Feld musste so gelegt werden, dass es auch Zeit war das Vieh zu füttern.
Zurück im Haus griff Franz nach seinem abgegriffenen Tornister, der noch von seiner älteren Schwester Elisabeth stammte. Diese Schultasche hatte ihr Vater Alois zu ihrer Einschulung aus Tannenholz und Fellen selbst gebaut. Da er Handwerklich ziemlich geschickt war, fertigte er solche Dinge gerne selbst. Außerdem brauchte er nicht von seinem Hof weg, wenn man all die Dinge selber machen konnte, und das war ihm nur recht.
Franz' behelfsmäßige, dünnen Schuhe ließen seine Zehen vor Kälte taub werden und die Handschuhe schützten nur bedingt vor der Kälte. Er war heilfroh, als er nach einem Fußmarsch von einer halben Stunde den Marktplatz erreichte und in das Obermayersche Schulhaus treten konnte. Der Holzofen war bereits angeheizt und da der Lehrer noch nicht da war, verharrte er für einen Moment vor dem Feuer und versuchte sich zu wärmen, ehe er sich auf seinen angestammten Platz hinter dem Pult niederließ.
Der Wittmann Schorsch, sein bester Freund von Kindesbeinen an, kam auch soeben in das Klassenzimmer geschlendert und setzte sich nach einem kurzen Gruß neben Franz in die Bank.
„Bist du mit der Hausaufgabe gestern zurechtgekommen?“, fragte er den Franz. „Ich wusste einfach nicht mehr weiter und meine Mam' war mir auch keine große Hilfe.“
Franz zuckte mit den Schultern. „Ich habe sie gar nicht gemacht. Ich bin gestern nach der Schule gleich mit Papa im Holz gewesen und später war es dann schon zu finster.“
„Dann hoffe ich für dich, dass der Lehrer Beer dich hernach nicht aufrufen wird.“
„Das hoffe ich auch. Mir tut der Hintern vom letzten Mal noch weh. Die blauen Flecken sieht man immer noch.“
Franz verzog das Gesicht und rieb sich die entsprechende Stelle am Gesäß.
Da die Lehrerwohnung sich direkt über dem Klassenzimmer befand, konnten die Kinder genau hören, wenn der Lehrer sich auf den Weg über die knarzende Holztreppe nach unten machte. Eben tobten noch die einen umher, die anderen saßen brav an den Tischen, aber sobald der Lehrer Beer zu hören war, begaben sich alle vierundfünfzig Kinder schnell auf ihre Plätze und verschränkten die Arme vor sich auf dem Pult.
Mit großen Schritten kam Lehrer Beer in das Zimmer gestürmt. Sofort erhoben sich die Schüler von ihren Plätzen und begrüßten ihn mit einem Guten-Morgen-Herr-Lehrer-Chor.
„Morgen“, nuschelte der Lehrer in seinen Vollbart und stellte seine Mappe auf dem Tisch ab. Als er sofort nach dem Rohrstock griff, war Franz klar, dass irgendetwas vorgefallen sein musste. Die Frage war nur, wer oder was den Lehrer so erzürnt hatte.
„Gruber, vortreten!“
Franz erschrak und wurde ganz bleich im Gesicht. Als er nicht reagierte trat ihm sein Banknachbar Schorsch mit dem Fuß. Schlagartig erwachte Franz aus seiner Lethargie. Beer blickte ihm jetzt durchdringlich in die Augen.
„Gruber, vortreten habe ich gesagt, und zwar sofort!“, wiederholte er mit Nachdruck.
Mit weichen Knien erhob sich Franz von seinem Stuhl und trat langsam auf den Lehrer zu. Was mochte er wohl nur verbrochen haben? Franz hatte nicht die leiseste Ahnung, aber gleich würde er es zu seinem Leidwesen herausfinden.
„Wo sind deine Aufgaben, Gruber?“, fragte Beer und setzte ein schiefes Grinsen auf. Natürlich, die Hausaufgaben! Für die waren ja gestern keine Zeit mehr. Irgendwie musste Beer davon Wind bekommen haben. Vielleicht hat er ihn beim Arbeiten draußen im Wald gesehen und konnte sich denken, dass Franz für seine Aufgaben keine Zeit mehr hatte. Franz überlegte fieberhaft nach einer Ausrede. Keinesfalls wollte er sich erneut vor der ganzen Klasse die Blöße geben und seinen nackten Hintern versohlen lassen.
„Ich habe sie nicht gemacht“, antwortete er in einem leisen, kaum hörbaren Ton.
„Red' lauter! ich habe dich nicht verstanden.“
„Ich sagte, ich habe sie nicht anfertigen können.“
„Warum nicht?“, fragte der Lehrer und ließ den Stock bedrohlich auf den Boden aufstampfen.
„Ich war gestern mit meinem Vater im Holz.“
„Das ist keine Ausrede“, sagte er unerbittlich. „Frei machen!“
Nein und nein! Franz konnte sich nicht dazu überwinden, erneut die Erniedrigung über sich ergehen zu lassen.
„Hörst du nicht?“
Als Franz nicht antwortete, packte Beer ihn am Schopf und zog den Kopf nach oben. „Schau mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Du machst dich jetzt frei und erträgst deine gerechte Strafe.“
Reflexartig schlug Franz den Arm des Lehrers, der an seinen Haaren griff, zur Seite und stieß Beer von sich weg. Dieser stolperte nach hinten, verlor das Gleichgewicht und plumpste unter lautem Gepolter zu Boden. Als der ganze Saal daraufhin zu lachen begann, wurde Franz schlagartig bewusst, was er da soeben angerichtet hatte. Das wird er mir nie verzeihen, dachte er und nahm seine Beine in die Hand. Blitzartig verließ er das Klassenzimmer, stürmte nach draußen und lief über den Marktplatz davon.
Nahe der Kirche Sankt Jakob, verfiel er in leichten Trab und stoppte letztendlich, um sich an der Friedhofsmauer abzustützen und wieder zu Atem zu kommen. Speichel tropfte aus seinem Mund und er wischte ihn mit seinem Ärmel ab. Er sog die eisige Luft ein, die sich unangenehm in seiner Lunge breit machte. Er war auf den Weg zur Kirche nur wenigen Menschen begegnet. Die meisten der Frauen hatten noch zuhause mit dem Vieh oder der Hausarbeit zu tun. Die Männer, zumeist Handwerker, verbrachten die Zeit in ihren warmen Werkstätten, in welchen sie vor dem beheizten Kamin ihr Werk verrichteten.
Es war bereits früher Nachmittag, als Franz den Mut fand den Weg nach Hause anzutreten. Zwischenzeitlich hat er sich in den Auwiesen herumgetrieben und Stöcke geworfen. Mit schweren Beinen machte er sich auf den zwei Kilometer langen Weg zum elterlichen Hof. Seine Zehen waren durchgefroren, trug er doch lediglich abgetragene dünne Lederschuhe, die ihm keinerlei Schutz vor der Kälte boten. Er zog sich die Mütze, die ihm seine Mutter als Geschenk für Heiligabend im letzten Jahr gestrickt hatte, tiefer ins Gesicht. Seinen Tornister hatte er in der Schule liegen gelassen, also hatte er seine Hände frei und vergrub sie tief in den Taschen seiner viel zu kurzen Strickjacke. Seine Hausaufgaben konnte er auch heute nicht machen, also würden die Prügel morgen so oder so erneut auf ihn warten. Vielleicht hätte er sie heute einfach über sich ergehen lassen sollen. Morgen würden sie um ein vielfaches Schlimmer ausfallen, dessen war er sich sicher.
Vorsichtig schob Franz die Tür auf. Sie war, wie immer, nicht abgesperrt. Abgesehen davon, dass das Türschloss schon seit Jahren kaputt war, würde niemanden in den Sinn kommen in das ärmliche alte Bauernhaus einzubrechen. Als er einen Schritt in die Stube tat, vernahm er Stimmen. Die eine Stimme war die vertraute seines Vaters, aber auch die andere Stimme war ihm bekannt. Es war eine weitere männliche Stimme, die nicht hierher gehörte, die er aber dennoch tagtäglich zu hören bekam. Auf leisen Sohlen schielte er um die Ecke und sein Verdacht bestätigte sich. Es war die voluminöse Stimme seines Schullehrers Beer. Er saß zusammen mit Franz' Vater bei einem Krug Bier am Esstisch und sie schienen sich angeregt zu unterhalten.
„Bist du jetzt endlich daheim?“ Diese Bemerkung von Franz Mutter, die genau in dem Moment mit zwei weiteren Bierflaschen um die Ecke kam, war eher eine Feststellung als eine Frage und riss Franz aus seinen Gedanken. Franz antwortete nicht, stattdessen wurden sein Vater und Herr Beer auf ihn aufmerksam.
„Franz, komm herein!“, forderte sein Vater ihn mit einer unwirschen Handbewegung auf. Franz' Knie wurden weich und waren kurz davor nachzugeben. Langsam trat er auf die Beiden zu und hielt demütig den Kopf gesenkt.
„Schau mich an, wenn ich mit dir rede.“
Franz hob den Kopf und schaute seinem Vater ins Gesicht. In seinem vom Wetter gegerbten Gesicht erkannte er lodernden Zorn. Verstohlen schielte Franz zu Beer. Auch er setzte eine finstere Mine auf, die aber auch eine Spur Belustigung enthielt. Wahrscheinlich wartete er schon gespannt auf die Tirade, die Franz über sich ergehen lassen müssen würde. Jetzt wird abgerechnet, schien sein Blick zu sagen und morgen früh gehörst du mir! Franz mochte gar nicht daran denken.
Franz sah die Watsche nicht kommen, als er den Kopf gehoben hatte. Der Schlag traf nicht nur seine linke Backe, sondern auch seine Nase. Der Schmerz war so groß, dass ihm sogleich Tränen in die Augen schossen. Das war das Letzte, was er jetzt wollte. Heulend vor Beer zu stehen. Ohne ein Wort zu sagen drehte er sich um und lief die Stiegen hinauf auf sein Zimmer. Dort schloss er die knarrende Tür und setzte sich auf sein Bett. Er hielt seine wunde Backe und ließ den Tränen nun freien Lauf. Was für eine Demütigung. Er war mit seinen zwölf Jahren doch schon fast erwachsen und dennoch sahen sie auf ihn herab wie auf ein kleines Kind. In dem Moment beschloss Franz die Schule nicht mehr zu besuchen. Er würde eine Arbeit suchen und auf den eigenen Füßen stehen. Keine Erwachsenen mehr, die ihn belächeln, keine Bevormundung und keine Demütigung mehr.
Er hörte seinen Vater und Herrn Beer noch laut reden. Hin und da streute wohl einer der beiden einen Witz ein, denn Franz vernahm zwischendurch immer wieder schallendes Gelächter. Von seiner Mutter hörte er nichts. Sie kam auch nicht zu ihm aufs Zimmer, um nach ihm zu sehen.
3
Franz ging gestern Abend hungrig ins Bett. Keinesfalls wollte er seinem Vater nochmals über den Weg laufen und so verzichtete er auf sein übliches Brot mit extra viel selbst gemachter Butter. Entsprechend knurrte ihm der Magen, als er am Morgen von seinem Vater geweckt wurde.
„Aufstehen!“, knurrte dieser nur und verließ gleich darauf das Zimmer, um sich zum Frühstückstisch zu begeben. Franz war einerseits erleichtert, als sein Vater gleich wieder von dannen zog, ohne noch ein Wort zu gestern zu verlieren, andererseits war ihm mulmig zumute, da sein Vater vielleicht nur darauf wartete ihm beim gemeinsamen Frühstück die Leviten zu lesen. Langsam zog Franz die gleiche Kleidung von gestern über und trottete in die Küche. Vater und Mutter aßen bereits und auch auf Franz' Teller warteten schon seine Rühreier.
„'Morgen“, murmelte er und setzte sich zu ihnen. Vater sagte nichts, seine Mutter wünschte ihm ebenfalls einen guten Morgen. Franz begann zu Essen und schielte immer wieder erwartungsvoll zu seinem Vater hinüber. Dieser aber aß in allerseelenruhe seine Eier und beachtete ihn gar nicht weiter. Franz war erleichtert und aß schließlich mit großem Appetit seine Portion auf. Als er schon aufstehen wollte, wandte sich sein Vater doch noch an ihn.
„Dass du mir heute ja gleich heimkommst“, sagte er noch immer kauend, ohne ihn dabei direkt anzusehen. Als Franz nicht gleich antwortete, fügte er hinzu: „Gestern habe ich das ganze Holz allein spalten müssen, als du dich da draußen sonst wo herumgetrieben hast.“
Stimmt, dabei hätte er seinen Vater eigentlich zur Hand gehen sollen.
„Ich komme gleich, wenn die Schule aus ist“, sagte Franz. Ob er aber tatsächlich hingehen würde, ließ er noch offen. Zu sehr fürchtete er den Zorn von Lehrer Beer. Wenn er aber Glück hatte, dann wäre der Zorn schon genau so verraucht, wie der von seinem Vater. Vielleicht hatte Vater ihm gestern aber gut zugeredet, so dass alles vergeben und vergessen war.
„Und wegen gestern“, sagte der Vater schließlich, „Ich möchte, dass du dich beim Beer anständig und aufrichtig entschuldigst.“
Franz nickte kaum merklich. Vater nahm davon kaum Notiz, er erhob sich vom Tisch und begab sich nach draußen zum Außenabort. War das alles, was Vater zu dem Vorfall zu sagen hatte? Er blickte hinüber zu seiner Mutter. Die wusste, was er dachte.
„Dein Vater legt nicht viel Wert auf die Schule. Sieh lieber zu, dass du Daheim bist und auf dem Hof mithilfst. Den sollst du ja in ein paar Jahren übernehmen.“
Und genau das war, was Franz auf keinen Fall wollte.
„Aber dazu brauch ich doch auch eine Ausbildung“, erwiderte Franz.
„Nein, dein Vater hatte keine und du brauchst auch keine. Alles, was du wissen musst, lernst du von ihm. So wie er es von seinem Vater gelernt hat.“
„Aber dann versauer ich mein ganzes Leben lang auf diesem Hof.“
Seine Mutter schaute ihn entgeistert an. „Was soll denn das heißen? Natürlich bleibst du auf dem Hof. Das ist deine Pflicht als Sohn.“
„Und wenn ich das gar nicht will?“
„Du musst den Hof übernehmen, Franzl. Es ist doch sonst keiner da. Deine Schwester ist bereits unter der Haube. Die kann den Hof nicht mehr übernehmen.“
„Das kann doch nicht dein Ernst sein!“
„Das ist halt jetzt einfach so.“
„Aber ich will selbst entscheiden, was ich aus meinem Leben mach. Ich will einen gescheiten Beruf lernen und ganz bestimmt was anderes machen, als den Hof zu übernehmen.“
„Was meinst du, was dein Vater dazu sagt?“
„Ich weiß genau, was er dazu sagt, und das ändert nichts daran. Ich werde den Hof ganz bestimmt nicht weiterführen. Ich mach eine Lehre und gehe meinen eigenen Weg. Das ist schließlich mein Leben!“
Ehe Mutter was erwidern konnte, öffnete sich die Tür und Vater kam von seinem morgendlichen Toilettengang zurück.
„Was ist los?“, fragte er. „Ihr seid so laut.“
Mutter antwortete nicht und Franz erhob sich vom Tisch. „Ich muss jetzt weiter, sonst komm ich noch zu spät zur Schule und dann lerne ich nichts.“
Er griff nach seiner Strickjacke, zog die Lederschuhe an, die von gestern noch nicht ganz getrocknet waren, legte den Ranzen um und ging, ohne sich zu verabschieden nach draußen. Als er die Tür hinter sich zugezogen hatte, ging er hinüber zum Stall, um sich seinen Aufgaben zu widmen, ehe er den Weg zur Schule antrat. Er ging zuerst hinüber in den Kuhstall, um auszumisten und ihnen frisches Futter zu geben. Seine Mutter hatte heute Morgen vor dem Frühstück bereits gemolken. Es war eine mühevolle und schmutzige Arbeit, aber Franz war inzwischen daran gewöhnt. Seit er zehn Jahre alt war, also seit zwei Jahren, gehörte dies zu seinen Pflichten. Wenn er den Hof übernehmen wird, würde dies sein ganzes Leben lang so weitergehen. Daran mochte er gar nicht denken. Dabei hat er sich schon so viele Gedanken um seine Zukunft gemacht. Eine Lehre im Handwerk absolvieren und darin einer der Besten zu werden. Vielleicht könnte er es vom Gesellen bis zum Meister bringen. Er würde jemand sein! Jemand, auf den die Leute heraufschauen und die ihn respektieren, für das was er kann. Vielleicht ein Vermächtnis hinterlassen. Diese Befriedigung würde ihm das Leben auf dem Hof niemals geben können. Aber so wie es jetzt aussah, würde er in zwei Jahren von der Schule abgehen und den Hof bewirtschaften. Einen anderen Weg würde sein Vater niemals tolerieren. Zu sehr lag ihm der Hof am Herzen, als das er einfach zusehen würde, wie er aufgegeben wird. Missmutig und voller Unlust, trat Franz in den Haufen Klee, der für die Kühe zur Fütterung diente. Er warf die Mistgabel in die Ecke, wobei einer der vier Zinken verbog, und stapfte aus dem Stall. Er machte sich auf den Weg durch die Kälte in Richtung Langquaid auf.
Am oberen Teil des Marktes traf er auf seinen Freund, den Schorsch.
„Hast du auf mich gewartet?“, fragte Franz.
„Ja, wir können ja das letzte Stück miteinander gehen.“
„Dann schicken wir uns, vielleicht kann ich noch die Aufgaben von vorgestern von dir abschreiben, bevor der Beer wieder in das Zimmer rumpelt.“
„Ob ihn das besänftigen wird, bezweifle ich. Der war gestern noch bis Mittag geladen. Dem Hermann hat er nachher noch so eine feste Watsche gegeben, dass er fast vom Stuhl gekippt wäre.“
„Warum das denn?“
Schorsch zuckte mit den Achseln. „Du kennst doch den Lehrer Beer. Der braucht keinen großen Grund. Was hat eigentlich dein Vater gestern gesagt?“
„Komischerweise nichts. Dem, glaub ich, ist das relativ wurscht.
Die Schule interessiert ihn nicht. Ihn interessiert nur, dass ich den Hof weitermache.“
Heute hatte Franz sich vorgenommen rechtzeitig von der Schule nach Hause zu gehen, um seinen Vater nicht zu enttäuschen. Aber noch am Ausgang des Schulhauses wurde er vom Brückner Xaver und den Gebrüder Hoffmann abgefangen. „He Gruberbub“, begann der Brückner und versetzte dem armen Buben einen Stoß. „Warst gestern ganz schön mutig, hä?“
Franz antwortete nicht. Stattdessen versuchte er sich an Brückner und seinen Freunden vorbeizuzwängen. „Dableiben“, sagte Xaver und hielt ihn am Kragen fest. „Weil es nicht reicht, dass du der Abkömmling von einem Betrüger bist, jetzt hat der Beer seine ganze Wut gestern an uns ausgelassen. Er hat uns gestern acht Seiten lang abschreiben lassen. Was glaubst du, wie mir gestern die Hand wehgetan hat.“
„Tut mir leid“, versuchte Franz sich kleinlaut zu entschuldigen. Dass seine Mitschüler für seine Sünden büßen müssen, dafür konnte er nun wahrlich nichts, aber er wollte dem Konflikt unbedingt aus dem Weg gehen. Jeder hier wusste, wie unberechenbar der Brückner sich aufführen konnte.
„Ja, mir tut es auch leid“, äffte Xaver ihn nach. „Aber wenn ich Schmerzen gehabt hab, dann sollst du auch welche haben. Das nennt man ausgleichende Gerechtigkeit.“
Die Hofmann-Brüder packten daraufhin Franz von beiden Seiten und Xaver krempelte vielsagend seine Ärmel nach oben. Aber noch ehe Xaver ausholen konnte, entriss sich Franz geschwind der völlig überraschten Brüder, stieß Xaver von sich, ähnlich wie er es bei Beer getan hatte, und lief davon. Die Brüder folgten ihm sogleich auf den Fuß und da sie älter und größer waren, hätten sie ihn sicherlich gleich eingeholt, aber Franz rettete sich, in dem er die nächstbeste Tür öffnete, im Gebäude verschwand und die Tür hinter sich schloss. Er lauschte einen Moment an der Innenseite, aber weder die Gebrüder Hoffmann, noch Xaver machten Anstalten ihm weiter zu folgen.
Da schaute der Bub sich erst um, wo er überhaupt hineingelaufen war. Es war die Brauerei des Bürgermeisters. Das Gepolter hatte Münsterer auf den Jungen aufmerksam gemacht. Als er nach dem Radau sehen wollte, sah er vor sich einen jungen Burschen stehen, mit seinem Tornister auf dem Rücken. Franz drehte sich überrascht nach ihm um. Der Junge machte einen erbärmlichen Eindruck. Für diese Jahreszeit war er zu leicht angezogen und die abgenutzte Kleidung war ihm viel zu klein. Er schaute ängstlich und unsicher drein, als er Münsterer entdeckte und dieser ihn stimrunzelnd beobachtete. Franz wäre am liebsten gleich wieder hinausgestürmt, aber Münsterers Mine machte einen vertrauenswürdigen Eindruck und so gab er sich einen Ruck.
„Sie sind doch der Bürgermeister?“, fragte er etwas schüchtern. Münsterer antwortete mit einem gutmütigen Lächeln. „Und wer bist du?“, fragte er daraufhin.
„Ich bin der Gruber Franz“, antwortete der Junge selbstbewusst. Münsterer schien kurz nachzudenken. „Ach ja, vom Gruberhof draußen, richtig? Du bist der Bub vom Alois.“
Franz zeigte sich beeindruckt. Der Bürgermeister schien seinen Vater zu kennen. Ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen war, dessen war er sich nicht ganz sicher. Sein Vater ging nur selten unter die Leute. Eigentlich nur zu zwei Anlässen: Wenn es notwendig war zum Ferkelmarkt und selten mal in die Kirche. Vater schob das vor dem Pfarrer Anton Schießl auf die viele Arbeit auf dem Hof. Franz hingegen hatte den Eindruck, als ob er es mit dem Glauben nicht ganz so ernst nehmen würde. Von seiner Oma, die letztes Jahr verstorben war, kannte er es noch ganz anders. Die war so fromm, dass sie sogar zweimal in der Woche die Kirche besuchte und auch daheim viel Wert darauf legte, vor jeder Mahlzeit und am Abend gemeinsam zu beten. Nach ihrem Tod schlief das Ritual aber sehr schnell ein, obwohl Franz lange darauf bedacht war die Gebete im Sinne seiner Oma fortzuführen. Ganz vorbei war es einen Tages, als Franz vor dem Abendessen zu Beten anfangen wollte und ihn Vater mit einem unwirsehen „Lass den Schmarrn jetzt!“ abkanzelte und sich ein Stück Brot in den Mund schob. Seitdem betete Franz für sich allein im Stillen und muss dabei noch jedes Mal an seine selige Großmutter denken.
„Ja, der bin ich wohl“, antwortete Franz schließlich. Münsterer nickte wohlwollend. „Dann verrate mir doch bitte, was dich zu mir verschlagen hat.“
Franz suchte nach einer Ausrede, doch es fiel ihm auf die Schnelle keine ein. Also beschloss er bei der Wahrheit zu bleiben. „Da waren drei ältere Buben hinter mir her. Die sind mir nachgelaufen und wollten mich hauen.“ Bei dem Gedanken an die Burschen, brach ihm der Schweiß aus. Egal wie der Braumeister reagieren würde, früher oder später müsste er die Brauerei wieder verlassen und spätestens dann würden sie ihn schließlich kriegen.“
„M-hm“, ließ Münsterer nur verlauten und trat näher an den Buben heran. „Und warum sollten sie das tun wollen? Hast du sie recht geärgert?“
„Nein!“, entfuhr es Franz und hob abwehrend die Hände. „Ich wollte mit dem Schorsch nach der Schule heimgehen und auf einmal sind die drei hergekommen und haben angefangen mich herumzuschubsen. Der Schorsch ist gleich weg, aber mir haben sie den Weg versperrt. Dann bin ich losgerannt und weil sie mir nach sind, bin ich schnell hier rein, weil die Tür einen Spalt offenstand.“
Das erinnerte Münsterer wieder daran, dem Schreiner Bescheid zu geben.
„Hast du die Burschen gekannt? Vielleicht aus der Schule?“, fragte Münsterer.
„Ich glaube zwei von denen gehen in die achte Klasse im Rathaus drüben, aber den dritten habe ich nicht gekannt. Der war, glaub ich, schon ein bisschen älter.“
„Es läuft schon viel Gesindel draußen rum“, murmelte Münsterer mehr zu sich selbst, als dass er sich an Franz gewandt hätte. Dieser sah sich immer noch unsicher um. Die Gerätschaften, die er dabei entdeckte, übten allerdings eine Gewisse Faszination auf ihn aus. Die neugierigen Blicke blieben dem Brauer nicht unbemerkt.
„Magst du sich ein wenig umschauen?“, fragte Münsterer im väterlichen Ton. Und ob Franz das wollte. Er nickte eifrig und ließ seinen Tornister zu Boden gleiten. Münsterer deutete auf eine große Trichterähnliche Apparatur aus Metall.
„Schau her, da ist unser Malzboden. Dort wird das Malz geröstet und dann ein wenig Wasser dazugegeben. Das Gemisch kommt dann in die Maischpfanne dort drüben.“ Er deutete auf ein Gerät gleich dahinter. Münsterer zeigte ihm noch die vielen weiteren Gerätschaften und die fertig abgefüllten Bierfässer.
„Aber horch mal“, wandte sich Münsterer dann wieder an den Jungen. „Ist es nicht langsam Zeit, dass du heimkommst? Dem Vater macht sich sonst Sorgen“
Richtig. Der Vater braucht ihn heute für die Holzarbeit. Franz hatte das im Zuge der vielen Eindrücke ganz vergessen, oder besser gesagt, verdrängt.
„Ich glaub, ich werde auch Brauer“, sagte Franz, ehe er sich verabschiedete. „Die Schule kann mir bis dahin gestohlen bleiben.“
„Ich weiß, was du meinst“, schmunzelte der Bürgermeister, „aber auch als Brauer musst du die Schule besucht haben. Du musst schließlich die richtigen Mengen berechnen können und die Rezeptur lesen können.“
„Die lerne ich sowieso auswendig“, entgegnete Franz mit einem Schulterzucken. Münsterer musste daraufhin laut lachen. „Aber, du willst doch sicher nicht von deinem Chef beschissen werden, indem er dir zu wenig Lohn auszahlt? Genauso wie beim Einkäufen oder im Wirtshaus. Die Leute warten nur auf Leute wie dich, die sie über den Tisch ziehen können. Momentan wächst du noch behütet auf, aber die Welt da draußen ist grausamer als du denkst. Da meinen es nicht alle gut mit dir. Die meisten, die da draußen rumlaufen und ehrlich tun, sind in Wirklichkeit Verbrecher.“
Rums - das hat gesessen. Die Worte aus dem Mund des Bürgermeisters öffneten dem jungen Gruber die Augen. Ob der Mann wohl Recht hat? Franz tat sich sichtlich schwer die Worte richtig einzuschätzen, aber Münsterer war ihm dabei sogleich behilflich. „Na, ganz so schlimm ist es vielleicht nicht, aber du weist nie wem du trauen darfst und wer es nicht so gut mit dir meint.“
Franz nickte verwirrt. „Ich glaube, ich mache mich jetzt besser auf den Weg.“
„Das würde ich dir auch raten. Es wird spät.“
Nach einem Abschiedsgruß wandte sich der Junge zur Tür, die natürlich klemmte, und lief heim zum Gruberhof. Seine Gedanken drehten sich aber gleich wieder um die drei Burschen. Das Trio war schon lange weg, aber Franz fragte sich, was der ältere Bursche mit der Bemerkung über seinen Vater gemeint haben könnte.
Franz' Finger waren noch ganz wund, als er Mittag aus dem Schulgebäude herauskam. Er war in der Früh viel zu spät im Klassenzimmer und der Lehrer Beer, der den Buben spätestens seit gestern auf dem Kieker hatte, bestrafte ihn hierfür mit einem Dutzend Schlägen mit dem Lineal. Seine Finger wegzuziehen, wie es ihm aus Reflex fast passiert wäre, wagte er nicht. Er wusste, die Strafe dafür würde ihn umso härter treffen. Zumal sich Beer dadurch erneut den Spott der ganzen Klasse zugezogen hätte. Er erinnerte sich zurück an die vierte Klasse, als der Fischer Hubert es einmal gewagt und seine Finger weggezogen hatte. Der Lehrer Beer hat sich daraufhin selbst mit dem Lineal erwischt und das Gelächter der gesamten Klasse war groß. Der Zorn des Lehrers war daraufhin enorm und der Hubert kam tags darauf mit zwei geschwollenen Augen in die Schule. Keiner weiß ob's der Lehrer gewesen war. Der Hubert hat nie darüber gesprochen und bald hat auch keiner mehr danach gefragt.
Als Franz noch ganz in Gedanken versunken war, spürte er plötzlich einen groben Rempler, stolperte ein paar Schritte nach vom und konnte sich um Haaresbreite gerade noch auf den Beinen halten. Franz drehte sich nach dem Verursacher um, erkannte gerade noch einen der drei Burschen von heute Morgen, ehe er nach einem weiteren Schubser schmerzvoll auf dem Steißbein landete.
„Du hast wohl gemeint, du kommst einfach so davon, was?“, lachte der Älteste von dem Trio, der Brückner Xaver, und grinste recht dümmlich.
Franz versuchte sich aufzurappeln, wurde aber mit einem Tritt gegen den Unterschenkel von einem der zwei Kumpanen daran gehindert. Schmerzerfüllt hielt er sich das Bein.
„Was sollt ihr denn von mir?“, fragte Franz.
„Du bist halt ein Gruber!“, entgegnete Xaver. Franz verstand diese Aussage nicht. Ja, er war ein Gruber. Na und?
„Und die Gruber sind alles Betrüger! Die ganze Sippschaft!“, fügte der Anführer hinzu. „Lügner und Diebe, alle miteinander!“
Franz wurde wütend. Was sagte der Kerl denn da nur? Warum war er so gemein zu ihm und wie kommt er auf so blödsinnige Gedanken?
„Halt doch dein Maul!“, entfuhr es Franz
„Und der schlimmste ist dein Vater!“, setzte Xaver nach.
Jetzt reichte es Franz, er versuchte aufzustehen, wollte sich Xaver entgegenstellen. Wie konnte er sich nur so erdreisten? Aber die Hoffmannbrüder traten ihm die Beine weg, so dass er erneut zu Boden sackte.
„Lasst ihn endlich in Ruhe!“, rief plötzlich eine Mädchenstimme und die drei Burschen drehten sich nach ihr um. Die Stimme gehörte Marianne Berghammer, der Tochter des hiesigen Kaufmannes. Sie war vierzehn und eher als zurückhaltend bekannt. Franz war überrascht, dass sie sich für ihn einsetzte. Hatten sie doch bisher kaum mehr als ein paar Worte miteinander gewechselt. Was wohl auch daran lag, dass Marianne die Schule drüben im Rathaus besuchte. Sie war seines Wissens in der Mädchenklasse der Lehrerin Therese Rüby. Seit einigen Jahren wurden Buben und Mädchen in den Klassen getrennt, da man nicht viel von der gleichgeschlechtlichen Erziehung hielt. Da im Rathaus mittlerweile zwei Schulräume zur Verfügung standen, bildete man dort schließlich eine Klasse nur für Mädchen.
„Misch dich nicht, Mädchen“, raunte Xaver ihr zu. Er wandte sich wieder an Franz.
„Doch, ich mische mich ein!“, entgegnete sie energisch. „Drei gegen einen ist mehr als unfair, Xaver Brückner! Das dürfte sogar dir klar sein.“
Xaver verdrehte sie Augen. „Marianne, du nervst! Steck deine Nase lieber in deine Schulbücher und nicht in Dinge, die dich nichts angehen. Das hier ist Männersache.“
„Männersache? Drei gegen einen hat nichts mit Männersache zu tun, sondern nur mit Feigheit. Dein Vater würde sich schämen, wenn er das hier mitansehen müsste.“
Xaver ließ widerwillig von Franz ab und gab den Hoffmannbrüdem das Zeichen ihm zu folgen. „Wir sehen uns wieder!“, raunte er Franz noch zu und schlenderte mit seinen Kumpanen den Marktplatz hinab.
„Alles klar?“, fragte Marianne und reichte ihm die Hand, um ihm aufzuhelfen. Franz nahm sie jedoch nicht an und stützte sich stattdessen vom Boden ab. Er brauchte keine Hilfe von einem Mädchen, um aufzustehen.
Als er aufgestanden war, wischte er sich den Schmutz von den Händen und schaute sich nach allen Seiten um. Er hoffte, dass ihn niemand gesehen hatte
„Passt schon“, antwortete er nur knapp. Er klopfte den gröbsten Dreck von seiner Hose und beachtete Marianne nicht weiter. Es war ihm peinlich mit einem Mädchen gesehen zu werden, noch dazu wo sie ihm sogar noch zu Hilfe kommen musste.
„Dann ist es ja gut“, sagte sie daraufhin. Als Franz nicht antwortete, fügte sie hinzu: „Was wollten denn die Burschen von dir?“ Franz zuckte mit den Schultern. „Weiß nicht“.
„Kannst du mich nicht anschauen, wenn du mit mir redest?“
Jetzt endlich blickte Franz zu ihr auf. Natürlich kannte er Marianne. Hier in Langquaid kannte jeder jeden, aber eher nur flüchtig. Aber bisher war ihm noch nicht aufgefallen, wie hübsch das Mädchen eigentlich war. Ihre gewellten, strohblonden Haare lugten unter ihrer dicken Strickmütze hervor und an ihren Backen bildeten sich Grübchen, wenn sie lächelte. Ihre blauen Augen strahlten. Sie sieht aus wie ein Engel, dachte Franz und wurde noch nervöser. Warum eigentlich? Reiß dich zusammen und sei kein solcher Idiot, schalt er sich selbst.
„Ich muss jetzt nach Hause“, stammelte Franz verlegen. Er griff nach seiner Mappe und ging flotten Schrittes am altehrwürdigen Kastnerhaus, dem heutigen Postamt, vorbei. Marianne sah ihm noch verwirrt nach, ehe auch sie sich auf den Nachhauseweg machte.
4
Das Rathaus am Marktplatz war, abgesehen von der Kirche, das höchste Gebäude in der Gemeinde. Der im fünfzehnten Jahrhundert erbaute Ortsmittelpunkt war schon von weitem mit seiner neugotischen und in stufenform angelegten Außenfassade als die erste Adresse am Platz erkennbar. Das Rathaus diente nicht nur als zusätzlicher Schulsaal im ersten Stock und im Dachgeschoss. Das Rathaus beherbergte zudem die Marktwaage, die von den Bauern der Umgebung rege genutzt wurde, vor allem zur Hopfenernte. Zudem befanden sich eine Fleischbank, eine Brotniederlage, das Waschhaus und ein öffentlicher Abort im und an dem historischen Gebäude.
An diesem Dienstagabend war das Treiben am Rathaus bereits abgeebbt. Nur etwa ein halbes Dutzend Gemeinderatsmitglieder befanden sich noch im großen Sitzungssaal, um über verschiedene Themen zu diskutieren und abzustimmen.
Neben seiner Tätigkeit in der Brauerei versuchte der Bürgermeister hier sich für das Wohl der Mitbürger einzusetzen. Zumindest so weit die begrenzten Mittel des Marktes es ihm erlaubten. Der Markt lebte in erster Linie von der Landwirtschaft und von einfachen Handwerkern. Vom Aufstieg und Siegeszug der Industrie, die dank der Erfindung der Dampfmaschine vor wenigen Jahren zu florieren begann, bemerkte man in Langquaid nichts. Und das hatte laut Münsterer vor allem einen Grund: Die Gemeinde benötigte dringend einen Anschluss an die weite Welt. Sie brauchten eine Eisenbahnlinie, die sie zu den Metropolen der ganzen Welt führen würde.
Hektisch eilte Münsterer von der Brauerei hinüber zum Rathaus.
Er war spät dran, denn er wollte zuvor den Gärprozess im Kessel noch ein wenig im Auge behalten. Letzte Woche zeigten die Anzeigen im Sudkessel falsche Werte an und Münsterer wollte jetzt auf jeden Fall vermeiden erneut literweise Sud aus seiner Produktion zu verlieren. Dies konnte und wollte er sich nicht leisten.
Gerade als er den Türgriff in die Hand nahm, erreichte auch Manfred Gerstl das Rathaus. Er war außer Atem, denn auch er war zu spät dran.
„Ah, der Herr Bürgermeister. Ich dachte schon ich bin zu spät dran.“
„Das bist du auch, Michl“, entgegnete Münsterer.
„Aber du kommst doch auch gerade erst an.“
„Ja, weil ich eben auch zu spät bin.“
„Ohne dich fangen sie doch gar nicht an.“
Münsterer schüttelte den Kopf. „Täusch dich nicht. Der Hammerl Lorenz hat bestimmt schon das Ruder an sich gerissen. Das wäre ja nicht das erste Mal.“
„Der Lorenz macht sich gerne wichtig, aber ohne den Gemeinderat an seiner Seite hat auch er nichts zu sagen.“
„Wirst du es heute wieder ansprechen?“, fragte Gerstl schließlich als sie hineingegangen waren und vor der Tür zum Sitzungssaal standen.
Der Bürgermeister zuckte mit den Schultern. „Ich werde es weiter versuchen. Ich werde gar keine andere Möglichkeit haben.“
Alle Anwesenden erhoben sich sofort von ihren Sitzen als Gerstl und Münsterer den Saal betraten. Abgesehen von Hammerl, der nur zögerlich aufstand und dabei eine finstere Miene zog. Münsterer war dies nicht entgangen, aber er ignorierte beflissen diese Respektlosigkeit. Er bedeutete dem Gemeinderat mit einer Handbewegung sich wieder zu setzen.
Das Gemeindeoberhaupt nahm Platz, setzte seine Lesebrille auf und öffnete anschließend seine Tasche. Er holte ein Bündel beschriebener Blätter heraus, die lose mit einer Schnur verbunden waren und legte sie vor sich auf den Tisch. Nachdem er die Schnur entfernte hatte, überflog er seine Notizen, räusperte sich und wandte sich schließlich an die Gemeinderatsmitglieder, die ihn bis dahin wortlos beobachtet hatten. Münsterer hat in der Vergangenheit bereits viel für den Markt getan, sowohl als Bürgermeister als auch als Brauer und Geschäftsmann und hat sich dadurch über die Jahre den Respekt der Menschen erarbeitet, aber bestimmt würde er bald wieder auf das eine Thema zur Sprache bringen.
Nachdem die Tagesordnung abgearbeitet worden war, sagte er schließlich: „Ich möchte nochmal auf den Bau der Laabertalbahn zu sprechen kommen.“
Ein Raunen durch drang den Raum.
„Wir brauchen diese Bahnlinie nach Eggmühl. Nur so profitiert auch unser Markt vom Wiedererstarken der Wirtschaft.“ Münsterer versuchte den Gemeinderatsmitgliedern die Dringlichkeit seines Anliegens klarzumachen. „Andernfalls wird unsere Gemeinde eher früher als später dem wirtschaftlichen Ruin entgegentreten.“
„Josef, das erzählst du uns jetzt schon seit Jahren“, entgegnete Gemeinderat Lorenz Hammerl von der Opposition. „Die Gemeindekassen sind leer. Und schenken wird uns die Bahn bestimmt keiner.“ Hammerl war ein großgewachsener hagerer Mann mit stechendem Blick. Er war Landwirt und Ökonom und einer der wohlhabenderen Menschen im Ort.
„Sieh es endlich ein. Wir sind nicht Regensburg und München, sondern nur ein ganz kleiner Markt, mitten im Nirgendwo. Das wird auch immer so bleiben. Hier leben in erster Linie Landwirte und Handwerker. Was sollen wir mit einer sündhaft teuren Eisenbahn anfangen? Ganz zu schweigen von den Unterhaltungskosten, die so ein Bahnhof mit sich bringt. Wer bezahlt den Bahnbeamten?“ Er blieb vor Münsterers Platz stehen und beugte sich zu ihm hinunter. „Sei doch Vernünftig, Josef. Das alles ist eine Nummer zu groß für dich und für unseren Markt.“
Der Bürgermeister schüttelte empört den Kopf. Er blickte durch die Runde und sah neugierige Augenpaare, die alle auf ihn gerichtet waren und gespannt eine Gegenreaktion erwarteten. Er seufzte.
„Lorenz, hast du jemals schon etwas von Fortschritt gehört? Hätten wir nur so engstirnige Menschen wie dich, würden wir immer noch in Höhlen wohnen und mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gehen.“
Auf Hammerls Stirn bildeten sich Zomesfalten. „Was faselst du da von Höhlenmenschen, Josef? Sie dich doch mal um. Wir haben Felder, Tiere und was zu Essen. Nahezu jeder lebt in seinem eigenen kleinen Haus Wir haben alles, was wir brauchen. Uns geht es gut, so wie es ist und das wird auch so bleiben.“
„Du verkennst die Lage, Lorenz. Ich wiederhole mich: Die Gemeindekassen sind leer. Wir haben kaum Geld, um unsere Infrastruktur zu erhalten und für dringend nötige Reparaturarbeiten. In den umliegenden Gemeinden fehlt das Geld ebenso. In ein paar Jahren wird die Gegend dermaßen heruntergekommen sein, dass die Leute das Labertal weiträumig meiden werden, weil das traurige Elend niemand mehr anschauen kann.“
Hammerl grinste hämisch. „Dann hast du als Bürgermeister viel verkehrt gemacht!“
„Nein, aber ich werde viel verkehrt machen, wenn ich jetzt nicht für den Aufbruch in die Zukunft sorge. Wir brauchen die Eisenbahn jetzt, und unser Markt wird wieder florieren, so wie er es früher schon getan hat. Mir ist es egal, wie du darüber denkst und auch der Rest des Gemeinderats. Mir ist es allein schon ein persönliches Anliegen den Markt wieder groß zu machen und dafür werde ich bis zum letzten Atemzug kämpfen. Selbst wenn es bedeuten würde, dass ich zu Fuß nach München laufen muss, um für meinen Plan zu werben. Selbst vor dem Prinzregenten werde ich nicht Halt machen um ihm die Dringlichkeit meines Anliegens klarzumachen! Von ein paar Ewiggestrigen lasse ich mich davon nicht abhalten!“
Der Kopf des Bürgermeisters lief rot an und Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Um seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen, hämmerte er mit der Faust auf den Tisch.
Die Gemeinderäte ließen sich von seiner Rede mitreißen und stimmten ihrem Bürgermeister lautstark zu, applaudierten dabei und klopften auf den Tisch. Über den Saal legte sich ohrenbetäubender Lärm.
„Recht hast', Joseph! Langquaid muss vorangehen in die Zukunft!“
Hammerl packte wortlos seine Unterlagen zusammen und verließ mit grimmiger Miene den Sitzungssaal.
5
Donnerstag, am 16. Januar 1896
Zwei Tage waren vergangen, seitdem die drei Burschen Franz aufgelauert haben. Gestern haben sie ihn in Ruhe gelassen. Der Brückner Xaver war nicht zu sehen gewesen und die beiden Hoffmann Brüder ignorierten Franz sowohl gestern, als auch heute Morgen vor der Schule. Franz hoffte inständig, dass dies auch heute Mittag so bleiben würde. Er hatte keine Lust weiter terrorisiert zu werden und sich zum Gespött der Mitschüler zu machen. Vor allem der Mädchen, die drüben im Rathaus bei Frau Rüby Unterricht hatten. Es reichte schon, dass Marianne gestern mitbekommen hatte, wie hilflos er den drei Burschen gegenüberstand. Wenn es wenigstens die hässliche Charlotte vom Nachbarhof gewesen wäre. Vor der bräuchte er sich nicht genieren, aber die Marianne war ein richtig hübsches Mädchen, das musste sogar er sich eingestehen. Und mutig. Nicht viele Mädchen hätten sich getraut einzuschreiten bei der Rangelei vorgestern. Zumal Xaver als Raufbold verschrien war, der immer und überall Ärger macht.
Marianne hat er gestern vor der Schule kurz gesehen, als sie gerade vor dem Eingang der Gemeinde auf ihre beste Freundin Petra gewartet hat. Als sie flüchtig auf die andere Straßenseite hinüberblickte, hatte sie Franz gleich entdeckt und ihm zugewunken. Als Franz den Gruß schüchtern erwiderte, zwinkerte sie ihm noch kess zu. Als dann ihre Freundin kam, schlenderten sie zusammen in das Rathaus. Franz blieb verdattert stehen und hatte ein ganz flaues Gefühl im Magen. Er wurde erst aus seiner Lethargie gerissen, als der Schorsch ihn am Arm gepackt und gerüttelt hatte.
„Was ist denn mit dir los?“, hatte er gefragt. „Warum starrst du die ganze Zeit nach drüben? Dort sind doch nur die dummen Mädchen, also reiß dich zusammen.“
„Ich... ich habe geglaubt, der Xaver wäre dahinten gestanden.“
Schorsch schüttelte den Kopf. „Vergiss den Kerl einfach. Es sind nur noch ein paar Monate und dann ist er fertig mit der Schule und du hast deine Ruhe. Außerdem habe ich gehört, dass er die restliche Woche Strafarbeiten zu machen hat. Der hat gar keine Zeit mehr, um irgendjemanden zu ärgern.“
Franz nickte nur und wandte sich zum Gehen. Nicht jedoch ohne noch einen letzten Blick zum Fenster in den ersten Stock zu werfen. Vielleicht würde er einen Blick auf Marianne erhaschen können.
Der Lehrer Beer erzählte im Unterricht etwas von Multiplikation und Division, aber Franz' Gedanken drehten sich nur um Mariarme. Ob er verliebt war? Diesen Gedanken versuchte er sofort beiseitezuschieben. Natürlich war Marianne ein hübsches Mädchen, vielleicht sogar das Hübscheste in der ganzen Gemeinde, aber Franz sperrte sich gegen den Gedanken verliebt zu sein. Er ist doch erst zwölf und Marianne bereits vierzehn, also schon eine Jugendliche, fast schon erwachsen. Selbst wenn er verliebt sei, das war ihm völlig klar, würde sie von so einem kleinen Jungen wie ihm sicherlich nichts wissen wollen. Vielleicht bewunderte er sie auch einfach nur für ihren Mut.
Lehrer Beer war heute wieder schlecht drauf gewesen, hatte seine Launen aber zu Franz' Erleichterung am Schmidl Sepp ausgelassen, so dass er selbst ungeschoren davonkam. Der Sepp konnte Beer den Kehrwert bei den Divisionsaufgaben nicht erklären und darauf rastete dieser aus und hatte ihn fortan den restlichen Vormittag auf den Kieker.
Es war nun Zeit für den Nachhauseweg, doch Franz zögerte. Er sollte heute Nachmittag zusammen mit seinem Vater wieder Holz machen und auf diese Arbeit freute er sich überhaupt nicht. Die Arbeit war hart und Vater würde ihn wegen jeder Kleinigkeit anschreien. Franz konnte sich genau vorstellen, wie es wieder ablaufen würde. Franz würde seinem Vater zu langsam sein, er würde zu viele Schläge brauchen, würde die Axt falsch halten und zu unsicher arbeiten. Er kannte das alles schon. Er schaute hinüber zur Brauerei des Bürgermeisters und unwillkürlich zog es ihn auf die andere Straßenseite. Er blieb vor der Brauerei stehen, betrachtete die schwere Eichentür und das Schild darüber. Franz begann zu frieren, das Thermometer zeigte eine Temperatur von nur knapp unter null Grad an. Er schaute zum Fenster hinein und konnte den warmen Ofen sehen, in dem das Feuer flackerte und knisterte. Den Arbeitern dort drinnen würden heute Nachmittag nicht die Finger steif frieren. Sie konnten im Warmen arbeiten und mussten sich wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit anblaffen lassen.
Plötzlich ruckelte es an der Tür. Sie war wohl etwas schwerfällig, denn Münsterer öffnete sie mit großer Anstrengung. Unter einem langgezogenen Klagelaut, öffnete sie sich schließlich.
„Die gehört endlich repariert“, erklärte er entschuldigend. „Warum kommst du nicht gleich herein, wenn du schon die ganze Zeit zum Fenster reinschaust?“
Franz errötete. Wie peinlich. Aber Münsterer wiegelte gleich ab.
„Das braucht dir nicht zuwider sein, komm einfach rein und wärm dich auf.“
Zögerlich folgte Franz dem Bürgermeister und sofort umhüllte die angenehme Wärme des Holzofens seinen Körper. Er musste sogar seine Mütze abnehmen um nicht anfangen zu schwitzen.
„Ganz schön warm hier drinnen, was Franzl?“
Franz nickte schüchtern und knöpfte auch seine Strickjacke auf.
„Magst was trinken?“
Franz schüttelte den Kopf. „Ich darf noch kein Bier trinken!“
Münsterer lachte schallend. Verwirrt blickte Franz sich um. Was war daran so lustig?
„Ich hab' natürlich auch ein Kracherl, falls dir das lieber ist.“
Münsterer hielt ihm eine Flasche Limo hin. Franz machte große Augen. Eine Limo war etwas ganz Besonderes. Zuhause gab es nur Milch von den Kühen und Wasser aus dem Brunnen. Sein Vater hatte zwar Bier zuhause, aber das durfte er freilich noch nicht trinken. Einmal tat er es doch, zum einen, weil er so einen großen Durst verspürte, zum anderen, weil er es einfach mal probieren wollte. Der Vater kam ihm aber drauf und hat ihn daraufhin windelweich geprügelt. Drei Tage lang tat ihm alles weh und seitdem hat er die Finger vom Bier gelassen.
Er hielt die Limoflasche in der Hand und betrachtete die Flasche ehrfürchtig. Er traute kaum sie zu bewegen aus Angst sie könnte runterfallen und zerbersten. Die Flasche muss unglaublich teuer gewesen sein und er bekam sie einfach so in die Hand gedrückt. Franz fühlte sich, als hätte er einen Schatz in den Händen.
„Was ist los, warum trinkst du nicht, Franz? Dürstet dich etwa nicht?“
Franz wusste nichts darauf zu antworten. Er betrachtete den Schnappverschluss und wusste gar nicht damit umzugehen. Wie würde er die Flasche unfallfrei öffnen können? Er drückte unbeholfen gegen den Deckel, aber dieser ließ sich nicht so ohne weiteres öffnen. Münsterer erkannte sogleich die Problematik und kam ihm zu Hilfe. Er nahm Franz die Limo aus der Hand und zeigte ihm wie man es macht.
„Schau Franzl, du hältst die Flasche am Hals, drückst auf den Seiten mit beiden Daumen gegen den Verschluss und, Schwupps, ist die Flasche offen.“
Mit einem lauten 'Plopp' sprang der Verschluss auf und Franz konnte die Limo nun endlich trinken. Und wie sie ihm schmeckte. Die Limo war ein regelrechter Genuss. Franz trank beinahe die ganze Flasche auf einmal aus. Schließlich war ihm aber etwas unwohl geworden. Er fasste sich an den Bauch und schon glaubte er sich übergeben zu müssen. Er hielt die Hand vor den Mund und ehe er nach einem Kübel Ausschau halten konnte, entfuhr ihm ein langgezogener Rülpser. Schlagartig fühlte er sich wieder besser. Der Rülpser war ihm so peinlich, dass er errötete und nur ein zaghaftes „’tschuldigung“ herausbrachte, aber der Brauer Münsterer lachte nur. „Freut mich, wenn dir die Limo geschmeckt hat.“
Es klopfte an der Hintertür.
„Ja?"
Ein hagerer älterer Mann mit schütterem Haar trat mit unsicheren Schritten herein. Er war ärmlich gekleidet und als er zu sprechen begann, offenbarte sich ein zahnloser Mund.
„Ich bringe die Gerste.“
„Oh, sehr gut. Sie können sie dort drüben abladen.“ Münsterer deutete in die hinterste Ecke, in der schon ein halbes Dutzend Säcke herumstanden. „Ich kann ihnen leider nicht helfen, ich muss dringend noch nach der Würzpfanne sehen.“
„Das passt schon.“ Als der Lieferant sich umdrehte erkannte Franz, dass dieser nur einfache Schlappen trug. Bei dieser Kälte war dies fast eine Garantie, um sich eine Erkältung oder im schlimmsten Fall eine Lungenentzündung zu holen.
„Warten sie, ich helfe ihnen!“, rief Franz ihm nach und eilte zu ihm nach draußen. Dort stand ein Ochsenkarren mit den Säcken voller Gerste bereit, aber einen Ochsen, der den Wagen ziehen sollte, konnte Franz nicht sehen. Der Alte wird doch den Karren nicht selbst gezogen haben? Franz blieb nicht viel Zeit, um darüber nachzudenken. Er nahm dem Alten den ersten Sack aus der Hand und sagte: „Lassen sie mich das ruhig machen und sie ruhen sich etwas aus.“
Der Alte schaute Franz erstaunt an und sein müdes Gesicht zeigte einen Anflug von einem Lächeln.
„Ich bin noch jung, mir macht das nichts aus“, sagte Franz noch, ehe er den Sack über seine Schultern hievte und ihn in die Brauerei hineintrug.
Als er den dritten Sack abstellte, musste er kurz verschnaufen. Ganz ohne war die Arbeit doch nicht und vor allen Dingen knurrte zudem noch sein Magen. Er hatte seit dem Frühstück nichts mehr gegessen und der Hunger machte sich zunehmend bemerkbar. Franz wollte sich jedoch keine Blöße geben und vor allem den Alten nicht hängen lassen und so biss er die Zähne zusammen und schnappte sich auch noch die restlichen Säckle voll Gerste.
Als Franz alle acht Säcke hineingetragen hatte, klopfte er sich den Staub von der Kleidung und blies die Backen auf. Der Alte kam freudig auf ihn zu und tätschelte ihm die Schulter. „Danke Bub“, sagte er. „Du bist ein ganz ein Guter. Dein Papa kann stolz auf dich sein!“
Dessen war Franz sich da nicht so sicher. Als der Alte seinen Karren wieder davonschob, tauchte Münsterer wieder auf.
„Das war richtig nett von dir“, sagte er. „Wenn du willst, kannst du mir auch noch ein bisschen helfen. Mir ist für heute ein Geselle ausgefallen.“ Der Brauer deutete auf die Bierfässer im Nebenraum. „Das ist die Bierlieferung für die Wirtshäuser heute Nachmittag. Die gehören noch auf meine Fuhre aufgeladen. Willst du das vielleicht noch machen?“
Franz schluckte. Eigentlich wollte er jetzt möglichst rasch nach Hause, schließlich wartete nicht nur der Vater mit einer Menge Arbeit auf ihn, sondern auch ein warmes Mittagessen, auf das er ungern verzichten wollte. Andererseits war der Bürgermeister so nett zu ihm und er wollte ihn auf keinen Fall enttäuschen.
„Na gut“, sagte er schließlich. „Ich helfe ihnen mit den Fässern.“
„Das freute mich. Packen wir es gleich an, dann haben wir es bald geschafft.“
Nacheinander rollten sie die Fässer in Richtung des Hinterausgangs. Dabei tat Franz sich noch leicht, aber als es darum ging, die rund ein halber Zentner schweren Fässer auf den Wagen zu heben, hatte er sichtlich Probleme. Auch hier wollte er sich nichts anmerken lassen und strengte sich extra an. Dank der harten Arbeit am Hof zu Hause, war Franz mit seinen zwölf Jahren bereits ziemlich kräftig und so hatte er noch genügend Kraftreserven, um auch das letzte Fass auf den Wagen zu befördern. Gerade als er das Fass abgeladen hatte, kam Frau Pöschenrieder hinzu. Sie war um die siebzig und durch den Deutsch-Französischen Krieg bereits mit vierzig Jahren Witwe geworden. Seitdem lebte sie allein und läuft auch nach vielen Jahren zumeist in schwarzer Trauerkleidung durch die Straßen Langquaids. Böse Zungen titulierten sie auch als wandelndes Klatschblatt, da sie jeden kannte, alles wusste und sich mit ihrem neu angehäuften Wissen nicht hinter dem Berg hielt.
„Ja Joseph, hast du etwa einen neuen Lehrbuben eingestellt? Das scheint ja ein recht ein Fleißiger zu sein.“
Ehe Münsterer ihr antworten konnte, hatte sie Franz bereits von oben bis unten gemustert. Ihre Augen verengten sich zu einem Schlitz und ihre Hakennase zog sich nach unten, als sie die Lippen schürzte. „Moment mal! Du bist ja ein Gruber! Du bist dem Gruber Alois sein Bub, hab' ich nicht recht?“
Franz nickte. „Jawohl, Frau Pöschenrieder, ich bin der Franz.“
Sie wandte sich an den Bürgermeister. „Und so einen stellst du ein? Und das in deiner Position?“
Franz war irritiert. Was meinte denn die gute Frau damit?“
Münsterer hatte für die Dame allerdings nur ein müdes Lächeln übrig. „Den Franz hab' ich nicht eingestellt, ich habe ihn nur gebeten mir beim Verladen der Fässer zu helfen. Und das hat der Franz auch sehr gut gemacht.“
Franz fühlte sich trotz des Lobes unwohl in seiner Haut. Die ablehnende Haltung der Frau Pöschenrieder ihm gegenüber war ihm nicht entgangen.
„Ich muss jetzt nach Hause“, sagte er schließlich. „Der Papa wartet schon mit einem Haufen Arbeit auf mich.“
Als Franz gerade gehen wollte, packte Münsterer ihn an der Schulter. „Warte mal noch kurz“, sagte er und griff in seine Jackentasche. Er holte einen kleinen Gegenstand heraus und drückte ihn dem überraschten Jungen in die Hand. Als Franz sich die Hand vors Gesicht hielt, erkannte er eine 10-Pfennig-Münze.
„Die gehört dir, Franzl. Als Dankeschön für deine Hilfe.“
Franz wusste nicht, was er sagen sollte. Zehn Pfennig. Franz hat noch nie eigenes Geld besessen und die zehn Pfennig kamen ihm wie ein Vermögen vor. Er überlegte schon, was er damit machen sollte. Vielleicht gleich runter zum Kramerladen gehen und was zum Schlecken kaufen? Aber dann fiel ihm ein, dass die meisten Geschäfte jetzt Mittagspause machten. Er steckte die Münze in seine Hosentasche und bedankte sich artig beim Bürgermeister. Schließlich wandte er sich zum Gehen. Er hörte aber noch, dass zwischen dem Bürgermeister und der Frau Pöschenrieder ein heftiger Disput ausbrach.
„Wie kannst du dem Buben auch noch Geld geben?“ Münsterers Antwort darauf konnte er allerdings schon nicht mehr hören. Im Laufschritt eilte er nach Hause. Der Papa würde bestimmt schon Böse sein und das Essen wahrscheinlich schon kalt.