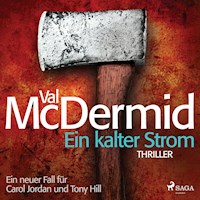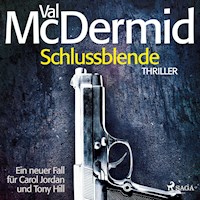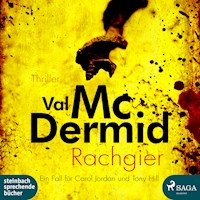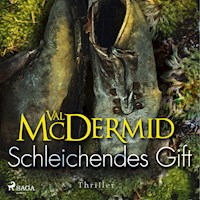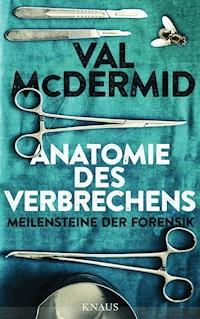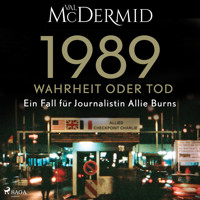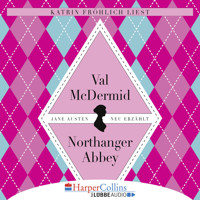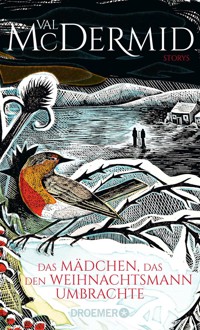9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Carol Jordan und Tony Hill
- Sprache: Deutsch
Die Bestseller-Autorin Val McDermid liefert im dritten Band der Thriller-Serie um das Ermittlerduo Carol Jordan und Tony Hill wieder Nervenkitzel pur: Die Kriminalkommissarin und den Profiler führt es dieses Mal nach Deutschland, jedoch in unterschiedlicher Mission. Ein Wahnsinniger hat es offensichtlich auf Psychologen abgesehen, die er auf bestialische Weise misshandelt und anschließend nackt und gefesselt ertränkt. Der Killer wurde offenbar selbst in seiner Kindheit vom eigenen Großvater grauenvoll gequält und gedemütigt. Als Tony Hill der schrecklichen Vergangenheit illegaler Nazi-Experimente an Kindern auf die Spur kommt, ist es bereits zu spät. Er schwebt als Psychologe selbst in höchster Lebensgefahr. Kaum vorstellbar, doch der Nervenkitzel dieser Thriller-Serie lässt nicht nach, denn Carol Jordan ist parallel undercover in einem internationalen Drogen- und Menschenhändlering einschleust worden – ohne zu ahnen, welch Grausamkeiten sie hier ausgesetzt ist. Sie hat sich auf einen Pakt mit dem Teufel eingelassen... Im dritten, nervenaufreibenden Band der erfolgreichen Thriller-Serie treffen die beiden Ermittler in ein Wespennest aus Korruption und Gewalt – und stoßen dabei schmerzhaft an ihre eigenen Grenzen. "Der kalte Strom" ist die ungeheuer fesselnde Suche nach bald mehr als einem Psychopathen im Dreieck von Deutschland, England und den Niederlanden. Ein weiterer Fall der preisgekrönten Thriller-Serie von Val McDermid, die mit Garantie für Nervenkitzel und schaflose Nächte sorgt. Spannend, actiongeladen und mit einer wirklich guten Story! Lovelybooks.de Val McDermid ist die wahre Herrscherin im Reich des psychologischen Thrillers. The Express Mehr Nervenkitzel garantieren weitere Fälle der spannenden Thriller-Serie um Tony Hill und Carol Jordan: Bd. 1: Das Lied der Sirenen Bd. 2: Schlussblende Bd. 3: Ein kalter Strom Bd. 4: Tödliche Worte Bd. 5: Schleichendes Gift Bd. 6: Vatermord Bd. 7: Vergeltung Bd. 8: Eiszeit Bd. 9: Schwarzes Netz Bd. 10: Rachgier Bd. 11: Der Knochengarten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 789
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Val McDermid
Ein kalter Strom
Roman
Aus dem Englischen von Doris Styron
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Fallbericht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Fallbericht
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Fallbericht
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Fallbericht
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Fallbericht
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Epilog
Danksagung
Für Cameron Joseph McDermid Baillie.
Ein vergleichsweise bescheidenes Geschenk, aber das Beste, was ich geben kann.
Die letzte Lockung ist der Hochverrat.
Aus falschem Trieb tun rechte Tat.
T. S. Eliot,Mord im Dom
Die Psychologie hat nur dann wirklich Gewicht,
wenn sie die Verantwortung für psychologische Analysen
zu Staatszwecken übernimmt.
Max Simoneit, wissenschaftlicher Leiter des Amtes für Wehrmachtspsychologie, 1938
Name: Walter Neumann
Sitzung Nummer: 1
Bemerkungen: Der Patient lässt sich offenbar schon längere Zeit von einem übertriebenen Gefühl der Unfehlbarkeit lenken. Er zeigt einen beunruhigenden Grad von übermäßigem Vertrauen in seine Fähigkeiten. Bei dem anspruchsvollen Bild von sich selbst kann er nur zögernd zugeben, dass es möglicherweise begründete Kritik an ihm geben könnte.
Wenn er herausgefordert wird, scheint er beleidigt und hat sichtlich Schwierigkeiten, seine Empörung zu verbergen. Er sieht keine Notwendigkeit, sich zu verteidigen, denn er betrachtet es trotz aller gegenteiligen Beweise als selbstverständlich, dass er Recht hat. Seine Fähigkeit zur Selbstanalyse ist offensichtlich eingeschränkt. Seine typische Reaktion auf eine Frage ist eine Gegenfrage. Er zeigt eine ausgesprochene Abneigung dagegen, sein eigenes Verhalten oder die Konsequenzen seines Handelns zu überprüfen.
Das Konzept und die Einsicht in eine weiter gefasste Verantwortung fehlen ihm. Dem äußeren Anschein nach hat er Gemütsbewegungen, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies mehr als eine nützliche Maske ist.
Therapeutische Maßnahmen: Behandlung zwecks Zustandsveränderung eingeleitet.
Kapitel 1
Blau ist die Donau eigentlich nie. Ihre Farbe schwankt zwischen Schiefergrau, Schlammbraun, schmutzigem Rostrot, verschwitztem Khaki und den Abstufungen dazwischen, die sämtliche Träume eines an ihrem Ufer stehenden Romantikers zerstören würden. Gelegentlich hat sie dort, wo Schiffe liegen, einen öligen Glanz, wenn die Sonne auf dem Film verschütteten Treibstoffs den Regenbogenschimmer einer Taubenkehle aufs Wasser zaubert. In dunklen Nächten, wenn die Wolken die Sterne verdecken, ist sie schwarz wie der Styx. Aber heute im Mitteleuropa der Jahrtausendwende kostet die Überfahrt mit dem Fährmann etwas mehr als eine Münze.
Vom Land wie vom Wasser aus glich der Ort einer verlassenen, heruntergekommenen Werft für Schiffsreparaturen. Die verrottenden Streben zweier Lastkähne und rostige, alte Maschinenteile, deren früherer Zweck ein Geheimnis blieb, waren alles, was man durch die Lücken zwischen den Brettern des hohen Tores sehen konnte. Hätte jemand aus Neugier auf der stillen kleinen Nebenstraße angehalten und in den Hof hineingespäht, dann hätte er sich mit dem Eindruck zufrieden gegeben, wieder einmal die letzte Ruhestätte einer kommunistischen Fabrikanlage vor sich zu haben.
Aber es gab keinen ersichtlichen Grund, gerade in Bezug auf diesen Flussarm eine solch müßige Neugier zu hegen. Das einzig Rätselhafte an ihm war, warum jemand es selbst in den irrationalen Tagen des Totalitarismus für sinnvoll gehalten hatte, hier einen Betrieb zu errichten. In allen Himmelsrichtungen gab es im Umkreis von zwanzig Kilometern keine bedeutende Ansiedlung. Die wenigen Bauernhöfe im Hinterland hatten, wenn sie genug abwerfen sollten, schon immer mehr Arbeit erfordert, als die dort ansässigen Familien leisten konnten. Also gab es da auch keine überzähligen Arbeitskräfte. Als die Werft noch in Betrieb war, hatte man die Arbeiter von weit her mit Bussen zu ihrem Arbeitsplatz gebracht. Der einzige Vorteil war die Lage am Fluss. Vor der Hauptströmung bot eine niedrige Sandbank Schutz. Sie war mit struppigem Gebüsch und ein paar Bäumen bewachsen, die sich in die Richtung des gerade vorherrschenden Windes neigten.
Dies blieb der hervorstechende Vorzug für die, die jetzt ganz im Verborgenen dieses offensichtliche Beispiel verfallender Industriearchitektur aus der schlechten alten Zeit nutzten. Denn dieser Standort war nicht das, was er nach außen hin zu sein schien: ganz und gar keine Ruine, sondern eher eine wichtige Zwischenstation auf einer Reise. Wenn jemand sich die Mühe gemacht hätte, sie näher zu betrachten, wäre er bald auf Ungereimtheiten gestoßen. Zum Beispiel auf die Einzäunung aus vorgefertigten Stahlbetonplatten, die in erstaunlich gutem Zustand war und deren oben befestigter Stacheldraht viel zu neu aussah, um ein Relikt aus der kommunistischen Zeit zu sein. Es waren nicht besonders viele Anhaltspunkte, aber doch Hinweise, die der lesen konnte, der sich mit der Sprache falscher Vorspiegelungen auskannte.
Hätte ein solcher Beobachter an diesem Abend die anscheinend verlassene Werft überwachen lassen, dann hätte sich das für ihn bestimmt gelohnt. Aber als der elegante schwarze Mercedes die kleine Nebenstraße entlangglitt, gab es keine neugierigen Blicke, die ihm hätten folgen können. Der Wagen hielt kurz vor dem Tor an, und der Fahrer stieg aus. Einen Augenblick fröstelte er, als er aus der klimatisierten Wärme im Wagen in die feuchtkalte Luft hinauskam. Er suchte in den Taschen seiner Lederjacke nach einem Schlüsselbund und brauchte eine Weile, um die vier ungewohnten Vorhängeschlösser aufzuschließen. Aber dann öffneten sich nach leichtem Druck die Torflügel geräuschlos. Er zog sie vollends auf, eilte zum Wagen zurück und fuhr hinein.
Nachdem der Fahrer das Tor hinter dem Mercedes geschlossen hatte, stiegen zwei Männer aus dem Fond der Limousine. Tadeusz Radecki streckte seine langen Beine, zog die Bügelfalten seines Armani-Anzugs glatt und holte seinen langen Zobelmantel aus dem Wagen. Es war ihm jetzt oft so kalt wie nie zuvor, und dies war ein unwirtlicher Abend. Sein Atem entwich wie dünne Rauchfahnen aus seinen Nasenlöchern. Er zog den Pelz enger um sich und musterte die Umgebung. In letzter Zeit hatte er abgenommen, und im blassen Scheinwerferlicht glich sein knochiges Gesicht einem Totenschädel, in dem nur seine haselnussbraunen Augen lebendig wirkten.
Darko Krasic schlenderte um den Wagen herum, blieb neben Radecki stehen und hob das Handgelenk, um auf das Zifferblatt seiner klobigen goldenen Uhr zu sehen. »Halb zwölf. Der Laster sollte jetzt jeden Augenblick hier sein.«
Tadeusz neigte leicht den Kopf. »Ich denke, wir werden das Päckchen selbst mitnehmen.«
Krasic runzelte die Stirn. »Tadzio, das ist keine gute Idee. Es ist doch alles geplant. Es ist nicht nötig, dass du so nah an die Ware rankommst.«
»Meinst du nicht?« In Tadeusz’ Stimme lag eine trügerische Lässigkeit. Dabei wusste Krasic genau, dass er ihm nicht widersprechen sollte. Bei dem Verhalten, das sein Boss in letzter Zeit an den Tag gelegt hatte, wagten es nicht einmal seine engsten Mitarbeiter, ihm entgegenzutreten und damit einen Wutanfall zu riskieren.
Krasic hob besänftigend eine Hand. »Wie du willst«, sagte er.
Tadeusz entfernte sich vom Auto und fing an, in der Werft umherzustreifen, während seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Einerseits hatte Krasic Recht. Es war nicht nötig, dass er sich selbst direkt in irgendeine Phase seiner Geschäfte einschaltete. Aber gerade jetzt sollte nichts als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Seine Wesensart war durch seine Großmutter geprägt worden, die trotz des adeligen Blutes in ihren Adern, das sie immer erwähnte, genauso abergläubisch gewesen war wie nur irgendeiner der Bauern, die sie so verachtet hatte. Aber sie hatte ihre vernunftwidrigen Ansichten mit kunstvollen literarischen Zitaten verbrämt. Statt dem Jungen beizubringen, dass ein Unglück selten allein komme, hatte sie das Shakespearewort herangezogen: »Wenn die Leiden kommen, so kommen sie wie einzle Späher nicht, nein in Geschwadern.«
Katerinas Tod hatte ihm schon Kummer genug gebracht. Tadeusz war stolz darauf, seine Gesichtszüge so zu beherrschen, dass sie ihn nie verrieten, weder bei geschäftlichen Anlässen noch in privaten Beziehungen. Aber diese Nachricht hatte sein Gesicht zu einer heulenden Maske der Verzweiflung verzerrt, während die Tränen ihm in die Augen schossen und ihn ein unterdrückter Schrei zerriss. Er hatte immer gewusst, dass er sie liebte, doch wie sehr – das hatte er nie begriffen.
Aber noch schlimmer war, dass alles so lächerlich erschien. So typisch für Katerina. Sie war in ihrem offenen Mercedes-Kabrio unterwegs gewesen und hatte gerade die Autobahn an der Ausfahrt Ku’damm verlassen, war also wahrscheinlich zu schnell gefahren, als ein Motorrad vor ihr aus einer Seitenstraße herausschoss. Verzweifelt versuchte sie auszuweichen, um den leichtsinnigen Motorradfahrer nicht zu erfassen. Dabei schoss sie auf den Gehweg zu, verlor die Kontrolle über den mächtigen Sportwagen und raste in einen Zeitungskiosk hinein. Sie war in den Armen eines Sanitäters gestorben, ihre Kopfverletzungen unvorstellbar entsetzlich.
Der Motorradfahrer war längst verschwunden und war sich des Blutbads, das er angerichtet hatte, wohl kaum bewusst. Bei einer Untersuchung des Fahrzeugs hatte man einen Defekt im Antiblockiersystem des Mercedes entdeckt. Das war jedenfalls die offizielle Version.
Aber als die erste Trauer sich gelegt hatte und Tadeusz wieder handlungsfähig war, kamen ihm Zweifel. Krasic, seine ihm stets treu ergebene rechte Hand, hatte berichtet, dass es während Tadeusz’ vorübergehender Abwesenheit ein paar mehr oder weniger raffinierte Versuche gegeben hatte, in sein Territorium einzubrechen. Mit stoischer Ruhe war Krasic, unbeirrt von dem schmerzlichen Verlust, den sein Chef erlitten hatte, den Drohungen rücksichtslos entgegengetreten; erst nach den Anzeichen von neuem Lebenswillen bei Tadeusz hatte er diesem die ganze Geschichte unterbreitet.
Von da an galt die Parole: Tadeusz ist hinter dem Motorradfahrer her. Die von ihm geschmierten Polizisten waren keine große Hilfe gewesen, und es gab kaum Zeugenaussagen. Alles war so schnell geschehen. Es hatte gerade angefangen zu nieseln, so dass die vorbeikommenden Fußgänger im Regen die Köpfe gesenkt hielten. In der unmittelbaren Umgebung gab es keine Überwachungskameras.
Der Privatdetektiv, den Tadeusz beauftragt hatte, noch einmal mit den Zeugen zu sprechen, hatte ein bisschen mehr zusammenbekommen. Ein Jugendlicher, der selbst gern Biker gewesen wäre, hatte bemerkt, dass es eine BMW-Maschine gewesen war. Tadeusz wartete ungeduldig darauf, dass seine Kontaktleute bei der Polizei eine Liste möglicher Kandidaten lieferten. So oder so, ob der Tod nun ein Unfall oder das Resultat eines grausamen Plans war, würde jemand dafür bezahlen müssen.
Tadeusz wusste, dass er sich in der Wartezeit beschäftigen musste. Normalerweise überließ er die Planung Krasic und dem Kreis kompetenter Organisatoren, mit denen sie sich im Lauf der Jahre umgeben hatten. Er kümmerte sich um die großen Pläne, Details waren nicht seine Sache. Aber er war gereizt. Da draußen im Dunkeln lauerten drohende Gefahren, und es war an der Zeit, alle Glieder der Kette darauf zu überprüfen, ob sie noch so intakt waren wie am Anfang, als das System aufgebaut wurde.
Und es schadete nichts, die Handlanger daran zu erinnern, wer hier das Sagen hatte.
Als er zum Ufer ging und flussaufwärts blickte, konnte er die Buglichter eines riesigen Rheinschiffs ausmachen, dessen stampfendes Motorengeräusch über das Wasser heranzog. Er sah zu, wie das Schiff in den schmalen, tiefen Kanal einbog, in dem es längsseits am Bootskai anlegen wollte. Tadeusz hörte, wie hinter ihm die großen Torflügel wieder aufgingen.
Er drehte sich um und sah einen zerbeulten Transporter herankommen, seitlich einscheren und neben dem Mercedes halten. Sekunden später hörte er das elektronische Warnzeichen eines großen Containerlastzugs, der rückwärts in die Werft einfuhr. Drei Männer sprangen aus dem Transporter. Zwei davon liefen auf die Werft zu, während der dritte, in der Uniform eines rumänischen Zollbeamten, zum hinteren Ende des Lkws ging, wo er auf den Fahrer traf. Zusammen entfernten sie das Zollsiegel vom Container, nahmen die Schlösser ab und machten die Türen weit auf.
In dem Container waren Kartons mit Kirschkonserven aufgestapelt. Tadeusz verzog bei diesem Anblick die Lippen. Wer, der bei rechtem Verstand war, würde auf die Idee kommen, rumänische Kirschen aus der Dose zu essen oder gar komplette Lkw-Ladungen davon zu importieren? Er sah zu, wie der Zollbeamte und der Fahrer anfingen, die Kartons auszuladen. Inzwischen glitt hinter ihm das Schiff längsseits an den Kai heran, wo die beiden Männer fachmännisch beim Vertäuen halfen.
Bald bildete sich ein schmaler Gang zwischen den Kartons. Nach kurzer Pause drängten Menschen durch die Lücke und sprangen auf den Boden hinunter. Verwirrte chinesische Gesichter glänzten schweißüberströmt im matten Licht, das von den Fahrzeugen und dem Schiff auf sie fiel. Der Strom menschlicher Körper wurde langsamer und verebbte. Etwa vierzig chinesische Männer kauerten eng zusammengedrängt, Bündel und Rucksäcke an die Brust gedrückt. Ihre verängstigten Blicke zuckten hier- und dorthin über das fremde Werftgelände, wie von Pferden, die Blutgeruch in der Luft wittern. Sie zitterten in der plötzlichen Kälte, ihre dünne Kleidung bot keinen Schutz vor dem kalten Nebel, der über dem Fluss lag. Ihr unbehagliches Schweigen war beunruhigender, als es jedes noch so laute Geplapper hätte sein können.
Eine leise Brise trug einen Schwall abgestandener Luft vom Lkw zu Tadeusz herüber. Voller Ekel rümpfte er die Nase bei dem Gestank von Schweiß, Urin und Kot, der von einem leicht stechenden chemischen Geruch überlagert war. Da muss man ganz schön verzweifelt sein, um eine solche Reise machen zu wollen. Es war eine Verzweiflung, die nicht unwesentlich zu seinem Wohlstand beigetragen hatte, und er hegte einen gewissen widerwilligen Respekt für alle diejenigen, die den Mut hatten, diesen Weg in die Freiheit, den er ihnen anbot, einzuschlagen.
Flugs organisierten der Lkw-Fahrer, die beiden Männer vom Transporter und die Schiffsmannschaft ihre Ladung. Zwei der Chinesen sprachen genug Deutsch, dass sie dolmetschen konnten, und die illegalen Einwanderer wurden gleich in Dienst genommen. Zuerst luden sie die Kirschkonserven und die Chemie-Toiletten ab, dann spritzten sie die Ladefläche mit Schläuchen ab. Als alles sauber war, bildeten sie eine Menschenkette und luden Kartons mit Obstkonserven vom Schiff auf den Lastwagen. Schließlich kletterten die Chinesen an Bord des Schiffes und begaben sich anscheinend ohne Zögern in den jetzt leeren Container. Tadeusz’ Mannschaft errichtete zwischen den Flüchtlingen und den Containertüren eine Wand aus Kartons, dann brachte der Zollbeamte Siegel an, die genau denen glichen, die er vorher abgenommen hatte.
Es lief wie geschmiert, bemerkte Tadeusz nicht ohne Stolz. Die Chinesen waren mit einem Touristenvisum nach Budapest gekommen. Einer von Krasics Leuten hatte sie abgeholt und in ein Lagerhaus gebracht, wo sie in den Container auf dem Lkw geladen wurden. Zwei Tage zuvor war das Schiff vor den Augen der Zollbeamten in der Nähe von Budapest mit ganz legaler Ware beladen worden. Hier, wo Fuchs und Has sich Gute Nacht sagten, trafen sie aufeinander, und die Ladungen wurden ausgetauscht. Das Schiff würde viel länger brauchen, um Rotterdam zu erreichen, aber es war weniger wahrscheinlich, dass es durchsucht wurde, da es gültige Dokumente und Siegel hatte. Wenn neugierige Beamte tatsächlich Zweifel hegten, konnte man auf die zuständigen Behörden verweisen, die das Beladen überwacht hatten. Und der Lkw, der viel eher angehalten und durchsucht wurde, konnte mit seiner harmlosen Fracht die Fahrt an den Zielort fortsetzen. Wenn irgendjemand am Flughafen oder im Lagerhaus etwas gesehen hatte, das er verdächtig genug fand, um die Behörden zu unterrichten, würden sie nur eine Wagenladung Dosen mit Kirschen finden. Sollten die Beamten bemerken, dass die ungarischen Zollsiegel beschädigt worden waren, konnte der Fahrer dies leicht als Beschädigung durch Dritte oder einen versuchten Diebstahl abtun.
Auf dem Weg des Zollbeamten zurück zum Lkw trat Tadeusz ihm entgegen. »Einen Augenblick, bitte. Wo ist das Päckchen für Berlin?«
Krasic runzelte die Stirn. Er hatte schon gedacht, dass sein Boss es sich noch einmal überlegt hätte und in Bezug auf das chinesische Heroin, mit dem die illegalen Einwanderer einen Teil ihrer Reise bezahlten, eine vernünftigere Entscheidung getroffen hätte. Es gab keinen Grund für Tadzio, den Ablauf zu ändern, den Krasic mit so großer Sorgfalt ausgearbeitet hatte. Keinen anderen Grund außer den albernen, abergläubischen Vorstellungen, denen er seit Katerinas Tod anhing.
Der Zollbeamte zuckte mit den Schultern. »Der Fahrer wird’s wohl wissen«, sagte er und grinste nervös. Er hatte den großen Boss noch nie gesehen und legte auch jetzt auf dieses Privileg keinen gesteigerten Wert. Krasic war im Bestechungsnetz von ganz Mitteleuropa für seine Brutalität im Dienst von Tadeusz berüchtigt.
Tadeusz blickte den Fahrer an und zog eine Augenbraue hoch.
»Ich hebe es in meinem Funkgerät auf«, sagte der Fahrer. Er führte Tadeusz um das Führerhaus herum und nahm das Gerät aus seinem Gehäuse. Darin war genug Platz für vier versiegelte Riegel des gepressten braunen Pulvers.
»Danke«, sagte Tadeusz. »Sie brauchen sich auf der Fahrt nicht darum zu kümmern.« Er fasste hinein und zog die Päckchen heraus. »Das Geld kriegen Sie natürlich trotzdem.«
Krasic sah zu, und ihm sträubten sich die Nackenhaare. Er konnte sich an keine Gelegenheit erinnern, bei der er die Grenze auch nur mit einem Joint passiert hatte. Mit vier Kilo Heroin quer durch Europa zu fahren erschien ihm verrückt. Vielleicht fühlte sein Chef eine Todessehnsucht, aber Krasic hatte keine Lust, sich ihm anzuschließen. Er murmelte ein Gebet zur Jungfrau Maria und folgte Tadeusz zurück zu seinem Wagen.
Kapitel 2
Carol Jordan sah lächelnd in den Spiegel der Damentoilette und boxte vor heimlicher Freude wild in die Luft. Ihr Vorstellungsgespräch hätte nicht besser laufen können, wenn sie selbst den Text dazu geschrieben hätte. Sie hatte alles gewusst, und man hatte ihr die Art von Fragen gestellt, bei denen sie ihr Wissen zeigen konnte. Das Team, das sie befragt hatte, zwei Männer und eine Frau, hatte öfter, als sie in ihren wildesten Träumen hätte hoffen können, genickt und zustimmend gelächelt.
Zwei Jahre hatte sie für diesen Nachmittag gearbeitet. Sie war von ihrer Stelle, der Kripo-Leitung in Seaford, Yorkshire, wieder zur Met in London zurückgekehrt, damit sie die beste Gelegenheit haben würde, als Quereinsteigerin bei der Elitegruppe, dem National Criminal Intelligence Service – dem Kriminalnachrichtendienst NCIS –, mitzuarbeiten. Jeden Kurs in Kriminalistik und Fallanalyse, den es gab, hatte sie belegt und fast ihre ganze Freizeit geopfert, um Fachbücher und Forschungsergebnisse zu studieren. Sogar eine Woche ihres Jahresurlaubs hatte sie für ein Praktikum bei einer privaten Softwarefirma in Kanada hergegeben, die sich auf Programme zur Verbrechensverknüpfung spezialisiert hatte. Carol störte es nicht, dass ihre sozialen Kontakte sehr eingeschränkt waren; sie mochte ihre Arbeit und hatte sich angewöhnt, sich nicht mehr zu wünschen. Sie schätzte, dass es wahrscheinlich keinen Detective Chief Inspector im ganzen Land gab, der die Thematik besser kannte als sie. Und jetzt war sie bereit für den nächsten Schritt.
Sie wusste, dass ihre Referenzen untadelig waren. Ihr früherer Vorgesetzter, Chief Constable John Brandon, hatte sie schon lange angehalten, von der vorderen Front der Polizeiarbeit in den strategischen Bereich von Nachrichtendienst und Fallanalyse überzuwechseln. Anfangs hatte sie sich dagegen gewehrt, weil ihre frühe Bekanntschaft mit dem Bereich ihr zwar einen deutlich besseren Ruf verschafft, sie aber zugleich in emotionale Verwirrung gestürzt hatte, bei der ihre Selbstachtung einen einmaligen Tiefpunkt erreichte. Schon der flüchtige Gedanke daran ließ das Lächeln von ihrem Gesicht verschwinden. Sie blickte in ihre ernsten grauen Augen und fragte sich, wie lange es dauern würde, bis sie an Tony Hill denken konnte, ohne dass ihr im Magen flau wurde.
Carol hatte wesentlich dazu beigetragen, dass zwei Serienmörder zur Strecke gebracht wurden. Sie hatte ein außergewöhnliches Bündnis geschlossen mit Tony, einem Psychologen und Fallanalytiker, der selbst mehr als genug psychische Schäden hatte, um die klügsten Köpfe zu verwirren. Diese Allianz hatte all ihre Abwehrmechanismen überbrückt, die sie in den zwölf Jahren bei der Polizei errichtet hatte, und ihr war der Grundfehler unterlaufen, dass sie sich jemanden zu lieben erlaubte, der es nicht zuließ, dass er ihre Liebe erwiderte.
Seine Entscheidung, sich von der Front zurückzuziehen und nur noch im akademischen Bereich zu arbeiten, war für Carol wie eine Erlösung gewesen. Endlich fühlte sie sich frei, ihrem Talent und ihren Wünschen zu leben und sich auf die Art Arbeit zu konzentrieren, für die sie am besten geeignet war, ohne durch Tonys Anwesenheit abgelenkt zu werden.
Nur war er trotzdem immer präsent; sie hörte seine Stimme in ihrem Kopf, und sein Blick auf die Welt beeinflusste ihre Gedanken.
Carol fuhr sich frustriert durch die struppigen blonden Haare. »Scheiß drauf«, sagte sie laut vor sich hin. »Das ist jetzt meine Welt, Tony.«
Sie wühlte in ihrer Tasche und fand ihren Lippenstift, besserte schnell ihr Make-up aus und lächelte ihrem Spiegelbild wieder zu, diesmal entschieden trotziger. Das Team hatte sie gebeten, in einer Stunde wiederzukommen, um die Entscheidung zu hören. Sie beschloss, in die Kantine hinunterzugehen und zu Mittag zu essen, denn vorher war sie zu nervös zum Essen gewesen.
Mit federndem Schritt kam sie aus der Toilette. Vor ihr bimmelte weiter vorn im Korridor der Aufzug. Die Türen gingen auf, und ein hochgewachsener Mann in Paradeuniform trat heraus und bog nach rechts ab, ohne in ihre Richtung zu blicken. Carol verlangsamte den Schritt; sie hatte Commander Paul Bishop erkannt und fragte sich, was er bei NCIS zu tun hatte. Das letzte Mal, als sie etwas über ihn gehört hatte, war er einer Abteilung im Innenministerium zugeteilt worden. Nach dem dramatischen, chaotischen und peinlichen Debüt der Nationalen Einsatzgruppe zur Erstellung von Täterprofilen, der er vorstand, wollte niemand in prominenter Stellung, dass Bishop in einer irgendwie öffentlich exponierten Position arbeitete. Zu ihrem Erstaunen ging Bishop direkt auf den Raum zu, aus dem sie zehn Minuten zuvor herausgekommen war.
Was war hier bloß los? Warum redeten sie mit Bishop über sie? Er war nie ihr Vorgesetzter gewesen. Sie hatte sich einer Versetzung zu der neu entstehenden Task Force für Täterprofile hauptsächlich widersetzt, weil es Tonys persönlicher Wirkungsbereich war und sie vermeiden wollte, dass sie ein zweites Mal eng mit ihm zusammenarbeiten musste. Aber trotz ihrer guten Absichten war sie in den Sog einer Ermittlung geraten, die sich nie so hätte abspielen sollen, wie sie lief, und hatte dabei gegen Regeln verstoßen und Grenzen überschritten, an die sie lieber gar nicht denken wollte. Jedenfalls wollte sie nicht, dass Paul Bishop ihre Vergangenheit ausgerechnet vor den Befragenden zerpflückte, die entschieden, ob sie die Stelle einer hochgestellten Fallanalytikerin bekam. Er hatte sie nie gemocht, und da Carol die leitende Beamtin bei der Überführung des bekanntesten Serienkillers Englands gewesen war, hatte er den größten Teil seines Ärgers über die eigenwillige Ermittlung auf sie persönlich gerichtet. Sie nahm an, es wäre ihr in seiner Situation genauso gegangen. Aber das machte ihr den Gedanken auch nicht angenehmer, dass Paul Bishop gerade den Raum betreten hatte, wo über ihre Zukunft entschieden wurde. Plötzlich hatte Carol keinen Appetit mehr.
»Wir haben Recht gehabt. Sie ist perfekt«, sagte Morgan und tippte mit dem Bleistift auf den Rand seines Notizblocks, eine wohlüberlegte Geste, die die Geltung betonte, die er unter seinen Kollegen zu haben glaubte.
Thorson runzelte die Stirn. Es war ihr nur allzu klar, was alles schief gehen konnte, wenn unergründliche Emotionen bei einem Einsatz ins Spiel gebracht wurden. »Wieso glauben Sie, dass sie fähig genug ist?«
Morgan zuckte mit der Schulter. »Wir werden es nicht mit Sicherheit wissen, bis wir sie in Aktion sehen. Aber ich sage Ihnen, wir hätten keine Frau finden können, die besser passt, selbst wenn wir überall nach ihr gesucht hätten.« Er schob unternehmungslustig sein Hemd über die muskulösen Unterarme hinauf.
Es klopfte an der Tür. Surtees erhob sich und öffnete, um Commander Paul Bishop hereinzulassen. Seine Kollegen blickten nicht einmal von ihrer angeregten Diskussion auf.
»Das ist auch gut so. Wir würden schön blöd dastehen, wenn wir alles so weit geplant hätten und dann zugeben müssten, keine glaubhafte Person für den Einsatz zu haben. Aber trotzdem ist es sehr gefährlich«, sagte Thorson.
Surtees machte Bishop ein Zeichen, er solle den Stuhl nehmen, den Carol vor kurzer Zeit frei gemacht hatte. Er nahm Platz und zog dabei mit Daumen und Zeigefinger seine Bügelfalten etwas hoch.
»Sie hatte ja vorher auch schon Einsätze in gefährlichen Situationen. Vergessen wir die Sache mit Jacko Vance nicht«, erinnerte Morgan Thorson und schob eigensinnig das Kinn vor.
»Also, Kollegen, Commander Bishop ist hier«, sagte Surtees energisch.
Paul Bishop räusperte sich. »Da Sie es schon erwähnten … Wenn ich nur kurz etwas über die Vance-Ermittlung sagen dürfte?«
Morgan nickte. »Tut mir Leid, Commander, ich wollte nicht unhöflich sein. Sagen Sie uns, woran Sie sich erinnern. Deshalb haben wir Sie ja gebeten, dazuzukommen.«
Bishop neigte würdevoll seinen schönen Kopf. »Wenn eine Ermittlung als erfolgreich abgeschlossen gilt, ist es leicht, alles, was nicht geklappt hat, unter den Teppich zu kehren. Aber wenn man die Dinge objektiv betrachtet, war die Verfolgung und schließliche Gefangennahme von Jacko Vance der Albtraum eines jeden Polizisten. Ich muss es als die Aktion einer Person bezeichnen, die sich nicht an die Regeln hielt. Ehrlich gesagt, das Dreckige Dutzend nahm sich dagegen wie eine gut disziplinierte Kampftruppe aus. Alles lief ohne entsprechende Befugnis, man übersprang rücksichtslos die Rangordnung der Polizei, setzte sich mit einem unbekümmerten Mangel an Respekt über die Grenzen zwischen den Zuständigkeitsbereichen hinweg, und es ist ein Wunder, dass es uns überhaupt gelang, einen positiven Ausgang zu erreichen. Wäre Carol Jordan eine meiner Beamtinnen gewesen, dann hätte sie sich einer internen Untersuchung stellen müssen und wäre zweifellos degradiert worden. Ich habe nie verstanden, warum John Brandon sie nicht bestraft hat.« Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, und die sanfte Glut seiner rechtschaffenen Rache wärmte ihm sichtlich das Herz. Jordan und ihr Haufen selbst ernannter Rächer waren ihn teuer zu stehen gekommen, und dies war die erste richtige Chance, die er bekam, um es ihnen heimzuzahlen. Es war ihm ein Vergnügen.
Aber zu seiner Überraschung schienen alle kaum beeindruckt. Morgan lächelte tatsächlich. »Sie meinen, wenn sie richtig in der Klemme sitzt, dann befreit sich Jordan einfach aus dem ganzen Mist und handelt? Und dass sie kein Problem damit hat, Initiative zu zeigen und mit dem Unerwarteten fertig zu werden?«
Bishop runzelte leicht die Stirn. »Ganz so hätte ich es nicht ausgedrückt. Eher so, dass sie offenbar denkt, die Regeln gelten für sie nicht.«
»Hat sie mit ihrem Handeln sich selbst oder ihre Kollegen gefährdet?«, fragte Thorson.
Bishop zuckte leichthin mit den Schultern. »Schwer zu sagen. Um ehrlich zu sein, die Beteiligten waren nicht gerade gesprächig in Bezug auf manche Aspekte ihrer Ermittlung.«
Surtees, das dritte Mitglied der Runde, blickte auf. Sein Gesicht war so blass, dass es im schwächer werdenden Nachmittagslicht fast zu leuchten schien. »Darf ich zusammenfassen? Nur um sicherzugehen, dass wir uns verstehen. Vance versteckte sich hinter der Fassade der bekannten Fernsehpersönlichkeit und ermordete mindestens acht junge Mädchen. Er hatte bei den Behörden keinerlei Verdacht auf sich gezogen, bis eine theoretische Übung der Task Force zur Erstellung von Täterprofilen ein rätselhaftes Bündel von möglicherweise zusammenhängenden Fällen zutage brachte. Und weiterhin nahm niemand außerhalb der Gruppe den Fall ernst, nicht einmal, nachdem eines der Mitglieder auf brutale Weise umgebracht wurde. Stimmt es, dass DCI Jordan nichts mit dem Fall zu tun hatte, bis Vance anfing, außerhalb seiner Zielgruppe zu morden, und bis es klar war, dass er bestimmt wieder töten würde, wenn ihn nicht jemand aufhielte?«
Bishop schien leicht verlegen. »Diese Betrachtungsweise ist möglich. Aber als sie dazukam, war die Polizei in West Yorkshire schon dabei, den Fall zu untersuchen. Man unternahm dort die richtigen Schritte und führte eine ordentliche Ermittlung durch. Wenn Jordan dazu hätte beitragen wollen, wäre der korrekte Weg der Kontakt zu mir gewesen.«
Morgan lächelte wieder. »Aber Jordan und ihre bunt zusammengewürfelte Truppe lösten den Fall«, sagte er schonungsvoll. »Finden Sie, dass Jordan während der Jacko-Vance-Ermittlung Charakterstärke bewies?«
Bishop hob die Augenbrauen. »Sie war zweifelsohne eigensinnig.«
»Hartnäckig«, sagte Morgan.
»Ich nehme an.«
»Und mutig?«, warf Thorson ein.
»Ich weiß nicht, ob ich es als Mut oder Sturheit bezeichnen würde«, sagte Bishop. »Hören Sie, warum hat man mich eigentlich hierher kommen lassen? Das ist nicht der normale Verlauf bei der Bestellung eines NCIS-Mitarbeiters, selbst in übergeordneter Position.«
Morgan schwieg. Er verfolgte seinen Bleistift bei seiner kreiselnden Bewegung. Bishop hatte nicht wissen wollen, warum er hier war, als er glaubte, es sei eine Gelegenheit, über Jordan herzufallen. Erst als ihm klar wurde, dass er es mit Leuten zu tun hatte, die seine Sicht nicht teilten, hatte er eine Erklärung haben wollen. Nach Morgans Erachten hieß das, er hatte keine verdient.
Surtees überbrückte die Schwierigkeit. »Wir ziehen DCI Jordan für eine sehr anspruchsvolle Rolle in einer Operation von grundlegender Wichtigkeit in Betracht. Es ist eine hochgradig vertrauliche Angelegenheit, Sie werden also sicher verstehen, dass wir Ihnen keine Einzelheiten mitteilen können. Aber was Sie uns gesagt haben, hat uns sehr geholfen.«
Das hieß wohl, dass man ihn entließ. Er konnte kaum glauben, dass man ihn dafür vom anderen Ende Londons herzitiert hatte. Bishop stand auf. »Wenn das alles ist …?«
»Ist sie beliebt bei ihren Mitarbeitern?« Damit brachte ihn Thorson leicht aus der Fassung.
»Beliebt?« Bishop schien wirklich verwirrt.
»Würden Sie sagen, sie hat Charme? Ausstrahlung?«, beharrte sie.
»Aus persönlicher Erfahrung kann ich dazu nichts sagen. Aber meine Leute in der Einsatzgruppe haben ihr jedenfalls aus der Hand gefressen. Sie folgten ihr, wohin sie sie führte.« Jetzt konnte er den bitteren Unterton nicht mehr verbergen. »Was immer sie an weiblicher List eingesetzt hat, es reichte jedenfalls aus, dass die Leute ihre Ausbildung und Loyalität vergaßen und auf ihr Geheiß überall im Land auf die Jagd gingen.«
»Danke, Commander. Sie haben uns sehr geholfen«, sagte Surtees. Die Runde saß schweigend da, während Bishop den Raum verließ.
Morgan schüttelte den Kopf und grinste. »Sie hat ihn wirklich gegen sich aufgebracht, was?«
»Aber wir haben herausgefunden, was wir wissen müssen. Sie hat Mumm, sie zeigt Initiative, und sie kann mit ihrem Charme alles erreichen.« Surtees kritzelte auf seinen Notizblock. »Und sie hat keine Angst davor, die Gefahr direkt anzugehen.«
»Aber so etwas wie unsere Sache hier nicht. Wir müssten sie auf eine Art und Weise absichern, wie wir das noch nie zuvor überlegt haben. Zum Beispiel könnte sie nicht mit einem Funkgerät ausgestattet werden. Das könnten wir nicht riskieren. Alle Ergebnisse werden also wegen Mangel an Erhärtung beeinträchtigt sein«, warf Thorson ein.
Surtees zuckte mit den Achseln. »Sie hat ein eidetisches Gedächtnis für akustische Stimuli. Es steht in den Unterlagen. Sie ist von unabhängigen Experten getestet worden. An alles, was sie hört, kann sie sich wortgetreu erinnern. Ihre Berichte werden wahrscheinlich genauer sein als die verrauschten miesen Aufnahmen, die uns die Überwachungen oft liefern.«
Morgan lächelte triumphierend. »Ich hab’s ja gesagt, sie ist perfekt. Das Zielobjekt wird ihr nicht widerstehen können.«
Thorson schürzte die Lippen. »Uns allen zuliebe hoffe ich das. Aber bevor wir endgültig entscheiden, möchte ich sie in Aktion sehen. Einverstanden?«
Die beiden Männer blickten sich an. Morgan nickte. »Einverstanden. Sehen wir, was sie unter Druck leistet.«
Kapitel 3
Als Tony Hill den langen Hügel nach St. Andrews hinauffuhr, schienen ihm die Sonnenstrahlen in einem ungünstigen Winkel schräg entgegen. Er klappte die Sonnenblende herunter und sah in den Rückspiegel. Hinter ihm hob sich das Grün des Tentsmuir Forest von dem blauen Glanz des Firth of Tay und weiter hinten der Nordsee ab. Er warf einen Blick auf die zerrissene graue Silhouette der Stadt, Ruinen gleich neben imposanten Gebäuden aus dem neunzehnten Jahrhundert, die aus der Ferne nicht auseinander zu halten waren. In den letzten achtzehn Monaten, seit er die Stelle als Dozent für Verhaltenspsychologie an der Universität angetreten hatte, war ihm der Anblick vertraut geworden, aber er genoss diese friedliche Aussicht immer noch. Die Entfernung gab ihr etwas Zauberisches und verwandelte die Überreste des St.-Regulus-Turms und die Kathedrale in bizarre Disney-Phantasiegebäude. Und das Beste war, dass er hier so weit entfernt war, dass er sich nicht mit seinen Kollegen und Studenten abgeben musste.
Obwohl sein Professor hatte durchblicken lassen, dass er jemanden mit Tonys Ruf als eine wesentliche Bereicherung für ihre Abteilung sehe, war Tony nicht sicher, ob er die hochgesteckten Erwartungen erfüllte. Er hatte immer schon gewusst, dass das Leben als Akademiker eigentlich nicht das Richtige für ihn war. Für die politischen Interessen und Schachzüge an der Universität hatte er kein Geschick, und bei den Vorlesungen hatte er immer noch schweißnasse Hände und zitterte vor Nervosität. Aber als ihm die Stelle angeboten wurde, schien sie eine bessere Wahl als die Arbeit, für die er sich nicht mehr geeignet glaubte. Er hatte als klinischer Psychologe angefangen und in der vordersten Linie einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt mit Serientätern gearbeitet. Als das Innenministerium anfing, sich für die Entwicklung von Täterprofilen im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zu interessieren, war er einer der nächstliegenden Kandidaten gewesen, um die Machbarkeitsstudie durchzuführen.
Es hatte seinem Ruf fast so viel gebracht, wie es seiner Psyche geschadet hatte, dass er im Lauf der Studie unmittelbar in die Überführung eines psychopathischen Killers hineingezogen wurde, der es auf junge Männer abgesehen hatte. Dabei war er wegen seiner Feinfühligkeit fast selbst vernichtet worden. Die Intensität, mit der er persönlich in diese Sache verwickelt wurde, ließ ihn jetzt noch schreiend und schweißgebadet aus seinen Albträumen erwachen, und er spürte dann tatsächlich noch den Schmerz von damals.
Als aufgrund seiner Empfehlung beschlossen wurde, eine Task Force zur Erstellung von Täterprofilen zu gründen, musste die Wahl unweigerlich auf ihn fallen, an der Spitze einer sorgsam ausgewählten Gruppe junger Polizeibeamter zu stehen, die er in die Erstellung psychologisch fundierter Fallanalysen einzuweihen hatte. Eigentlich hätte es eine einfache Aufgabe sein können, aber für Tony und seine Mitarbeiter wurde es zu einem Ausflug in die Hölle. Zum zweiten Mal war er gezwungen worden, die Regel zu durchbrechen, die besagte, er solle nicht in unmittelbarer Nähe des Geschehens arbeiten. Zum zweiten Mal war er schließlich in blutiges, schuldhaftes Geschehen verstrickt worden und war sich absolut sicher, dass er nie wieder in diese Lage geraten wollte.
Seine Mitarbeit in der schattenhaften Welt der Täterprofile hatte ihn so viel gekostet, dass er es gar nicht genau zusammenrechnen wollte. Es war jetzt zwei Jahre her, und immer noch war er ständig mit der Vergangenheit beschäftigt. Jeden Tag, wenn er mechanisch die Abläufe eines beruflichen Lebens hinter sich brachte, an das er nicht wirklich glaubte, dachte er unwillkürlich wieder an das, was er aufgegeben hatte. Er hatte gute Arbeit geleistet, das wusste er. Aber letzten Endes war das nicht genug gewesen.
Er wurde ungeduldig und stellte die Philip-Glass-Kassette ab. Musik gab ihm zu viel Raum für sinnloses Grübeln. Worte brauchte er, die ihn von seiner fruchtlosen Introspektion abhielten. Er hörte das Ende einer Diskussion über das Auftauchen neuer Viren südlich der Sahara und hielt den Blick bei der Fahrt durch die malerische Landschaft des East Neuk auf die Straße gerichtet. Als er zum Fischerdorf Cellardyke abbog, kündigten die vertrauten Piepstöne die Vier-Uhr-Nachrichten an.
Die ruhige Stimme des Sprechers begann mit den Meldungen. »Die Berufungsverhandlung des verurteilten Serienmörders und früheren Fernsehmoderators Jacko Vance hat heute begonnen. Vance, der früher britischer Meister im Speerwerfen war, wurde wegen der Ermordung eines Polizisten vor achtzehn Monaten zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Es wird erwartet, dass die Berufungsverhandlung zwei Tage dauern wird.
Die Polizei hat in Nordirland dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren …« Er sprach weiter, aber Tony hörte nicht mehr zu. Eine letzte Hürde, dann würde es endlich vorbei sein. Die Angst, so hoffte er inbrünstig, würde sich endgültig legen. Verstandesmäßig wusste er, dass es keine Chance für die Berufung von Vance gab. Aber solange die Entscheidung nicht gefallen war, würde ihm die Unsicherheit keine Ruhe lassen. Er hatte dazu beigetragen, dass Vance hinter Schloss und Riegel kam, aber der arrogante Killer hatte immer weiter behauptet, er würde ein Schlupfloch finden und freikommen. Tony hoffte, dass der Weg in die Freiheit nur ein Hirngespinst im Kopf von Vance war.
Als der Wagen den Hügel hinunter auf das kleine Haus am Meer zufuhr, das Tony vor einem Jahr gekauft hatte, fragte er sich, ob Carol von der Berufungsverhandlung gehört hatte. Er würde ihr heute Abend eine E-Mail schicken, um sicherzugehen. Gott sei gedankt für die elektronische Kommunikation. Dadurch ließen sich so viele peinliche Gelegenheiten vermeiden, die es beim Zusammentreffen oder sogar am Telefon immer wieder gegeben hätte. Es war ihm klar, dass er Carol gegenüber und zugleich auch gegenüber sich selbst versagt hatte. Er dachte fast immer an sie, aber ihr das zu sagen wäre ein Betrug gewesen, den zu begehen er nicht über sich brachte.
Tony hielt auf der schmalen Straße vor dem Häuschen an und parkte das Auto am Gehweg. Im Wohnzimmer brannte Licht. Früher hätte bei diesem Anblick die Angst wie eine kalte Hand sein Herz umklammert. Aber seine Welt hatte sich auf so vielfältige Weise verändert, wie er es sich nie hätte träumen lassen. Jetzt wollte er nur, dass alles so blieb, wie es war: klar, beherrschbar, eingeteilt.
Es war nicht vollkommen, keineswegs. Aber es war besser als nur erträglich. Und für Tony war besser als erträglich so gut, wie es je gewesen war.
Das Klopfen der Motoren beruhigte ihn, so wie es immer gewesen war. Schlimme Dinge ereilten ihn nie auf dem Wasser. Solange er denken konnte, hatten Schiffe ihn geschützt. Es gab Regeln für das Leben an Bord, Regeln, die immer klar und einfach waren und die es aus guten, logischen Gründen gab. Aber selbst als er noch zu jung gewesen war, um das zu verstehen, und unabsichtlich Dinge getan hatte, die er nicht hätte tun sollen, war die Strafe nie erfolgt, bevor sie an Land gingen. Er hatte gewusst, sie würde kommen, aber solange die Motoren dröhnten und ihm der Geruch von ungewaschenen Männerkörpern, altem Fett aus der Küche und dem Dieseltreibstoff in die Nase stieg, hatte er es immer geschafft, die Angst in Schach zu halten.
Die Schmerzen hatten ihn immer erst heimgesucht, wenn sie das Leben auf dem Wasser hinter sich ließen und in die stinkende Wohnung am Fischereihafen in Hamburg zurückkehrten, wo sein Großvater ihm die Macht demonstrierte, die er über den kleinen Jungen in seiner Obhut hatte. Während er noch schwankte, um an Land das Gleichgewicht zu halten, fing die Strafe schon an.
Wenn er daran dachte, schien sich jetzt noch die Luft in seiner Lunge zusammenzupressen, und seine Haut fühlte sich an, als kräusle sie sich auf dem Körper. Jahrelang hatte er versucht, nicht daran zu denken, weil er sich dann so schwach fühlte, wie zerbrochen. Aber nach und nach hatte er begriffen, dass er so nicht entkommen würde. Es war nur ein Aufschieben. Deshalb erinnerte er sich jetzt absichtlich und schätzte die schrecklichen Empfindungen fast, denn sie waren ein Beweis, dass er stark genug war, um seine Vergangenheit zu besiegen.
Kleine Verstöße hatten damals bedeutet, dass er gezwungen wurde, in der Küche in der Ecke zu stehen, während sein Großvater auf dem Herd Wurst mit Zwiebeln und Kartoffeln anbriet. Es roch besser als alles, was der Schiffskoch jemals auf den Tisch brachte. Ob es auch besser schmeckte, erfuhr er nie, denn wenn die Zeit zum Essen kam, musste er in der Ecke warten und zusehen, wie sein Großvater den dampfenden Teller Gebratenes verdrückte. In den köstlichen Duft eingehüllt, stand er da, sein Magen verkrampfte sich vor Heißhunger, und sein Mund war voller Speichel.
Der alte Mann schlang das Essen in sich hinein wie ein Jagdhund, der in seinen Zwinger zurückgekehrt ist, während sein verächtlicher Blick zu dem Jungen in der Ecke hinüberschweifte. Wenn er fertig war, strich er den Teller mit einem Brocken Roggenbrot aus. Dann nahm er sein Schiffer-Klappmesser heraus und schnitt zusätzliches Brot in Stücke, holte eine Dose Hundefutter vom Schrank, kippte den Inhalt in eine Schüssel und vermischte das Fleisch mit dem Brot. Dann stellte er die Schüssel vor den Jungen hin mit den Worten: »Du bist ein Hundesohn. Deshalb verdienst du das hier, bis du endlich lernst, dich wie ein Mann zu betragen. Ich habe Hunde gehabt, die schneller gelernt haben als du. Ich bin dein Herr, und du hast dein Leben so zu führen, wie ich es dir sage.«
Zitternd vor Angst, musste sich der Junge hinknien und auf allen vieren essen, ohne das Futter mit den Händen zu berühren. Auch das hatte er durch bittere Erfahrung gelernt. Jedes Mal, wenn er die Hände vom Fußboden hob und zur Schüssel führte, trat ihm sein Großvater mit der Stahlkappe seines Stiefels in die Rippen. Das war eine Lektion, die er sich schnell zu Herzen nahm.
Wenn seine Vergehen geringfügig waren, durfte er vielleicht auf dem Feldbett im Flur zwischen dem Schlafzimmer seines Großvaters und dem verwahrlosten Bad mit kaltem Wasser schlafen. Aber wenn er dieses Luxus nicht für würdig erachtet wurde, musste er auf dem Küchenboden auf einer schmutzigen Decke liegen, die noch nach dem letzten Hund stank, den sein Großvater besessen hatte, einem Bullterrier, der die letzten paar Tage seines Lebens nichts mehr halten konnte. Oft lag er zusammengerollt da, die Angst ließ ihn nicht schlafen, und die Verwirrung machte ihn gereizt und fahrig.
Wenn die Sünden, die er unabsichtlich beging, schwerer waren, zwang ihn sein Großvater, die Nacht in der Ecke seines Schlafzimmers stehend zu verbringen, den grellen Lichtstrahl einer 150-Watt-Birne auf sein Gesicht gerichtet. Der Teil des Lichts, der zu seinem Großvater schien, störte diesen wohl nicht, denn er schnarchte und grunzte die ganze Nacht wie ein Schwein. Aber wenn der Junge erschöpft in die Knie ging oder stehend eindöste und gegen die Wand sank, ließ ein sechster Sinn den alten Mann immer sofort aufwachen. Nachdem dies ein paarmal geschehen war, lernte der Junge, sich zum Wachbleiben zu zwingen. Alles würde er tun, um nicht wieder den brennenden Schmerz an den Hoden spüren zu müssen.
Wenn befunden wurde, dass er mutwillig ungezogen gewesen sei, wenn er im kindlichen Spiel gegen die Vorschriften verstoßen hatte, die er instinktiv hätte begreifen sollen, dann stand ihm eine noch schlimmere Strafe bevor. Er musste in der Kloschüssel stehen. Nackt und zitternd versuchte er krampfhaft eine Position zu finden, bei der keine Krämpfe seine Beine durchzuckten. Sein Großvater kam ins Bad, als sei der Junge unsichtbar, knöpfte seine Hose auf und entleerte seine Blase, wobei der stinkende, heiße Strahl über die Beine des Jungen floss. Der Großvater schüttelte ab, wandte sich um und ging ohne zu spülen hinaus. Der Junge musste balancierend mit einem Fuß in dem Gemisch aus Wasser und Urin in der Schüssel stehen und sich mit dem anderen Fuß am schrägen Porzellanrand abstützen.
Als dies zum ersten Mal geschah, glaubte er, sich übergeben zu müssen. Er meinte, schlimmer könne es nicht kommen. Aber natürlich stimmte das nicht. Als sein Großvater das nächste Mal kam und die Hose herunterließ, setzte er sich, um seinen Darm zu entleeren. Der Junge war eingezwängt, der Klositz schnitt in seine weichen Waden, mit dem Rücken stand er gegen die kalte Wand, und das warme Gesäß seines Großvaters legte sich wie ein Fremdkörper an seine Schienbeine. Der scharfe Geruch stieg zwischen ihnen auf und ließ den Jungen würgen. Aber sein Großvater tat immer noch so, als sei er nur ein unsichtbarer Geist. Er kam zum Ende, wischte sich ab und ging hinaus, den Jungen in seinem Unrat zurücklassend. Die Botschaft war laut und deutlich: Er war nichts wert.
Morgens kam sein Großvater ins Bad, füllte, immer noch ohne dem Jungen die geringste Beachtung zu schenken, die Wanne mit kaltem Wasser und spülte endlich die Toilette. Dann – als sehe er seinen Enkel jetzt erst – befahl er ihm, den Schmutz abzuwaschen, hob ihn hoch und warf ihn in die Wanne.
Es war kein Wunder, dass er, sobald er zählen gelernt hatte, die Stunden zählte, bevor sie wieder aufs Schiff kamen. Sie waren nie länger als drei Tage an Land, aber wenn sein Großvater nicht mit ihm zufrieden war, konnten sie ihm wie drei verschiedene Leben voller Demütigungen, Leiden und Elend vorkommen. Trotzdem beschwerte er sich nie bei der Mannschaft. Ihm war gar nicht klar, dass es Grund gab, sich zu beschweren. Vom Leben anderer isoliert, hatte er keine Wahl, als zu glauben, dass alle so lebten.
Dass seine Sicht der Dinge nicht die einzige Wahrheit war, hatte er nur langsam begriffen. Aber als es so weit war, brach diese Einsicht wie eine mächtige Woge über ihn herein, und eine vage Gier nach Befriedigung erfüllte ihn.
Nur auf dem Wasser war er ruhig. Hier hatte er die Kontrolle über sich selbst und seine Umgebung. Aber das war nicht genug. Er wusste, es gab mehr, und er wollte mehr. Und er wusste, bevor er seinen Platz in der Welt finden konnte, musste er dem Bannkreis seiner Vergangenheit entkommen, der ihn jeden einzelnen Tag gefangen hielt. Andere Leute schienen es ohne Anstrengung zu schaffen, glücklich zu sein. Er hatte die meiste Zeit seines Lebens nur die eiserne Klammer der Angst gespürt, die jede andere Möglichkeit ausschloss. Selbst wenn es nichts Konkretes zu fürchten gab, erfüllte ihn immer schwache, zitternde Zaghaftigkeit.
Langsam lernte er, wie er das ändern konnte. Er hatte jetzt eine Mission. Wie lange es dauern würde, sie durchzuführen, wusste er nicht, war nicht einmal sicher, wie er merken würde, ob er am Ziel war, außer dass er dann wahrscheinlich beim Gedanken an seine Kindheit nicht mehr zittern müsste wie ein überstrapazierter Motorblock. Aber was er tat, war nötig, und es war möglich. Er hatte den ersten Schritt einer weiten Reise unternommen. Und schon fühlte er sich besser.
Jetzt, als das Schiff den Rhein durchfurchte und sich auf die holländische Grenze zubewegte, war es Zeit, die Pläne für die zweite Stufe zu konkretisieren. Allein im Cockpit, holte er sein Mobiltelefon heraus und wählte eine Nummer in Leiden.
Kapitel 4
Carol sah ihre drei Gesprächspartner verständnislos an. »Ich soll ein Rollenspiel für Sie machen?«, sagte sie und versuchte, etwas weniger skeptisch zu klingen, als ihr zumute war.
Morgan zog an seinem Ohrläppchen. »Ich weiß, es scheint etwas … ungewöhnlich.«
Carol konnte nicht umhin, die Augenbrauen zu heben. »Ich war des Glaubens, hier in einem Vorstellungsgespräch zu sein, bei dem es um die Stelle geht, für die ich mich beworben habe. Verbindungsperson zwischen Europol und der NCIS. Jetzt weiß ich nicht genau, was hier eigentlich läuft.«
Thorson nickte verständnisvoll. »Ich kann Ihre Verwirrung nachvollziehen, Carol. Aber wir müssen Ihre Fähigkeiten als Geheimagentin abschätzen können.«
Morgan unterbrach sie. »Wir führen eine grenzübergreifende europaweite Operation durch und sammeln zur Zeit nachrichtendienstliche Fakten. Wir glauben, dass Sie einen ganz eigenen Beitrag dazu leisten könnten. Aber wir müssen sicher sein, dass Sie die Fähigkeiten haben, dies durchzustehen. Und dass Sie sich in die Lage eines anderen Menschen versetzen können, ohne dabei ins Straucheln zu geraten.«
Carol runzelte die Stirn. »Es tut mir Leid, Sir, aber das hört sich nicht sehr nach der Stelle einer Verbindungsbeauftragten bei Europol an. Ich dachte, meine Rolle würde im Wesentlichen Fallanalysen betreffen, nicht den konkreten Einsatz.«
Morgan sah zu Surtees hin, der nickte und den Ball aufnahm. »Carol, es besteht unter uns kein Zweifel, dass Sie eine hervorragende Verbindungsbeauftragte für Europol wären. Aber bei der Betrachtung Ihrer Bewerbung ist uns klar geworden, dass es eine ganz bestimmte Funktion gibt, die nur Sie im Rahmen dieser einzigartigen, komplizierten Aktion erfüllen könnten. Aus diesem Grund hätten wir gern, dass Sie sich überlegen, ob Sie einen Tag lang an einem Rollenspiel als Agentin teilnehmen würden, damit wir beobachten können, wie Sie unter Druck reagieren. Ich kann Ihnen versprechen, dass diese Sache, wie immer sie auch ausgehen mag, unsere Entscheidung über Ihre Eignung als Verbindungsbeauftragte für Europol nicht nachteilig beeinflussen wird.«
Carol machte sich schnell klar, was Surtees da gesagt hatte. Es klang, als ob sie meinten, sie werde die Stelle auf jeden Fall bekommen. Man sagte ihr, sie hätte nichts zu verlieren, wenn sie dem exzentrischen Vorschlag zustimmte. »Was genau verlangen Sie von mir?«, fragte sie mit unverbindlicher Miene und in nüchternem Ton.
Thorson nahm jetzt die Sache in die Hand. »Morgen werden Sie komplette Anweisungen bekommen, in welche Rolle Sie schlüpfen sollen. An dem angegebenen Tag sollen Sie an einen bestimmten Ort gehen und Ihr Bestes tun, um die in Ihren Anweisungen gesetzten Ziele zu erreichen. Von dem Moment an, in dem Sie Ihre Wohnung verlassen, müssen Sie diese andere Person sein, bis einer von uns Ihnen sagt, dass das Rollenspiel zu Ende ist. Ist das klar?«
»Werde ich mit anderen Menschen zu tun haben oder nur mit Kollegen?«, fragte Carol.
Auf Morgans gerötetem Gesicht erschien ein Lächeln. »Tut mir Leid, mehr können wir Ihnen jetzt nicht sagen. Morgen früh bekommen Sie die Anweisung. Und ab sofort haben Sie frei. Wir haben das mit Ihren Vorgesetzten abgeklärt. Sie werden Zeit brauchen, um sich kundig zu machen und sich auf Ihre Rolle vorzubereiten. Noch Fragen?«
Carol sah ihn fest mit dem kühlen Blick ihrer grauen Augen an, der bei Vernehmungen oft so gut wirkte. »Bekomme ich den Job?«
Morgan lächelte. »Sie haben einen Job, DCI Jordan. Es mag nicht die Stelle sein, die Sie erwartet hatten, aber ich glaube, es ist richtig, zu sagen, dass Sie nicht mehr viel länger bei der Met sein werden.«
Als Carol zu ihrer Wohnung im Barbican zurückfuhr, war sie sich kaum des Verkehrs bewusst, der um sie herum floss. Obwohl sie sich oft sagte, dass ihr in ihrem Beruf immer das Unerwartete bevorstehen könne, hatte der Verlauf dieses Nachmittags sie völlig überrumpelt. Erstens war aus heiterem Himmel Paul Bishop erschienen. Dann hatte das Vorstellungsgespräch eine absonderliche Wendung genommen.
Irgendwo in der Nähe der Überführung am Westway mischte sich langsam Ärger in Carols Verwirrung. Etwas stimmte hier nicht. Die Stelle einer Verbindungsbeauftragten für Europol hatte nichts mit konkreten Einsätzen zu tun. Es ging dort um Analysen, nicht um praktische Arbeit. Sie würde Schreibtischarbeit machen, reisen und Erkenntnisse aus vielen verschiedenen Quellen in der ganzen Europäischen Union durchgehen und sortieren. Organisierte Kriminalität, Drogen, Menschenschmuggel – auf solche Dinge würde sie sich konzentrieren. Ein Europol Liaison Officer, ein ELO, war jemand mit dem Computerwissen und dem ermittlerischen Grips, um Zusammenhänge aufspüren, Verwirrendes und Nebensächliches herausfiltern und so eine möglichst klare Darstellung der kriminellen Aktivitäten geben zu können, die sich auf Großbritannien auswirken könnten. Ein ELO würde höchstens dann in die Nähe der Praxis kommen, wenn es um Kontakte mit Polizeibeamten aus anderen Ländern ging, um sich zu vergewissern, dass die Informationen, die bei ihm ankamen, ebenso genau wie umfassend waren.
Warum also sollte sie jetzt etwas tun, was sie noch nie zuvor getan hatte? Sie mussten doch aus ihrer Akte ersehen haben, dass sie noch nie als Agentin gearbeitet hatte, nicht einmal in ihrer frühen Zeit bei der Kripo. Es gab nichts in ihrer Vergangenheit, das annehmen ließ, sie eigne sich, in die Rolle eines anderen Menschen zu schlüpfen.
Im stockenden Verkehr auf der Marylebone Road wurde ihr klar, was ihr am meisten Kopfzerbrechen bereitete. Sie wusste nicht, ob sie es konnte. Und wenn es etwas gab, was Carol noch mehr hasste, als den Durchblick nicht zu haben, dann war es der Gedanke daran, zu scheitern.
Wenn sie diese Herausforderung bestehen wollte, würde sie sich wirklich kundig machen müssen, und zwar schnell.
Frances schnitt Gemüse, als Tony hereinkam, und die Stimmen von Radio Four bildeten einen strengen Kontrast zu dem Geräusch des Messers auf dem hölzernen Schneidebrett. Er blieb einen Moment auf der Schwelle stehen, um die so normale, behagliche, aber in seinem Leben relativ fremde Szene einer Frau, die in seiner Küche das Abendessen zubereitete, dankbar zu betrachten: Frances Mackay, 37, eine Französisch- und Spanischlehrerin an der Highschool in St. Andrews, mit dem blauschwarzen Haar, den saphirblauen Augen und der hellen Haut, die für die Hebriden typisch sind, mit der sportlichen Figur einer Golfspielerin und dem scharfen, verschlagenen Humor einer Zynikerin. Sie hatten sich im Bridge-Club kennen gelernt. Tony hatte seit den Anfängen seines Studiums nicht mehr gespielt, aber es war etwas, was er wieder aufnehmen konnte, ein Teil seiner Vergangenheit, der es ihm erlauben würde, ein weiteres Mauerstück in die Fassade einzupassen, die er ständig aufrechterhielt. Insgeheim betrachtete er sie als Hilfsmittel, um sich als Normalmensch darzustellen.
Ihr früherer Bridgepartner war wegen einer neuen Stelle nach Aberdeen gezogen, und genau wie er brauchte sie einen neuen Dauerpartner, mit dem sie eine gemeinsame Taktik beim Reizen aufbauen konnte. Sie verstanden sich am Spieltisch sofort sehr gut. Es folgten Bridge-Partys außerhalb des Clubs, dann eine Einladung zum Essen, um die Feinheiten ihres Spiels vor einem Turnier zu planen. Nach ein paar Wochen gingen sie zusammen ins Byre Theatre, aßen Lunch in den Pubs überall im East-Neuk-Gebiet, gingen in den West Sands beim peitschenden Nordostwind spazieren. Er mochte sie, war aber nicht verliebt, und das hatte den nächsten Schritt möglich gemacht.
Die rein physische Abhilfe für die Impotenz, unter der er fast schon sein ganzes Erwachsenenleben litt, stand seit einiger Zeit zur Verfügung. Tony hatte sich zunächst der Verlockung, Viagra zu nehmen, widersetzt, denn er wollte nicht auf ein pharmazeutisches Mittel wegen eines im Grunde psychischen Problems zurückgreifen. Aber wenn es ihm mit dem Wunsch, sich ein neues Leben aufzubauen, ernst war, dann gab es keinen logischen Grund, weiterhin den Maximen des alten Lebens anzuhängen. Also hatte er die Tabletten genommen.
Schon allein die Tatsache, dass er es schaffte, mit einer Frau ins Bett zu gehen und dabei nicht dauernd mit der trüben Aussicht auf sein Versagen beschäftigt zu sein, war eine neue Erfahrung für ihn. Von der schlimmsten Angst befreit, konnte er die Zaghaftigkeit und Peinlichkeit vermeiden, die das Vorspiel für ihn immer bedeutet hatten. Er war selbstbewusst und konnte fragen, was sie sich wünschte, und traute sich zu, es ihr geben zu können. Sie schien es jedenfalls zu genießen, so sehr, dass sie nach mehr verlangte. Und er hatte zum ersten Mal den Machostolz und das großspurige Auftreten verstanden, das sich einstellt, wenn ein Mann seine Frau befriedigt hat.
Und doch, und doch. Trotz der körperlichen Lust konnte er das Bewusstsein nicht abschütteln, dass diese Lösung eher etwas übertünchte, als es zu beheben. Er hatte die Symptome nicht behandelt, sondern sie nur versteckt, und was er gefunden hatte, war lediglich eine neue und bessere Maske, mit der er seine Unzulänglichkeit als Mensch verdeckte.
Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn der Sex mit Frances tiefe Emotionen geweckt hätte. Aber Liebe war eben etwas für andere Menschen. Liebe war etwas für Männer, die der Partnerin etwas geben konnten, die mehr bieten konnten als eine deformierte Psyche und Bedürfnisse. Er hatte sich angewöhnt, die Liebe als etwas für ihn Unerreichbares zu betrachten. Es hatte keinen Sinn, sich nach dem Unmöglichen zu verzehren. Die Grammatik der Liebe war eine Sprache, die er nicht beherrschte, und keine noch so große Sehnsucht danach würde das je ändern. Also verdrängte er seine Angst zusammen mit seiner funktionellen Impotenz und fand mit Frances eine Art Frieden.
Er hatte sogar gelernt, diesen Zustand als selbstverständlich anzusehen. Augenblicke wie dieser, wo er innehielt und die Lage analysierte, waren in dem bedachtsamen Leben, das sie sich zusammen aufgebaut hatten, immer seltener geworden. Er war, so sagte er sich selbst, wie ein Kleinkind gewesen, das die ersten unbeholfenen Schritte tat. Anfangs hatte es ihn extrem viel Konzentration gekostet und eine Menge unerwarteter Schrammen und Stürze mit sich gebracht. Aber nach und nach vergisst der Körper, dass jeder sichere Schritt nach vorn ein verhindertes Fallen ist. Es wird möglich, zu gehen, ohne es als ein kleines Wunder zu betrachten.
So verhielt es sich auch mit seiner Beziehung zu Frances. Sie hatte ihre eigene moderne Doppelhaushälfte am Rand von St. Andrews behalten. Sie verbrachten die meisten Wochen je zwei Nächte bei ihr, zwei Nächte in seinem Haus und den Rest jeweils getrennt. Es war ein Rhythmus, der ihnen beiden zusagte, und in ihrem Zusammenleben gab es bemerkenswert wenig Reibungen. Wenn er darüber nachdachte, schien ihm diese Ruhe die direkte Folge davon, dass es zwischen ihnen keine brennende, heftige Leidenschaft gab.
Jetzt sah sie von den Paprikaschoten auf, die ihre kleinen Hände geschickt in Würfel schnitten. »’n guten Tag gehabt?«, fragte sie.
Er zuckte mit den Achseln, ging zu ihr und drückte sie liebevoll an sich. »Nicht schlecht. Und du?«
Sie verzog das Gesicht. »Es ist um diese Jahreszeit immer furchtbar. Der Frühling lässt die Hormone der Teenager verrückt spielen, und vor den Prüfungen liegt neurotische Angst in der Luft. Es ist, als müsste man einen Sack voll melancholischer Flöhe unterrichten. Ich habe den Fehler gemacht, meine fortgeschrittene Spanischgruppe einen Aufsatz über ›Mein perfekter Sonntag‹ schreiben zu lassen. Die Hälfte der Mädchen hat schmalzige romantische Geschichten abgegeben, gegen die sich Barbara Cartland wie hartgesottener Realismus anhört. Und die Jungs haben alle über Fußball geschrieben.«
Tony lachte. »Es ist ein Wunder, dass die menschliche Spezies sich vermehren kann, so wenig wie Teenager mit dem anderen Geschlecht anzufangen wissen.«
»Ich weiß nicht, wer sehnsüchtiger die Minuten gezählt hat, bis es klingelte, sie oder ich. Manchmal denke ich, das ist doch für intelligente Erwachsene keine Art und Weise, sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Man reißt sich die Beine aus, um ihnen die Wunder einer Fremdsprache näher zu bringen, und dann übersetzt jemand coup de grâce mit Rasenmäher.«
»Das hast du aber jetzt erfunden«, sagte er, nahm einen halben Champignon und zerkaute ihn.
»Ich wollt, es wäre so. Übrigens, als ich hereinkam, hat gerade das Telefon geklingelt, aber ich hatte zwei volle Einkaufstüten, da hab ich es dem Anrufbeantworter überlassen.«
»Ich sehe nach, wer es war. Was gibt’s denn heute?«, fügte er hinzu, während er zu seinem Büro ging, einem winzigen Raum im vorderen Teil des Häuschens.
»Maiale con latte mit geschmortem Gemüse«, rief ihm Frances nach. »Für dich: Schweinefleisch gegart in Milch.«
»Hört sich interessant an«, rief er zurück und drückte auf den Wiedergabeknopf des Anrufbeantworters. Ein langes Piepsen, dann hörte er ihre Stimme.
»Hi, Tony.« Es folgte ein langer Augenblick der Ungewissheit. Zwei Jahre Schweigen, nur ab und zu hatten sie in unregelmäßigen Abständen E-Mails ausgetauscht. Aber mehr als die drei kurzen Silben war nicht nötig, um die Schale zu durchbrechen, mit der er seine Gefühle umgeben hatte.
»Hier Carol.« Noch drei Silben, aber die waren völlig unnötig. Er hätte ihre Stimme auch inmitten von Rauschen und Krachen erkannt. Sie musste die Nachrichtenmeldung über Vance gehört haben.
»Ich muss mit dir sprechen«, fuhr sie fort und klang jetzt sicherer, sachlich und nicht so, als gehe es um etwas Persönliches. »Ich habe einen Einsatz vor mir, bei dem ich wirklich deine Hilfe brauche.« Sein Magen wurde bleischwer. Warum tat sie ihm das an? Sie kannte die Gründe, weshalb er die Täterprofile aufgegeben hatte. Ausgerechnet sie sollte ihn doch schonender behandeln.
»Es hat nichts mit Täterprofilen zu tun«, fügte sie hinzu und verhaspelte sich vor Eile, weil sie das Missverständnis aufklären wollte, das sie befürchtet hatte und dem er prompt so schnell erlegen war.
»Es ist etwas für mich. Etwas, was ich tun muss, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Und ich dachte, du könntest mir helfen. Ich hätte eine E-Mail geschickt, aber ich meine, es wäre einfacher, es zu besprechen. Kannst du mich bitte anrufen? Danke.«
Tony stand bewegungslos da und starrte aus dem Fenster auf die leeren Fassaden der Häuser, die auf der anderen Straßenseite standen. Eigentlich hatte er nie geglaubt, dass Carol endgültig der Vergangenheit angehörte.
»Willst du ein Glas Wein?«, kam Frances’ Stimme aus der Küche und unterbrach sein Träumen.
Er ging in die Küche zurück. »Ich hol die Gläser«, sagte er und zwängte sich an ihr vorbei zum Kühlschrank.
»Wer war’s denn?«, sagte Frances harmlos, eher aus Höflichkeit als aus Neugier.
»Eine Kollegin von früher.« Tony versuchte sein Gesicht zu verbergen, während er den Korken zog und Wein in zwei Gläser goss. Er räusperte sich. »Carol Jordan. Von der Polizei.«
Frances runzelte besorgt die Stirn. »Ist das nicht diejenige, die …?«
»Ja, die, mit der ich bei den Fällen der beiden Serienmörder zusammengearbeitet habe.« Sein Tonfall ließ schließen, dies sei kein Thema, über das sie sprechen sollten. Sie kannte die Geschichte in groben Zügen, hatte aber immer gespürt, dass es etwas zwischen ihm und seiner ehemaligen Kollegin gab, was er verschwieg. Jetzt war vielleicht die Gelegenheit gekommen, dieses lang gehegte Geheimnis zu lüften und zu sehen, was sich dahinter verbarg.
»Ihr wart einander wirklich nah, oder?«, drängte sie.
»Die Arbeit an solchen Fällen bringt die Kollegen immer zusammen, solange sie damit zu tun haben. Man hat ein gemeinsames Ziel. Dann hinterher kann man sich nicht mehr ausstehen, weil man sich an Dinge erinnert, die man verdrängen will.« Eine Antwort, die nichts preisgab.
»Hat sie wegen diesem Dreckskerl Vance angerufen?«, fragte Frances, die genau merkte, dass er versuchte, sie vom eigentlichen Thema abzubringen.
Tony stellte ihr Glas neben dem Hackbrett ab. »Du hast davon gehört?«
»Es kam in den Nachrichten.«
»Du hast es nicht erwähnt.«
Frances nahm einen Schluck von dem kühlen, frischen Wein. »Es ist deine Sache, Tony. Ich dachte, du würdest schon noch darauf zu sprechen kommen, wenn du darüber reden wolltest. Wenn nicht, dann eben nicht.«
Er lächelte sarkastisch. »Ich glaube, du bist die einzige Frau, die ich je gekannt habe, der das Gen zur Schnüffelei abgeht.«