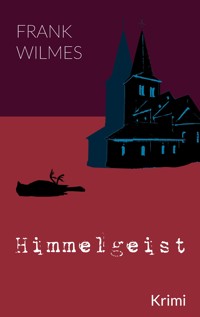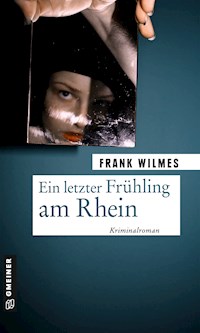
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kilian Stockberger
- Sprache: Deutsch
Die Modewelt - eine verworrene Gesellschaft aus Selbsterhöhung, frivolem Bürgertum und Boheme. Kommissar Kilian Stockberger und sein Team ermitteln im Mordfall eines populären Models. Das Werbegesicht lebte in einem Luxusdomizil am Rhein. Intensive Gespräche mit Personen aus ihrem Umfeld zeigen den Beamten das Psychogramm eines Menschen auf, der zwischen Melancholie und Promi-Partys schwebte. Wem vertraute die Tote? Und wie gingen ihre Vertrauten damit um? Ein Krimi über eine abstruse Welt aus religiösem Wahn und der Sucht nach vollkommener Schönheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Wilmes
Ein letzter Frühling am Rhein
Kriminalroman
Zum Buch
Seelentod Kilian Stockberger, Leiter der Mordkommission Düsseldorf, und sein Team, ermitteln im Fall eines getöteten Models. Das populäre Werbegesicht lebte in einem Luxusdomizil am Rhein. Intensive Gespräche mit Nachbarn, Freunden und Personen aus ihrem beruflichen Umfeld zeigen den Beamten das Psychogramm eines Menschen auf, der zwischen Melancholie und Promi-Partys schwebte. Wem vertraute die Tote? Und wie gingen ihre Vertrauten damit um? Die Modewelt – eine verworrene Gesellschaft aus Wahn und Selbsterhöhung, aus frivolem Bürgertum und Boheme. Kommissar Stockberger ermittelt in einem mondänen Umfeld. Dabei schaut er in den Abgrund einer zerstörten Seele und gerät einem unglaublichen Mysterium auf der Spur. Doch erst der Hinweis eines Zeugen weist ihm den richtigen Weg und führt zu einem dramatischen Finale – an einem erstaunlichen Ort.
Frank Wilmes stammt aus dem Münsterland, dem Land der Bauernhöfe und Springreiter, der Schwarzbrote und Schinken, an der Kante zu Niedersachen und Holland. Seit mehr als 30 Jahren lebt er in Düsseldorf – eine Kunst- und Modestadt mit internationalem Flair, die sich selbst aber nicht so wichtig nimmt. Er hat als Regierungskorrespondent und als Wirtschaftsjournalist Staatschefs und Wirtschaftsführer kennengelernt, über sie Reportagen geschrieben und mit ihnen Interviews geführt. Privat beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit den Launen des Zeitgeistes und mit der Geschichte der Klöster. Daraus entstand die Idee für seinen Krimi „Ein letzter Frühling am Rhein“.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © cydonna / photocase.de
ISBN 978-3-8392-6732-5
Zitat
»So geht es all denen, die aus dem einsamen und beschaulichen Leben heraustreten und in Städten unter Menschen leben wollen, die von grenzenlosem Bösen erfüllt sind.«
Leonardo da Vinci
1.
Das Gewölbe der Kirche umschloss sie wie ein finsteres Zelt, und sie hatte den Eindruck, dass es nach Mittelalter roch, nach Hexen und Scheiterhaufen.
Sie zog ihre Lippen dunkelrot nach, prüfte die Kontur in ihrem Spiegel und holte aus ihrer Imitat-Gucci-Tasche ein Papiertaschentuch, das sie in ihren Handballen drückte. Später säuberte sie mit einem feuchten Tuch für Baby-Popos ihre von Pfützen verschmierten Sneakers aus glattem Leder und schlug den Kragen ihrer Jacke hoch, weil sie glaubte, der Teufel könnte ihr in den Nacken springen.
Die Kerzen vor dem Bild einer erstaunlich faltenfreien Mutter Gottes vollzogen ungerührt ihren Dienst. Sie leuchteten zart für reichlich Mystik: Licht bedeutet Leben. Was hell erscheint, kann nicht böse sein. Nur in der Düsternis versteckt sich das Böse.
Sie kniete.
Sie faltete die Hände.
Sie hatte Angst, in den Beichtstuhl zu gehen.
Der Gedankenstrom kollabierte. Alles Denken, Träumen, Ahnen, Staunen und Verzweifeln gingen über- und durcheinander.
»Ich kann nicht mehr.«
Sie atmete tief, aber hektisch, dann stöhnte sie mit leiser Stimme.
»Mein Gott, wer bin ich?
Mein Gott, was erwartest du von mir?
Mein Gott, habe Erbarmen mit mir.«
Der Beichtstuhl war frei.
Der Pfarrer war bereit.
Sie kniete noch immer.
Die aschgrauen Wolken hingen tief im Himmel und zogen wie eine müde Elefantenherde weiter. Für einen Moment fand die Sonne eine Lücke. Sie erhellte die farbigen Kirchenfenster und rückte deren Figuren und Motive bedeutungsvoll in den Vordergrund.
Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat.
Jesus, der für uns gegeißelt worden ist.
Jesus, der für uns gekreuzigt wurde.
Der Organist übte für den nächsten Sonntagsgottesdienst.Die Pfeifen der Orgel trugen die Töne bis auf den Burgplatz, feierlich heiter und herausfordernd klar. Eine Musik, die nicht unterhalten wollte, sondern für einen höheren Sinn erdacht war. Zum Ruhme des Herrn.
Sie summte den Tönen hinterher.
Großer Gott, wir preisen dich.
Wir huldigen deine Güte.
Holst uns aus Sünde und Verdammnis.
In alle Ewigkeit.
Eine frierende Einsamkeit durchzog ihren Geist, der Trost hatte ausgespielt, die Hoffnung war nicht mehr zu hören. Das Leben versank ins Innere, tief und tiefer, als würde sie in einen Brunnen fallen und den Wind des Fallens spüren.
»Finde ich dort mein Glück?«
2.
Die zarte Frühlingssonne lugte über die Häusergipfel, als sie vor der mit Alu verkleideten Eingangstür standen. Keine Seiten- oder Blickfenster. Keine Klinke. Keine Briefkästen. Keine Namensschilder von den Bewohnern. Nur eine Klingel, die in einen Messingrahmen neben dem Eingang eingelassen war. Eine herzliche Anmutung mit einladendem Charakter sollte dieser Eingang auf gar keinen Fall vermitteln. Könnte diese Tür sprechen, sie würde sagen: Kommt mir nicht zu nahe.
Das Gebäude mit seinen schmalen und hohen Fenstern im massiven Mauerwerk grober, vierkantiger Steine war mindestens 200 Jahre alt. Ein paar Schritte um die Ecke verlief im Mittelalter die schützende Stadtmauer von Düsseldorf. Von außen betrachtet nur ein schlichter Bau ohne jeden kreativen Blitz. Kein Erker. Kein Türmchen. Kein Platz für das Vergeuden von Quadratmetern. Funktional ehrlich. Über dem Eingang waren mit scharfem Blick noch die verwitterten Buchstaben aus Stein in geschlungener Schrift erkennbar:
Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen.
Nach dem Klingeln hörten sie ein leises Summen. Die Tür öffnete sich automatisch, aber ganz langsam, sodass ein hastiges Hineingehen nicht möglich war. Das muss sich eine Yogalehrerin in Trance ausgedacht haben, dachte sich Hauptkommissar Kilian Stockberger. Tief einatmen und entspannen. Langsam, langsam …
Ein gesichtsmäßig älterer Mann im dunkelblauen Anzug und dunkelblauer Krawatte stand hinter einem hölzernen Podest, als wollte er eine Rede halten. Er ging nur wenige Schritte auf die Besucher zu. Der Kommissar musste seinerseits mehrere Schritte auf ihn zugehen, um ein Gespräch in normaler Lautstärke führen zu können. Jetzt betrug die Distanz nur noch 1,50 Meter. Ein Begrüßungshandschlag war unter diesen Umständen nicht vorgesehen.
Der blaue Anzugträger öffnete leicht den Mund, als würde gleich ein Vogel mit einem Würmchen heranfliegen, um ihn zu sättigen. Dabei ließ er seinen aufgestauten Atem langsam durch die behaarten Nasenlöcher fließen. Immerhin versuchte er ein Lächeln. Ein Lachdolmetscher würde seine Mimik allerdings so übersetzen: Was willst du denn hier? Staubsauger verkaufen? Spenden sammeln? Ich habe keine Lust auf dich.
Er stellte sich als Portier vor, ohne seinen Namen zu nennen. Er sprach leise, um damit zu betonen, dass dieser Ort kein Allerlei vertrage. Wer hier lebt, hat Respekt verdient. Es fielen Worte wie Leistungsträger und Prominenz. Die brauchten Ruhe und Schutz vor falscher Aufmerksamkeit. Eine laute oder gar hektische Stimme würde seiner Aufgabe in keiner Weise gerecht. Er war sozusagen ein Aufpasser, ein Schutzbefohlener, ein Ordnungshüter für die wichtigen Menschen in diesem Haus. Ob der leise Mann auch laut fluchen konnte? Seine Stimme war wie eine Höhle, die die Welt nicht gesehen hatte. Sie verkroch sich ängstlich vor dem Leben. Er sprach im Rhythmus eines Ruhepulses mit ermüdender Geschwindigkeit.
Der Blick führte an ihm vorbei in den Besucherraum, der früher eine kleine Kapelle mit drei Fenstern aus Spitzbögen war. Statt farbiger mosaikartiger Muster enthielten sie nur milchiges Glas. Hier beteten die Nonnen noch vor ein paar Jahren sieben Mal am Tag. Stets begann der Morgen mit den gleichen Worten:
Herr, öffne meine Lippen. Damit mein Mund dein Lob verkünde.Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja.
Die Nonnen hatten ihr Kloster verlassen, weil sie es nicht mehr finanzieren konnten. Die meisten Räume standen leer. Der Nachwuchs fehlte. Die letzte Novizin war vor zwölf Jahren ins Kloster eingetreten. Das Durchschnittsalter der Schwestern lag bei 69 Jahren. Die Nachfrage nach Rollatoren überstieg zuletzt die Anzahl an Gebetbüchern. So verabschiedete sich das Haus von den Nonnen, von ihren Gebeten und ihrer Andacht. Die klösterliche Spiritualität aber wollte selbst nach vielen Jahren nicht aus den Mauern weichen. Sie kämpfte gegen den Einfall der Architekten und Raumausstatter, die aus dem Kloster ein Luxusdomizil gemacht hatten. Edel, teuer und mit Blick auf den Rhein. Kontemplation auf das neue Sein. Wer hier lebte, hatte es geschafft. Ein scharfer Kontrast zum Armutsgelübde der Nonnen.
Chira Walldorf, 28 Jahre alt, ein international beachtetes Model, lebte hier auf zwei Etagen, aber sie war selten zu Hause. Ihr Terminkalender las sich wie ein internationaler Flugplan. London. Rom. New York. Berlin. London. Paris. London. New York. Berlin. Mailand. Sie war das Gesicht von Haute-Couture-Modenschauen und bekannter Marken. Sie machte Werbung für eine französische Automarke und eine Hautcrème mit dem Namen »Vole«, die mit ihrer rosa geschwungenen Schrift verwöhnende Zärtlichkeit versprach – für Frauen, die sich mögen. Dazu der Slogan:
WEIL DU ES BIST.
Schon bald kalauerte der Spruch durch die Straßen und löste Albernheiten aus. Pubertierende Mädchen äfften ihren Lehrer nach: Du bekommst keine fünf, weil du es bist. Und man konnte kaum noch in eine Kneipe gehen, ohne den Spruch zu hören: Das Bier geht auf meinen Deckel, weil du es bist. Ein Psychologe hatte sogar ein Buch über die Alltagswirkung von Werbesprüchen geschrieben. Das Buch hieß: »Weil du etwas willst!« Erstes Kapitel: »Belohne dich!«
Chira Walldorf genoss schicke Partys, sehen und gesehen werden: dort, wo schön und reich aufeinandertrafen. Wer in diesem Olymp der gesellschaftlichen Avantgarde aufgestiegen war, musste all die B-Promis und Sternchen auf Distanz halten, weil sie nicht gut waren für das eigene Image. Glamour ist nicht zum Discountpreis zu haben. Glamour umfasst Ausstrahlung, Stil, Begehrtheit. Das ist nur mit A-Level zu schaffen.
Der Portier – Hausmeister sagte hier keiner – traute seinen Segelohren nicht.
»Wir sind von der Kriminalpolizei, mein Name ist Kriminalhauptkommissar Stockberger. Und das ist Oberkommissarin Winkler und Kommissar Reichenhall.«
Er möge bitte die Wohnungstür von Frau Walldorf öffnen. Er schaute kribbelig auf die Polizeimarke, versuchte cool zu sein und stellte eine typische Frage aus einem Fernsehkrimi.
»Darf ich fragen, worum es geht?« Er kicherte dabei ein wenig, selbst überrascht von seiner offensiven Frage, die allerdings ohne Antwort blieb.
»Bitte, lassen Sie mich vorangehen«, sagte er eifrig und dienerisch mit nervösem Augenzucken. Dabei grinste er. Er war jetzt der Mann, der der Polizei eine Wohnung aufschloss. Kein Träumer, ein Macher. Mit voller Entschlossenheit. »Bitte hier entlang.«
Der Fahrstuhl hielt nicht auf dem Flur, sondern öffnete sich direkt zur Wohnung. Die ersten Blicke fielen auf vergrößerte Schwarz-Weiß-Fotos von Chira Walldorf in der französischen »Vogue« und in der deutschen »Madame«. Gegenüber der Garderobe hing ein körpergroßes Foto von ihr. Sie trug ein langes weißes Kleid ohne Schmuck. Lässig hielt sie in der rechten Hand, nach unten sinkend, ein Sektglas, offenbar ein Urlaubsfoto.
Schauspieler stellen ihren »Bambi« für die beste Hauptrolle oder als bester Nebendarsteller in eine Vitrine. So machen das auch Sportler mit ihren Medaillen von Olympiaden, Europa- und Weltmeisterschaften. Diese Zurschaustellung adelt Leistung und Stolz und holt den gestrigen Ruhm in die Gegenwart. Models zeigen ihr Kapital: das Gesicht. Es muss wirken, und die Wirkung ist das Nonplusultra einer Branche, die den Schein des Lebens über alle Unebenheiten hinweg perfektioniert. Perfekt ist das, was du siehst. Was du nicht siehst, geht dich nichts an.
Ihre fast dreieinhalb Meter lange Couch wirkte wie eine Bühne, die großes Theater erlebt hatte. Lust und Hingabe, Gelassenheit und Protest, Reden und Schweigen. Die Inszenierungen des Lebens brauchten diese Couch, um sich fallen zu lassen und das Leben zu spüren, allein, zu zweit, zu dritt, zu viert oder noch mehr, alles egal. Wichtig war allein: Wer hier war, musste dem Leben nicht mehr hinterherlaufen.
Rechts von der Couch befand sich eine Bar mit 20, 30 Gläsern. In Flötenform, kegel- und ballonförmig, schmal, zylindrisch und mit langem Stil – für Champagner, Weiß- und Rotwein, Whisky, Obstler und Cognac. Aber keine Biergläser. Bier ist das Volk, Champagner das Königreich.
Nur 500 Meter von der Wohnung thronten die bekannten und traditionswürdigen Altbier-Hausbrauereien, darum windeten sich kleine und große Lokale mit deutscher, italienischer, spanischer und türkischer Küche. Täglich gingen mehrere Tonnen Lebensmittel über die Tresen. Von der Schweinshaxe über Pizza bis zum Döner. Essen ging immer. Was den Leib füllte, fütterte auch die Seele. Feinschmecker wären hier allerdings so fehl am Platze wie eine Dessous-Show im Vatikan.
Frauen und Männer, Jung und Alt, Heimische und Touristen zogen durch die Gassen der Ablenkung und der Inspiration, des Träumens und Vergessens. Liebeshungrige, Neugierige, Verwegene. Aus den Lokalen dröhnte der Bass irgendeiner hektischen Musik. Die Menschen schrien sich an, um verstanden zu werden. Ein paar Meter weiter aber regierte schon wieder die Gemütlichkeit. Helene Fischer sang aus einer Box: Du fängst mich und lässt mich fliegen.
Manchmal wehte der Wind die Stimmen und die dumpfen Schläge der Musik hinüber zu ihrer Wohnung. Die Treppe in ihrer Maisonettewohnung führte zu einem ovalen Raum, den die Nonnen für ihre Exerzitien genutzt hatten.
Geistige Übungen, um Gott näher zu kommen.
Betrachten.
Besinnen.
Horchen.
Sie saßen auf Yoga-Hockern in der Runde. Ein Gong ertönte, und Weihrauch zog wie ein grauer Schleier zur Decke und verbreitete seinen balsamartigen Duft.
Auf die Atmung achten.
Ein und aus, tief und satt.
Deine Stirn ist glatt.
Du bist entspannt.
Erfasse deinen Geist.
Spüre deinen Glauben.
Öffne dich.
Rosenkränze hingen sanft zwischen den Fingern, als bräuchten die 59 Perlen der Gebetskette mütterliche Fürsorge.
Andacht und Hingabe verbündeten sich zur Askese. Sprechende, schweigende, singende Gebete – dann wieder eine Stille, die ein Stadtmensch nicht einmal erahnen könnte. Eine Stille, die keine nervöse Ruhe entfachte, weil sich nichts tut, sondern eine heilende Unruhe, weil sie neue Gedanken freisetzte, um das Leben für Gott weiter zu entwickeln.
Stille.
Lass dich fallen.
Und auffangen.
Der Sinn dieses Raumes hat sich in eine spröde Weltlichkeit verwandelt. Puristischer Schick statt Kerzen und Kreuze. Nichts lag dort herum. Eine Ordnung, die fast schon anstrengend wirkte, weil sie für das Auge nichts hergab. Vielleicht hatte diese aufgeräumte Sturheit auch nur den einen Sinn, ihr aufreibendes und üppiges Leben mit Kargheit und Klarheit einzufangen. Oder es war alles ganz anders. Die Putzfrau fühlte sich wie ein strenger Sheriff für Sauberkeit und Ordnung.
Verhaftet: Die Blumenvase ohne Blumen.
Verhaftet: Das Kleid auf dem Stuhl.
Verhaftet: Einige Bücher auf dem Parkettboden.
Ein Buch hatte sie vergessen: »Jahrmarkt der Eitelkeiten«.
Wer eitel ist, sollte seine Eitelkeit verstehen – das feine Gerippe aus Dominanz und Anmaßung, aus Selbstachtung und Lebenslust. Eine Eitelkeit ohne Sendungsbewusstsein ist nutzlos. Sie braucht eine Botschaft, die anmacht, provoziert und lenkt. Eine Nonne darf nicht eitel sein. Das Gebet kennt keine Eitelkeit. Demut als Lebensaufgabe. Gott dienen und preisen. Nur darum geht es im Kloster. Ein Model muss eitel sein, um all den Sehnsüchten ein Bildnis zu geben. Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte. Ein Blick reicht, um die Sprache des Gesichtes zu verstehen. Triumph, Trauer, Offenheit, Stolz, Leidenschaft, Herz oder Herzlosigkeit, Liebe oder Abwehr. Mit dem Gesicht fängt alles an.
Die Dekokissen auf der schmalen Couch an der Schlafzimmerwand hatten augenscheinlich alle den gleichen Abstand und in der Mitte einen Knick. In dieser adretten Spießigkeit konterkarierten sie den Lebensstil der Bewohnerin, die Weltbürgerin und Zigarillo-Raucherin, die Entfesselte und Mutige, die Spielerin zwischen Hochmut und Gleichmut, zwischen Arroganz und Bescheidenheit.
Aber es sind ihre Kissen.
Die Seite mit ihrem Tagebucheintrag von gestern war noch aufgeschlagen.
»Die Leute verstehen nicht, dass ich doch nur Ich bin, sie glauben, dass ich Wir bin, für alle da, immer nett und offen, aber ich gehöre nur Gott, auch wenn es mir keiner glaubt.«
Vor den Fenstern ihres Schlafzimmers hingen weiche, fast durchsichtige weiße Vorhänge – zugezogen. Die Sonne offenbarte die feinen Strukturen des Stoffes. Auf der Wand tänzelten einzelne Punkte, Striche, Figuren. Schattenspiele im aufhellenden Hintergrund.
Eine heitere Frische durchzog die Frühlingsluft. Draußen schallte das Gelächter einer Jugendgruppe ins obere Stockwerk. Es waren Tage, die zur Verwegenheit herausforderten und sich triumphierend über das Notwendige und Angemessene hinwegsetzten. Das Leben erschien in seinen schönsten Farben, als hätte es nie ein Grau gegeben.
Chira Walldorf lag auf dem Bett.
Ihre langen Haare fielen nach links und rechts, als müssten sie nach dem Gerechtigkeitsprinzip jede Gesichtshälfte gleichmäßig berücksichtigen.
Auf ihrem leblosen Körper lag eine Karte.
ICH HABE MIR DEINE SCHÖNHEIT GELIEHEN.
DU LEBST WEITER.
IN EINER ANDEREN WELT.
DU MUSST DAS VERSTEHEN.
ICH WEISS, DASS DU JETZT GLÜCKLICH BIST.
DAS IST MEIN TROST.
3.
Auf dem Flur der Mordkommission roch es nach Bohnerwachs. Man hörte das leise Zischen der Röhrenleuchten an der Decke, einige flackerten nur kurz auf. Vor jeder Tür standen vier graue Plastikstühle, darauf Menschen mit abweisenden, gleichgültigen, nervösen oder verweinten Augen. Die Tristesse des Abgrunds – die Schuld – verortete sich genau hier. Was einmal war, Glück, Aufbruch, Leben, verkehrte sich nun in eine bohrende und bedrückende Finsternis. Mord ist schwarz, dunkel, schrecklich. Die Moral hat versagt.
Wer auf diesem Flur Zeuge oder Beschuldigter war, verriet kein Gesicht. Das Böse ist weder schön noch hässlich, die Spuren liegen allein im Motiv. »Jeder Engel kann zum Teufel werden.« Davon war Kilian Stockberger, der seit zwei Jahren als Kriminalhauptkommissar das Dezernat für Tötungsdelikte leitete, restlos überzeugt. »Das kann ganz schnell gehen. Wenn aus Liebe Hass wird, brennen schon mal die Sicherungen durch.« Für ihn war die Vernehmung eines Beschuldigten »großes Theater«. Dramaturgie, Gefühle, Ergriffenheit, Ausdruck, all das entwickelte sich bis zum Finale – bis zur Aufklärung eines Falles. Darin mischten sich Erfahrung und Routine, aber auch Anspannung und Neugierde. Fest stand allein, dass zwei Menschen aufeinandertrafen, von dem keiner etwas von dem anderen wusste, wie er dachte und sich fühlte, welchen Charakter er verbergen oder zeigen würde. Der erste Akt der Vernehmung: Kilian und der mutmaßliche Täter nahmen sich gegenseitig wahr, sie glucksten, steuerten und bremsten, der Kampf um die Deutungshoheit von Worten und Gesten begann. Welche Rolle nahm Kilian ein, welche der Beschuldigte? War der Vernehmer in der Lage, Emotionen und Geduld zielgenau einzusetzen? Er wusste, dass er sich mit einer »blöden Frage« oder einer Unbeherrschtheit die ganze Vernehmung kaputt machen konnte. Wenn der Beschuldigte bockig war und dichtmachte, war das Spiel erst einmal aus. Der zweite Akt der Vernehmung: Kilian kreiste den mutmaßlichen Täter vorsichtig ein, ließ ihm aber Luft zum Nachdenken. Er stellte analytische, bohrende, feinsinnige, geschickte, raffinierte, spitzfindige Fragen, aber nie Fragen, die den Beschuldigten bloßstellten. Die Kunst bestand für ihn darin, so zu fragen, dass der Beschuldigte sich mehr und mehr öffnete und schließlich alles erzählte. Selbst ausgebuffte Profi-Lügner hatte Kilian mit seiner beharrlich freundlichen Fragerei aus der Reserve gelockt. Außerdem achtete er penibel darauf, Ruhe mit Worten und Gesten auszustrahlen. Denn wer ruhig ist, vermittelt Vertrauen, als spreche der Vater zu seinem Sohn oder der Arzt zu seinem Patienten. Der dritte Akt: Das bedrückende Geheimnis des Beschuldigten fand seinen Weg über Selbstmitleid und Verzweiflung, Hingabe und Offenheit. Dann fiel der Satz, der sich wie erfrischendes Gewitter über den schwülen Tag legte: »Ich war es.« Dafür verteilte Kilian Streicheleinheiten. »Es ist gut, dass Sie sich freigemacht haben, jetzt atmen Sie erst einmal kräftig durch. Wie wäre es mit einem Kaffee oder einer Zigarette?« Er hatte das Geständnis, aber das reichte ihm nicht. Er wollte den Hintergrund des Abgrunds wissen, warum, wieso, allein, wo und wie? Erst wenn er alles wusste, war er seiner Rolle als Vernehmer gerecht geworden.
Finale.
Der Vorhang fällt, Applaus.
Das Licht geht aus,
die Masken sind gefallen,
leer die Bühne,
und all die Müdigkeit wabert durch die Luft.
Ein anonymer Hinweis brachte ihn und seine Kollegen zum Opfer. Irgendjemand hatte einen Brief in den Briefkasten der Polizei geworfen:
BITTE KÜMMERN SIE SICH
UM CHIRA WALLDORF.
SIE HAT ES VERDIENT.
Zuerst dachte Kilian, einen Notarzt dorthin zu schicken oder einen psychologischen Dienst. Denn da war ein Mensch in Sorge um einen anderen Menschen. Er fragte sich, was das mit ihm zu tun hatte? »Wir sind für tote Menschen zuständig, die irgendein Mistkerl getötet hat.« Es war ohnehin ein Zufall, dass der Brief auf seinem Schreibtisch landete, weil ihn die Poststelle falsch einsortiert hatte. Er schaute auf den Brief wie auf die Anzeige eines Sportwagens, den er gerne hätte und den er sich niemals leisten könnte. Er ahnte, dass diese »komische Sache«, wie er den schriftlichen Notruf beschrieb, nicht in die Schablone seiner Erfahrungen und seines durchtrainierten Misstrauens passte.
Wenn Kilian in sich gekehrt nachdachte, träumte er mit offenen Augen. Seine Frau Charlotte kannte das. Er schaute sie an, ohne sie bewusst wahrzunehmen. So ähnlich erging es jetzt seinem Kollegen Miko Reichenhall, der ihm aus drei Metern Entfernung zurief, dass Chira Walldorf doch diese Modetante sei. Keine Reaktion. Er kam näher und klopfte auf Kilians Schreibtisch. »Hallo, Chef, Chira Walldorf ist eine Weltberühmtheit.«
Während die Männer der Spurensicherung in ihren weißen Overalls aus Vliesstoff mögliche Beweise sicherten, kniete sich der Gerichtsmediziner Albert Justus über die Leiche. »Oh, noch verdammt jung«, staunte er spontan.
»Um es genau zu sagen: 28 Jahre«, bemerkte Kilians Kollegin Cosima Winkler und schaute sich den Personalausweis genauer an.
»Schade für so ein junges Leben«, nuschelte der Mediziner und fragte, wer sie denn sei.
Die Kommissarin wunderte sich über die Frage. »Ist doch egal, wer das ist. Das hat doch mit deiner Arbeit nichts zu tun.«
»Mein Gott, bist du heute wieder empfindlich«, raunzte er zurück.
»Das ist Chira Walldorf, das Model«, mischte sich Kilian ein.
»Oh, dann kann ich mir ja die Aufzeichnung der Körpermaße sparen«, lächelte Albert provokativ in die Runde.
»Wie, was?« Cosima schaute ihn frech an.
Er schaute fröhlich zurück. »Also, wenn ich das recht überblicke, schätze ich ihre Maße auf 87-66-92.«
»Arschloch!« Sie verließ den Raum. Kilian blieb.
»Also, jetzt zur Sache, Albert, du kennst doch die Fragen aller Fragen?«
»Logisch, wann und wie.«
Kilian sah ihn ungeduldig an.
Albert war die Ruhe selbst. Er summte leise, als würde er über etwas brüten, über einen Hinweis oder einen Verdacht, aber er meinte nur: »Ich sehe keine Gewaltspuren.«
»Du siehst gar nichts?«, fragte Kilian ungläubig, schaute dabei zur Decke, als würde er dort seinenGlauben wiederfinden.
»Kilian, alter Kumpel, lass den Stress raus.«
»Oh«, intonierte er dann bedeutungsvoll, um eine Entdeckung anzukündigen.
Kilian drehte sich sofort zu ihm um. »Ja?«
»Wenn ich mir die Pupillen anschaue, den Schaum an und auf den Lippen und dann den Geruch bewerte, na ja, es könnte sich um Gift handeln.« Als Kilian spontan nichts sagte, ergänzte er: »Hast du verstanden: könnte!«
»Wie kam das Gift in den Körper? Durch Selbsttötung?«, fragte Kilian pflichtbewusst.
Er wusste zwar, dass der Brief, der auf der Leiche lag, ebenso wie der, der in den Briefkasten der Polizei geworfen worden war, nicht zu einem Selbstmord passte. Trotzdem wollte er nichts ausschließen. Er ließ nach Anhaltspunkten für einen Suizid suchen. Abschiedsbrief, angebrochene Medikamentenschachteln, Gläschen und Fläschchen mit giftigen Rückständen.
Später müsste er noch in ihrem Leben herumwühlen. Einsamkeit? Liebeskummer? Trauer? Depressionen? Alkohol- und Drogenprobleme?
Albert suchte auf den Venen mit einer Lupe nach Einstichspuren. Selbst wenn er welche gefunden hätte, müsste er gleichwohl die Obduktion abwarten, um verlässliche Informationen zu bekommen.
»Nee, das wird hier nichts mehr.« Er packte seine Utensilien in sein Alu-Köfferchen und versprach: »Morgen mache ich euch glücklich und sage, wann und woran sie starb.«
Nachdenklich offenbarte er beim Hinausgehen: »Wenn es sich tatsächlich um einen Giftmord handeln sollte, wäre das für mich eine Premiere. In meinen 26 Berufsjahren habe ich so etwas noch nicht erlebt, auch bundesweit kommt es eigentlich kaum vor.«
Kilian schaute aus dem Fenster. Er sah eine Gruppe älterer Menschen vor einem der Ausflugsschiffe auf dem Rhein. Ein paar Jugendliche stellten Plastikhütchen in Rot, Blau, Gelb, Grün und Lila hintereinander auf, um sie dann mit ihren Skateboards zu umrunden. Der Freitag hatte seinen Nachmittag erst zur Hälfte absolviert. Aber schon jetzt füllten sich die Terrassen der Restaurants. Die fahrenden Eisverkäufer in ihren VW-Bullis mussten aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig die Kunden wegnahmen. Obwohl die Sonne immer mal wieder hinter einer Wolke verschwand und sie schwächelte wie ein ausgepumpter Bodybuilder, saßen auf den meisten Nasen Sonnenbrillen, als müssten sich die Menschen ihrer lieblichen Jahreszeit vergewissern, die nicht nur Wärme bringt, sondern auch die Natur zum Leben erweckt.
Ihm gefiel dieser Anblick, weil der Mensch nicht für Matsch und Kälte geboren wurde. Er selbst brauchte den Aufbruch einer Jahreszeit, die ihn aus der Tristesse befreite.
Er dachte darüber nach, wie schön es doch wäre, wenn Charlotte ihn nach der Arbeit mit einem Aperol Spritz begrüßen würde, um auf den Frühling anzustoßen. Das hatte sie allerdings noch nie getan.
Er müsste Charlotte schon anrufen, um das Getränk konkret anzufordern. Aber damit wäre der Reiz des Moments verflogen, nämlich den Frühling mit seinen zarten Anmutungen und Zufällen ohne Plan und Ordnung einzufangen.
Er hörte aus dem hinteren Zimmer: »Die Leiche kann in die Gerichtsmedizin.«
Die Nachricht vom Tod der Berühmtheit ließ nur ein paar Stunden auf sich warten – wenn überhaupt. Plötzlich riefen scharenweise Journalisten in der Pressestelle des Polizeipräsidiums an, um Details zu erfahren. Der Pressesprecher musste sich selbst schlaumachen, worum es ging.
Die Online-Ausgaben der großen Zeitungen reagierten auf den Tod mit reißerischen, spekulativen oder sachlichen Eilmeldungen:
»Heute tragen die Engel Chanel«
»Schneewittchen-Mord im Kloster«
»Drogentod am Altar?«
»Chira Walldorf ist tot«
»Warum musste Chira Walldorf sterben?«
Diese mediale Wucht, die wie nach einem Dammbruch schlammige Wassermassen ins Tal drückte, überwältige Kilian, der in seinem ganzen Leben vielleicht acht Sätze mit einem Journalisten gesprochen hatte. Bisher konnte er unbehelligt von der Öffentlichkeit seine Fälle bearbeiten. Aber jetzt wurde er zu einer Figur des öffentlichen Interesses.
»Wer ist der Kommissar, der den Model-Mörder jagt?«, titelte eine Nachrichtenagentur. Besorgt rief ihn Charlotte an, er solle einen Anzug mit weißem Hemd anziehen. Diese Notfallbekleidung für repräsentative Anlässe hing permanent in seinem Büroschrank. Aber bisher gab es keinen Notfall. Er konnte auch nicht erkennen, warum die aktuellen Ermittlungen einen Anzug mit weißem Hemd erforderlich machten.
Beziehungsweise: Er wollte Charlotte bewusst falsch verstehen. Trotz gehörte zu seinem Charakter, und er war mit seiner Art das, was Menschen manchmal als sonderbar oder kompliziert bezeichneten. Die Norm, wie ein Mensch geheimhin sein sollte, um den allgemeinen Erwartungen zu entsprechen, passte nicht in seine Welt. Das machte sich freilich auch an kleinen Dingen des Alltags fest. Er scheute die Petitesse durchaus nicht. So hasste er es zum Beispiel, eine Parfümerie zu betreten. Er sagte, er bekomme in der warmen Raumluft Kopfschmerzen von den unterschiedlichen Düften, die sich die Kundinnen auf die Haut sprühen ließen, um den Geruch zu testen. Außerdem mochte er es nicht, wenn die Verkäuferin ihm ein Parfüm-Pröbchen zum Mitnehmen anbot, weil er nicht als eitel gelten wollte. Männer mit Parfüm waren für ihn eitel. Aber Charlotte meinte, er sollte von der Verkäuferin alles annehmen und sich dafür bedanken. Sie liebe es, wenn Kunden übertrieben »Danke« sagten, das gebe ihr das Gefühl, eine Wohltäterin zu sein. Und die Wohltäterin würde ihr dann beim nächsten Einkauf sagen: »Ach, Sie haben aber einen netten Mann!« Gefolgt von dem Satz: »Warten Sie noch kurz, ich gebe Ihnen noch ein paar Pröbchen mit, die müssen Sie unbedingt ausprobieren.« So funktionierte also Frauen-Kommunikations-Konsum, dachte sich Kilian.
Da war er natürlich sehr viel klarer im Kopf. Er wollte sich nicht verstellen und irgendwelche Spielchen spielen, um das Verkaufspersonal für ein bestimmtes Verhalten zu gewinnen. »Ich bin authentisch«, betonte er mehrmals am Tag, besonders dann, wenn seine Frau nach seinem Empfinden mal wieder nicht authentisch war. Dabei fand er das Wort »authentisch« ziemlich bescheuert, weil es jeder »Plapperheini« benutzte und es deshalb völlig kraftlos wirkte. Den Widerspruch hielt er aber locker aus.
Er versuchte, auch »dynamisch« und »innovativ« weitgehend aus seinem Wortschatz zu verbannen, obwohl er sich selbst als dynamisch und innovativ bezeichnen würde, aber klar, wenn die größten Langweiler sich als dynamisch und die erfolglosesten Typen sich als innovativ hochjubelten, müsste er andere Worte für sich finden.
Ihn gab es nur exklusiv, und er musste ständig aufpassen, kein Opfer des Zeitgeistes zu werden. Der Zeitgeist mit seinen Moden und Stimmungen war für ihn ein gefährlicher Geselle, und seine Charlotte eine gefährliche Kumpanin des Zeitgeistes.
Angriff: »Zieh doch mal etwas Anderes an«, forderte sie ihn auf.
Die Verteidigungslinie stand sofort: »Ich bin nicht ein Clown, der sich verkleidet.«
Gegenangriff: »Ein Clown fällt wenigstens auf.«
Kilian war Dauer-Jeans-Träger. Manchmal kombinierte er seine Jeans mit einer blauen Jacke, wenn er das Gefühl hatte, dadurch nicht seine Authentizität zu beschädigen. »Bullen-Outfit« nannte das Charlotte, weil alle zivilen Polizisten so oder ähnlich herumliefen. Sie sagte, sie müsse übertreiben, weil ihr Mann auf sprachliche Feinheiten hinsichtlich der Mode nicht reagiere.
4.
Vor dem Haus der Ermordeten drängelten sich Fotoreporter und Kamerateams um die besten Plätze. Sie schubsten sich beiseite und motzten wirr durcheinander. Einige hatten eine Standleiter dabei, um über die anderen Köpfe hinweg die Linse auszurichten für das bewegende, animierende, herausfordernde Motiv. Optimal wäre ein Motiv gewesen, das Trauer und Anmut, Stille und Intimität im entscheidenden Bruchteil einer Sekunde einfängt, so etwa: Als die schwarz gekleideten Männer vom Bestattungsinstitut die anthrazitfarbene Leichenbahre aus dem Haus tragen, öffnen sich die Wolken und die Sonne strahlt wie ein Abschiedsgeschenk für Chira Walldorf. Schön kitschig. Aber die Leiche war schon in der Gerichtsmedizin, und auf das Wetter hatten die Fotoreporter ohnehin keinen Einfluss.
Der Nachrichtenstrom erfasste die Republik, als sei ein Modelmord wichtiger als eine Sozialreform. Wichtiger als der Trump-Putin-Gipfel. Wichtiger als ein Machtkampf um das Kanzleramt. Was die Menschen ins schockhafte Staunen versetzte und ihnen Anlass zum Tratschen gab, musste einfach bedeutungsvoll und damit wichtig sein. Die großen Modehäuser in Paris und Mailand gaben Beileidsbekundungen heraus. Artige Worte im feinen Kostüm des Schreckens.
»Wir trauern um ein großes Leben«, schrieb die wohl renommierteste Modelagentur »Z 10«. Großes Leben, stand da tatsächlich, als ob Chira Walldorf sich viele Jahrzehnte für junge Künstler eingesetzt oder Spenden für arme Kinder in Deutschland gesammelt hätte.
Der schillernde Modemacher Massimo Dutti beließ es nicht mit einer schriftlichen Erklärung. Mit Sonnenbrille trat er aus dem Palast seiner Haute Couture, obwohl die Sonne nicht schien. Er sagte mit belegter Stimme, monoton, aber doch unruhig, als müsste er mit genau 38 Buchstaben das Unbegreifliche einer plötzlichen Endlichkeit auf den Punkt bringen: »Wir sind alle bestürzt und unendlich traurig.« Er schaute für einen Augenblick in die Kameras, ging dann zurück durch die gläserne Tür, die einen massiven Türgriff hatte, der einem Rugbyball ähnelte.
Die Branche des Zeitgeistes kannte sich mit den Worten der Schmeichelei aus, mit all den Befindlichkeiten und Sehnsüchten, begehrt zu sein. Aber nun befand sie sich in einer beklemmenden Starre zwischen Ergriffenheit und Verwirrtheit. Ihr buntes, schrilles, heiteres Spektakel offenbarte müde, ratlose Worte und ebenso müde und ratlose Gesichter. Mode ist Leben. Extravaganz. Partys. Aber doch kein Leichensack!
Die sündhafte teure Modemarke »Patricia Home«, mit der die Tote zum Star-Mannequin wurde, setzte auf eine Hoffnungsprosa, um das Nicht-Mehr-Sein zu verarbeiten und sich von den Trauerworten der anderen abzusetzen:
Der Tod ist die Fratze des Lebens
Übermütig offenbart er sich
in einer Sekunde des Schmerzes
triumphiert im Dunkel der Angst
und merkt nicht
das neue Leben hat schon begonnen
im Kirschblütenland.
Das Kirschenblütenland war nun allerdings das Gerichtsmedizinische Institut. Zur Todesursache schrieb Albert formal nüchtern:
»Absichtliche Fremdbeibringung durch Gift. Die angewandte Dosierung führte innerhalb von zwei Stunden zum Tod. Der Tod trat zwischen 19 und 22 Uhr ein.«
Die Journalisten wollten mehr wissen. Sie gierten nach Details, um ihre Geschichten damit zu bereichern. Daraus wurde eine Sucht, die nicht informieren, sondern unterhalten wollte. Ein mediales Spektakel, das nicht nur von Fakten lebte, sondern auch von Spekulationen. Daran trug Staatsanwalt Martin Hummelberger mit seiner übervorsichtigen und zudem hölzernen Art wesentlich bei. Informationen, die längst durchgesickert waren wie etwa »Mord durch Gift«, behandelte er aus »polizeitaktischen Gründen« als Staatsgeheimnis. Das führte wiederum dazu, dass er eine Pressekonferenz, wie sie in aufsehenerregenden Fällen üblich war, ablehnte.
Was er freilich nicht beachtete, dass die Journalisten sich daran nicht störten. Sie bastelten ihre eigenen Nachrichten, befragten Nachbarn, Modehändler, Werbepartner und stöberten im Leben des toten Models herum. Jeder Krümel verdichtete sich zu einem krossen Brot, frisch aus dem Backofen. In all diesen Inszenierungen konnte man gar nicht groß genug denken.
Ein Kommentator schrieb: »In welcher Welt leben wir eigentlich? Ein Mensch, der das Schöne und Gute verkörperte, musste sterben.«
Spitzfindig fragte Charlotte ihren Kilian am anderen Tag, was denn ein gewaltsamer Tod mit Schönheit zu tun hätte?
»Quatsch mit Soße«, brummte er.
»Du bist ja ein Prachtanalytiker«, schob sie nach.
»Kauf dir einen Fisch und wickle ihn in dieses Scheißblatt ein.«
»Welchen Fisch möchtest du denn?«
»Steak mit Pommes.«
Kilian war durchaus begabt darin, sein Gemüt von empathisch auf dickfellig umzustellen. Darin mischte er allerdings häufig die Andeutung eines Witzes, um nicht so streng herüberzukommen.
Die Onlinemedien, Radio- und TV-Sender hatten sich an der ersten Nachrichtenwelle sattsam abgearbeitet. Die Wochenzeitungen und Magazine mussten nun mit eigenen Geschichten nachziehen und einen Dreh finden, um aus Alt Neu zu machen. Genau genommen fiel ihnen das auch nicht schwer, weil sie meisterlich darin waren, ihren Geschichten einen rührseligen, sentimentalen und weinerlichen Antrieb zu geben.
Ein Magazin, das donnerstags erscheint, verschob seinen Redaktionsschluss sogar von Dienstag auf Mittwochmorgen, um noch von der Mord-Model-Hysterie zu profitieren. Es kramte aus seinem Archiv alte Mordgeschichten hervor, layoutete dazu eine aufwendige Bilderstrecke mit wenig Text. Das wirkte. Dafür durfte natürlich der Schillerndste aller Modeschöpfer nicht fehlen. Ein Serienkiller schoss Gianni Versace vor seiner Villa »Ocean Drive« in Miami Beach zweimal in den Kopf. Über die Gründe zweifelt die Polizei selbst Jahrzehnte nach der Tat noch immer. Der Killer nahm sich später auf der Flucht das Leben.
Dagegen war der Mord an Mauricio Gucci in der »Via Palestro« in Mailand ein echter Klassiker. Die rachsüchtige Gattin Patrizia Reggiani konnte es nicht verwinden, dass ihr Ehemann sie nicht mehr wollte, und engagierte den Todesschützen. Vier Kugeln benötigte er für die Vollendung seines Auftrages. Anschließend schrieb die Witwe ein griechisches Wort in ihr Tagebuch: »Paradeisos«, Paradies.
5.
Die Spurensicherung sicherte 124 verschiedene Spuren, Fingerabdrücke, Echthaare und Haare von einer Perücke, Speichel, Schuppen, Schmutz, der mit Schuhen in die Wohnung hineingetragen wurde. Auffällig war, dass von den Gläsern im Glasschrank zwei Gläser komplett ohne Spuren waren. Solch eine penible Reinigung erfuhr auch der Boden in der Küche, der klinisch sauber erschien.
Die Sichtung ihres Smartphones ergab: Ihr letztes Gespräch führte sie noch am Morgen mit ihrem Bruder. Es dauerte keine zwei Minuten. Aus den weiteren Anrufen und Nachrichten ließ sich bis zu diesem Zeitpunkt nur erkennen, dass viele Verbindungen ins Ausland führten oder von daher kamen.
6.
»Wer sind diese Menschen, die im Haus von Frau Walldorf wohnen?«, wollte Kilian wissen, nachdem die ersten Routinebefragungen, die nach Auffinden der Leiche begonnen hatten, keine Erkenntnisse gebracht hatten.
»Bin schon dran«, antwortete Cosima mürrisch, als wüsste sie nicht selbst, was in welcher Reihenfolge zu tun ist.
»Ich will auch wissen, wer da so ein- und ausgeht, und besonders natürlich, wer alles am Todestag sich in diesem Haus aufgehalten hat.«
Am liebsten hätte sie gesagt: »Darauf wäre ich niemals von allein gekommen. Zum Glück gibt es da aber jemanden, der mir sagt, was ich schon längt weiß.«
»Ja, Herr Hauptkommissar, wird gemacht«, salutierte sie stattdessen mit übertriebener Befehlsbereitschaft.
Kilian schaute sie irritiert an. »Ist was?«
»Nein, ich bin einfach nur dankbar, dass du mir immer genau sagst, wann was zu tun ist.« Sie verband diese Worte allerdings mit einem Lächeln. Eine auflockernde Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass er Ironie genau in diesem Moment nicht verstanden hätte.
Sie legte sich einen Plan zurecht.
Erstens: Recherche im Polizeicomputer. Gibt es polizeibekannte Auffälligkeiten, Hinweise und so weiter.
Zweitens: Externe Recherchen in Zeitungen und Online-Diensten. Vielleicht gab es Berichte über oder Interviews mit einem Hausbewohner und damit erste Anhaltspunkte über Meinungen, Befindlichkeiten, Vorlieben, Affären.
Drittens: Einzelgespräche mit allen Bewohnern. Sie überlegte, was schlauer war: Sollten die Gespräche in den Wohnungen stattfinden oder im Polizeipräsidium? Für das Polizeipräsidium sprach: Hier lügt es sich schwerer, weil der Ort einschüchtert. Dagegen sprach: In einer Wohnung nähme sie mehr Details auf.
Sie entschied sich für die Wohnungen, zumal dieser Ort enormes Steigerungspotenzial besaß. Das Polizeipräsidium mit offizieller Ladung käme dramaturgisch an die Reihe, wenn aus einer Befragung eine Vernehmung würde.
Cosima schaute neugierig auf die Namen, als wären sie Schmuckstücke. Schick, teuer, außergewöhnlich.
Dr. Max Moritz, Zahnarzt, alleinlebend, 49 Jahre.
Hans Meiser, ehemaliger Topmanager, jetzt Pensionär, 73 Jahre, mit seiner Frau Klara, 55 Jahre, die sich einen Namen als Charity-Lady gemacht hat.
Der Diskobesitzer Hans Langbein, 62 Jahre, und seine Freundin Agnes Fiedler, 34 Jahre, die momentan nicht arbeitet.
Jürgen Wolters, Rechtsanwalt, 48 Jahre, und seine Frau Emma Seewald-Wolters, 51 Jahre, ebenfalls Rechtsanwältin.
Prof. Dr. Heinrich Zirschke, Theaterwissenschaftler, 60 Jahre, und seine Frau Annette Hahn-Zirschke, 48 Jahre, Inhaberin eines Yoga-Studios.
Simone Capella, Filmregisseurin, 55 Jahre, alleinlebend.
Ulli Holdt, Fußballmanager, 44 Jahre, und seine Frau Dr. Agnes Pauli, 44 Jahre, Urologin.
Noch hatte sie mit niemandem gesprochen, aber ihre Fantasie formte bereits ein konkretes Menschenbild. In dem Haus lebten narzisstische Menschen mit viel Geld, die nicht kapierten, wie das wahre Leben funktioniert. Natürlich wusste sie, dass es Vorurteile waren. Sie hatte in diesem Moment aber keine Lust, ihre Gedanken zu differenzieren. In ihrem Haus lebten Handwerker, Lehrer (auch ihr Freund war Lehrer), eine Richterin für Arbeitsrecht und irgendein Therapeut, keiner wusste so genau wofür, jedenfalls roch es aus seiner Wohnung häufig nach indisch Curry scharf und Meditationsräucherstäben mit holzigem Duft und leicht süßlicher Note. Er war der Haus-Guru, ansonsten waren die Nachbarn recht normale Menschen; normal hatte aus ihrer Sicht ohnehin den unschätzbaren Vorteil, »dass bei uns niemand ermordet wird.« Mitunter liebte sie simple Befunde, auch wenn sie ahnte, dass sie in Wirklichkeit nur Wünsche und Mutmaßungen enthielten. Ansonsten vertraute sie ihrem »gesunden Menschenverstand« in alltäglichen Lebensfragen. Würde es kniffliger, wäre das auch kein Problem. Sie konnte schwierige Zusammenhänge schnell erfassen. Das lag sicherlich daran, dass sie schon als Kind Schach spielte und in Mathematik immer Klassenbeste war. Klar, dass nach ihrem Abitur alle gutgemeinten Ratschläge darauf hinausliefen, sie sollte doch bitte unbedingt Mathematik studieren. Sollte – doch – bitte, diesen Dreiklang aus Verzweiflung, dass sie ihr Talent wegwirft, hat sie nicht mit Trotz ignoriert, sondern mit einem eigenen Berufswunsch konterkariert. Sie ließ sich vom Werdegang einer Bekannten inspirieren, die Polizistin geworden ist.
Sie suchte Dr. Max Moritz auf. Er hatte den Ruf eines Prominenten-Zahnarztes. Viele reiche Russen ließen sich zu ihm einfliegen. Im Service inbegriffen: Shuttle-Service in einer schwarzen Limousine, Unterbringung im Fünf-Sterne-Hotel und natürlich ein Dolmetscher.
Er wohnte in der ersten Etage. Der Flur hatte weiße Wände, schwarze Fliesen und Lampen im Art déco-Stil. Vor seiner Wohnung stand eine hellgrüne Bonsaizucht in einem Terrakottagefäß, so schüchtern wie ein Balletttänzer vor seinem ersten Boxtraining.
Cosima dachte über den Namen ihres Gesprächspartners nach. Wie konnten die Eltern ihr Kind nur Max – bei dem Nachnahmen Moritz – nennen? Wie konnte aus Liebe ein Witz werden? Dachten sie etwa an die Geschichten von Wilhelm Busch über Max und Moritz? Eine Freundin von Cosima wollte ihre Tochter Amelie nennen. Den Namen fand auch sie so richtig süß, aber ein Bekannter, ein Pathologe meinte, dass in der Medizin »Amelie« bedeute, dass Arme und Beine fehlen. Damit war es um diesen Namen geschehen.
In der Wohnung von Dr. Moritz fielen ihr sofort die Vasen, Kissen und Kerzenständer in unterschiedlichen Größen und Materialien auf. Er verfolgte einen erkennbaren Stil, eben kein geschmackliches Durcheinander. Die Bilder hingen so, dass sie sich nicht gegenseitig die Schau stahlen. Er hatte Sinn für eine klare Struktur und inszenierte die Wohnung ohne jede Überanstrengung für das Auge. Das Ambiente hatte etwas Selbstverständliches, weil der Bewohner sich in dieser Wohnung nicht verlor. Was Cosima sah und verinnerlichte, war nicht ihr Geschmack, aber sie mochte es doch irgendwie. Sie hatte keine Chance, diesen Widerspruch aufzulösen. Vielleicht ging sie innerlich auch nur deshalb auf Distanz, um ihre Ikea-Möbel schönzureden.
Sie begrüßte ihren Gesprächspartner mit einem kräftigen Händedruck.
»Schön, Herr Moritz, dass Sie Zeit für mich haben«, sagte sie brav. Denn dass er sich Zeit nehmen musste, war tatsächlich ein Muss.
»Der Doktor gehört eigentlich zu meinem Namen«, entgegnete er mit einem schmalen Lächeln.
Sie ließ sich nichts anmerken.
»Herr Dr. Moritz, Sie wissen, warum ich bei Ihnen bin. Es geht um den Tod von Frau Walldorf. Es ist sehr wichtig, dass Sie alles sagen, was Sie wissen. Wenn Ihnen später etwas einfällt, rufen Sie mich einfach an, okay?«
»Ja, ja, klar«, nuschelte er hektisch. Er wirkte dabei abwesend. Bilder und Worte flogen durch seinen Kopf wie vernarrte Vögel. Nachbarin / Tod / noch so jung / so schön / wie schrecklich / hoffentlich passiert mir so etwas nicht / hoffentlich ist die Tante von der Polente bald wieder weg.
Er berührte mit seinen Mittelfingern die linke und rechte Stirn, massierte sie und ging so durch den Raum. Cosima dachte wieder an Wilhelm Busch, und Dr. Moritz regte sich noch immer nicht, als müsste er sein Leben durchdenken oder einen einzigartigen Gedanken aufspüren. Dann kam doch der Moment. Er sagte fast entschuldigend: »Frau Walldorf sah ich kaum. Der Rhythmus unseres Lebens oder unserer Arbeitszeiten war total unterschiedlich. Aber glauben Sie mir, ich hätte mich gerne um Ihre Zähne gekümmert. Sie hätte zu meinem Profil als international angesehener Zahnarzt gepasst. Aber ich glaube, sie war bei einem Kollegen in Monte Carlo. Da wohnte sie zeitweise, oder wo auch immer.«
Er schaute die Kommissarin an, oder besser gesagt, er taxierte sie von unten nach oben und von oben nach unten. Es schien, als suchte er nach Andockmöglichkeiten, um das Gespräch aufzulockern. Die Chance, die ihr roter Pulli mit V-Ausschnitt ihm bot, ließ er liegen. Wahrscheinlich fiel ihm nichts zu Rot ein. Keine roten Tulpen. Keine roten Lippen. Kein roter Wein. Wahrscheinlich wusste er auch nicht, dass die Menschen meistens dann Rot einsetzen, wenn sie sich geschwächt fühlen und ihren Energiehaushalt füllen wollen. Wahrscheinlich war also die Polizistin seelisch nicht ganz auf der Höhe, aber er konnte diese Schwäche nicht ausnutzen.
Cosima fragte ihn, ob er einmal in der Wohnung von Frau Walldorf gewesen war.
»Nein«, antwortete er sehr bestimmt.
»Nie?«, fragte sie zurück.
»Niemals!«
»Dann berichten Sie doch einmal von Ihren wenigen Begegnungen mit Frau Walldorf.«
»Ja, gerne. Ich weiß aber nicht, was Sie unter Begegnung verstehen?«, fragte er umständlich zurück, um dann doch weiterzureden. »Was ist eine Begegnung? Ein Gespräch? Ein längeres Gespräch? Also, ich hatte mit ihr nur einige zufällige Hallo-Begegnungen. Ich schätze, dass eine Begegnung maximal zwei Sekunden gedauert hat.«
»Für ein Hallo brauchen Sie zwei Sekunden? Das geht doch schneller!«
»Ich sagte ja auch: maximal zwei Sekunden.«
Cosima merkte, dass ihr die Befragung aus dem Ruder laufen könnte. Er war zu indirekt, zu versteckt, zu defensiv. Das mochte durchaus daran liegen, dass er sie nicht ernst nahm. Er strich sich mehrmals mit der Hand durch seine langen Haare. Vielleicht war er auch nur deshalb nicht gut drauf, weil er sein Haargummi für den Pferdeschwanz nicht finden konnte. Denn er schaute häufig in den Spiegel. Einige Mal ging er nah heran, als wollte er einen Mitesser auf der Nase ausdrücken.
Sie überlegte, woran Dr. Moritz sie erinnerte. Sie fühlte, dass sie es gleich wüsste. Als er seine Haare zusammenband und sein langer Hals somit in den Mittelpunkt seiner Physiognomie rückte, zumal er ein T-Shirt trug und kein Hemd, schoss ihr durch den Kopf: Er sah aus wie eine Giraffe, was natürlich Blödsinn war. Aber sie bekam den Zwang, ihn für eine Giraffe zu halten, nicht mehr aus dem Kopf. Sie empfand das als amüsant.
Sie konzentrierte sich.
»Was wissen Sie über Frau Walldorf oder anders gefragt: Was redet man über sie?«
Die Giraffe saß aufrecht auf der vordersten Kante des Stuhls, schlug das linke Bein über das rechte Bein und entfernte Flusen von der kanarienfarbigen Leinenhose.
Cosima kam sich bei diesem Gehabe fast wie ein Kerl vor. Sie saß bequem und angelehnt. Sie weigerte sich, es auf einen Wettbewerb für elegante Sitzhaltung ankommen zu lassen. Denn den würde sie haushoch verlieren. Sie schaute auf die Vitrine mit Porzellanhunden, Porzellankatzen und einem Porzellanaffen.