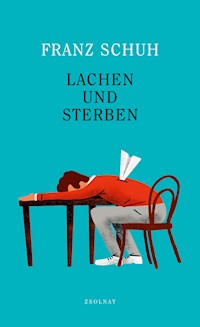Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Franz Schuh – der „titanisch gebildete Denker“ (Eva Menasse, „Die Zeit“) – widmet sein neues Buch dem Jahr 2022 und schreibt ein Panorama der menschlichen Tragikomödie. "Dieses Buch ist von der ersten bis zur letzten Seite dem Jahr 2022 gewidmet, dem 'annus horribilis' im Lebenslauf vieler Menschen, auch in meinem." Nach elf Monaten in verschiedenen Krankenhäusern ist Franz Schuh, dieser Solitär der österreichischen Literatur, wieder aufgetaucht. Seine Erzählungen, Essays, Gedichte analysieren die herrschenden Lebensformen und fügen sich mit unterhaltsamem, manchmal melancholischem Witz zu einem Panorama der menschlichen Tragikomödie. Ob er von Erlebnissen in der Eisenbahn berichtet, von seiner Kindheit in der Wiener Vorstadt oder sich mit Anna Netrebkos Widersprüchen auseinandersetzt, Schuh hat einen ausgeprägten Sinn für das Komische im Tragischen. Das Lachen auf gescheite Weise ist sein Metier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Franz Schuh — der »titanisch gebildete Denker« (Eva Menasse, »Die Zeit«) — widmet sein neues Buch dem Jahr 2022 und schreibt ein Panorama der menschlichen Tragikomödie.»Dieses Buch ist von der ersten bis zur letzten Seite dem Jahr 2022 gewidmet, dem 'annus horribilis' im Lebenslauf vieler Menschen, auch in meinem.«Nach elf Monaten in verschiedenen Krankenhäusern ist Franz Schuh, dieser Solitär der österreichischen Literatur, wieder aufgetaucht. Seine Erzählungen, Essays, Gedichte analysieren die herrschenden Lebensformen und fügen sich mit unterhaltsamem, manchmal melancholischem Witz zu einem Panorama der menschlichen Tragikomödie. Ob er von Erlebnissen in der Eisenbahn berichtet, von seiner Kindheit in der Wiener Vorstadt oder sich mit Anna Netrebkos Widersprüchen auseinandersetzt, Schuh hat einen ausgeprägten Sinn für das Komische im Tragischen. Das Lachen auf gescheite Weise ist sein Metier.
Franz Schuh
Ein Mann ohne Beschwerden
Über Ästhetik, Politik und Heilkunde
Paul Zsolnay Verlag
Die »Beschwerde« sieht wohl jeder, dass sie die Schwierigkeit des Werdens darstellen soll.
Plato, Kratylos (419c)
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Franz Schuh
Impressum
Inhalt
Der alte Mann heute
Glück mit Pascal
Keine Klinik unter Palmen — Eine Krankengeschichte
Der individuelle Überrest
Wen Juckt das noch?
Kaiser-Franz-Josef-Spital
Nichts Neues vom Krieg
Liebesgrüße aus Moskau — Über die selbstbestimmte Macht
Kein Frühling für Hitler — Über Krieg und Frieden
Trotzdem
Radikale Erinnerungen an den Kompromiss
Military Look 68
Monks Beitrag zur notwendigen Abrüstung
Lob der Dialektik
Meine Universitäten
Postskriptum Kunstuniversitäten
Kunst und Theologie
Niederlechners Festspielkolumne
Postskriptum Salzburger Festspiele
Die Kultur ist keine Kunst, aber vielleicht ist es die Kulturpolitik?
Erste Klasse
Cathrin aus Gmunden
Ich bin ich, aber wirklich!
Erklär mir nichts!
Apfelmus
Alles Walzer
Seid lieb! — Anstelle eines Nachworts
Konkrete Poesie
Der alte Mann heute
Es ist ein Wintertag,
aber nicht kalt.
»Es ist unkalt«,
sagt der alte Mann heute
(so wie man speziell Tote
Untote nennt.) Untote
sind tot, aber sie haben
das Leben
nicht aufgegeben,
ohne weiterzuleben.
Leben, leben, leben.
Das Leben steht dem Alten
zur Seite, heute.
Die Zeitung vor der Tür,
Der Standard,
ist mir zu links,
hat die Frau damals gesagt.
Die Neuigkeiten liegen jetzt da
auf dem Fußabstreifer.
Der Alte
liest keine Zeitung mehr,
lesen, lesen, lesen.
Er kündigt das Abonnement nicht.
Niemals. Der Erinnerung wegen,
und aus Respekt davor,
dass so eine Zeitung einmal
einen Sinn hatte. Sein Augenlicht
ist nicht verlöscht. Aber es macht
keine Zeilen mehr sichtbar,
erhellt sie nicht mehr.
Das Tagebuch,
ungeschrieben in den letzten Jahren,
die Jahreszeiten aber penibel genannt:
Frühling, Sommer, Herbst und Winter,
sonst aber nichts,
als Vorgriff auf die Zukunft.
Die Frau, sagt er, war mir gestorben.
Vor Jahren, weiß Gott
vor wie vielen. Sie hat mich verlassen,
im Stich gelassen, denkt er. Seinen Wahlspruch
hat sie in ein Tuch gestickt,
das ihm als Wandbehang
mit Friedrich Nietzsche täglich sagt:
»Besser noch närrisch sein vor Glücke
als närrisch vor Unglücke,
besser plump tanzen
als lang gehen.« Heute
ringt der Alte nach Luft,
im Stiegenaufgang
der kurze Atem,
die Schweißausbrüche.
Seine letzten Jahre,
das Wasser in der Lunge,
das Wasser in den Beinen,
ob Sommer oder Winter,
ob Frühling oder Herbst,
das Heim, sein Zuhause,
die Wohnung
war noch erreichbar,
aber heute
Glück mit Pascal
Blaise Pascal lebte von 1623 bis 1662. »Er war«, sagt das Lexikon, »ein französischer Mathematiker, Physiker, Literat und christlicher Philosoph.« Die Schrift Pascals, die ihn als all das auf einmal zeigt, heißt »Pensées«, zu Deutsch »Gedanken«, und es kann gar nicht anders sein, als dass einem in Gedanken die Frage nach dem Glück vielseitig vorkommt.
Pascal ist, was das Glück betrifft, ein Skeptiker. Das rührt auch daher, dass er, ein christlicher Philosoph, das einzig dauerhafte Glück auf Erden in Gott verankern muss. Dementsprechend lautet der Gedanke Nr. 407: »Die einen sagen: ›Haltet Einkehr in euch selbst, dort werdet ihr eure Ruhe finden. Und das‹, sagt Pascal, »ist nicht wahr.«
»Die anderen«, führt er weiter aus, »sagen: Geht nach außen und sucht das Glück in einer Zerstreuung. Und das ist nicht wahr: Die Krankheiten kommen.« Und daraus zieht der christliche Philosoph den Schluss: »Das Glück ist weder außerhalb von uns noch in uns; es ist in Gott und sowohl außerhalb von uns als auch in uns.«
Man muss kein gläubiger Mensch sein, um das Problem zu erkennen: Das Glück lässt sich nicht, wie die Glückslehren es suggerieren, in uns selbst festhalten. Aber außer uns haben wir auch keins. Beides, einerseits das Glück der Einkehr und andererseits das Glück der Zerstreuung — beides ist zu einseitig. Vom Glück kann man durchaus etwas in sich haben, man muss in sich gehen — und da ist es.
Aber auch nach außen gewandt, und sei es in der Zerstreuung, lässt sich das Glück nicht lumpen. Was gilt also, wenn beides gilt? Für den christlichen Philosophen hat Gott das letzte Wort. — Es ist die Transzendenz, eine Jenseitigkeit, in der sich die Einseitigkeit der widersprüchlichen Glückskonzeptionen dauerhaft aufheben lässt.
Wer an Gott nicht glaubt, bleibt am Widerspruch hängen: Die Einkehr hält nicht, was sie verspricht, und die Zerstreuung erst recht nicht. Aber andererseits haben beide etwas für sich. Sowohl in der Zerstreuung mag man den glücklichen Augenblick finden als auch in der Meditation. Und der moderne Mensch, den Pascal noch gar nicht gekannt hat, schwankt nervös zwischen beiden: zwischen Selbstbesinnung und Selbstvergessenheit, zwischen Einkehr und Zerstreuung, zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit.
Das spielen die Menschen einander auch vor, zum Beispiel in dem Frömmigkeitstheater auf dem Domplatz in Salzburg, wo der Tod den Jedermann endlich von seinen Zerstreuungen erlöst. Das ist christlich: die Abwertung von Vergnügungen. Diese Abwertung ist ein Irrtum, ein Missverständnis der conditio humana, der Festlegungen, in der der Mensch sich dreht und wendet, und weder so noch so Erlösung findet. Eine Seite der Existenz, die man durch Abwertung der anderen gefunden glaubt, bietet im Fall der abgewerteten Zerstreuungen einen großen Vorteil: Diese Abwertung lädt ein zur Heuchelei, der man huldigen muss, will man das schlechte Gewissen spektakulär, aber gesichert folgenlos beruhigen. Dabei ist der »Jedermann« in Salzburg gar nicht er selbst, kein beliebiger Irgendwer, sondern er ist ein reicher Mann, was dramaturgisch einleuchtet, denn nur der Reiche genießt so viele Zerstreuungen, dass es sich auszahlt, sie ihm zum Schein vorzuwerfen. In Salzburg hat man doch so gerne die reichen Leute im Publikum, und auf der Bühne wird darauf gezeigt, dass die Reichen doch auch nur Menschen sind. Der Kritiker Alfred Polgar meinte, er hätte bei einer Aufführung des »Jedermann« geradezu die Schritte hören können, mit denen einer der kapitalistischen Jedermänner »in sich ging«.
Ich gehöre zu denen, die den »Jedermann« gerne als Komödie der Heuchelei sehen, als eine Art Moralkabarett. Die angeblich tragischen Momente erreichen mich leider nicht. In unserer Kultur ist die Erlösung des Reichen nicht gerade das Anliegen großer Teile der Gesellschaft. Die Reichen empfinden die ausgepowerte Mehrheit sowieso als erlöst. Ich hänge halt altmodisch an der Bibel: »Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.« Die Kirche hat viel dafür getan, dass man das nicht ganz so wörtlich nehmen muss, und die Reichen, die es zu den Salzburger Festspielen geschafft haben, sind auch alle gut durch das Nadelöhr gekommen.
Für allzu zielgruppenorientiert und für theologisch bedenklich halte ich es, wenn dem Teufel vom Glauben mitgeteilt wird: »Auf deiner Seiten steht nit viel, / Hast schon verloren in dem Spiel, / Gott hat geworfen in die Schal / Sein Opfertod und Marterqual / Und Jedermanns Schuldigkeit / Vorausbezahlt in Ewigkeit.« Das, um Himmels willen, ist keine fromme Hoffnung, sondern ein Blankoscheck für die Erlösung von allen Sünden. Der Scheck wird am Domplatz ausgestellt, und er bezeugt auch, dass im Christentum Luther unvermeidlich war.
Den Tod hat man allzeit zu gewärtigen, damit man nicht über die Stränge schlägt. Das wusste Pascal schon vor Hofmannsthal. »Da die Menschen«, sagt Pascal, »kein Heilmittel entdecken konnten gegen den Tod, das Elend, die Unwissenheit, so sind sie darauf verfallen, um sich glücklich zu machen, nicht daran zu denken. Das ist alles, was sie erfinden konnten, um sich über so viel Übel zu trösten.«
Pascals Kampf gegen die Vergnügungen argumentiert zweischneidig, einerseits domplatzmäßig: Das Vergnügen, sagt er, welches der Mensch als sein größtes Gut ansieht, ist sein größtes Übel , weil es mehr als alles andre ihn davon abhält, das wahre Heilmittel für sein Übel zu suchen. Aber andererseits ist es auch ein Beweis für die Größe des Menschen, »denn nur deshalb fühlt der Mensch sich bei allem unbehaglich und sucht diese Menge von Beschäftigungen, weil er die Vorstellung des Glücks hat, das er verloren«.
Das ist die Herleitung der Glückssuche aus einem Verlust. Das Glück auf Erden besteht in der Sehnsucht nach einem gewesenen Zustand, nach einer Heimat, in der die Menschen ganz waren, also nicht geteilt in Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Deshalb, weil man einmal glücklich war, im Schoß Gottes, im Paradies, will man nimmer aufhören, glücklich zu sein. Das Glück ist eine Erinnerung, ein ewiges Es-war-einmal.
Die menschliche Existenz steckt in einer Falle. Menschen können sich ihre Aussichtslosigkeit noch so klarmachen, sie werden nicht aufhören, die Vergeblichkeit ihrer Existenz aufheben zu wollen: »Wir sehnen uns nach der Wahrheit und finden in uns nur Ungewissheit. Wir streben nach dem Glück und finden nur Elend und Tod. Wir sind unfähig, uns nicht nach Wahrheit und Glück zu sehnen, und wir sind der Gewissheit wie des Glücks unfähig. Dieses Verlangen ist uns erhalten geblieben, um uns zu bestrafen, und auch, um uns empfinden zu lassen, von welchem Ort wir herabgesunken sind.«
Die Herleitung der Glückssuche aus einem Verlust (also aus der Vergangenheit und nicht aus der Zukunft) bleibt lebendig, ja quälend, aber vielleicht doch auch motivierend: Deshalb, weil man einmal glücklich war, und sei es im Paradies, will man nimmer aufhören, glücklich zu sein. Man hält dem Glück die Treue —im Glauben, dass man es einmal hatte. Man könnte es ja sein lassen und leugnen oder darauf verzichten, Glückskinder zu sein. Dafür muss man Pascals Schluss auf Gott nicht teilen.
Der Gedanke vom wahren Glück als einer Erinnerung und vom Rest des Lebens als einer Verfallsgeschichte geht auch gottlos. Im zwanzigsten Jahrhundert hat Ernst Bloch sein Werk »Das Prinzip Hoffnung« mit einer berühmten, oft zitierten Wendung beendet, in der die Sehnsucht nach einer Vergangenheit mit einer zukünftigen Erfüllung kombiniert ist. »Die Wurzel der Geschichte«, heißt es bei Bloch, »ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.«
Bei Bloch nimmt das Problem des dauerhaften Glücks, das Pascal an Gott gebunden hat, eine humanistische Wendung. Der Mensch ist seines Glückes Schmied, aber das Glück ist auch nicht da, aber es war da, wenn auch nur als Schein in der Kindheit.
Keine Klinik unter Palmen
Eine Krankengeschichte
Ich habe eine gute Nachricht aus dem Internetlexikon. Dort steht: »Seit 2020 verbringt Schuh krankheitsbedingt viel Zeit in Krankenhäusern als ›Pflegefall‹.« Das ist eine gute, eine sehr gute Nachricht, weil sie nicht stimmt. Ich bin nach elf Monaten, ich glaube im Mai 2021, fürs Erste aus der Patientenlaufbahn ausgestiegen. Zuerst war ich intensiv im Spital, dann — auf eine Rückoperation wartend — im Pflegeheim, um schließlich zwei Spitälern meine Aufwartung zu machen. Mir ist das natürlich unvergesslich, dieses auratische Moment, dieser Einschnitt in mein Leben, da die Rettung mich auf der Bahre trug und im Erdgeschoss um die Ecke brachte.
Ich hatte nicht vor, darüber jemals ein Wort zu verlieren und mich zum stolzen Pflegefall aufzuspielen, der seine Halbprominenz mit einer Krankengeschichte aufbessert. Dass es dann doch so gekommen ist, rührt daher, dass das Interesse an Schauergeschichten bei meinen Nächsten groß ist. Der Voyeurismus macht sie munter, und nichts ist wichtiger als eine aufgemunterte Umgebung. Es liegt selbstverständlich auch an meiner Redseligkeit, mit der ich seit alters her meine Einsamkeit übertöne.
Außerdem verdient der Sachverhalt meiner eventuell tödlichen Krankheit mein Schweigen — Schweigen wie ein Grab. Aber je mehr ich mich in diese Richtung schreibend bewege, desto deutlicher wird mir eine Rechtfertigung des Gegenteils: Es gibt überhaupt keine Stimme, es gibt nicht einen Diskurs, der souverän von Patientinnen und Patienten gesteuert wird. Gewiss, wir sind bettlägerig, für die Hilfe dankbar und zugleich von ihr abhängig. Viele von uns sind so krank, ja so kaputt, dass sie etwas anderes zu tun, nein, zu erleiden haben, als Öffentlichkeit herzustellen. Und wenn das doch passiert, dann in den liebenswürdigsten Äußerungen über die aufopfernden Leistungen des Personals.
Na gut, ich habe hervorragende Ärztinnen und Ärzte kennengelernt, und vor allem zur Mitternacht, als die Rettung mich ins Krankenhaus Rudolfstiftung brachte, und da war tatsächlich ein Arzt da, der so etwas konnte wie einen Nabelbruch operieren, durch den sich das ganze reale Innenleben eines Menschen nach unten hin auflöste. Dieser Chirurg spricht derzeit nicht mit mir; es könnte deshalb sein, weil er mein Buch »Lachen und Sterben« gelesen hat, mit dem ich dem Gesundheitssystem keine Ehre mache. Aber zum Lachen ist auch manches: Als ich aus der Intensivstation auf die normale Station verlegt wurde, hatte ich ein technisch hochstehendes Bett, mit vielen Bedienungselementen. Auf einem Knopf stand »Exit«. Dieser Knopf ist dafür da, dass man den schließlich Toten nicht umständlich aus dem Bett herausziehen muss, sondern es schleudert die Leiche nach vorne, und der einstige Mensch fällt in den Sack, mit dem man ihn dann wegschleppt.
Aber die Spitzenleistung der Realkomödie einer Todkrankheit brachte eine niedergelassene Ärztin zusammen. Ich telefonierte mit ihr, während eine Ohrenzeugin dem Telefonat zuhörte. Von Frau Doktor wollte ich eine Bestätigung, dass ich Monate in Spitälern lag, wenn auch nur ein Spital meine Anwesenheit krankenkassamäßig korrekt dokumentiert hatte. Frau Doktor, bitte, möge mir bestätigen, dass ich nicht zu Hause herumtollte, sondern auf höchstem Level litt. Sie bestätigte natürlich gar nix — die haben alle Todesangst, sich in die Stricke der Bürokratie zu verwickeln —, aber sie schenkte mir die Anekdote des letzten Drittels meines Lebens. Der krankenkassamäßig zu erfassende Sachverhalt, den ich am Telefon schilderte, war nämlich bürokratisch dermaßen verwickelt, dass die Ärztin bei der Anhörung vertraulich ins Ohr der Zuhörerin den ernst gemeinten medizinischen Befund flüsterte: »Jetzt halluziniert er.«
In der Krankheit erfährst du dich selbst als nicht funktionierend, eine interessante Erfahrung: Wie kommst du durch, ohne zu funktionieren? Und in unseren Breiten erfährst du in der Krankheit das sogenannte Gesundheitssystem. Dass das sogenannte Gesundheitssystem funktioniert, ist bei Krankheiten, wie ich sie hatte, essentiell. In Amerika hätte man mich schlicht auf die Müllkippe geworfen. Unser großartiges Gesundheitssystem hat jedoch eine unglaubliche Pannenanfälligkeit und besteht in vielen Fällen aus wechselseitigen Missverständnissen der Akteure. Die Routinen zum Beispiel: Einerseits sind Routinen notwendig, andererseits verschleiern und ermöglichen sie eine sagenhafte Empathielosigkeit. Die dicke Schwester Doris blaffte mich an: »Wenn Ihna was net passt, lass i Sie liegen, wia Sie san!«
Schön war auch die Begegnung mit einem dieser Jungärzte, die einem das altmodisch-konservative, ja das reaktionäre Wort »Rotzbub« nahelegen. Da stand so einer vor meinen Bett und kreischte, mich zurechtweisend: »Hern S’ amol, des do is a Akutgeriatrie. Des is nur füa de Oidn und für’n Lebensabschluss. Se g’hern da gar net her, und waon S’ net in ana Woch’n a klore Verbesserung zeigen, dann schmeiß i Se holt raus, beziehungsweise muaß Se heimschicken. Ham S’ daham a Stiagn auffe in de Wohnung?« — »Gewiss«, sagte ich (erwidern kann man bei meiner leise gewordenen Stimme nicht sagen), »gewiss, Herr Obermedizinalrat. Sie müssen verzeihen, es war nämlich so: Ich saß im kühlen Sommerwind auf einer Bank im Stadtpark, wohin mich die freundliche Rettung transportierte, im Ambulanzwagen, und ich studierte mit Genuss die Prospekte des Wiener Gesundheitsverbands. Nach langer Bedachtnahme, sehr geehrter Herr Medizinalrat, entschied ich mich für Ihr Etablissement mitten im Herzen von Wien, und auch weil in meinem Alter mein Bleiben in der Akutgeriatrie eventuell nicht sonderlich lang dauern wird.« — »Jo«, sagte der Obermedizinalrat, »des waß i scho, dass Sie Ihnen des net söba ausg’suacht ham. Oba i ma a net.«
Dem Sinn nach stimmt die Geschichte ganz. Dramaturgisch habe ich sie ein wenig eingerichtet. Ich sage ja nichts, aber auf den Wegen und Abwegen einer schweren Krankheit trifft man ebenso den Anti-Typen zum oben gezeichneten Arzt, und zwar in zweierlei Gestalt: Man trifft auf den Könner und auf die Ärztin, die Könnerin, die nicht den Patienten, sondern ihren Job perfekt erledigen. Diese Ärzte sind schnell in ihrer Arbeit und doch höchst gewissenhaft, und dann gibt es den Gentleman-Arzt. Es kommt inmitten der Ärzteschaft auch die Lady vor. Das sind Könner, die ihren Beruf nicht nur pragmatisch ausüben, sondern die eine unsentimentale Nähe zum Patienten haben. Sie haben einen ausgeprägten Sinn für den Wert der Hilfe, die sie leisten, aber auch für die Not, die den Kranken peinigt. Ich warne alle frisch Eingelieferten: Nach meiner Erfahrung sind diese Ärzte, die den Betrieb vermenschlichen, eine Erscheinung, nämlich eine Ausnahmeerscheinung. Niemand kann damit rechnen, dass sie erscheinen. Falls doch, bedanken Sie sich bei der geistlichen Schwester oder schnell vor der Letzten Ölung noch beim Anstaltspriester.
Ein Spital ist vor allem für die Ärzte gut und kommt ihnen entgegen. Der Dienst ist hart, Tennis spielen ist besser — ein Plauscherl im Schwesternzimmer, ein Meinungsaustausch mit dem Primar, ein Semmerl aus der Kantine. Das Einzige, das nicht wenige Ärzte am Spital stört, sind die Patienten: Der Dienst ist eben hart, und diese Leute, privilegiert durch ihr Kranksein, liegen in der Komfortzone herum, gepflegt von hervorragend ausgebildeten Krankenschwestern. Es gibt einen Kabarettisten, der den harten Konkurrenzkampf in der Unterhaltungsbranche überstehen wird, und wenn nicht, macht’s auch nix — der Mann ist nämlich — hoffentlich im Nebenberuf — Arzt. Auf der Bühne liest er aus den »Ambulanzprotokollen« vor, die er aus der Hack’n mitgebracht hat, um endgültig zu beweisen, was für Idioten Patienten sind. Zum Beispiel vertraut so ein Idiot den Ärzten schriftlich an: »Habe vor drei Tagen einen Eiswürfel geschluckt und bis jetzt noch nicht herausbekommen.«
Möge das doch als Protokoll gefakt sein. Immerhin kriegt man eine Ahnung von einer christlichen Botschaft, dass nämlich angesichts des großen Gottes wir »geistlich Armen« selig sind, also genau wir, die auf einer Kabarettbühne vom Arzt als zu blöd ausgestellt werden. Jedoch haben wir sogar in der Ambulanz einen Gutschein für das Himmelreich. »Selig sind die, die da Leid tragen.« So einen Schein hat nicht einmal ein Kabarettist in Österreich!
Übrigens habe ich der Realität auch eine gute Kabarettnummer abgeschaut. Als Partnerin wünsche ich mir Monika Weinzettl. Sie spielt Schwester Babsi, ich Doktor Ronald Hatzenfeld. Wir stehen beide vor einer nigelnagelneuen Ultraschallmaschine. Doktor Hatzenfeld macht sich zu schaffen: »Wos is’n noch des? Ja, wer hot denn do? Oiso, do stimmt do ja wos net. I drah des jetzt no amoi an.« Schwester Babsi singt: »No amoi, no amoi.« — Hatzenfeld: »Jo, do muaß irgendwer … Do kummt jo ka Büd. Heast, des geht do gor net onders.« Schwester Babsi: »Jo, oba so geht’s a net.« Sie nimmt die Sache in die Hand — ein paar Handgriffe, und die Maschine surrt selbstzufrieden. Unzufrieden ist Hatzenfeld: »Wos hast ma des net glei g’sogt, Babsi!«
Ein Freund und Kritiker hat in den Oberösterreichischen Nachrichten die Frage gestellt, ob ich schon ganz deppert bin, weil ich den guten Gesundheitsminister Anschober für die Niete der Saison hielt. Gemein wie ich bin, nannte ich Anschober den »Burnout auf zwei Beinen« — und das war vor dem Abbruch seines segensreichen Wirkens im Ministerium. Ich hatte ja wegen meines monatelangen Spitalsaufenthalts die diesbezügliche Expertise als Spezialist für Zusammenbrüche, und Jobs, die mich physisch überfordern, habe ich auch niemals angenommen. Ich nenne eine spezifische Pathologie der Karriereplanung in unserer Spätzeit den »Anschoberismus«: Unter Anschoberismus leidet, wer gierig nach einem Job greift, für den ihm die physischen Voraussetzungen fehlen. Anschoberismus kommt häufig vor, weil er einen einzigartigen Ausweg bietet, nämlich, wenn’s brenzlig wird, die Flucht in die Krankheit.
Mir war Anschobers pfäffischer Ton zuwider, seine Verkündigungsrhetorik schlechter Nachrichten. Sie war herrlich komplementär zur Chuzpe von Bundeskanzler Kurz, der eines Tages persönlich der Pandemie ausrichten ließ, dass sie nicht mehr existiert. Aber das sind sinnlose Sympathiewerte, der gute Mann aus der Gesundheitsversorgung, Anschober, der Minister von einst, schreibt ja jetzt Bücher, in denen er angeblich sogar Fehler eingesteht. In der Hauptsache ist er aber angekommen, wo ein Politiker seiner Art einen angestammten Platz hat: in der Kronen Zeitung mit einer Kolumne, die im Buchstabenchaos — wie einst er selbst in der Politik — untergeht. Man könnte auch von Buchstabenhalde sprechen, denn eine Halde ist im Bergbau die künstliche Aufschüttung von Schlacke oder von tauben Gesteinsmassen.
Mein persönlich-politisches Problem war ein anderes: Ich saß fest im Pflegeheim Wien-Meidling, und dort ereignete sich ein Wunder: An einem Tag war kein Corona, sowas gab’s dort gar nicht, auch die ganzen Wochen davor — kein Corona, nichts, absolut nichts. Aber siehe da, auf einmal, von einem Tag zum andern, erschien eine Spezialtruppe der Helden des Alltags plötzlich mit Badehaube und Plastikschürzen. Schließlich schob man uns in unseren Betten aus den Zimmern, und der Desinfektionstrupp rumorte darin herum. Die Gesundheitspolitik hatte genug Zeit gelassen, damit das Virus erfolgreich so viele Menschen wie möglich anstecken konnte, worüber wir natürlich von den Helden des Alltags und schon gar nicht von der Heimleitung (»Heimleitung!«) informiert wurden.
Unser Schicksal sollte ihr Geheimnis bleiben. Die Heimleitung leuchtet uns sowieso auf allen Wegen heim. Hätte es nicht den Sozialarbeiter Herrn Karl Wolf gegeben, einen kundigen und unsentimental solidarischen Menschen, dann hätte man gleich die Mauer, gegen die wir stets anrannten, ins Grab runterlassen können. Oder besser aus der Mauer den Grabstein hämmern können. Ich weiß, viele meiner Kolleginnen und Kollegen waren dement, aber eben (noch) nicht alle und nicht alle ganz. Vom Bett aus kriegt man schön langsam mit, was los ist, es spricht sich leise herum, und ein paar Eingeweihte machen auch Andeutungen: Corona — ganze Krankenzimmer sind nach Liesing verschickt worden.
Am schlimmsten war das Besuchsverbot. Der gute Mensch Anschober hat natürlich keine Ahnung, was tun, wenn die Isolation Schwerkranker und physisch Immobiler in mentales Leiden umschlägt. Kein Gedanke daran, kein Einfall, wie man den Absolutismus des Virus relativieren kann. Im Gegenteil, man berief sich darauf: Da das Virus eben da ist, muss alles raus, was sonst noch da sein könnte. Sogar die Physiotherapeutinnen mussten viele Wochen draußen bleiben, wodurch ich das Privileg hatte, alles, was ich schon konnte, Wochen später von neuem lernen zu müssen.
Die Stationsärztin war eine freundliche Frau. Sie wurde aber in der Gegenwart der Stationsoberschwester sofort bösartig, weil sie zeigen musste, welche Frau im dritten Stock der Boss ist und das Sagen hat. Die Ärztin war mir immer schwer verständlich, sie sprach, ich glaube, Rumänisch mit deutschen Vokabeln und sagte auf mein Jammern über die Vereinsamung, über das Besuchsverbot der ganzen Welt für mein kleines Zimmer: »Ich hab’s Ihnen ja gesagt: Das ist Ihr Problem. Damit müssen Sie fertigwerden.« Die Schutzmaske verstärkte die Unklarheit ihrer Ausführungen, die nur in quälenden Details deutlich wurden. Die Stationsoberschwester war zufrieden.
Ich seh’s ja ein: Wegen dauernder Krisen ist man nicht Innenminister oder Gesundheitsminister geworden. Der Innenminister hat zum Quälen die Immigranten, ein Grünpolitiker hat sich der Humanität verschrieben, als deren erster Profiteur er in die Geschichte eingehen will. Man wollte nur Auszeichnungen verleihen und nachher ein Glas Sekt trinken. Aber auf einmal sitzt man mitten in einer Krise, die sich nicht managen lässt. Da bleibt einem nur der Sekt und das Warten darauf, bis einen die Krone engagiert. Der Grüne hat eben ein gutes Herz und setzt es ins Politische um, indem er am Sprungbrett bastelt, das den österreichischen Rechtsradikalismus auf die Regierungsbank schleudern wird.
Man muss unterscheiden zwischen der Medizin, einem Wissenssystem, und der ärztlichen Praxis. Die Medizin ist ein hochgradiges System, in dem in erster Linie die Wissenschaft ihre Chancen wahrnimmt und ihre Zwänge errichtet. Das System steht im Allgemeinen nicht für das Böse. Es gehört zu den polemischen Idiotien, das System als solches anzuprangern, um die eigenen Gesinnungsgenossen und sich selbst als Exponenten der individuellen Freiheit im Kampf gegen irgendein System hinzustellen. System ist ein Zusammenhang von ausdifferenzierten einzelnen Komponenten, die miteinander eine beabsichtigte Wirkung erzielen, es aber nicht immer können. Es gibt die Komplexität der Systeme, es gibt Über- und Unterkomplexität. Das kracht und ergibt oft kein freundliches Zusammenwirken.
Die einzige Möglichkeit, komplexe Probleme wie schwere Krankheiten halbwegs in den Griff zu bekommen, ist ein Gesundheitssystem. Ähnliches gilt für die Pathologie in der Politik. Auch Politik muss systematisch sein und darf nicht auf und ab und hin und her reagieren, sonst verliert sie selbst dort an Substanz, wo bereits gute Kräfte wirken. Wenn ich mich auch als Leidtragender dem Nichtfunktionieren des Systems widme, kann ich nicht leugnen, dass ich diese Hölle, diese Unterwelt ohne Orpheus überlebt habe. Da kam einmal eine Ärztin ins Vierbettzimmer sterblicher Männer, die nichts mehr zu tun hatten als die Produktion ihrer eigenen Überreste. Diese Ärztin war etwas Nochniedagewesenes, das heißt, sie hatte uns noch nie besucht. Mich fragte sie: »Na, wie geht’s denn?« Und ich antwortete schal, also ohne irgendeine besondere Betonung: »Den Umständen entsprechend!« Da krächzte sie los: »Das ist keine Antwort. Ich kenn ja Ihre Umstände nicht.«
Wer hat schon die Antwort, aber ihr hätte ein klein wenig Umschauen genügt, und die Umstände wären ihr sofort in den Sinn gekommen. Tja, das System — von ihm zu erwarten, dass es glatt funktioniert, wäre ein Blödsinn. Ich bin gegen die Idealisierung der Lösungsmöglichkeiten von lange schwelenden Problemen. Ich habe außerdem die Erfahrung gemacht, dass komplexe Dinge überhaupt nur über Pannen funktionieren. Der einst bedeutende Philologe und Kritiker Walter Jens hat gesagt: »Auf dem Weg zum Abgrund kann eine Panne lebensrettend sein.« Es wird nie eine Kultur geben, in der die Probleme glatt sind, in der man sie bloß anzugehen braucht, und dann hat man sie hinter sich. Deshalb haben wir auch eine Religion, weil im Jenseits sind die Widersprüche aufgelöst, und wir können mit den Engeln gemeinsam Gott anbeten, ohne dabei die geringste Panne befürchten zu müssen.
Manchmal aber retten auf Erden erst die Pannen die Kranken. Lasst uns auf die Pannen hoffen! Das war an meinem Schicksal seltsam: Ärzte haben mich gerettet, ich würde sie und ihren Stand ehren. Aber meine Rettung passierte erst, nachdem andere Ärzte mich hineingeritten hatten. Ich hatte — da war ich schon in Freiheit — einen Wahlarzt gewählt, und der hatte für 150 Euro das Wasser in meiner Lunge übersehen. Eine Krankenkassa-Ärztin (die ich von da an stets wähle) schickte mich sofort und ohne Gnade ins Spital. Aber das Schlimmste war wohl die muffige junge Frau, die, als Notärztin kostümiert, mich untersuchte. Der Nabelbruch wäre mit freiem Auge zu sehen gewesen, aber sie schenkte ihm keinen Blick. Mein Bauch war, als die Ärztin ihn abgriff, unsichtbar unter dem Pullover verstaut. So viel Unkenntnis grenzt an Gemeinheit, gilt doch in der Branche die für Analphabeten vorformulierte eiserne Regel: Keine Diagnose unter der Hose!
Diese Ärztin, eine mir unbekannte Frau, hat mich Monate meines Lebens gekostet. Aber das ist falsch oder nur halbrichtig gedacht. Diese Kosten sind ja das Leben, zu dem die Irrtümer und die Attacken gehören, die andere und die die Umstände an mir ausprobieren. Ärzte haben ein nicht einlösbares Image. Von ihnen soll die Lösung aller gesundheitlichen Probleme kommen, und dann wundert man sich über den Schaden, den auch Ärzte und Ärztinnen stiften. Sie haben zu viel Macht, zu viel echte und zu viel scheinbare Macht. Bevor es zum Jüngsten Gericht kommt, steht noch ein Arzt mit dem Befund da. Ja, ich weiß, ich kann es explizit, ausgesprochen machen: Es gibt den Verdacht, aber Beweise dafür, dass man meine Erfahrungen in der Spitalshölle verallgemeinern könnte, gibt es nicht. Dass mir alles so und nicht anders passiert ist, als eine Summe von Einzelfällen, genügt aber. Es reicht.
Gewiss, es gibt einen Teil der Ärzteschaft, die von ihrem Beruf ergriffen ist, es gibt viele Helfer aus Vernunft und Leidenschaft. Sie können nichts dafür, dass ich solche Menschen nur als Ausnahmeerscheinungen erlebt habe. Ihnen publizistisch in den Rücken zu fallen wäre eine Gemeinheit. Andererseits ist es verantwortungslos, sich um die These herumzudrücken, dass nicht sie der bestimmende Faktor im Gesundheitssystem sind — das sollte der angehende und der eingelieferte Patient genau wissen, um Vorsicht walten lassen zu können.
Ich bete zum Herrgott, dass es ganz andere Pflegeheime gibt als das, in dem ich geparkt wurde, um auf meine letzte Operation zu warten — solche mit Freilicht und Frischluft. Davon konnte man in dem Betonbunker, in dem ich steckte, einem umgebauten Umspannwerk, nur träumen. Aber auch hier wieder Ambivalenz: Hier überleben Menschen in Würde an der Grenze ihrer Entwürdigung, aber noch in Würde. Ein Schuft, der nicht dankbar ist!
Als ich ins Pflegeheim kam, empfing mich ein Gedicht aus der Jandlschule. Vis-à-vis von meiner kleinen Zelle erschallte über den Hof hinweg unaufhörlich der Ruf: »Oaschloch, Oaschloch, Oaschloch.« Ich dachte: Bin das ich? Und musste mir die Frage selbst beantworten: nein, eher nicht. Das Gedicht war der Versuch, auf aggressive Weise und rauschartig in der Lautmalerei unterzugehen. Da ging ich mit.
Aber im Pflegeheim hatte ich auch gepflegte Konversation: Frau Napalek saß gerne am Gang auf einem Sofa vor sich hin. Das war vis-à-vis von meiner Tür, und als ich einmal aus derselben hinausgeschoben wurde, begrüßte sie mich mit einem freundlichen »Guten Tag, Herr Schuh!«. Da war ich sehr stolz: Man kennt mich also auch hier, ich bin berühmt, und fragte bescheiden: »Frau Napalek, wieso kennen Sie denn meinen Namen?« — »Na ja«, sagte sie, »der steht an Ihrer Tür.«
Ich kam mit den Schwestern im Pflegeheim nicht klar, wie der Deutsche sagt. Gegen mich unterschrieben sie sogar eine Petition. Während ich mit zwei Pflegern auf gutem Fuß stand (eine gute Wendung für einen Menschen, der nicht gehen kann), und während ich mit ihnen eine Hetz hatte, wurde ich von den Schwestern abgelehnt, wohl auch, weil mir die Heuchelei misslang, dass diese Ablehnung auf Gegenseitigkeit beruhte. Mir kamen sie ständig überfordert vor, und als Pflegerinnen waren sie im Medizinischen hilflos. Die meisten hatten Feldwebelattitüden und litten darunter, dass ich noch nicht dement genug war, um mich ihren Anordnungen nahtlos zu fügen. Obwohl sie keine Österreicherinnen waren, schwärmten sie intensiver als die Eingeborenen von der Pension. Mit der Petition allerdings hatten sie recht. Die Gründe dafür hatten nichts mit meinem Querulantentum zu tun, sondern mit meiner Überbeanspruchung ihrer Hilfe. Nicht nur das, was sie an mir — wegen ihrer fragwürdigen Ausbildung — nur schwer versorgen konnten, war das Problem. Ich verlangte auch Unterforderndes: Das wichtigste Gerät in der Immobilität ist die Fernsehfernbedienung. Der Laie glaubt es nicht, aber die Fernsehfernbedienung verschwindet wie nichts im Krankenbett. Der Kranke kann sie nicht selbst dingfest machen, er läutet nach den Schwestern — in der Tat ein Sakrileg.
Ja, und außerdem bin ich sogar im Liegen noch unfassbar schlampig, unzumutbar, wofür ich mich aufrichtig bei den Schwestern entschuldige, die mir ja auch schöne Momente bereitet haben. Schwester Elena zum Beispiel (Name von der Redaktion geändert) sprach, wenn sie im Hochsommer mein Zimmer betrat, einen herrlichen Monolog, den kein Horváth und kein Schnitzler geschrieben hat: »Pah, do is ja haß. I holt des nimma aus … de Operation. I muaß wida … des faungt jetzt wida au. I kaun mi net buck’n, da Rucken … Geh mochn S’ bitte de Balkontür auf … Ah, Sie kennan ja gor net. Sie arma Mau. Jetzt geh i amoi an Kaffe trinken, draußen beim Stützpunkt. Pah, do is haß, i bin glei wieda do.«
Die Medizin hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Viele Ärzte sind jedoch auf dem von Molière festgehaltenen Niveau zurückgeblieben. Als Patient mit elfmonatigem Lehrgang behaupte ich zu wissen, worin der Fortschritt der Medizin in erster Linie besteht. Er besteht in der relativen Kontrollierbarkeit der Schmerzen. Der Patient ist den Schmerzen nicht mehr absolut ausgeliefert. Aber nur sehr beschränkt kontrollierbar bleiben die kommunikativen Abgründe, die sich zwischen der Medizin als einer Wissenschaft und der Praxis auftun: Die Praxis findet von und mit realen Menschen statt. Ich bin jemand, der von bildungsbürgerlichen Usancen versklavt ist. So einen muss man aushalten. Eine Schwester im Pflegeheim brachte es nicht ohne Hass über die Lippen: »Was ham Sie denn so viele Bücher herumliegen? Zum Lesen genügt doch eins.«
Das Schlimmste am Tod ist, dass mit ihm auch die gesammelten Erfahrungen, die Gefühle und das Wissen eines Menschenlebens verschwinden. Ich konnte im Leben mit dem Tod nur kokettieren. Ich hatte nicht viel vom Tod gesehen, konnte mir aber vieles über ihn denken. Irgendwie besteht der Tod ja auch aus Goethe-Zitaten, aus Aphorismen des Trauerns. Jetzt verstehe ich mehr vom Tod. Vor allem, dass man ihn sich wünschen kann. In dem Zustand, in dem ich war, habe ich mir, nicht unpathetisch, gedacht: Ich habe das Meine geleistet. Ich wäre zufrieden gestorben. Das Meine war die Lesung von Konrad Bayers »kasperl am elekrischen stuhl« für den Österreichischen Rundfunk. Da wollte ich nach dem Tod meiner Freundin Elfriede Gerstl hin, mich in eine Tradition hineindrängen: Konrad, schau auffe!
Der Tod ist ein Grenzbegriff. Er findet im Leben statt und ist das Ende dieses Lebens. On the edge. Der Tod gehört nicht zum Leben und nicht nicht zum Leben. Er dirigiert beides. Eher gehört das Leben dem Tod. Das hängt von der Vitalität des Betroffenen ab.
Die erlebte Todesnähe bedeutet aber gar nichts, gar nichts für eine Zukunft, die man eventuell noch oder doch noch hat. Diesbezüglich lebt man weiter, als wäre nichts gewesen. Das Leben ist nämlich grundsätzlich etwas ganz anderes. Wie sollte man denn leben — »todgeweiht«? Als mein Vater gestorben ist, hat man mich im Spital gefragt, ob ich seine Leiche sehen möchte. Ich habe gesagt: Das möchte ich auf keinen Fall! Diese Leiche ist nicht mein Vater! Ich habe im Spital Leute sterben sehen, und ich erinnere mich besonders an den Tod eines Menschen, der sehr langsam ins Nichts hinübergeglitten ist. Um ihn herum saßen die Ärzte. Es war Nacht, und mit dem bisschen Krankenhauslicht über dem Sterbebett schien es wie ein Weihnachtsfest. Heilige Nacht! Der Sterbende hat seltsamerweise »Mama!« gerufen. Er war sehr, sehr alt, und da war bestimmt keine Mama mehr am Leben. Aber sie ist von Anfang an die einzig glaubwürdig und absolut Mitleidende im Leben gewesen.