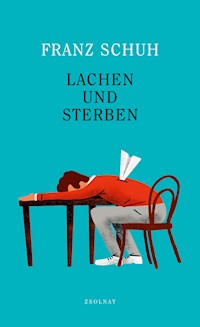Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Ich schreibe über das Glück“, schreibt Franz Schuh, „erstens weil ich Glück hatte, und zwar so viel, dass ich damit dem unvermeidlichen Unheil trotzen kann. Zweitens weil ich den Eindruck habe, dass das Glücksstreben alle Menschen gemeinsam haben, dass aber das Glück die Menschen auch voneinander trennt, weil nicht alle, wahrscheinlich nur die wenigsten Menschen halbwegs glücklich sind.“ Im Wort „Glück“ fließt vieles von dem ineinander, was man von der menschlichen Existenz wissen kann und vielleicht sogar wissen sollte. Von der Ablehnung des Wortes bis zu seiner spekulativen Ausbeutung und zur endgültigen Banalisierung reicht die Bandbreite dieser Betrachtungen zur Philosophie des Glücks.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
»Ich schreibe über das Glück«, schreibt Franz Schuh, »erstens weil ich Glück hatte, und zwar so viel, dass ich damit dem unvermeidlichen Unheil trotzen kann. Zweitens weil ich den Eindruck habe, dass das Glücksstreben alle Menschen gemeinsam haben, dass aber das Glück die Menschen auch voneinander trennt, weil nicht alle, wahrscheinlich nur die wenigsten Menschen halbwegs glücklich sind.«Franz Schuh geht es weniger darum, wie man glücklich wird, wer weiß das schon? Ihm geht es darum, dass im Wort »Glück« vieles von dem ineinanderfließt, was man von der menschlichen Existenz wissen kann und vielleicht sogar wissen sollte. Von der Ablehnung des Wortes »Glück« bis zu seiner spekulativen Ausbeutung und zur endgültigen Banalisierung reicht die Bandbreite von Schuhs »Glücksquellen«, zu denen auch das Lachen und so etwas Sensibles wie die Hoffnung zählen.
Zsolnay E-Book
Franz Schuh
Fortuna
Aus dem Magazin des Glücks
Paul Zsolnay Verlag
Inhalt
Liebkind
Save Our Souls
Ich schreibe über das Glück
Leidenskraft und Lebenswille
Schopenhauer am Inn
Mariahilfer Straße
Von Königen
Meiner Söö
Last, Lust, List
Zwei Schauspieler
Virtuosität
Philomele
Einer ist keiner
Routine
Schwarzmalen
Schadenfreude
»Ich glaube nicht, dass …«
Vergänglich
Nein
Der grüne Koffer
MMS – Multimedia Messaging Service
Ambivalenz
Eheberatung
Im Alter
Alles eitel!
Weißer Bademantel
Frisches Grün
Gut untergebracht
In einem anderen Dialekt
Gegen die Unangepasstheit
Passt!
Horváth
Nicht bezahlen!
Textilie
Im Spital
Schule der Weisheit
Von einem weisen Mann
Hoffnung
Die Kirche im Dorf
Attnang
Bei Sinnen
Stammersdorf
Ein Stromstoß von Glück
Die Welt des Glücklichen
Stillleben am Inn
Textnachweis
Liebkind
In meinem Körper
bin ich die Nummer 1.
Dieses biologische Bündel,
das ich bin
und aus dem ich auch
hervorschaue.
Aber schaut mir
die Mama ins Gesicht,
sieht sie den Papa,
und schaut mir
der Papa ins Gesicht,
sieht er die Mama.
Und alle beide sehen
die Nummer 1.
Save Our Souls
Im Zug nach Gmünd. Über ein paar Schaltern, die nahe beim Ausstieg angebracht waren, standen die Buchstaben zu lesen: SOS. Ein Dummdödl (nicht nachschlagen, das Wort habe ich erfunden) im besten Alter, so um die dreißig, enge Jeans, dicker Rucksack, durchtrainierte Muskeln, auf dem Kopf eine knallrote Baseballkappe, berührte unabsichtlich mit seinem Rucksack einen der Schalter. Sofort erklang ein Messton, hinter dem eine Stimme nicht gerade laut wurde. Die Stimme sagte: »Hallo.« Der Dummdödl erschrak und antwortete im Telegrammstil: »Bin angekommen am Schalter.« »Hallo«, sagte da die Stimme, und Dummdödl darauf: »Irrtümlich angekommen.« – »Hallo« – »Irrtümlich angekommen«, und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie immer noch »irrtümlich angekommen«.
Ich schreibe über das Glück
Ich schreibe über das Glück, erstens weil ich Glück hatte, und zwar so viel, dass ich damit bis jetzt dem unvermeidlichen Unheil trotzen konnte. Zweitens weil ich den Eindruck habe, dass das Glücksstreben alle Menschen gemeinsam haben, dass aber das Glück die Menschen auch voneinander trennt, weil nicht alle, wahrscheinlich nur die wenigsten Menschen halbwegs glücklich sind. Es zeigt sich, behaupte ich, wie im Wort »Glück« vieles von dem ineinanderfließt, was man von der menschlichen Existenz wissen kann und vielleicht sogar wissen sollte. Von der Ablehnung des Wortes »Glück« bis zu seiner spekulativen Ausbeutung und zur endgültigen Banalisierung reicht die Bandbreite, reicht das Bedeutungsgelände, das ich auf einigen Verzweigungen abschreiten werde.
Es ist erstaunlich, wie sehr man in einem Lebenslauf auf Glück (oder auf das, was »Glück« genannt wird) angewiesen ist. Ein Versuch, durchs Leben zu kommen, ist es daher, sich vor Glücks- und Unglücksfällen abzuschirmen. Der Versicherungsgedanke resultiert daraus, und es gibt sogar eine »Lebensversicherung«. Politiker benützen gerne die Redewendung, sie müssten (oder sie würden dieses oder jenes) »sicherstellen«. Man will das Glück, will sich aber aufs Glück nicht verlassen (müssen). Immerhin existiert eine gigantische Glücksindustrie, nicht nur für die Reichen und Schönen, auch die Armen werden massenmedial billig mit Glück (oder besser: mit Glücksersatz) versorgt. Die Lehre, die dahintersteckt, kann zynisch sein, dass es nämlich viele Menschen gibt, denen nur das Glück, das sie nicht haben werden, helfen könnte.
In diesem Buch, in »Fortuna – Aus dem Magazin des Glücks«, geht es weniger darum, wie man glücklich wird, wer weiß das schon? Es hat mich die Frage beschäftigt, warum denn Immanuel Kant bei der Glücksfrage so wenig seine definitorische Formulierungskraft einsetzt. Der kategorische Imperativ – »Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne« – ist ein Sprachkunstwerk, das unübertrefflich die unendlich vielen Fälle des Handelns in einer sprachlichen Form vereinigt. Das Glück lässt sich Kant entgehen, weil er in ihm in erster Linie die Kontingenz, das Zufällige sieht, fast nach dem Motto: Was soll’s – jeder ist mit etwas anderem glücklich, wie sollte da eine einheitliche Formulierung lauten?
Man muss Kant verstehen: Er hatte es mit der Vernunft so intensiv, wie es ein paar hundert Jahre später der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky mit der Vollbeschäftigung hatte. Mit jeder Faser von Herz und Verstand fürchtete sich Kreisky vor Arbeitslosigkeit und vor dem, was durch sie in einer Gesellschaft geschehen kann. Ich glaube, Kant hatte einen Horror vor dem, was unter Menschen passiert, deren Handeln nicht auf Vernunft gegründet ist. Wie handeln sie dann? Wie Tiere, vielleicht sogar lüstern, lasterhaft, dem Glück ausgeliefert? Oder gar bestialisch?
Die Ethik der Pflicht ermöglicht diesen gefährlichen Spielraum nicht. Pflicht ist Vernunft in der Moral, und die Vernunft ist die Quelle der Autonomie, der menschlichen Freiheit, die sich bei allem notgedrungen Sinnlichen nicht einstellt. Nichts gegen das Sinnliche, aber eine Philosophie machen wir daraus nach Kant nicht. Kant musste »sicherstellen«, dass die Natur den Geist nicht übertrumpft. Lieber streng und preußisch, auf keinen Fall ein Genussmensch sein, dessen Horizont von Wohlfühlen oder Nicht-Wohlfühlen bestimmt ist.
Das kann man verstehen, aber man kann auch behaupten, dass so ein nicht von der Hand zu weisendes Konzept, auch weil es von mir einseitig, geradezu dogmatisch dargestellt ist, einem die Lebensfreude verderben kann. So ein Konzept, falls es einseitig hingenommen wird, kann wie eine paradoxe Intervention wirken: Jetzt erst recht will man nichts von Pflicht wissen und strebt nach dem Glück, egal was es (die anderen) kostet. Die forcierte Pflichtethik kann ihr Gegenteil bewirken: Nieder mit dieser die Lebensquellen austrocknenden Vernunft, es lebe das sinnliche Vergnügen.
In der Literatur, bei Thomas Mann, gibt es eine Stelle, in der der Übergang vom Glück zur Pflicht einprägsam dargestellt ist. Es geht um das »Wulicke-Syndrom«. Ich glaube, dass im Werk und in der Person von Thomas Mann die Frage, wie man sein Leben führen soll, beispielhaft zum Thema wird. Thomas Mann stellte sowohl durch die eigene Biographie als auch durch das Leben seiner Figuren vor Augen, dass es ein wie immer auch gefährdetes Modell gibt, das eine vernünftige Lebensführung ermöglicht: Es ist das Modell der Bürgerlichkeit.
Der bürgerliche Mensch in seinem an der Pflicht ausgerichteten Denken und Handeln ist heute im Wesentlichen eine Erinnerung. So etwas gibt es noch in Ansätzen, im Ganzen ist der selbstbewusste und pflichtbewusste Bürger von gestern. Der Bürger, der durch Arbeit und Fleiß zu Besitz und Wohlstand gekommen ist, bleibt ein zitierbares Ideal, aber in unserer Welt von Managern und zur Macht gekommenen Kleinbürgern ist er eine verblasste soziale Realität.
Auch Thomas Mann hat das Bürgertum nicht verherrlicht, sondern es in seiner Widersprüchlichkeit und Anfälligkeit, also in seiner Auflösung gezeigt. In den Jahren 1896 bis 1900 schrieb der Dichter – als noch sehr junger Mann – den Roman »Buddenbrooks«, der den Untertitel »Verfall einer Familie« trägt. In dem Verfall verlieren die Buddenbrooks alles, auch ihre Gesundheit. Es ist erstaunlich, wie stark das Zusammenspiel von Krankwerden, von körperlichem Verfall, von seelischer Überempfindlichkeit und von gesellschaftlichem Abstieg bei den Buddenbrooks ausgeprägt ist. Das ist für mein Verständnis sozialdarwinistisch (und gar nicht humanistisch) gedacht, woraus man vielleicht herauslesen kann, dass ein Zeitgeist stärker sein kann als eine noch so redliche Absicht.
Hanno Buddenbrook jedenfalls, der Sohn des Thomas Buddenbrook, ist ein übersensibler Gymnasiast. Sein Vater war der Letzte in der Kaufmannsfamilie, der versuchte, alles in der Familie und im Geschäft auf die bürgerliche Weise, korrekt und pflichtbewusst, kalkulierend und zugleich herzlich zusammenzuhalten. Auch die Geschäftsführung unterliegt der Dekadenz. Er ist daran gescheitert, und im jungen Leben seines Sohnes Hanno zeichnete sich zusätzlich der Zeitenwandel ab, und zwar durch besagtes »Wulicke-Syndrom«.
Das Gymnasium, das Hanno Buddenbrook besuchte, erfuhr nämlich, nein, erlitt einen Paradigmenwechsel, einen grundlegenden Wandel des pädagogischen Ideals. »Damals«, so heißt es im Roman, »war Doktor Wulicke, bislang Professor an einem preußischen Gymnasium, berufen worden, und mit ihm war ein anderer, ein neuer Geist in die alte Schule eingezogen. Wo ehemals die klassische Bildung als ein heiterer Selbstzweck gegolten hatte, den man mit Ruhe, Muße und fröhlichem Idealismus verfolgte, da waren nun die Begriffe, Pflicht, Macht, Carrière zu höchster Würde gelangt, und der ›kategorische Imperativ unseres Philosophen Kant‹ war das Banner, das Direktor Wulicke in jeder Festrede bedrohlich enfaltete.«
Thomas Mann sieht hier etwas voraus, was er zur Zeit der Niederschrift im vollen Umfang gar nicht wissen konnte: die Verhärtung, ja die Militarisierung, wie sie zum Ersten Weltkrieg führte und über diesen hinaus – in den zweiten Krieg. Der Wechsel der Anschauungen stellt sich in der Gymnasialbildung dar als die Ablöse der antiken Glücksethik durch eine preußische Pflichtethik, die sich auf den kategorischen Imperativ Kants berief.
Kants Imperativ, wenn man ihn wie Doktor Wulicke verengt interpretiert, hat etwas freudlos Hartes, und was immer das näherhin bedeutet, es bedeutet nicht, dass das beliebte Motiv des Handelns, nämlich glücklich zu werden, auch nur eine Nebenrolle spielt. Es spielt gar keine Rolle mehr, und alles, was an einen heiteren Selbstzweck erinnern könnte, ist ausgeschlossen. »Die Schule«, schreibt Thomas Mann, »war ein Staat im Staate geworden, in dem preußische Dienststrammheit so gewaltig herrschte, daß nicht allein die Lehrer, sondern auch die Schüler sich als Beamte empfanden, die um nichts als ihr Avancement und darum besorgt waren, bei den Machthabern gut angeschrieben zu stehen.«
Gesetz und Pflicht waren das Thema, begleitet von einer Selbstentmächtigung mit dem Zweck, den Machthabern zu gefallen, flankiert von einer Selbstverbeamtung, die keinen Zweifel daran lässt, dass man zu funktionieren gedenkt. Draußen bleiben muss das Glück, um das es heute im Übermaß zu gehen scheint, sodass man fragen kann: Kommt wieder ein Paradigmenwechsel, vom kleinen massenhaften Glück in die Anbetung kategorischer Strenge? Von der halblustigen liberalen Gesellschaft zur illiberalen Demokratie, deren antiquierter Ernst und aufrufendes Pathos man schon über die Zäune hören kann, die gegen Flüchtlinge errichtet worden sind?
Leidenskraft und Lebenswille
»Leidenskraft und Lebenswille« – unter diesem Titel wollte ich ein Buch veröffentlichen, das im Untertitel gut und gerne »Aus dem Magazin des Glücks« hätte heißen können. Aber Fachleute aus dem Verlagswesen erklärten: Sowas geht nicht! Da kann man ja gleich ein Buch »Verstörung« nennen. Wer würde schon einen Band »Verstörung« kaufen, die Leute wollen eine Hetz und keine sich selbst auskostende Depression.
Besser fand ich einen anderen Einwand: »Leidenskraft und Lebenswille« – das klinge nach Esoterik-Branche, nach sektiererischem Spiritualismus. Um Gottes willen, dachte ich, was habe ich mir denn gedacht bei »Leidenskraft und Lebenswille?«
Ich fand den Zweiklang der Worte schön, und auch, dass sinngemäß die Leidenskraft an den Lebenswillen erinnert, denn rein klanglich fehlt der Leidenskraft nicht viel zur Leidenschaft, und Leidenschaft ist wohl einer der Gipfelpunkte des Lebenswillens, der Lebenskraft. Aber das Schönste ist, dass nach meinem Verständnis zusätzlich zu den nicht wenigen Kräften, die einen Menschen ausmachen, tatsächlich so etwas wie Leidenskraft dazukommt.
Leidenskraft gibt es, und ein Missverständnis, an dem ich durch diese Wortwahl selber schuld bin, kann ich aufklären: Leidenskraft in meinem Sinn bedeutet nicht Duldsamkeit, bedeutet überhaupt nichts, was man einfordern könnte, etwa nach dem Motto: Reiß dich zusammen, das musst du doch aushalten!
Vielleicht ist es ein Privatmythos, kommt doch die Leidenskraft in meinem Fall aus der sogenannten persönlichen Erfahrung: Als ich krank war und darniederlag, war das nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Man liegt eben nicht da wie nichts und ist vom Schmerz befallen. Man hat Schmerzen, aber man nimmt sie nicht passiv hin.
Auch wenn man selbst, aus sich heraus, nichts gegen die Schmerzen tun kann, entwickelt man einen Widerstand gegen sie. Wenn dieser Widerstand erlahmt, dann hat einen die Leidenskraft verlassen, und ich spreche von einer psychischen Kraft, wohl wissend, dass es auch einen physischen Widerstand gibt, der, wenn man Glück hat, von den medizinischen Behandlungen (mit) in Gang gesetzt wird.
Für mich war das erstaunlich, dass man nicht einfach krank ist und passiv das Kranksein erträgt. Der Kranke mobilisiert noch in seiner Ohnmacht Kräfte. Diese Mobilisierung macht die Leidenskraft zum Partner des Lebenswillens. Leidenskraft und Lebenswille: ein Tandem, wenn man will.
»Es gibt nur einen angeborenen Irrtum, und es ist der, dass wir da sind, um glücklich zu sein.« Das hat Arthur Schopenhauer gesagt, ein Philosoph des 19. Jahrhunderts. Ihm verdanke ich den ach so weit ausholenden Begriff »Lebenswille«. Mit diesem Willen soll uns der Irrtum, wir seien zum Glück auf der Welt, angeboren sein? »Angeboren ist er uns«, sagt Schopenhauer, »weil er mit unserm Dasein selbst zusammenfällt, und unser ganzes Wesen ist eben nur seine Paraphrase, ja unser Leib sein Monogramm ist: sind wir doch eben nur Wille zum Leben; die sukzessive Befriedigung alles unsres Wollens aber ist, was man durch den Begriff des Glückes denkt.«
Das Glück liegt in den Genen, aber wer darüber nachdenkt, kommt vielleicht dahinter, dass die Verhältnisse nicht so sind. Überall, wo man sich mit Elan, also mit Lebenswillen, engagiert, kann man seine Enttäuschungen erleben, und vollkommen enttäuscht ist nach Schopenhauer der Weise. Der Weise weiß, Schmerz und Trübsal machen das Leben aus, und er negiert den Lebenswillen. In dieser Negation, in der Abwendung vom Leben, kann er sich dem geistigen Leben widmen, der Philosophie und dem Schönen. Das allein, so Schopenhauer, macht ein Leben erträglich, in dem der Tod das letzte Wort hat.
Schopenhauer am Inn
Eines Morgens
hatte es den Himmel aufgerissen
»frühmorgens, der Wolkenschleier reißt«,
schrieb Schopenhauer an einer Stelle,
an der keiner es vermutet hätte.
Er schrieb es mutig und unvermutet.
Ich behaupte, frühmorgens.
Überrascht,
»Die Welt als Wille und Vorstellung« in der Hand,
ein Exemplar der Reclam-Reihe,
das Mehrwert hat,
denn es steht im zweiten Band
gedruckt als Vorankündigung
für das kommende Buch
auf der allerersten Seite
des Exemplars
»Die Welt als Wille und Vorstrellung«
wie Prellung / schon der Titel verdruckt –
zitatenreif die orthographische Verstrellung.
Eines Morgens
hatte es den Himmel aufgerissen.
Am Morgen schien’s
wie über Nacht.
Doch so ein Anschein
spart das Morgengrauen aus
mit dem naturgemäß/selbstverständlich
ein jeder Tag beginnt: das Morgengrauen
die Straßen sind leer
der Fluss im Nebel
eine Hexenküche
noch ungewiss
was sie auskocht
Über die Unendlichkeit der Liebe
ein Monolog
und über die Beschränktheit der Natur,
die sogar mein armer Körper abschütteln kann
bis zu gewissen metaphysischen Graden,
die keiner vorher von sich kennt
(die keiner von sich gekannt haben will),
ein Dialog.
Der Intellekt,
der zur Trommel tanzt,
als wäre er der Wille selbst,
wird zur Trance / und die Trance
zur Demenz. Was ist der Mensch? –
vor dem Mittagessen
kann sich einer wie geboren fühlen
Durch das graue Licht hindurch
kam die Sonne und eroberte sich heute
den Tag. Das Licht, ihr Leute, geht auf meine Kosten.
Ich bezahle gern mit der Buchhandlungsrechnung
für den Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung
in der Hand / das verdruckte Sonderheft
der Reclam Vorstrellung / die Philosophie
im Griff / glücklich / unglücklich
saß ich nachmittags auf der Terrasse.
Die Schwermut von Berufs wegen
omnes ingeniosos melancholicos esse
(alle nennenswerten Geister sind traurig)
wich der ruhigen Freude,
dass der Schnee auf einmal
im Sonnenlicht weiß war,
so weiß, dass er in den Augen,
die sich freuten,
schmerzte.
Auch die Kälte
war im Sonnenlicht freundlich
und mein Körper,
geschweige denn die Seele,
suchten im Freien
keinen Schutz,
sondern zu dieser Jahreszeit schon
»die Außenwelt«.
Die schneebedeckten Ufer
begleiten den Fluss.
Auf dem Wasser
sehe ich ein Lichtspiel.
Sonne und Schatten. Der Fluss
spiegelt. Mein Leben lang
habe ich Spiegelungen
gerne gehabt.
Reflexionen. Nach langer Sehnsucht
nach dem Licht schwingt jetzt
in der Empfindung
schon Enttäuschung mit.
Das wird’s am Ende auch nicht sein,
was mich beruhigt. Im Halbfertigen
die Vollendung suchen
nimmt kein Ende: Es gibt
kein Glück.
Die Geometrie der Schwäne:
Zwei fliegen voran und bilden die Spitze.
Sie fliegen nicht weit voneinander entfernt.
Und dann, in viel größerem Abstand
als zwischen den ersten beiden,
folgt die Nachhut, ein Schwan nach dem anderen,
zwischen ihnen der gleiche Abstand
wie zwischen den Schwänen an der Spitze.
Es ist das Glück.
Der Winter ist vorüber
wenn auch fürs Erste
nur im Augenblick. Ein Februar
ist lang, halbfertig auch
die Winterwende. Das spiegelnd Eisig-Klare
ist im Fluss, eine Folge der Illumination,
die vom Himmel kommt. Das Sonnenlicht
als Licht schon stark
zu schwach noch für die Wärme.
Dieser gnadenreiche Ort,
an dem Verlust in Verzicht übergeht
bis der Unterschied davon vergeht
und ein Subjekt – souverän –
leiden kann. Im Bewusstseinsstrom
auf einmal ein Wackelkontakt:
Einen Stock höher steht der Mann
mit Einblick auf meine Terrasse –
Die männliche Stimme telefoniert:
»Servus. Pfiat God« lautet
plötzlich ein Abschied über mir.
Ein Schmerz. Eingespeichert im Nokia
trage ich die Nummer meines Orthopäden
bei mir. Lachend hat er mir
eines Tages ins Gesicht gesagt
seine Behandlung wirke nicht
auf Krankenschein. So wurde ich
sein Privatpatient. Es gibt für alles
eine Lösung.
Schopenhauer, der Schmerzspezialist.
»Durch Selbstbeobachtung
unserer Person können wir uns
dessen gewiss werden,
was wir letzendes sind.« Das steht
im Wikipedia – unter Schopenhauer.
So eine Verwirrung.
Ich denke, »letzen Endes«
sind wir tot. Oder diese eine Person,
die »wir« haben oder sind. Und das können
wir niemals »an uns selbst«
beobachten. Vom Privatpatienten
zum Privatdozenten (der Schopenhauer
von 1820 bis 1832 an der Uni Frankfurt war).
Dem Tod sagte er nichts Schlechtes nach.
Wenn was uns, sagte er,
Wenn was uns den Tod
so schrecklicklich erscheinenen lässt
der Gedanke des Nichtseyns wäre
so müssten wir mit gleichem Schauder
der Zeit gedenken da wir noch nicht
waren. Denn es ist unumstößlich
gewiss, dass das Nicht-Seyn nach dem Tode
nicht verschieden sein kann
von dem vor der Geburt,
folglich auch nicht beklagenswerter.
So bin ich privat auch.
Wenn ein Schmerz mich quält
interpretiere ich ihn
damit er weniger wehtut.
Aber es hat noch nie geholfen.
Wie ich mich auch drehe und wende
der Schmerz kommt wieder,
und zwar haargenau an die Stelle,
von der ich sagte
hier ist doch nichts.
Es ist, sage ich im Seminar
zu Professor Kampits,
einer der freundlichen Fehlschlüsse
im philosophischen Elend. Das Leben
das zwischen dem einen Nicht-Seyn
und dem anderen Nicht-Seyn war
macht den ganzen Unterschied:
La différence (so heißt auch
ein Restaurant in Köln.)
Im Sommer spielen
drüben die Kinder – dort,
wo ein Bach aus dem Gebirge
in den Inn fließt. Auf der anderen Seite des Flusses
ist dieser Platz jetzt leer. Wie lange
dauert so ein Nachmittag? Ungefährlich
ist das Wasser: kein Strudel, kein Fluss.
Dort steht das Wasser,
wo ein Bach aus dem Gebirge einfließt,
und die Kinder sind sicher.
Sicher. Da kommen noch
ganz andere Tage.
Wie lange dauert dieser Nachmittag?
Aber hier und jetzt
Wär’s momentan egal. Das werden
andere noch erleben, das erste helle Licht
im Jahr. »Freiluftgedanken« – viele nach mir,
die leben und mich überleben,
werden nach mir / mit eigenen Augen
das Licht, den Fluss vielleicht noch klarer sehen.
Ich kann mir diesen Augenblick
nicht patentieren lassen. So ein Moment
ist niemals exklusiv. Es scheint bloß,
dass er mir allein gehört – eines Nachmittags
um 16 Uhr.
Im Reclam-Heft blättere ich die Seite um.
Unlösbare Beklommenheiten, Größe,
aber nach welchem Maßstab? Unlesbare
Beklommenheiten. Summe eines Lebens
aber auf verquere Weise,
auch das anderer, die am Weg dabei waren,
die in den Fortschritt hineinpfuschten.
An diesem Nachmittag bin ich eine Zeit lang
Schopenhauers Sargträger. Ich trage ihn
über den Inn, hinüber nach Deutschland.
Er ist an diesem Nachmittag
150 Jahre tot – »ein Jubiläum« nennt man sowas
in Wien.
Schopenhauer, der alte Tote,
hat gut reden,
wenn er aus seinem Grab
aus der bequemen Lage
seines perfekten Nicht-Seyns
(Seyn eben mit y und nicht mit i)
uns die Botschaft zukommen lässt,
Daseyn wäre nichts
als ein ephemerer Lebenstraum,
und uns zusätzlich
den Kalauer des Grauens übermittelt:
»Klopfte man an die Gräber
und fragte man die Toten,
ob sie wieder aufstehn wollten,
sie würden mit den Köpfen schütteln.«
Zum Glück
sind die Allerweltsschmerzen,
die Allerweltszusammenbrüche,
die Selbstzerstörungen,
die haben sein müssen,
bis auf weiteres nicht vererbbar.
Die Toten sind in unseren Köpfen
klinisch rein, aber Achtung,
was von ihnen lebendig erscheint,
will immer noch anstecken, infizieren.
Die Vögel kreischen im Chor.
Kein Solist dabei, keine Hungerkrähe.
Die Spechte schweigen noch im Walde.
Bald schmilzt der Schnee auf der Terrasse
und eine kurze Zeit noch
wird im Holz das Muster bleiben,
das er von diesem Winter hinterlässt.
Sommerlicher Nachtrag
Der Lärm der Badenden
auf der anderen Seite des Inns
wird mir plötzlich heilig.
Da ist kein »Wille zum Leben«,
der auch seine dunklen Seiten hat
(dieser Sog zum Nicht-Seyn), diese Seite
auf denen dann ein »Tristan« steht.
Grandiose Note für grandiose Note.
Die Kakophonie der Badenden
ihre Rufe, alles ein Spiel
zum Eintauchen und Abkühlen,
das zu nichts führt
und verschlossen bleibt
in diesem Hochsommertag
der bald nur noch der Erinnerung
offensteht.
Mariahilfer Straße
Das Ende des Lebens meiner Eltern begann lange vor ihrem Tod. Es war ein Zufall, aber ich war dabei, als meiner Mutter eine Routinehandlung zum ersten Mal nicht gelang: Sie hatte oft in ihrem Familienleben faschierte Laibchen gemacht, und jetzt stand sie da und hatte auf einem Teller etwas angerichtet, von dem sie nicht wusste, wie es damit weitergehen sollte. Das war ein Wendepunkt, und der Vater trachtete, diese Wende, solang es ging, nicht zur Kenntnis zu nehmen. Während die Krankheit meiner Mutter immer mehr Raum einnahm, hielten wir uns (der Rest der Familie, ohne Mutter) zumindest ohne ihre bewusste Teilhabe an den eingebürgerten Ritualen fest. Am Heiligen Abend ging ich zu Fuß den Weg durch die Mariahilfer Straße in die Vorstadt, um bei den Eltern zu sein. Es war eine Ein-Mann-Prozession zu den eigenen Ursprüngen. Unterwegs befiel mich eine Einsamkeit, mit der ich glücklich war, weil sie am Ende einer feierlichen Stimmung doch sehr nahe kam.
Von Königen
»Doch im Gesicht trug er den Stempel des Irrsinns.« Das ist ein Satz, für mich ist es der Satz in Arno Geigers Buch »Der alte König in seinem Exil«. Meine Ergriffenheit von diesem Satz hat einen persönlichen Grund: Während mein Vater im hohen Alter seinen messerscharfen Verstand behielt, ja, ihn zur Schärfung seiner Paranoia, mit der er nicht immer nur falsch lag, benützen konnte, verfiel meine Mutter geistig über Jahrzehnte hinweg.
Das dreifach Dauerhafte ihres Lebens: erstens ihre hilflose Güte (die ihrer Hilflosigkeit wegen eben auch gegenstandslos war – eine Güte, die sich auf nichts und niemanden bezog); zweitens ihr lange, lange dauernder geistiger Verfall; und drittens die aussichtslose, aber unabänderliche Bindung an den Vater, der ein absoluter Herrscher über sie und alle ihre Angelegenheiten war. Am Ende saß ich meiner Mutter gegenüber und blickte hilflos in ihr Gesicht, das den Stempel des Irrsinns trug.
Der besagte Satz vom Irrsinn fällt in Arno Geigers Buch nach einem Bericht über eine Aktion des Vaters, der sich in einem signifikanten Stadium seiner Alzheimererkrankung ins Badezimmer eingesperrt hatte: »Er saß auf dem Badeschemel. In langer Hose und weißem ärmellosen Unterhemd, an den Oberarmen hing die Haut herunter, aller Spannkraft beraubt. Zwei Handtücher hatte er sich martialisch um den Hals gebunden, in der einen Hand hielt er eine nach oben aufgerichtete Rückenbürste, in der anderen Hand einen Nagelzwicker, dessen Nagelfeile ausgeklappt war. Er sah jetzt tatsächlich wie ein König aus – mit Zepter und Schwert. Doch im Gesicht trug er den Stempel des Irrsinns.«
Ich kenne aus der Krankengeschichte meiner Mutter einige Szenen, in denen sich mitten in einem Leben, das als normal durchgeht, der Irrsinn Platz schafft und alles andere zudeckt und man unweigerlich daran erinnert wird, wie nahe man dem Irrsinn selber schon gekommen ist und wie unberechtigt, ja, spießig die Hybris ist, mit der man sich auf seine Gesundheit Tag für Tag verlässt. Eines Tages kam die schamvolle Frau, meine Mutter, aus dem Klo, und aus ihrem Hintern hing eine endlose Klosettpapierrolle. An der Stelle fällt mir ergänzend ein, dass die Schwestern der Caritas jeden Kontakt zu uns abbrachen, weil der Vater in seinem autoritären, vollkommen unempathischen Ton auf dem Caritas-Stützpunkt, den er wütend gestürmt hatte, herumschrie, dass die Caritas in unserer Küche vergessen hatte, einen Haufen Scheiße aufzuwischen. Der Vater war nicht eine Sekunde in der Lage, den Rechtsanspruch, den er ja hatte (hatte er nicht einen Vertrag unterschrieben?), mit dem abzuklären, was an der professionell ausgeübten Hilfeleistung eine stete Überforderung des Menschenmöglichen war.
Geigers Buch ist für mich nicht nur wegen des Wiedererkennungswerts wertvoll. »Der alte König in seinem Exil« ist für mich auch in einer theoretischen Frage maßgeblich: Zu welcher Gattung nämlich gehört dieses Buch? Auf keinen Fall ist es ein Buch der Avantgarde, die mit dem Anspruch leben muss, mit jedem Text auch die dazugehörige Gattung neu zu erfinden – siehe zum Beispiel Konrad Bayers »der sechste sinn«, bei dem schon der Titel sagt, die fünf Sinne allein reichen nicht, im Wesentlichen geht es um einen sechsten.
Geigers Buch ist kein Roman, aber er ist auch kein Tatsachenbericht. Ich glaube, es ist ein Text auf einem hohen künstlerischen Niveau, der entschieden und jenseits der Gattungsgrenzen eine der Grundfunktionen von Literatur wiederbelebt, nämlich die Unterhaltung über die Conditio humana, über die Verfasstheit des menschlichen Lebens, genauer, die Aufforderung zum Austausch der Meinungen darüber. Da das Problem, genannt Alzheimer, sehr real ist, ist der Bericht von einer realen Erfahrung, von der Krankheit eines Vaters oder einer Mutter, eher angemessen als eine Fiktion, die ja selber schon ein Ausweg aus der Wirklichkeit ist. Nie saß ein Autor, um von einer Krankheit zu erzählen, mit größerer Berechtigung in so vielen Talkshows wie Arno Geiger.
Die Frage nach der Form des Buches ist eine Frage nach der künstlerischen Mühewaltung. Man kann mir eine Tendenz vorwerfen, dass Leid an elterlichem Alzheimer gepachtet zu haben und es nur mit einer künstlerischen Größe wie Geiger teilen zu wollen. Aber, Gott helfe mir, ich kann nicht anders: Wenn eine dieser Schauspielergrößen in einem Fernsehfilm oder auf der Theaterbühne den Dementen mimt, dann kommt mich, wie man in Wien sagt, der Schiach an. Ich sah einen Fernsehfilm, da wurden schön langsam die Insignien, ach, die Indizien der Krankheit vor Augen geführt, zum Beispiel eine Brille im Eiskasten.
Ich fand die Brille im Eiskasten inmitten der Tiefkühlkost billig und obszön. Der Trick, die private Vitalität eines Schauspielkünstlers einzusetzen, um im Film den schlagenden Beweis ihres Verfalls zu simulieren und zu illustrieren, und das alles im Rahmen formal konventioneller Darstellerei, ohne Mühewaltung, bringt mich auf die Idee eines Bilderverbots. Die Gesellschaft und erst recht ihre Kultur ist vom Schauspielen stigmatisiert, entseelt, und es wäre nicht schlecht, unterließen die Routinekünstler ihre Auftritte auf einem Gebiet, in dem der Ernst des Lebens bis zur Undarstellbarkeit herrscht.
Genau daran, genau an diesen totalitären Ernst, will uns Geigers Buch nicht glauben lassen, und es ist kein Einwand gegen seine Leistung, dass er es leichter hatte, weil auf dem Land die Geborgenheits- und Integrationsmöglichkeiten für einen alten Menschen ungleich größer waren, als sie es, wie bei meinen Eltern, in der teuflischen Zelle einer Wiener Gemeindebauwohnung sein konnten.
Fast unbemerkt steht in Geigers Buch auch eine kurze Abhandlung über eine Glücksfrage, die eine der wesentlichen ist und die oft keine Antwort findet. »Meinen Eltern war vor der Hochzeit nicht in den Sinn gekommen, darüber nachzudenken, was passiert, wenn zwei unterschiedliche Vorstellungen von Glück aufeinandertreffen. Die Zutaten für mögliches Glück brachten beide mit. Bei näherer Betrachtung zeigte sich jedoch, dass die Zutaten zu verschiedenen Arten von Glück gehörten, zu entgegengesetzten. Schließlich war jeder für sich unglücklich.«
Nichts ist ungeheurer als der Mensch. Das gilt einerseits, und vielleicht kann man es auch begütigend sagen: Nichts ist für den Menschen ungeheurer als seinesgleichen. Andererseits haben es die Ungeheuer im Laufe der Zeit geschafft, einander auch so etwas wie ein Glücksversprechen zu sein. Das Glück soll sich vertragen mit einer kalkulierbaren Ordnung der sexuellen Dinge und mit dem Kinderkriegen und dem Kindererziehen. Dieses Glück heißt Eheglück, und es ist oft die Hölle, zum Beispiel als »die perfekte Dissonanz der Lebensträume«, wie das Arno Geiger nennt, der sich auch sagen muss: »Über eine Ehe zu schreiben, die gescheitert ist, mutet an, als kehre man kalte Asche zusammen.«
Diese kalte Asche ist der Treibstoff meiner Lebensgeschichte. Mein Vater war nicht in der Lage, sich seinem Unglück gegenüber zu öffnen. In aller Ambiguität behielt er es für sich und warf es anderen vor, nicht zuletzt der Mutter. Wäre sie nicht krank gewesen, dann hätte er doch das schöne Leben gehabt, das ihm gebührte. Er hatte keine unglückliche Ehe, er nicht, und während er beredt war, wurde die Mutter im Laufe der Jahre sprachlos. Am Ende hatten ihre Wörter keinen Sinn, aber ihre Stimme war aussagekräftig, weil sie von einem kreatürlichen, ja tierischen Abgrund widerhallte. Der Vater hielt eisern, geradezu übermenschlich zur Mutter, versuchte ihre immer steiler werdenden Lebenskurven mit zu bewältigen. Als er aber – im Wilhelminenspital – in seinem zukünftigen Totenbett lag und der Zufall es gewollt hatte, dass seine Frau in einem anderen Gebäude desselben Spitals untergebracht war, wurde er gefragt, ob er sie denn nicht sehen wolle. Er verneinte mit der Begründung: »Wos bringt des an Krankn?«
Meiner Söö
I hob vom liabn Gott
den Geist bekommen,
der mir den Körper
tut verwalten.
Meiner Söö
ab und zu
ein Achterl Rotwein
oder a Zigarre,
des muss schon sein
des muss scho drin sein.
Mein Vater hat mich gelehrt,
der Vodda der Vodda,
Weine!, mein Sohn, weine!
Und i wein sehr gern.
Meiner Söö, Muadda,
was wan i gern.
Dann füühl i mi afoch wohler
weil angesammelter Seelenschmutz
mit dem Tränenfluss außikummt,
außirinnt. Meiner Söö.
Last, Lust, List
Die mir liebste Sprech-Schau, sprich Talkshow, ist nach ihrer Moderatorin benannt. Sie heißt »Stöckl«, und bei ihr war Lotte Tobisch zu Gast. Lotte Tobisch ist vormals, in früheren Zeiten, Schauspielerin am Burgtheater gewesen, aber so richtig berühmt wurde sie viel später, nämlich in der Zeit, da sie die Organisatorin des Wiener Opernballs war. Nach ihrer Demission von diesem gewiss erschöpfenden Job blieb sie in Österreich eine Person von öffentlichem Interesse. Ich verehre sie ihrer klaren Urteile wegen und auch deshalb, weil sie vor Augen führt, dass hohes Alter kein Fluch sein muss, sondern eine Daseinsmöglichkeit sein kann.
Außerdem verehre ich sie, weil sie eine Freundin des Philosophen Theodor W. Adorno gewesen ist, weil sie also einem Menschen nahe war, dessen geistige Nähe ich durch die Lektüre seiner Bücher suche. Bei »Stöckl« sagte Lotte Tobisch einen Satz über das Alter, dessen Prämissen ich weiterspinnen möchte: Im Alter, sagte sie, könne man Freude haben, aber der Spaß sei einem vergangen. Spaß, so fasse ich es zusammen, habe man also im Alter nicht, was jedoch durch die Freude, die man noch haben kann, aufgewogen wird.
Dialektisch denkend, wie Adorno, also Gegensätze zusammen-denkend (und sie zugleich auseinander-haltend), könnte man hier die etwas verkommene Wendung vom »Spaß an der Freude« einwenden und im Ernst sagen: Spaß ohne Freude ist schal, und Freude ohne Spaß ist so etwas wie Heuchelei, bei der man vorgibt, ein tieferes Gefühl zu haben, nur weil man an der Oberfläche gar nix empfindet. Damit ist man bei Nietzsches Vorwurf an die Christen: Diese hätten ein Evangelium, also eine Frohbotschaft, aber dass sie erlöst wären, merke man ihnen nicht an, weil sie griesgrämig ihr Leben führten. Sie müssten, sagte Nietzsche, »erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll«.
Es gibt ein Drittes, das sich von Freude und vom Spaß unterscheidet, das weder das eine ist noch das andere, an dem aber beide, Spaß und Freude, beteiligt sind. Das ist: die Lust, und die Lust, so wiederum Nietzsche, will angeblich »tiefe, tiefe Ewigkeit«. Lust sei also auf die Einheit von Dauer und Augenblick angelegt. Falls das stimmt, dann sind Menschen überaus dialektische Wesen: Ausgerechnet Lust, die wie nichts vergeht, soll Menschen eine Ahnung davon geben, wie es wäre, stünde die Zeit endlich still?