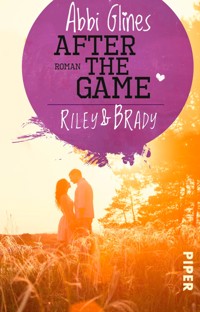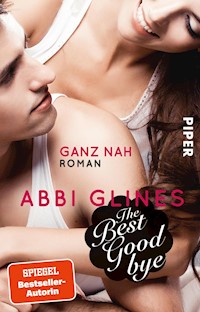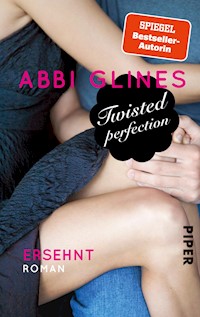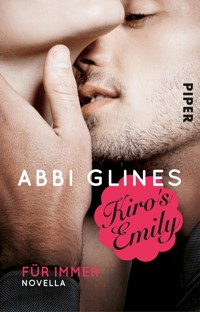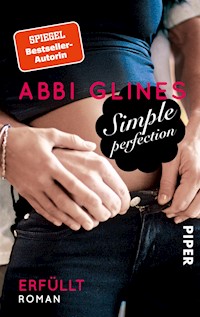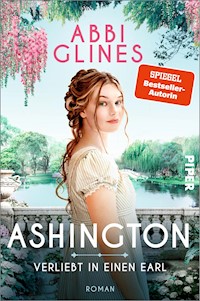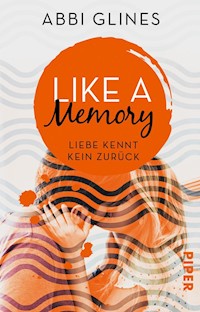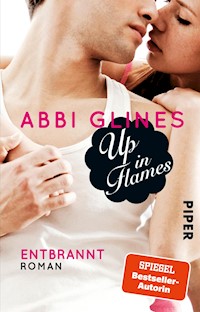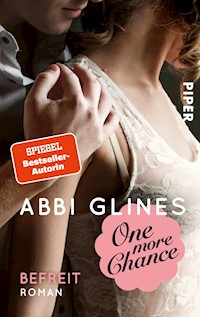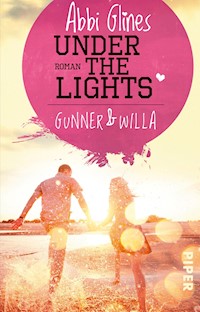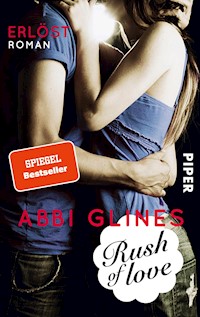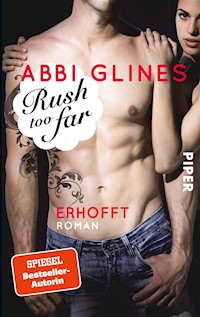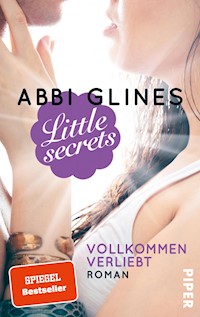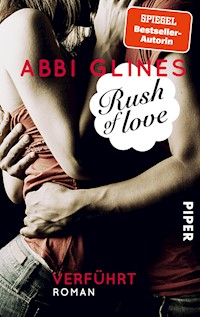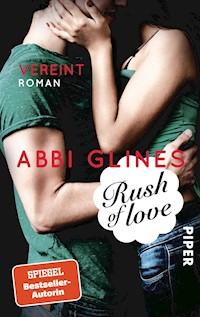9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vale hatte schon immer ein Faible für große Liebesgeschichten. Sie glaubt an die eine wahre Liebe, und als Crawford ihr sein Herz schenkt, kann sie ihr Glück kaum fassen. Seither sind sie ein Paar und teilen alles miteinander – Sorgen, Geheimnisse, Träume, aber vor allem viele Schmetterlinge im Bauch. Als sie die Highschool abschließen, erwartet sie ein Sommer voller Möglichkeiten. Doch was, wenn das Leben plötzlich eine Abzweigung nimmt, mit der man nie gerechnet hätte, und sich alle Wünsche und Pläne in einem einzigen Moment zerschlagen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für jedes Mädchen, das am Boden zerstört war und die Kraft zu kämpfen fand.
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Heidi Lichtblau
ISBN 978-3-492-990165
© Abbi Glines 2018
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»As She Fades«, Feiwel and Friends,
ein Imprint der Macmillan Pubilshing Group, LLC, New York 2018
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: momentimages/GettyImages und A-Digit/Getty Images
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Teil Eins – Ein Traum in einem Traum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Teil Zwei
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
Danksagung
Teil Eins
Ein Traum in einem Traum
Auf die Stirn nimm diesen Kuss!
Und da ich nun scheiden muss,
So bekenne ich zum Schluss
Dies noch: Unrecht habt ihr kaum,
Die ihr meint, ich lebte Traum;
Doch, wenn Hoffnung jäh enflohn
In Tag, in Nacht, in Vision
Oder anderm Sinn und Wort –
Ist sie darum weniger fort?
Schaun und Scheinen ist nur Schaum,
Nichts als Traum in einem Traum!
Edgar Allan Poe
Ein Traum in einem Traum
Schon als kleines Mädchen liebte ich Märchen. Und glaubte an die wahre Liebe. Da ich bereits mit sechs mein Herz an einen Jungen verlor, fiel mir das auch nicht schwer. Nicht viele erwischt es so jung, weshalb Crawford und ich uns für etwas Besonderes hielten. Wir glaubten, das Schicksal meine es gut mit uns, weil es uns so früh zueinandergeführt hatte, damit wir ein ganzes Leben miteinander verbringen könnten. Crawford war mein ganz persönlicher Prince Charming. In meiner Kindheit verging kein einziger Tag, an dem er nicht für mich da war. Mich zum Lachen brachte und gemeinsam mit mir das Leben genoss. Nur leider rechneten wir nicht mit den jähen Wendungen, die, die einen vom Kurs abbringen und alles für immer verändern. Nein, darauf waren wir nicht gefasst.
Unsere Geschichte hat es in sich. Das unbeschwerte Leben, das wir geführt hatten, wurde uns so schnell entrissen, dass uns keine Zeit blieb, uns darauf vorzubereiten. Aber wer kann das schon? Das sind die Schattenseiten des Lebens.
1. Kapitel
Der Geruch von Sommerabenden versetzte mich grundsätzlich in Hochstimmung. Von klein auf erinnerte er mich daran, dass ich nun Schulferien hatte und Abenteuer auf mich warteten: Baden im See, Basketballspiele mit meinen älteren Brüdern und natürlich unser alljährlicher Familienurlaub. Trotzdem, in diesem Jahr verhieß er Freiheit. Ein neues Leben, einen Neuanfang. Für mich und Crawford.
Er saß am Steuer, und als ich zu ihm linste, wurde mir bei seinem Anblick ganz warm ums Herz. Wir kannten uns schon von Kindesbeinen an. Zunächst nur als Spielgefährten, doch mit der Zeit war mehr daraus geworden. Heute waren wir auf die große Bühne getreten, die auf der Mitte des Footballfelds unserer Highschool aufgebaut worden war, und hatten unsere Abschlusszeugnisse in Empfang genommen. Wir waren Highschool-Abgänger. Yeah!
»Ich kann noch immer kaum fassen, dass es vorbei sein soll. Also die Highschool«, ergänzte ich, auch wenn Crawford bestimmt wusste, was ich meinte.
Er warf mir einen Blick zu, und seine Mundwinkel verzogen sich gerade so viel nach oben, dass seine Augen auf die Art funkelten, wie sie es immer taten, wenn er sich amüsierte oder freute. »Es ist noch nicht vorbei. Es fängt gerade erst an, V. Unser Leben wird genauso laufen wie geplant.«
Das wollte ich doch hoffen. Wir würden aufs selbe College gehen. Crawford hatte ein Footballstipendium ergattert. Ein Vollstipendium! Ich selbst hätte mir dieses College zwar nicht ausgesucht, aber ich wollte da sein, wo er war. Wir waren noch nie voneinander getrennt gewesen.
»Die anderen schienen heute Abend ja fast ein bisschen Muffensausen zu haben. Als würden sie trinken und abfeiern, um zu vergessen, dass wir jetzt Erwachsene sind. Aber so ist es eben.«
Crawford zuckte die Achseln. »Klar, die meisten haben einen Riesenbammel, darauf wette ich. Die haben nicht schon Pläne wie wir. Sie müssen erst noch entscheiden, wie’s jetzt weitergeht.«
Er hatte natürlich recht. Wie immer. Was ich an Crawford unter anderem so liebte, war seine Zuversicht. Sorgen waren ihm fremd, vor keinem Problem schreckte er zurück. Er packte es bei den Hörnern und bekam es in den Griff. Bei ihm fühlte ich mich sicher und geborgen, denn er schien für alles immer die nötige Antwort parat zu haben.
Er fasste herüber und nahm meine Hand. »Unser Leben wird so cool. Das College wird genau das sein, was wir brauchen. Wir kommen aus dieser Stadt raus, sind aber nicht zu weit weg. Wir können versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen, und trotzdem mal eben locker zu Besuch nach Hause fahren. Du wirst es lieben!«
Und ich glaubte ihm. Es würde großartig! Ich spürte eine Vorfreude auf die kommende Zeit in mir hochperlen, konnte es kaum erwarten, dass es August wurde.
Im Radio wurde unser Lieblingssong gespielt. Crawford stellte es lauter und stimmte völlig falsch mit ein. Er war ein schrecklicher Sänger, doch er wusste, er brachte mich damit zum Lachen, und tat es deshalb. Als er einen weiteren schiefen Ton von sich gab, prustete ich los. Wie ich mein Leben liebte!
Genau in diesem Moment legte Crawford eine Vollbremsung hin, und die Welt geriet völlig aus den Fugen. Der Geruch verbrannten Gummis und heftiges Reifenquietschen fegte all meine anderen Gedanken beiseite. In diesem Augenblick verschwanden alle Träume. Ganz und gar.
Ein Monat. Heute vor einem Monat hatten wir den Autounfall, der den Abend unseres Highschool-Abschlusses in einen Albtraum verwandeln sollte. Ich saß in dem Wartebereich, der mir inzwischen vertrauter war als mein eigenes Zimmer, und starrte die weißen Wände an. Der Sterilität um mich herum konnte auch der Geruch schalen Kaffees nichts anhaben. Nicht, dass es wichtig gewesen wäre. Wichtig war nur, dass Crawford wieder aufwachte.
Bald war ich an der Reihe, Crawford etwas vorzulesen. Für diese Zeit des Tages lebte ich. Dafür, ihn zu sehen und zu beten, dass er meine Stimme hören und die Augen öffnen würde. Damit wir wieder zusammen wären. Damit unsere Träume noch immer vor der Tür dieses einsamen, kalten Ortes auf uns warteten.
Am Morgen nach dem Unfall hatte der Arzt Crawfords Eltern erklärt, er glaube, komatöse Patienten könnten hören. Wenn Crawford mitbekam, dass wir mit ihm sprachen, würde er sich zu uns zurückkämpfen. Wieder aufwachen.
Bei der Erinnerung an seine Worte erschauerte ich. Komatös. Wie ich diesen Ausdruck hasste! Normalerweise strotzte Crawford nur so vor Leben und Energie. Es war schrecklich, ihn in diesem Zustand zu erleben.
Der Arzt meinte, je mehr Stimmen Crawford hören würde, umso besser. Daher hatte Crawfords Mutter für uns alle einen Zeitplan erstellt, doch nach einer Weile konnte ich so früh zum Vorlesen kommen, wie ich wollte. Als es mit ihrer Gesundheit dann bergab ging – ihr einziges Kind tagaus, tagein in diesem Zustand zu erleben, belastete sie sehr – hatte sie sich ihre Zeiten wieder neu einteilen müssen.
»Noch immer hier?«, fragte eine mir unbekannte männliche Stimme. Normalerweise schaute immer mal einer meiner älteren Brüder vorbei. Der jüngste, Knox, war nur wenig älter als Crawford und ich, und wenn er es zeitlich schaffte, las auch er Crawford etwas vor, wenn auch nicht jeden Tag. Eigentlich hatte er fest versprochen, heute herzukommen, da er schon ein paar Tage nicht mehr da gewesen war.
Ich hob den Kopf und sah in ein Paar dunkelgrüne Augen, die von dichten, schwarzen Wimpern umrahmt wurden – echt nicht übel für einen Jungen! Diese Augen waren mir schon zuvor aufgefallen. Genauso wie der dazugehörige Typ. Unterhalten hatten wir uns allerdings noch nie.
»Du bist immer hier«, meinte er. »In den letzten beiden Wochen gab es nicht einen Tag, an dem ich dich hier nicht gesehen hätte.«
Er hatte eine angenehme Stimme, sprach jedoch gedehnter als hier in Franklin üblich. Eher so wie in Alabama. Checkte er mich einfach nur ab, oder wartete er auf eine Antwort? Na ja, wahrscheinlich Letzteres. Es war unhöflich von mir, nicht zu antworten.
»Ich wüsste nicht, wo ich sonst sein sollte«, gestand ich. Ohne Crawford war ich verloren.
Der Typ verzog seine vollen Lippen zu einem Schmunzeln. Was gab es da zu schmunzeln?
»Ich könnte mir eine Menge Orte vorstellen, an denen ich lieber wäre. Aber ich hänge nun mal sehr an Onkel D. Deshalb bin ich hier.«
Ich war nicht sicher, ob er auf die Tränendrüse drücken wollte, aber so klang es eigentlich nicht. Ob es ihm wohl überhaupt etwas ausmachte, dass sein Onkel im Krankenhaus lag? Nicht, dass es mich wirklich interessiert hätte. Der Typ hatte etwas an sich, was mir auf den Keks ging. Er gefiel sich. Und wie! Er wusste, dass er gut aussah, und genoss die Aufmerksamkeit. Solche Typen kannte ich zur Genüge. Nicht mein Fall!
»Wow, wie selbstlos von dir!«, erwiderte ich mit einem ordentlichen Schuss Sarkasmus. Als seine Augen belustigt aufblitzten, wurde er mir gleich noch unsympathischer.
Er verschränkte die Arme vor seiner breiten Brust, und ich kam nicht umhin zu bemerken, wie sein Bizeps anschwoll und aus seinem Ärmel nunmehr ein Tattoo hervorlugte. Sein langes, dunkles Haar war leicht zerzaust und hinter die Ohren geschoben. Hätte er es sich jetzt noch zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, wäre der Piratenlook perfekt gewesen!
»Ich will hier nicht den Selbstlosen raushängen lassen, falls du das denkst. Nichts liegt mir ferner. Ich bin hier, um meinen Onkel zu sehen. Mehr ist da nicht dran. Andererseits sitze ich auch nicht Tag für Tag märtyrerhaft im Wartezimmer und starre die Wand an. Selbstlosigkeit ist dein Ding. Nicht meins.«
Warum redete der eigentlich noch mit mir? Und wo steckte Knox? Eigentlich hätte er längst mit einer Lunchbox von meiner Mom auftauchen und sich dann zu Crawford ans Bett setzen sollen. Ich war erst in drei Stunden dran. Und dieser Typ hier musste seinen Abgang machen! Ich warf ihm einen finsteren Blick zu.
»Gott, bist du empfindlich!«, murmelte er mit einem amüsierten Lächeln.
»Wolltest du nicht deinen Onkel besuchen?« Auf die Art musste ich ihn doch wohl loswerden.
Diesmal lachte er. Aus vollem Herzen. Es klang nett, fand ich. Mehr als nett. Doch dann erinnerte ich mich, dass er mich damit nur einwickeln wollte. Und schon nervte es mich.
»Doch, schon. Ich dachte bloß, ich versuche mal, dich zu etwas anderem zu bringen, als unentwegt die Wand anzustarren. Es macht mich traurig, wenn ich dich hier ganz allein sitzen sehe. Mein Fehler. Offensichtlich bist du gern allein.«
Er wollte, dass ich meine Krallen ausfuhr, doch diesen Gefallen tat ich ihm nicht. Der war’s doch gar nicht wert, dass ich wütend wurde!
»Slate, was machst du denn hier? Dein Onkel hat sich gerade nach dir erkundigt.« Eine junge Krankenschwester war aufgetaucht, die nun echt mit den Wimpern klimperte und ihren Vorbau rausstreckte, während sie mit … Slate sprach – wie er anscheinend hieß.
Er sah zu ihr und zwinkerte ihr dabei zu, wenn mich nicht alles täuschte. Ihre Wangen erglühten, und sie setzte einen Schlafzimmerblick auf. Herrje! Ich hatte genug gesehen. Hätte ich Lust auf eine Seifenoper gehabt, dann hätte ich den Fernseher in der Ecke angeschaltet!
»Sag dem alten Knaben, ich komme gleich.«
Sie kicherte, als fände sie seine Bemerkung urkomisch, und wandte sich dann nach einem kurzen Blick auf mich zum Gehen. Ihr Hüftschwung war übertrieben – jedes Mädchen, das wirklich so ging, hätte sich von einem Chiropraktiker wöchentlich die Hüften einrenken lassen müssen.
»Dann mal noch viel Spaß, Miss …«. Slate ließ den Satz unvollendet und meinte wohl, ich würde ihm nun meinen Namen nennen. Tja, da konnte er lange warten.
»Dein Fanclub braucht dich«, versetzte ich genervt und richtete meinen Blick wieder auf die Wand. So, wie ich es jeden Tag tat. Um nachzudenken. Über das Leben und meine Zukunft, unsere Zukunft. Meine und Crawfords.
»Wohl wahr«, gluckste er. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie er kopfschüttelnd davonging. Wobei man das eigentlich nicht als Gehen bezeichnen konnte. Eher als Stolzieren. Wenn Kerle denn überhaupt stolzierten. Vielleicht war es eher ein wiegender Gang?
Ach, wen interessierte das! Er war weg.
Ich griff nach meinem Stoffbeutel und kramte mein Handy heraus. Ich hatte Nachrichten und Anrufe erhalten, von meiner Mom zwei Anrufe, von jedem meiner vier Brüder jeweils eine Nachricht, zwei von der Frau meines ältesten Bruders und die letzten drei von meinem Dad. So lief das jeden Tag. Sie kontrollierten mich, baten mich, zum Abendessen nach Hause zu kommen oder mit ins Kino zu gehen, zum Shoppen, zu einem Basketballspiel … versuchten einfach alles, um mich aus dem Krankenhaus zu locken.
Keiner von ihnen kapierte es. Crawford lag im Koma.
Nur das zählte. Ich konnte doch nicht einfach so weiterleben, als würde er nicht reglos auf diesem Bett liegen. Wenn er aufwachte, musste ich zur Stelle sein. Denn das würde er. Musste er! Vor uns lag eine Zukunft, die wir schon seit Kindertagen geplant hatten.
Ich sah mir die eingegangenen Nachrichten an und tat, was jedes brave Mädchen getan hätte: Ich fing an, sie zu beantworten. Das Angebot meiner Mutter, mit mir einen Badeanzug kaufen zu gehen – als hätte ich in absehbarer Zeit Strandbesuche vor. Dann ihren Versuch, mich moralisch dazu zu verpflichten, an einem Familienessen teilzunehmen. Meine Nichten würden mich vermissen. Klar, leichte Gewissensbisse wegen Maddy und Malyn, den Zwillingen meines ältesten Bruders, plagten mich schon. Sie waren erst zwei, und es verwirrte sie vermutlich, wenn sie Tante Vale plötzlich nicht mehr zu Gesicht bekamen.
Vor dem Unfall hatte ich jeden Dienstag- und Donnerstagabend auf die beiden aufgepasst, denn da hatte Catherine, meine Schwägerin, im Altersheim Spätschicht. Nun kümmerte sich meine Mom in der Zeit um sie, denn ich verließ das Krankenhaus wirklich immer erst, wenn ich musste. Wenn Crawfords Mutter allabendlich um sieben wiederkam, wünschte ich ihm eine gute Nacht, gab ihm einen Kuss auf die Wange und weinte den ganzen Heimweg über. Morgens wachte ich um sieben auf, zog mich an, packte Bücher und Snacks in meine Tasche und machte mich zum Krankenhaus auf. So sah mein Tagesablauf aus. Mehr war mir nicht geblieben.
Heute Abend wollten meine Brüder nach dem Familienessen bei uns zu Hause noch Basketball spielen. Jonah war beim Militär und zurzeit im Einsatz. Und ich sollte als vierter Spieler einspringen. Doch das konnte zur Not auch mein Dad tun. Und trotzdem wollten sie mir weismachen, dass ich unentbehrlich wäre.
Ich war das Nesthäkchen und das einzige Mädchen. Insofern war ich viel zu behütet und beschützt aufgewachsen. Alle dachten, sie müssten mich in Watte packen. Dafür liebte ich sie und weil mir Jonah SMSen schrieb, während er im Auslandseinsatz war. Ich antwortete jedem von ihnen, ich wäre beim Basketballspiel dabei, wenn sie bis halb acht warteten. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock darauf. Doch ihnen lag daran.
Also tat ich ihnen den Gefallen.
2. Kapitel
Endlich kreuzte Knox auf. Mit einer Lunchbox, in der sich eine warme Mahlzeit für mich befand. Mom kam nur deshalb halbwegs damit klar, dass ich den ganzen Tag hier verbrachte, weil sie mich zumindest mit etwas zu essen versorgen konnte.
»So, bitte schön, Prinzesschen.« Knox reichte mir die Lunchbox und sank auf den Stuhl neben mir. »Na, wie läuft’s?«
Normalerweise leistete er mir beim Essen Gesellschaft. Darauf freute ich mich auch immer.
Knox war gerade mal zwei Jahre älter als ich, und von uns fünfen standen wir zwei uns am nächsten.
Beide hatten wir dunkle Haare und blaue Augen. Jeder sagte, wir könnten Zwillinge sein.
»So wie immer. Ich warte«, erwiderte ich. »Was gibt’s Neues von der Heimatfront?«
Seufzend lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Dad feilscht mit dem Klempner erbittert um den Preis der neuen Badewanne, die sich Mom wünscht, Mom backt deinen Lieblingskuchen in der Hoffnung, dich damit zum Abendessen heimlocken zu können, und Maddy weigert sich, das Töpfchen für große Mädchen zu benutzen, weil Tante Vale nicht da ist, um mit ihr den Töpfchen-Song zu singen.«
Er wollte mir keine Schuldgefühle machen. Das war nicht Knox’ Art. Er war einfach nur ehrlich.
»Kann Mom ihr das Lied nicht vorsingen? Von ihr stammt es ja ursprünglich.« Ich zog einen Behälter mit einem Brokkoliauflauf heraus, der noch immer schön warm war.
»Sie hat’s versucht«, meinte er achselzuckend. »Aber Maddy hat behauptet, dein Lied wäre anders.«
Ich musste dringend Zeit für meine Nichten finden. »Ich wünschte, Mom würde sie mal herbringen.«
Knox drehte sich zu mir. »Wieso? Du bist doch hier nicht an ein Bett gefesselt. Du kannst rausgehen, wann immer du willst, und was anderes tun. Crawford würde sich das wünschen.«
Manchmal traf einen Knox’ Ehrlichkeit echt hart.
»Wenn er wieder aufwacht, möchte ich da sein«, erklärte ich zum hundertsten Mal. Eigentlich wussten das alle, und doch musste ich mich ständig wiederholen.
»Das könnte auch mitten in der Nacht der Fall sein. Dann wärst du auch nicht hier!«
Schon klar. Ein schrecklicher Gedanke. Aber leider war es mir nicht gestattet, im Wartebereich zu übernachten. Wenn die Besuchszeiten vorbei waren, musste ich gehen. Krankenhausregeln. Nicht, dass ich es nicht probiert hätte. Sie hatten mich rausgeworfen.
»Lass mich das einfach auf meine Art machen«, sagte ich und machte mich über mein Essen her. Ich hatte Hunger. Mein Frühstück aus trockenem Müsli und Goldfisch-Kräcker lag lange zurück, und ich brauchte etwas anderes in den Magen als schalen Kaffee.
»Knox McKinley«, ertönte eine inzwischen vertraute Stimme, und ich hätte mich beinahe an meinem Auflauf verschluckt und deswegen liebend gern losgeflucht. Musste dieser Arsch meinen Bruder kennen?
»Slate!« Die Freude in der Stimme meines Bruders war echt. Er mochte diesen Kerl. Da sollte mal einer verstehen. »Was tust du denn hier?«
»Genau das wollte ich dich gerade auch fragen. Wie ich sehe, hast du bei der da schon größere Fortschritte gemacht als ich. Bei mir hat sie lieber die Wand angestarrt, als sich mit mir zu unterhalten.«
Ich spürte, wie sich Knox zu mir drehte, aber ich ignorierte die beiden und aß lieber noch einen Happen.
»Na ja, schließlich bringe ich ihr was zu futtern und teile dieselben Eltern mit ihr. Was bleibt ihr da anderes übrig?«, grinste Knox.
»Sie ist deine Schwester? Hach, das richtet mein angeschlagenes Ego wieder etwas auf.«
Ich nahm mir das Hörnchen, das meine Mom frisch gebacken hatte, und biss herzhaft hinein. Ich hatte den Mund so voll, dass keiner erwarten konnte, dass ich noch redete. Ich hörte, wie sich Knox ein Lachen verkniff. Vielleicht kapierte er den Wink ja und schickte Mr. Nervensäge seiner Wege.
»Hab gedacht, du würdest mit deinem Onkel in Huntsville wohnen? Was treibt dich von so weit her?«
Dafür, dass Knox das Thema wechselte, schuldete ich ihm was.
»Onkel D hat Krebs im vierten Stadium. Leberkrebs. Das Krankenhaus hier ist noch eines der nächsten, die für so was ausgerüstet sind.«
Oh. Der Onkel, bei dem er wohnte, lag im Sterben. Nun fühlte ich mich leicht mies. Okay, ziemlich mies sogar.
»Das tut mir leid – davon hatte ich vor den Semesterferien gar nichts mitgekriegt.« Knox war ehrlich. Er hatte ein großes Herz.
»Er hat es mir auch erst jetzt erzählt, als ich zurückgekommen bin. Und vor zwei Wochen wurde er dann das erste Mal operiert. Wenn er sich davon erholt hat, geht’s mit der Chemo los. Allerdings versprechen sie ihm lediglich, dass sie sein Leben verlängert. Nicht rettet.«
»Verdammt«, flüsterte Knox und schüttelte den Kopf. »Na, wenn ich irgendetwas tun kann, gib Bescheid. Meine Brüder und ich bringen unserer Schwester täglich ihren Lunch. Da können wir dich genauso gut mitversorgen.« Knox meinte jedes Wort ernst. Gleich morgen schon würde er Mom überreden, für diesen Typen mitzukochen.
»Nicht nötig, ich hab hier ja nicht mein Lager aufgeschlagen. Onkel D wäre stinksauer, wenn ich das versuchen würde. Ich schau zweimal am Tag vorbei. Hab eine Freundin hier in der Stadt, bei der ich pennen kann.«
Das sah ihm ähnlich. Kein Wunder, dass er nicht bei seinem Onkel blieb. Er wurde ja schon erwartet.
»Okay, na jedenfalls: Meine Nummer hast du.«
»Danke, Alter.«
Knox machte eine für die Kappa-Sigma-Studentenverbindung wohl typische Handgebärde, der Slate anscheinend auch angehörte.
»Wir sehen uns. Schau zu, dass du deine Schwester im Griff behältst«, scherzte Slate, und ich schluckte erst mal mein Brötchen hinunter, bevor ich zu ihm aufsah. Er zwinkerte mir zu.
»Ich versuch mein Bestes.«
Sobald er verschwunden war, sah Knox zu mir. »Kluges Mädchen!«
Ich runzelte die Stirn. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, einen Anschiss zu bekommen, dass ich seinen Verbindungsbruder gedisst hatte. »Wie? Was?«
Knox wies mit dem Kopf in Richtung der entschwindenden Gestalt. »Na, dass du ihn hast abblitzen lassen. Er ist mein Bruder und ein toller Typ, aber ein alter Aufreißer ist er auch. Ich wette, der hat bereits mit jeder Schwester hier auf der Station, die bei drei nicht auf dem Baum war, geschlafen. Der Typ lässt nichts anbrennen, dafür ist er bekannt.«
Das brauchte er mir nicht zu erklären. »Das habe ich mir auch schon zusammengereimt.«
Knox tätschelte mir das Knie. »Das hätte ich wissen müssen.«
Allerdings, das hätte er!
3. Kapitel
Den Großteil meines Lebens war mir Crawfords Mom, Juliet, wie eine zweite Mutter gewesen. Sie war jünger als meine, und Crawford war ihr einziges Kind. Seinen Vater hatte sie gleich nach der Highschool in der festen Überzeugung geheiratet, ihre junge Liebe sei stark genug, um den Prüfungen der Zeit zu widerstehen.
In den vergangenen Monaten hatte sie sich jedoch verändert. Von der lebenslustigen, lächelnden Frau war nichts mehr zu sehen. Plötzlich hatte sie Falten, die mir zuvor nie aufgefallen waren. Ihr einst so tolles blondes Haar war dünn und brüchig. Und wo sie zuvor aufrecht und in beispielhafter Haltung dagestanden hatte, ließ sie die Schultern nun hängen.
Crawford war ihre Welt. Ohne ihn brach sie auseinander, und ich verstand und akzeptierte ihre scharfen Worte und strengen Regeln, was die Besuche anging. Ich ließ es nicht an mich heran, wenn sie sich darüber beschwerte, dass ich immer im Wartebereich saß. Sie litt und musste um sich schlagen. Ich war da und fungierte als Sandsack. Crawford hätte dasselbe für mich getan.
Ich erkannte das Klacken ihrer Absätze, gerade als die Uhrzeiger, die ich schon seit einer Stunde beobachtete, auf die Vier-Uhr-Position glitten. Sie machte sich auf den Heimweg, um zu essen, ein Bad zu nehmen und sich auszuruhen, um nach ihrer Rückkehr die Nacht über zu bleiben. Davon, dass ihr Mann oder ich blieben, wollte sie nichts wissen. Sie musste zur Stelle sein. Für den Fall.
Für den Fall, dass er die Augen aufschlug. Oder … es nicht tat.
Ich wartete, bis sie in der Tür erschien und mich zu sich winkte.
Das lief bei uns immer nach demselben Muster ab. Diese Routine gab ihr Halt. Ich schnappte meine Tasche und stand auf. Endlich durfte ich mich zu Crawford setzen.
»Heute hat er ein bisschen mehr Hirnaktivität gezeigt. Die kurze Zeit, die Knox bei ihm war und ihm etwas vorlas, hat ihm gutgetan, denke ich. Ruf mich sofort an, wenn sich irgendwas tut«, sagte Juliet. Das wären ja eigentlich gute Neuigkeiten gewesen, hätte sie im vergangenen Monat nicht auch schon jeden Tag dasselbe behauptet.
»Mach ich!«
Sie nickte, warf noch mal einen Blick zu seiner Tür zurück, drückte mir die Schulter und ging.
Das war der einzige Zeitpunkt des Tages, auf den ich mich freute und vor dem ich mich zugleich fürchtete. Es fiel mir immer wieder schwer, den schlafenden Crawford an diese Gerätschaften angeschlossen zu sehen. Es tat immer wieder weh. Noch genauso sehr wie an dem Abend, als er das neue Stoppschild an der County Road 14 missachtet und uns ein Lkw auf Crawfords Seite mit fünfzig Meilen pro Stunde gerammt hatte. Ich hatte nicht mal das Bewusstsein verloren, im Gegenteil, ich konnte mich an jede Sekunde erinnern. Wie ich seinen Namen geschrien hatte, als er leblos dalag. Nicht imstande, ihn zu befreien oder auch nur meine Tür aufzukriegen. Von der tiefen Schnittwunde am Kopf tropfte mir Blut in die Augen und trübte meinen Blick, doch ich hatte alles miterlebt. Jede entsetzliche Sekunde.
Bei mir war von jenem Abend nur die Narbe unterhalb meines Haaransatzes zurückgeblieben, wo man mich hatte nähen müssen. Meine Blutergüsse waren längst verheilt. Die Gehirnerschütterung ebenso. Es war nicht fair, dass er es war, der dort lag. Ich hatte gelacht, als er bei einem Song mitgesungen, mal wieder keinen Ton getroffen und mich dann angelächelt hatte. Das war das Letzte, was ich gesehen hatte, ehe wir uns mehrmals überschlugen, Metall auf Metall krachte, und der Gestank von brennendem Gummi die Luft erfüllte.
Ich betrat den Raum. Crawford war magerer denn je, doch zumindest waren die Blutergüsse und Schnittwunden in seinem Gesicht verheilt, und er sah nicht mehr so versehrt und verwundet aus. Nur so, als schliefe er friedlich und bräuchte dringend einen Double-Cheeseburger.
Crawford liebte Double-Cheeseburger mit extra Gurkenscheiben und Senf. Inzwischen ertrug ich nicht mal mehr deren Anblick. Nicht ohne ihn.
»Ich bin da. Und hab ein neues Buch mitgebracht. Eins mit viel Action und wenig Liebeskram. Ach, und deine Mutter war überzeugt, du hättest heute Fortschritte gezeigt. Es ist so schön, sie glücklich zu sehen!«
Das war geschwindelt. Sie war alles andere als glücklich, aber falls er mich hören konnte, wollte ich nicht, dass er sich Sorgen um seine Mom machte. Das machte er nämlich immer.
»Knox hat mir einen Brokkoliauflauf und Brathähnchen mitgebracht. Moms Spezialität. Ich glaube, sie versucht, mich zu mästen. Er hat erzählt, er habe dir aus der College-Sport-Website vorgelesen, die du so liebst. Da hat er doch garantiert öfter mal seinen Senf dazu abgegeben, oder?«
In der Hoffnung, er könnte mich hören, sprach ich über alles, was am Tag so losgewesen war. Ich stellte mir gern vor, ich müsste ihn nur neugierig genug machen, dann würde er die Augen aufschlagen und mich ausquetschen. Mehrere Nächte in der Woche träumte ich, dass er wieder zu Bewusstsein käme, während ich mit ihm redete oder ihm die Hand hielt. Dann, wenn ich schließlich aufwachte, weinte ich, weil es nicht wahr wurde. Wenn er mein Lächeln nicht erwiderte, war mein Herz leer. Ich war verloren und würde es auch bleiben, bis er wieder aufwachte.
Einen Augenblick spielte ich mit dem Gedanken, ihm von Slate zu erzählen. Die Begegnung mit ihm war das einzig Ungewöhnliche an diesem Tag gewesen. Bis darauf, dass ein anderer Patient, ein gewisser Mr Wagoner, nach Hause entlassen worden war. Es würde mir abgehen, ihn in seinem Rollstuhl durch die Gänge kurven zu sehen. Aber ich wusste, er wurde von seinen Kindern und Enkelkindern schon sehr vermisst.
»Wenn ich heute Abend gehe, steht mir ein Basketballmatch mit den McKinley-Jungs bevor. Um sie zu schlagen, brauche ich deine Hilfe. Du weißt doch, wie gnadenlos die sind.«
Früher hatten Crawford, Knox und ich immer gegen Jonah, Michea und Dylan gespielt. Die Jüngeren gegen die Älteren. Erst als Dylan geheiratet hatte und weggezogen war, hatten wir sie endlich mal bezwingen können. Dass Crawford in einem Sommer fast dreizehn Zentimeter gewachsen war, hatte sich da auch als hilfreich erwiesen. Damals hatte er mit seinen ein Meter zweiundneunzig größenmäßig mit Jonah gleichgezogen.
»Zum Lunch habe ich noch ein Extrastück Sahnetorte mitbekommen. Ich glaube, Mom versucht, dich mit ihren Leckereien zu bestechen. Für mich ist es jedenfalls nicht, das weiß ich.«
Auch ich hatte abgenommen. Ungefähr drei Kilo, was sich bei meinen ein Meter achtundsechzig schon deutlich bemerkbar machte. Ja, Mom versuchte eindeutig, mich zu mästen.
Mein Handy summte, und ich warf einen Blick darauf.
Vergiss das Spiel heute Abend nicht! Die Nachricht stammte von Dylan, der mich aus mehreren Gründen zu Hause sehen wollte. Maddys Töpfchentraining war nur einer davon.
Keine Bange!, textete ich zurück und sah dann wieder zu Crawford.
»Ich will dich wiederhaben, Crawford. Ich vermisse dich!«
Keine Reaktion. Nicht mal ein Zucken.
Tränen stiegen mir in die Augen, und ich wischte sie weg, bevor ich meine Tasche abstellte und es mir neben ihm im Stuhl bequem machte. Bald würde ich ihm vorlesen, doch für den Moment wollte ich einfach nur seine Hand halten und ihm beim Atmen zuschauen. Mich vergewissern, dass Crawford da drinsteckte und zu mir zurückkehren würde. Bald.
4. Kapitel
Der Kaffee da ist scheiße! Hier, nimm den.«
Ich hatte gelesen, als mir unvermittelt eine himmlisch duftende Tasse Kaffee – das war definitiv keine schale Krankenhausplörre – unter die Nase gehalten wurde.
Ich kannte diese Stimme. Der Aufreißertyp war zurück! Und er hatte Kaffee dabei.
Ich nahm die Tasse, noch bevor ich zu ihm aufsah, und rang mir ein »Danke« ab. Es fiel mir schwer, aber schließlich war ich gut erzogen. Er war nett zu mir, weil ich Knox’ Schwester war. Damit kam ich klar.
»Du kommst ja zeitig her. So früh bin ich noch nie hier gewesen. Hab nicht gut geschlafen, weshalb ich mir dachte, ich mach mich gleich ans Tagwerk!«
Musste ich mich jetzt etwa mit ihm unterhalten, nur weil er mir einen gescheiten Kaffee mitgebracht hatte? Sah ganz danach aus. Außerdem war sein Onkel schwer krank. Wo war mein Mitgefühl geblieben?
»Wie geht’s deinem Onkel?«, fragte ich, denn nur das interessierte mich, was ihn anging. Es machte mich traurig, wenn jemand einen geliebten Menschen verlor.
Er zuckte die Achseln. »Immer noch derselbe Dickkopf, flucht wie ein Bierkutscher, ist weiterhin hundsgemein und gleichzeitig ziemlich liebenswert.«
Seine Antwort erstaunte mich. Andererseits fragte man sich, ob man von diesem Slate überhaupt je eine normale Antwort bekam.
»So«, fuhr er fort. »Wir haben zusammen Kaffee getrunken, teilen uns einen Bruder und hängen beide hier täglich rum. Das macht uns zu Freunden, glaube ich.«
»Wir teilen uns keinen Bruder«, sagte ich hastig.
Schmunzelnd nippte er an seinem Kaffee. »Kappa Sigma würde das anders sehen. Brüder fürs Leben!«
Ich wollte die Augen verdrehen, aber der Kaffee war köstlich, und so ließ ich es bleiben.
»Warum bist du die ganze Zeit hier, Vale?«, fragte er und überraschte mich mit meinem Namen. Von mir hatte er diese Info nicht.
»Woher kennst du meinen Namen?«, fauchte ich.
»Wie gesagt: Wir teilen uns einen Bruder. So, und nun sag: Was hält dich hier und lässt dich diese Wand anstarren?«
»Wenn wir uns denn einen Bruder teilen, müsstest du das eigentlich schon wissen!«
»Touché!« Er trank einen weiteren Schluck. »Okay. Wenn man’s genau nimmt, teilen wir uns nicht wirklich einen Bruder. Ich kenne Knox’ Geschmack, was Bier, Karten und Frauen angeht. Viel mehr weiß ich nicht. Und so wusste ich zum Beispiel bis gestern nicht, dass er eine Schwester hat. Kann ich also bitte erfahren, was meine neue Freundin hier den ganzen Tag lang so treibt?«
Ich stellte mich ganz schön an. Warum? Der Typ hier wollte nur nett sein. Dann flirtete er eben gern und war ein Playboy. Was kümmerte mich das? Hatte ich etwa Vorurteile? Gott, das wollte ich nicht hoffen.
»Mein Freund liegt im Koma.« Es laut auszusprechen tat weh. Als würde einem ein Messer in die Brust gerammt und man bekäme kaum noch Luft.
»Autsch!«, sagte er, als würde er den Schmerz fühlen, der mich gerade überwältigt hatte. »Wie ist das passiert?«
Ich musste darüber sprechen. Es tat mir gut, es mir von der Seele zu reden. Es zu akzeptieren versuchen. »Durch einen Autounfall am Abend nach unserem Highschool-Abschluss. Ich saß auch mit im Wagen.«
»Fuck«, murmelte er und ließ die Hand sinken, sodass sein Armgelenk auf seinem Schenkel ruhte, während er mit derselben Hand seine Tasse hielt. »Wie lang ist das her – einen Monat?«
Ich nickte. Einen Monat und einen Tag.
»Warum kannst du nicht bei ihm im Zimmer sitzen? Jeden Tag ganz allein hier draußen zu hocken, das wirkt … so einsam.«
Der löcherte einen vielleicht!
»Ich bin nur für drei Stunden am Tag eingeteilt. Dann können seine Eltern eine Pause machen.«
Er beugte sich vor, stützte die Ellbogen auf die Knie und sah mich so an, dass ich seinen Blick erwidern musste, wenn ich nicht unhöflich stur geradeaus starren wollte.
»Ansonsten sitzt du hier die ganze Zeit einfach nur rum …?«
Seinen Kaffee wusste ich zu schätzen. Ernsthaft. Seit Langem hatte ich keinen so köstlichen mehr getrunken, aber dieser Kerl war neugierig, und ich war nicht in der Stimmung, mich zu rechtfertigen. Wenn ich den ganzen Tag hier sitzen wollte, dann konnte ihm das egal sein. Weder er, noch meine Eltern, meine Brüder oder sonst wer brauchten das zu verstehen. Ich tat, was ich tun musste, um die Tage zu überstehen. Mein Leben befand sich in Crawfords Zimmer, und ich würde ihn nicht verlassen.
»Ja«, erwiderte ich.
Er nickte, nippte wieder an seinem Kaffee und richtete seinen Blick dann auf die Wand vor ihm. »Du musst ihn wirklich lieben.«
»Das tue ich schon, seit ich sechs bin und er meinen Lieblings-Brownie mit in die Schule genommen und heimlich in meine Lunchbox geschmuggelt hat.« Das war mehr, als ich irgendjemandem seit dem Unfall über Crawford oder unsere Vergangenheit erzählt hatte. Und doch war es mir ganz leicht über die Lippen gekommen.
Slate machte sich nicht über mich lustig. Stattdessen lächelte er. Ein kleines Lächeln, bei dem sich seine Mundwinkel nur ganz leicht hoben. »Das ist eine sehr nette Erinnerung.«
Ja, das stimmte. Ich hatte eine Million solcher Erinnerungen.
»So eine Liebe habe ich selbst noch nicht erlebt. Und glaube auch nicht dran. Aber es ist schön, jemandem zuzuhören, bei dem das so ist.« Er nahm noch einen großen Schluck Kaffee und erhob sich.
»Ich hoffe, dein Typ schlägt bald wieder die Augen auf«, sagte er. »Ich muss jetzt zu dem alten Herrn reinschauen und mich von ihm beim Pokerspiel schlagen lassen. Das gibt ihm das Gefühl, etwas vollbracht zu haben.«
Unvorstellbar, dass Slate irgendjemanden auf dieser Welt gewinnen ließ. Das Wissen, dass er das absichtlich tat, machte ihn etwas menschlicher. Das und der Kaffee. Der Kaffee schmeckte wirklich super.
»Danke. Den habe ich echt gebraucht.« Ich hob meine Tasse ein wenig.
Er zwinkerte mir zu. »Tun wir das nicht alle?« Mit diesen Worten wandte er sich um und ging davon.
Mag sein, dass ich ihm hinterhersah, bis er um eine Ecke bog. Nicht, dass ich ihn mochte, aber, wie gesagt, sein Gang, der hatte was.
»Es heißt, Slate Allen würde sich hier befinden?«, riss eine Krankenschwester mich aus meinen Gedanken, und das war auch dringend nötig.
Sein Nachname lautete also Allen.
»Er ist gerade in diese Richtung da verschwunden. Zum Zimmer seines Onkels.« Ich deutete den Gang entlang.
Sie strahlte. »Danke schön!« Und weg war sie.
Es handelte sich um eine andere als am Vortag. Die Krankenschwestern hier mussten ein paar Jährchen älter sein als er, doch das schien sie nicht zu stören. Kein Wunder, dass er so von sich eingenommen war.
Slate war attraktiv. Das musste man ihm lassen. Mit seinem Aussehen zog er alle Blicke auf sich und ließ Mädchenherzen höherschlagen. Doch darauf pfiff ich. Ein hübsches Gesicht und ein muskulöser Körper ließen mein Herz kalt. Denn das gehörte jemandem, der in einem Krankenhauszimmer lag, und so würde es immer sein. Eines Tages würde ich Crawford erzählen, was alles vorgefallen war, während er im Koma lag, und wir würden lächeln.
Er war eine Kämpfernatur, jawohl!
Mein Handy vibrierte in meiner Tasche, und ich wusste, nun würden wieder haufenweise Nachrichten eintrudeln. Gestern Abend hatte ich Basketball gespielt und selbst gebackenen Erdbeerkuchen gegessen, während ich mich mit Maddy übers Aufs-Töpfchen-Gehen unterhalten hatte. Mit jedem hatte ich mich beschäftigt. Heute mussten sie mir eine Pause gönnen und Ruhe geben.
Sobald Crawford wieder aufwachte, würde alles gut sein.
5. Kapitel
Tante Vale!« Maddys und Malyns Stimmchen erklangen durch die Krankenhausflure und erregten nicht nur meine Aufmerksamkeit. Mit identischen braunen Augen wie die ihrer Mutter und zu Zöpfen geflochtenen braunen Haaren, die vor und zurück schwangen, kamen sie mit weit auseinandergebreiteten Armen auf mich zugerannt.
Wenn ich den ganzen Tag hier im Krankenhaus verbrachte, vermisste ich niemanden so sehr wie die beiden. Ich legte mein Buch weg und stand genau zur rechten Zeit auf, um beide aufzufangen. Kleine Arme schlangen sich um mich. Mir schossen Tränen in die Augen, und ich drückte sie fest an mich.
»Meine Lieblingsmädchen sind da!« Ich küsste sie beide auf die Stirn, dann aufs Näschen.
»Hab mir gedacht, wenn ich Maddy zu Hause nicht dazu bringen kann, sich aufs Töpfchen zu setzen, dann bring ich sie eben zu dir!« Dylan sah genauso aus, wie ein verzweifelter Vater von Zwillingen im Kleinkindalter auszusehen hatte.
Während ich mit meinem großen Bruder lachte, verspürte ich Freude. Ein flüchtiges Gefühl, aber immerhin.
Ich legte den Kopf ein wenig zurück und sah zu Maddy. »Du musst das Töpfchen wie ein großes Mädchen benutzen, selbst wenn ich nicht da bin. Möchtest du denn, dass Malyn ohne dich mit der Schule für große Mädchen anfängt?« Die »Schule für große Mädchen« war die Vorschule, die im Übrigen erst im Herbst losging, doch beide Mädchen waren schon ganz aus dem Häuschen deswegen. Ich sollte im Herbst eigentlich aufs College gehen. Zusammen mit Crawford. Ob das klappte, stand inzwischen allerdings in den Sternen.
Maddy zuckte die Achseln. »Will bei dir bleiben.«
Was tun? Besorgt sah ich zu Dylan auf.
»Sie liebt dich und vermisst dich«, sagte er. »Wie wir alle.«
Schuldgefühle! Aber ich musste hier bei Crawford sein, er würde mich dahaben wollen, wenn er die Augen aufschlug. Das musste doch allen einleuchten!
»Ich liebe und vermisse sie auch. Euch alle. Aber habt doch bitte Verständnis, warum ich hier sein muss. Was, wenn es sich um Catherine handeln würde?«
Dylans Gesicht verfinsterte sich. »Schon verstanden. Was aber nicht heißt, dass ich dich nicht vermisse und mir Sorgen um dich mache.«
»Ich kann einen Spagat machen!«, sagte Malyn und zupfte mich am Arm, um meine Aufmerksamkeit zurückzugewinnen.
»Wirklich?«, fragte ich mit erstaunter Stimme, auch wenn ich mir das schon Tausend Male angesehen hatte. Malyn liebte es, damit eine Schau abzuziehen. Also sah ich ihr zu und klatschte, als sei es das Beste auf der Welt.
»Und ich kann das!« Maddy stellte sich auf die Zehenspitzen und wirbelte im Kreis herum.
»Wow, das ist ja super!« Ich griff aus, um ihr Halt zu geben, bevor ihr noch schwindelig wurde und sie hinstürzte.
»Warum zeigen wir Tante Vale nicht, wie du das Töpfchen für große Mädchen benutzt?«, schlug Dylan vor. »Malyn trägt schon Höschen für große Mädchen, Maddy aber noch eine Pull-Up-Windel«, informierte er mich, drückte mir eine Windelpackung in die Hände und sank auf den Stuhl neben mir. Daddy sah aus, als bräuchte er eine Pause.
»Na kommt, ihr zwei.« Ich führte sie den Gang entlang zu den Toiletten.
Gerade waren wir um die Ecke gebogen, als Maddy sagte: »Schau mal, Tante Vale. Der Junge da küsst die Krankenschwester!«
Ich folgte ihrem Blick und entdeckte in einer Ecke die Krankenschwester von vorhin zusammen mit Slate. Seine Hand lag auf ihrem Po, und sie presste sich an ihn, als bräuchte sie ihn wie die Luft zum Atmen. Eine öffentliche Zurschaustellung von »Zuneigung« in einem Krankenhaus, wo Leute dahinsiechten und starben – echt jetzt? Slate Allen war widerlich.
»Hat sie ihm sein Aua heile gemacht?«, erkundigte sich Malyn neugierig.
Ich war mir sicher, er hatte ihr schon ein paar Auas heile gemacht!
Ich lenkte die Aufmerksamkeit der beiden Kleinen auf die Toilettentür und dann aufs Töpfchengehen. Sogar das Lied sang ich dazu. Bei beiden mit Erfolg. Maddys Pull-up-Windel war trocken geblieben, und nachdem wir uns die Hände gewaschen hatten, verließen wir die Toilette wieder und entdeckten zum Glück eine leere Ecke. Kein weiteres Herumgeknutsche vor den Augen der neugierigen kleinen Mädchen.
Mein Glück verließ mich allerdings prompt, als wir um die Ecke bogen und sahen, dass sich Dylan mit niemand anderem als dem Krankenschwester-Romeo unterhielt.
»Daddy, wir waren auf dem Töpfchen!«, verkündete Maddy, während sie auf den Wartebereich zurannte.
Malyn kapierte, dass der Typ bei ihrem Dad derselbe war, der gerade noch die Krankenschwester geküsst hatte. Sie verlangsamte den Schritt und schlang ihre kleine Hand um mein Bein. Sie war die Schüchterne der beiden.
»Du hast die Krankenschwester geküsst! Hat sie dein Aua heile gemacht?«, kam Maddy gleich zur Sache.
Angesichts Dylans verwirrter Miene hätte ich beinahe gelacht. Aber nur beinahe.
Ende der Leseprobe