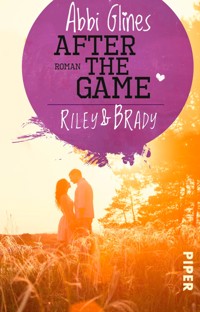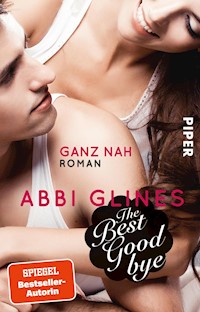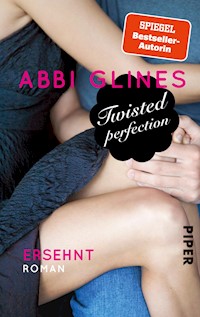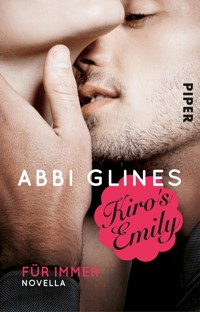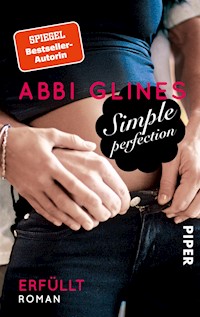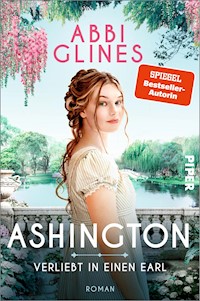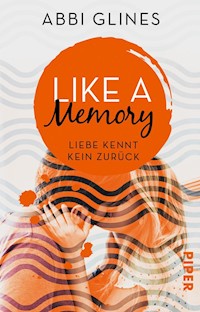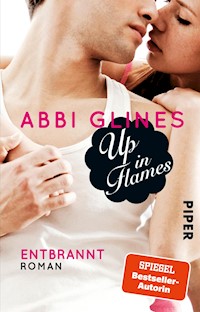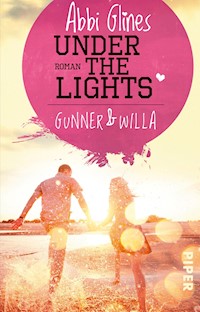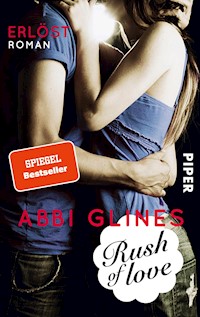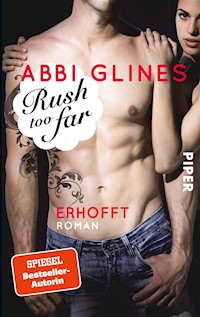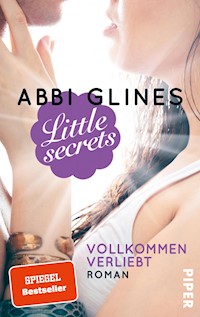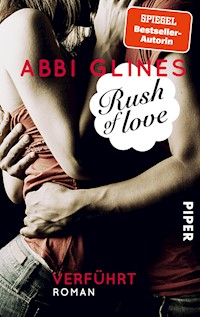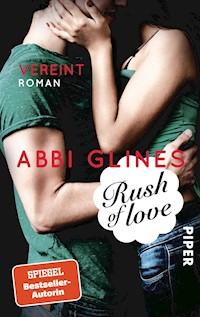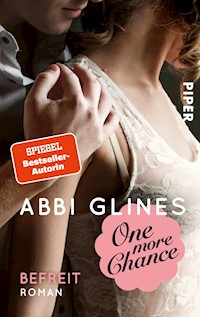
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Grant hat um Harlows Herz gekämpft, und er hat ihr bewiesen, dass sie ihm vertrauen kann. Da er längst nicht mehr der Playboy ist, für den alle ihn halten, hat Harlow sich schließlich auf ihn eingelassen. Sie hat all die neuen Gefühle und Wünschen zugelassen, die er ihn ihr weckt. Beinahe scheint es so, als könnten sie zusammen glücklich werden. Doch obwohl sie Grant vertraut, hat Harlow ein Geheimnis für sich behalten. Ein Geheimnis, das alles für immer verändern könnte und eines Tages alles zerstören wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Heidi Lichtblau
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96838-6
© 2014 Abbi Glines Titel der amerikanischen Originalausgabe: »One more Chance«, Atria Paperback (A Division of Simon & Schuster, Inc.), New York 2014 Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2014 Covergestaltung: Zero Werbeagentur, München Covermotiv: Elisabeth Ansley/Arcangel Images Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Für meinen Bruder Jody Potts. Du hast mich durch eine Liebesgeschichte aus Deiner Vergangenheit zu diesem Teil der Reise von Grant und Harlow inspiriert. Ich habe sie nie vergessen und weiß inzwischen auch, warum sie mir all die Jahre nicht aus dem Kopf gegangen ist.
»Den Augenblick in deinem Leben, in dem dir aufgeht, dass du dein Leben total versaut hast, diesen Augenblick kenne ich – nur zu gut.«
Grant Carter
Ich bin’s, aber das dürfte dir klar sein. Das hier ist meine achtundvierzigste Nachricht … Das heißt, ich habe dich seit achtundvierzig Tagen nicht mehr zu Gesicht bekommen. Dich nicht mehr in den Armen gehalten. Dein Lächeln nicht mehr gesehen. Harlow, ich weiß nicht, wo du steckst. Ich habe überall nach dir gesucht, Babe. Wo bist du bloß? Hörst du dir meine Nachrichten überhaupt an? Deine Mailbox ist alles, was mir von dir geblieben ist. Ich hab’s versaut. Total. Ich muss deine Stimme hören. Ich muss dich … ich muss dich einfach sehen, Harlow. Wenn ich dich nicht in den Armen halten kann, kriege ich das alles nicht …«
Piep!
Eine weitere Nachricht, die mittendrin abgeschnitten wurde. Diese verfluchte Mailbox ließ mich nie ausreden. Dabei wusste ich ja nicht mal mit Sicherheit, ob sich Harlow ihre Mailbox-Nachrichten überhaupt anhörte. Seitdem sie mich an jenem unheilvollen Abend in meiner Wohnung verlassen hatte, rief ich täglich bei ihr an, doch bislang hatte sie nie darauf reagiert. Ich war sogar zum Haus ihres Dads nach Los Angeles gereist, doch keiner schien zu Hause zu sein, wovon ich mich allerdings nicht persönlich überzeugen konnte, da man mich nicht einmal am Tor vorbeiließ und die Security mir damit drohte, die Polizei zu rufen.
Rush zufolge hielt sich Harlow aber auch nicht in Beverly Hills auf. Sie hatte ihm zwar kurz nach unserer Trennung erzählt, wo sie unterkommen wollte. Bei meinen Versuchen, ihn darüber auszuhorchen, hatte ich jedoch auf Granit gebissen. Er rückte mit keinerlei Informationen heraus. Sie brauche Zeit, argumentierte er, und die solle ich ihr geben. Daraufhin hatte mich so eine Wut gepackt, dass ich ihm zum ersten Mal in meinem Leben einen Kinnhaken verpasst hatte. Er hatte nur gegrinst und die Ruhe bewahrt, mich aber gewarnt, dass er sich das kein zweites Mal gefallen lassen werde. Bei allem Verständnis für meine Lage, beim nächsten Mal werde er zurückschlagen.
Im Nachhinein hatte ich mich ziemlich mies gefühlt. Schließlich wollte er Harlow nur beschützen, und so jemanden brauchte sie. Ich ertrug es nur nicht, sie nicht in den Armen halten zu können. Ihr nicht erklären zu können, warum ich mich so idiotisch benommen hatte.
Erst seit Kurzem sprach Blaire überhaupt wieder mit mir. Als sie Rushs übel zugerichtetes Gesicht gesehen hatte, war sie so wütend geworden, dass sie mich fast einen Monat lang wie Luft behandelt hatte.
Außer mit Harlows Mailbox konnte ich mit niemandem sprechen.
Morgens wachte ich auf, ging zur Arbeit und klotzte auf den Baustellen so richtig ran. Das brauchte ich, um nachts schlafen zu können. Ich fuhr erst nach Hause, wenn die Sonne unterging und ich nicht mehr arbeiten konnte. Dann aß ich etwas, nahm ein Bad, versuchte Harlow auf ihrem Handy zu erreichen und legte mich schlafen. Am nächsten Tag ging es wieder von vorn los.
Sogar Nannette hatte aufgehört, mich zu nerven. Nachdem ich weder auf ihre Anrufe reagiert noch ihr die Tür aufgemacht hatte, wenn sie vorbeigekommen war, hatte sie wohl endlich eingesehen, dass ihre Bemühungen sinnlos waren, und ließ mich seitdem in Ruhe. Ich hätte ihren Anblick nicht ertragen, der mich zudem daran erinnert hätte, wie viel Kummer ich Harlow bereitet hatte. Nein danke, ich brauchte keine weiteren Erinnerungen daran, was ich Harlow alles angetan hatte!
Kann man sich selbst hassen? Ich mochte mich jedenfalls nicht mehr im Spiegel sehen. Warum hatte ich mich bei unserer letzten Begegnung nicht besser im Griff gehabt und so viel Mist geredet? Ich hatte alles kaputt gemacht. Hatte sie verletzt. Ich wusste noch genau, wie ich sie zur Schnecke gemacht hatte, weil sie mir nichts von ihrer Krankheit erzählt hatte. Und ich erinnerte mich sehr gut daran, wie sie mich dabei angesehen hatte. Sie hatte sich gefürchtet, und ich hatte nur meine armseligen Ängste im Kopf gehabt. Wie hatte ich mich zu so einem Egoisten entwickeln können? Ich hatte einen Riesenschiss gehabt, sie zu verlieren, und genau dadurch hatte ich sie in die Flucht geschlagen.
Ich war ein herzloser Mistkerl. Ich verdiente sie nicht, aber ich wollte sie mehr als mein Leben.
Im Moment verlor ich wertvolle Zeit mit ihr. Ich wollte mich vergewissern, dass sie gut und sicher untergebracht war. Wollte bei ihr sein, mich um sie kümmern, auf ihre Gesundheit achten. Wer außer mir war dazu denn schon in der Lage? Fuck! Bei dem Gedanken, dass sie vielleicht nicht mehr am Leben war, zerriss es mich förmlich.
»Du musst mich anrufen, Schatz! So kann ich nicht weiterleben. Ich muss zu dir!«, rief ich in den leeren Raum hinein.
Ich saß auf einem Heuballen, hatte die Knie ans Kinn gezogen, die Arme um die Beine geschlungen und sah zu, wie mein Halbbruder Mase ein junges Rassepferd dressierte, das ihn gerade in den Wahnsinn trieb. Es lenkte mich von meinen Grübeleien ab, und das tat gut. Ich ertappte mich sogar dabei, dass ich mich mehr darum sorgte, Mase könnte sich den Hals brechen, als um meine eigenen Probleme.
Der Abend würde noch früh genug hereinbrechen. Mein Handy würde klingeln, und dann würde meine Mailbox mit einem Signalton das Eintreffen einer weiteren Nachricht von Grant verkünden. Die Stunden darauf würde ich mit gemischten Gefühlen an die Wand starren. Ich hätte mir seine Nachrichten so gern angehört. Ich vermisste ihn. Ich vermisste seine Stimme. Vermisste sein Lächeln mit den hübschen Grübchen in den Wangen. Aber es ging nicht, selbst wenn es ihm leidtat – und daran zweifelte ich nach den vielen Telefonanrufen und den Versuchen, an der Security vorbei in Dads Haus zu gelangen, nicht mehr.
Er litt unter Verlustängsten, ganz klar. Wenn ich ihm erzählen würde, dass ich unser gemeinsames Kind unter dem Herzen trug und die Geburt möglicherweise nicht überstehen würde, dann würde er, so fürchtete ich, denselben Schritt vorschlagen wie Mase. Einen Schritt, den mir übrigens auch die Ärzte nahelegten.
Ich liebte Grant Carter über alles. Aber genauso innig liebte ich jemanden anders. Ich legte mir die Hand auf den Bauch. Noch war er flach, aber ich hatte bei der Ultraschallaufnahme schon das kleine Leben darin gesehen. Wie konnte man von mir erwarten, es abzutreiben? Ich liebte es doch schon! Genauso wie seinen oder ihren Vater. Ich hatte nie damit gerechnet, so etwas jemals erleben zu dürfen. Das war ein Traum, den ich eigentlich schon vor Langem begraben hatte.
Ich wollte dieses Kind. Ich wollte Grants Kind das Leben schenken. Ein wunderbares, ausgefülltes Leben. Ein Leben voller Liebe und Geborgenheit. Meine Großmutter war strikte Abtreibungsgegnerin gewesen, und ich hatte mich immer gefragt, ob sie in meinem Fall anderer Meinung gewesen wäre. Aber es war mir nie in den Sinn gekommen, ich könnte mit einem Mann, den ich liebte, ein Kind zeugen. Mit einem Mann, der in mir Wünsche weckte, die ich nicht haben durfte.
Natürlich hatte ich manchmal Angst, die Ärzte könnten recht behalten und ich würde die Geburt nicht überleben. Ich aber glaubte an dieses Kind. Ich wollte es lieben, in den Armen halten und ihm die Gewissheit geben, dass ich für sie oder ihn alles tun würde. Ich wollte ein eigenes Kind, und zwar so sehr, dass ich fest davon überzeugt war, es zu bekommen und zu überleben. Ich würde das schaffen!
Ich hätte mir nur so gewünscht, dass Mase Verständnis gehabt hätte. Ich hasste es, wenn die Furcht in seinen Augen aufflackerte, wann immer sein Blick auf meinen Bauch fiel. Natürlich liebte er mich und hatte eine Heidenangst, mich zu verlieren. Aber er hätte Vertrauen haben müssen, dass ich es hinbekam – dass ich mit schierer Willenskraft Schwangerschaft und Geburt überstehen würde. Als hätte Mase meine Gedanken gehört, sprang er vom Pferd und sah zu mir herüber. Mit besorgtem Blick, wie immer. Ich beobachtete, wie er das Pferd zurück in den Stall führte. Wir waren den ganzen Vormittag hier draußen gewesen, und nun war es Zeit für das Mittagessen.
Sein Stiefvater hatte ihm im rückwärtigen Teil seines Anwesens ein Stück Land geschenkt, auf dem Mase sich ein kleines Blockhaus gebaut hatte. Ich konnte von Glück reden, dass es in seinem hundertzwanzig Quadratmeter großen Haus zwei Schlafzimmer gab. Niemand wusste von diesem Haus, denn es lag ziemlich abgelegen und vor neugierigen Blicken geschützt. Und das war gut so, denn die Medien wussten inzwischen, dass ich Kiros Tochter war, und daher konnte ich nicht mehr so leicht abtauchen. Als eines Tages die Pressegeier an der Haustür von Mase’ Mutter klopften, erklärte sie ihnen einfach, sie seien hier verkehrt, und wenn sie sich nicht auf der Stelle wieder verzögen, werde sie die Polizei rufen.
Seitdem herrschte Ruhe. In die Stadt gingen wir nicht, und ich versteckte mich weiterhin in Mase’ Blockhaus. Abgesehen von den Besuchen beim Frauenarzt, zu denen Mase’ Mutter mich fuhr, lebte ich völlig abgeschieden. Dad hatte ein paarmal angerufen, doch ich hatte ihm nichts von der Schwangerschaft erzählt. Ich selbst wusste ja auch erst seit Kurzem davon.
Mase wollte es Kiro erzählen, da er davon überzeugt war, dass Dad mich zu einer Abtreibung würde überreden können. Doch da lag er falsch, an meinem Entschluss war nicht zu rütteln. Mein Herz hatte sich längst entschieden. Und wenn mein Überlebenswille doch nicht reichte, würde mein Kind immerhin geliebt werden. Die einzige Person, die mich bei meinem Entschluss unterstützte, hatte mir versichert, sie werde dieses Kind großziehen und es lieben, als wäre es ihr eigenes.
Maryann Colt war eine Mutter, wie jedes Kind sie verdiente. Wenn ich als kleines Mädchen meinen Halbbruder Mase besuchte, backte seine Mutter uns Plätzchen und machte Picknicks mit uns. Wenn sie uns abends ins Bett steckte, küsste sie Mase auf die Wange und sagte, dass sie ihn liebe, und machte dann mit mir dasselbe. Als gehörte ich auch zu ihnen.
Und Maryann wusste, was es bedeutete, Mutter zu sein. Sie verstand mein Bedürfnis, dieses Kind zu beschützen. Als mir die Ärzte die Schwangerschaft bestätigten, hatte sie mir die Hand gehalten. Ihre Tränen rührten von Freude, nicht von Trauer. Sie hatte meine Freude geteilt. An diesem Abend hatte ich zum ersten Mal erlebt, wie Mase und seine Mutter sich stritten. Maryann hatte sich auf meine Seite gestellt, als ich erklärte, für mich komme eine Abtreibung nicht infrage. Mase war außer sich gewesen und hatte mich gebeten, mir das Ganze doch noch mal gründlich zu überlegen.
Ich wusste, mit Grant gäbe es noch viel heftigere Diskussionen. Es brachte nichts, mir einzureden, er habe mich vergessen oder ich sei ihm inzwischen egal. Ich wusste es besser, schließlich rief er noch täglich an und hinterließ eine Nachricht. Er schien das Risiko eingehen zu wollen, jemanden wie mich zu lieben, trotz meines Gesundheitszustands. Durch die Schwangerschaft würde das Risiko einer Verschlechterung bedeutend steigen. Letzten Endes glaubte ich nicht, dass er diesem Druck gewachsen wäre. Dafür hatte ich seine Worte bei unserer letzten Begegnung noch zu gut im Ohr. Wir hatten unsere Chance vertan.
»Alles okay mit dir?«, riss Mase mich aus meinen Gedanken. Mit der Hand schirmte ich meine Augen vor der Sonne ab und blinzelte zu ihm auf. Er trug seine ausgeblichenen Jeans und ein blau kariertes Hemd. Eine feine Staubschicht bedeckte ihn, und nun schob er seinen Cowboyhut zurück und wischte sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn.
»Ja, alles okay. Ich war mit den Gedanken nur gerade ganz woanders.«
Er streckte mir die Hand entgegen. »Komm, lass uns zu Mom gehen. Das Essen steht bestimmt schon auf dem Tisch.«
Maryann kochte jeden Mittag eine warme Mahlzeit. Sie war der Meinung, ihre Jungs bräuchten das, um draußen ganze Arbeit leisten zu können. Nach einem folgenreichen Sturz von seinem Traktor musste Mase’ Stiefvater noch immer einen Gehstock benutzen, auch wenn er keinen Gips mehr trug. Mase hatte nun schon eine ganze Weile seine Arbeit mit übernommen und schien erleichtert darüber, dass er allmählich wieder einsatzfähig war. Sein Stiefvater züchtete Mastrinder – eine echte Knochenarbeit. Und Mase hatte bislang nur Pferde dressiert.
Ich ergriff die Hand meines Bruders und ließ mich von ihm hochziehen. Ich würde ihm nicht gestehen, dass ich mich wegen meiner Appetitlosigkeit ziemlich schwach fühlte. Mir war zwar nicht übel von der Schwangerschaft, aber ich vermisste Grant und bekam daher kaum etwas runter. Zu gern hätte ich diese Zeit mit ihm gemeinsam erlebt. Ich wollte ihn lächeln sehen, lachen hören. Ich wollte mehr, als er mir geben konnte.
»Du hast schon seit Tagen nicht mehr gelächelt!« Mase ließ meine Hand los.
Ich brachte ein Achselzucken zustande. »Ich brauche dir ja wohl nichts vorzumachen. Ich vermisse Grant. Ich liebe ihn, Mase! Aber da sage ich dir ja nichts Neues.«
Nebeneinander gingen wir zu dem großen weißen Haus seiner Eltern. Es war rundherum von einer Veranda umgeben, und vor den Fenstern hingen Blumenkästen. Mase hatte eine Bilderbuchkindheit hinter sich. Er hatte die Art von Leben führen dürfen, die Leute wie ich nicht für möglich gehalten hätten, bevor sie es nicht selbst erlebt hatten. Solch ein Leben wünschte ich mir für mein Kind.
»Dann geh heute Abend doch einfach mal selbst ran, statt immer nur die Mailbox anspringen zu lassen. Er will deine Stimme hören. Wenigstens das kannst du ihm doch mal gönnen. Vielleicht geht’s dir dann auch besser«, meinte Mase.
Nicht zum ersten Mal drängte er mich, Grants Anruf anzunehmen. Ich hatte Mase nicht erzählt, warum ich Grant verlassen hatte, da ich befürchtete, dass er ihn dann hassen würde. Er würde Grants Reaktion nicht verstehen und sie ihm nie verzeihen. Dabei würden sie durch das Kind eines Tages derselben Familie angehören.
Und wenn ich nicht mehr da wäre …
»Harlow Manning, du bist so ein Sturschädel! Das ist dir doch wohl klar?« Er versetzte mir einen sanften Rippenstoß.
»Ich gehe ans Handy, wenn die richtige Zeit dafür gekommen ist. So weit ist es aber noch nicht.«
Mase seufzte frustriert auf. »Du erwartest ein Kind von ihm. Herrgott noch mal, das muss er doch wissen! Ich finde nicht richtig, was du machst.«
Ein paar Haare hatten sich aus meinem Pferdeschwanz gelöst, und ich schob sie aus dem Gesicht. Mase würde nicht kapieren, warum ich es Grant nicht erzählen konnte. Allmählich hatte ich die Unterhaltungen darüber satt.
»Niemand bringt mich dazu, mein Baby aufzugeben. Und ich gebe meinem Leben keinen Vorrang gegenüber dem des Kindes. Schluss, aus! Weißt du, am besten reden wir gar nicht mehr darüber … Ich muss es einfach auf meine Art durchziehen.«
Mase wirkte angespannt. Jede Erinnerung daran, dass ich mein Leben aufs Spiel setzte, regte ihn auf. Aber schließlich ging es um mein Leben. Ich drängte Mase nicht weiter, mir zuzustimmen. Schweigend setzten wir unseren Weg fort.
Maryann stand in einer gepunkteten Schürze am Herd, die ich ihr geschenkt hatte, als ich siebzehn war. Maryann wandte sich lächelnd zu uns um. »Ich bin fast fertig. Deckt doch bitte schon mal den Tisch, ja?« Damit drehte sie sich wieder zum Herd.
Mase ging zur Besteckschublade, und ich holte Geschirr. Inzwischen hatte sich das fast schon zu einem Ritual entwickelt. Nachdem ich für vier Personen gedeckt hatte, holte ich Gläser und füllte sie mit Eiswürfeln und süßem Tee.
»Heute brauchen wir fünf Gedecke. Major kommt zum Mittagessen. Er hat heute Morgen angerufen und gesagt, er sei auf dem Weg hierher. Dad hat sich einverstanden erklärt, ihn für das nächste halbe Jahr einzustellen. Bei ihm zu Hause herrscht gerade … nun ja … dicke Luft, und wir können hier ein weiteres Paar zupackender Hände dringend gebrauchen.«
Ich persönlich hatte Major als ausgesprochenen Fiesling in Erinnerung. Allerdings war ich Mase’ Cousin zuletzt mit zehn begegnet, insofern konnte sich seitdem einiges verändert haben. Hoffentlich hatte der kleine Wicht von damals noch etwas an Größe gewonnen und trug keine Spange mehr.
»Hat Onkel Chap immer noch vor, sich von seiner jetzigen Frau scheiden zu lassen?« Mase zog besorgt die Brauen zusammen. Major spielte in unserem Leben keine besonders große Rolle, was vor allem daran lag, dass er ständig woanders wohnte. Onkel Chap war Marineinfanterist, und zwar mit Leib und Seele. Außerdem schien er sich einen Sport daraus zu machen, so viele junge, schöne Frauen zu heiraten wie nur irgend möglich. Daher hatte Major immer wieder eine neue Mom.
Maryann stellte seufzend Brötchen auf den Tisch. »Na ja, diesmal geht es nicht darum, dass sich irgend so ein hübsches Ding einen Sugardaddy angeln wollte. Nein, Hillary hatte es auch auf Major abgesehen, und zwar mit Erfolg. Major hat sich dummerweise darauf eingelassen. Natürlich ist Chap weder auf seine Frau noch auf seinen Sohn sonderlich gut zu sprechen. Major hält sich lieber von zu Hause fern. Und zurück aufs College will er auch nicht. Der arme Junge ist völlig fertig!«
Mase stellte den Teekrug auf den Tisch und warf mir einen überraschten Blick zu. Das Ganze war ihm offensichtlich völlig neu. »Du meinst … Major hat seine Stiefmutter flachgelegt?«
»Sag nicht flachgelegt!« Maryann funkelte ihren Sohn böse an. »Ja, das hat er, aber Hillary ist ja auch gerade mal vier Jahre älter als er. Was hat Chap denn erwartet? Wenn er in seinem Alter eine so junge Frau heiratet und dann noch mit seinem attraktiven Sohn allein zu Hause lässt, während er selbst ständig unterwegs ist und arbeitet, braucht er sich doch nicht zu wundern, oder?«
Mase stieß einen anerkennenden Pfiff aus und lachte in sich hinein. »Ich fass es nicht. Major hat seine Stiefmutter flachgelegt!«, wiederholte er grinsend.
»Jetzt reicht’s! Er kann jeden Augenblick hier sein, und ich weiß, dass ihm das alles furchtbar peinlich ist. Seid bitte nett zu ihm. Stellt ihm meinetwegen Fragen übers College oder seine anderweitigen Pläne. Aber kein Wort über Hillary oder seinen Dad!«
Ich bemühte mich sehr, kein allzu verdattertes Gesicht zu machen. Auch mit noch so viel Phantasie konnte ich Major nicht mit dem Begriff »attraktiv« in Verbindung bringen. Doch ich kannte ja auch nur den zehnjährigen und nicht den zwanzigjährigen Major, der offenbar einer Frau den Kopf verdrehen konnte, die von ihm nichts wollen durfte.
In diesem Augenblick klopfte es an der Tür, und alle drehten sich um. Die Erwachsenenversion von Major Colt betrat den Raum. Sofort fielen mir seine grünen Augen auf, die fast schon smaragdfarben waren. Wie hatte ich die nur vergessen können? Mit einem unsicheren Lächeln blickte er zu seiner Tante und dann zu Mase, sodass ich ihn unauffällig weiter begutachten konnte. Inzwischen war er mindestens einen Meter fünfundneunzig groß und ausgesprochen gut gebaut, wenn man von den muskulösen Armen, die aus seinem kurzärmeligen T-Shirt herausschauten und mich sehr an die von Mase erinnerten, auf den Rest schließen durfte.
»Du warst also mit deiner Stiefmutter im Bett!« Das waren die ersten Worte, die die Stille durchbrachen. Natürlich stammten sie von Mase.
»Mase Colt Manning, du bekommst gleich einen Satz heiße Ohren!« Maryann wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab und ging auf Major zu. Der warf Mase einen Blick zu, der besagte, dass er ihm die Bemerkung keineswegs so krummnahm, wie Maryann befürchtete. Schließlich war er kein Kind mehr, das man durch so etwas in Verlegenheit bringen konnte. Im Gegenteil, er war in jeder Hinsicht ein Mann.
Major drehte sich zu Maryann um. Als sein Blick auf mich fiel, stutzte er. Dann lächelte er, diesmal ganz breit. Er schien mich erkannt zu haben. Eigentlich kein Wunder, da mein Gesicht in den letzten beiden Monaten ständig durch die Medien gegangen war.
»Na, wenn das mal nicht Miss-über-alle-Berge ist!«, rief er. »Und noch dazu viel hübscher als auf den Fotos, die im Fernsehen zu sehen waren!«
»Momentchen mal«, sagte Mase und stellte sich zwischen Major und mich. »Mag sein, dass du gern den Casanova spielst, aber Harlow steht für deine Annäherungsversuche nicht zur Verfügung. Onkel Chap hat garantiert bald eine neue Frau, der du an die Wäsche gehen kannst. Vielleicht stellst du dabei ja eine neue Rekordzeit auf …?«
»Jetzt reicht’s aber!« Maryann versetzte Mase einen Klaps auf den Arm und zog Major dann an sich. »Wir freuen uns ja so, dass du hier bist! Ignoriere bitte die Witzchen deines Cousins. Der Bursche hat kein Benehmen, tut mir leid.«
Major erwiderte Maryanns Umarmung und zwinkerte Mase über ihren Kopf hinweg zu. »Danke, Tante Maryann. Von dem lass ich mich nicht ärgern. Damit komm ich klar, ehrlich.«
»Unglaublich! Er schläft mit der Frau seines Alten, und du ergreifst auch noch Partei für ihn und stellst ihn als armes Opfer dar!«, versetzte Mase, doch er lächelte dabei.
Wieder ging die Tür auf. Dieses Mal kam Mase’ Stiefvater herein, der trotz seines Humpelns eine imposante Erscheinung abgab. Sämtliche Colts schienen sich durch eine stattliche Körpergröße auszuzeichnen.
»Schön, dich zu sehen, Junge«, begrüßte er Major. »Aber ich habe Hunger, und du wirst meine Frau loslassen müssen, damit sie mir was zu essen geben kann.«
Diesmal lachte Major, ein lautes, volles Lachen, das uns alle zum Grinsen brachte.
Nachricht Nummer fünfundfünfzig. Jeden Tag denke ich, es ist der letzte, an dem ich nur an deine Mailbox gerate, und du meldest dich endlich persönlich. Ich möchte doch nur deine Stimme hören und wissen, dass du gesund und glücklich bist. Mir geht’s beschissen. Ich bekomme zu wenig Schlaf und kann an nichts anderes denken als an dich. Ich vermisse dich, Babe. Ich vermisse dich unglaublich. Allein zu wissen, dass du gut untergebracht und gesund bist, würde mir helfen. Rush versichert mir, dass es dir gut geht, aber das muss ich schon aus deinem eigenen Mund hören. Alles … ich tue alles, wenn du nur mit mir redest!«
Piep!
Ich hasste diesen Ton. Er machte sich über meinen Kummer lustig und beendete die wenigen Sekunden, in denen ich mir einbilden konnte, Harlow würde mir zuhören. Aber wahrscheinlich hörte sie sich meine Nachrichten sowieso nicht an – sie hätte inzwischen bestimmt zurückgerufen, wenn sie sich auch nur eine meiner verzweifelten Mailboxnachrichten angehört hätte. Die konnte sie doch unmöglich einfach ignorieren.
Rush hatte behauptet, Harlow sei auch nicht bei Mase in Texas, aber ich war drauf und dran, trotzdem mal dort vorbeizuschauen, um zu erfahren, was er so wusste. Die zusätzliche Security, vor der ich gewarnt worden war, kratzte mich überhaupt nicht. Wenn ich dafür nur ein paar Antworten erhielt, ging ich meinetwegen auch ins Gefängnis. Ich war zu allem bereit, um herauszubekommen, wo Harlow steckte.
Mein Telefon klingelte, und mein Herz setzte kurzzeitig aus. Für den Bruchteil einer Sekunde gab ich mich der Hoffnung hin, es könnte Harlow sein, aber gut, sehr wahrscheinlich war das nicht. Ich sah auf mein Handy und entdeckte Rushs Namen auf dem Display. Er war zwar nicht Harlow, doch im Augenblick die einzige Verbindung, die ich zu ihr hatte.
»Was gibt’s?«, meldete ich mich und starrte an die Decke.
»Manchmal frage ich mich, wieso ich dich eigentlich noch anrufe, so schlecht, wie du immer drauf bist«, erwiderte Rush.
Das fragte ich mich auch. Aber wenn er anrief, hob ich ab. Selbst wenn er nicht wusste, wo Harlow steckte, war er doch der Einzige, bei dem ich das Gefühl hatte, er würde mich verstehen und kapieren, dass ich am Ende war. Nur bei ihm konnte ich mich dazu aufraffen, über die ganze Sache zu reden.
»Es ist spät«, meinte ich.
»Na ja, so spät nun auch wieder nicht. Blaire ist gerade erst hochgegangen, um Nate in den Schlaf zu wiegen.«
Rush hatte sein Glück gefunden. Er hatte eine Frau, die er anbetete, und einen Sohn, den er über alles liebte. Es freute mich, dass er nun alles besaß, was er sich immer so sehr gewünscht hatte. Davor hatten weder er noch ich gewusst, wie ein normales, glückliches Familienleben aussah. Nun wusste zumindest er es. Ich hingegen … vielleicht hätte es auch für mich eine Chance gegeben, wenn Harlow noch da gewesen wäre. Wer weiß.
»Ich weiß, du bist nicht in der Stimmung zu reden, aber ich wollte einfach mal hören, wie es dir so geht. Blaire hat mir das aufgetragen, bevor sie nach oben gegangen ist.«
Anscheinend hatte Blaire mir endgültig verziehen. Ich wünschte, ich hätte Rush antworten können, dass es mir gut gehe. Dass ich normal atmen könnte und mir der Brustkorb nicht ständig schmerzte. Dass ich mich nicht verloren und hilflos fühlte. Aber das war leider nicht drin. Ich brauchte Harlow, so sah es aus.
»Na ja, ging’s dir etwa gut, als dich Blaire damals verlassen hat?« Die Antwort kannte ich schon. Ich konnte mich noch gut erinnern, dass ich ihn dazu hatte zwingen müssen, überhaupt mal das Haus zu verlassen.
»Nein«, erwiderte er. »Du weißt, dass überhaupt nichts mehr mit mir anzufangen war.«
»Eben.« Damals hatte ich mich darüber gewundert. Doch nun leuchtete es mir ein. Es war ihm hundeelend gegangen, und doch wurde von ihm erwartet, dass er so lebte, als wäre alles in Butter, während er sich an die Hoffnung klammerte, dass Blaire zu ihm zurückkommen würde. »Im Nachhinein tut es mir leid, dass ich dich gezwungen habe, dein Haus zu verlassen und was zu unternehmen. Ich habe die Situation definitiv verkannt.«
Rush lachte leise in sich hinein. »Ach, so verkehrt war das doch gar nicht. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Wenn ich nur herumgesessen und Trübsal geblasen hätte, dann hätte mich das Ganze nur noch mehr runtergezogen. Ich hatte ja keinen Job wie du, der mich jeden Tag abgelenkt hätte.«
»Hast du mit Harlow geredet?« Ich konnte nicht anders, ich musste einfach fragen. Ich brauchte dringend einen Strohhalm, an den ich mich klammern konnte.
»Der geht’s gut. Und sie ist gut untergebracht. Sie hat sich auch erkundigt, wie es dir so geht. Ich habe ihr erzählt, dass du hundsmiserabel aussiehst und mit der Situation überhaupt nicht zurechtkommst.«
Hätte sie sich meine Nachrichten angehört, dann wäre ihr das sowieso schon klar gewesen. Bei meinen Anrufen hielt ich damit ja nicht direkt hinterm Berg. Ich öffnete mich ihr völlig und schüttete ihr mein Herz aus.
»Wird sie mir je verzeihen?« Aus Angst vor der Antwort schloss ich die Augen.
»Das hat sie bereits. Sie ist bloß nicht bereit, sich wieder zu öffnen. Sie macht gerade eine Menge durch. Ihre Mutter und Kiro, dann das hier … gib ihr einfach mehr Zeit.«
Wenn sie mir verziehen hatte, wieso hörte sie sich dann meine Mailboxnachrichten nicht an? Wieso nahm sie nicht wenigstens ab, wenn ich sie anrief?
»Sag ihr, dass ich einfach nur ihre Stimme hören möchte. Sie muss auch gar nicht lang mit mir telefonieren – nur eine Minute! Ich möchte ihr sagen, dass ich sie liebe. Und dass es mir leidtut. Ich … ich muss ihr nur sagen, dass ich sie brauche.«
Rush schwieg einen Augenblick. Jeder andere hätte sich darüber lustig gemacht, zu was für einem wehleidigen Waschlappen ich mich entwickelt hätte. Er nicht. »Ich richte es aus. Schlaf dich mal aus, und dann ruf mich an oder schau mal vorbei. Blaire macht sich Sorgen.«
Ich versuchte, den Kloß in meinem Hals herunterzuschlucken. Wir verabschiedeten uns. Dann ließ ich das Telefon auf meine Brust fallen und schloss die Augen. Bilder von Harlow stiegen vor meinem inneren Auge hoch.
Sie waren alles, was mir von ihr geblieben war.
Dein Handy klingelt!« Mase kam mit meinem Telefon in der ausgestreckten Hand zu mir nach draußen, wo ich gedankenverloren auf der Schaukel saß, die schon seit unseren Kindertagen hier im Garten hing.
»Wer ist es?« Ich fürchtete mich davor nachzusehen. Meine Widerstandskraft schwand allmählich, und die Versuchung, einen Anruf von Grant doch einmal anzunehmen, wurde immer größer.
»Blaire«, erwiderte Mase und warf mir das Handy in den Schoß. »Ich geh dann mal zum Stall. Gleich wird frisches Futter angeliefert, und ich muss Major zeigen, welche Aufgaben er übernehmen soll – jetzt, wo er sich eingelebt hat. Du musst mit Blaire sprechen. Und denk mal darüber nach, ob du danach nicht Grant anrufst.«
Ich drückte auf das grüne Symbol an meinem Handy und hielt es mir dann ans Ohr. »Hallo?«
»Hey, Harlow. Ich hab schon ein paar Tage nichts mehr von dir gehört und wollte fragen, wie’s dir so geht.« Blaire wusste nichts von meiner Schwangerschaft. Ich traute ihr in allem, nur nicht darin, vor Rush ein Geheimnis zu bewahren. Sie würde es ihm erzählen, und der wiederum würde es postwendend an Grant weitergeben. Er würde gar nicht anders können. Folglich behielt ich das Geheimnis lieber für mich.
»Mir geht’s bestens«, log ich. »Und bei euch in Rosemary, alles in Ordnung?«, fragte ich vage.
»Du meinst, wie es Grant geht? Gar nicht gut. Bei ihm läuft alles immer noch nach demselben Muster ab. Viel Arbeit und wenig Schlaf. Außer mit Rush spricht er mit keiner Menschenseele und fleht Rush mittlerweile jeden Tag an, ihm doch zu verraten, wo er dich finden kann. Er ist nur noch ein Häufchen Elend, Harlow. Er muss unbedingt deine Stimme hören.«
Mein Herz zog sich zusammen, und ich blinzelte die Tränen weg, die mir in die Augen stiegen. Der Gedanke, dass er so litt, war schwer zu ertragen. Aber wie konnte ich ihn zurückrufen, ohne dass ich einknickte und ihm erzählte, wie sehr ich ihn vermisste? Außerdem würde das überhaupt nichts bringen. Wenn ich ihm dann nicht auch meinen Aufenthaltsort verriet, würde er nur umso mehr leiden.
»Dazu bin ich noch nicht bereit«, erklärte ich Blaire.
Sie seufzte. Im Hintergrund war Nates glucksendes Lachen zu hören. Mehr als Kindergelächter war nicht nötig, um mich daran zu erinnern, warum ich Grant nichts erzählen durfte.
»Blaire, kann ich dich etwas fragen?« Es war mir herausgerutscht, bevor ich genauer darüber nachgedacht hatte.
»Natürlich«, erwiderte sie.
Nate begann das Wort »Dada!« zu singen, immer wieder. »Sekunde mal eben«, meinte Blaire. »Rush ist gerade reingekommen, und sobald Nate seinen Daddy sieht, ist er ganz aus dem Häuschen. Ich geh mit dir in einen anderen Raum.«
So ein Leben, wie Blaire es hatte, wünschte ich mir auch. Ich wollte zusehen, wie Grant mit unserem Baby spielte. Dem Kind, das wir geschaffen hatten. Dem Kind, das ich unter dem Herzen trug. Doch wünschte Grant sich das auch?
»Okay, jetzt kann ich dich besser verstehen. Was wolltest du mich fragen?«
Ich kniff fest die Augen zu und hoffte, dass ich jetzt keinen Fehler beging. »Vor Nates Geburt, hättest du dein Leben für ihn hergegeben? Hast du ihn da schon so sehr geliebt?«
Blaire schwieg, und ich dachte schon, ich hätte zu viel gesagt und sie könnte sich nun den Grund meiner Frage zusammenreimen.
»Er war ein Teil von Rush und mir. Sobald ich wusste, dass ich ihn erwartete, hätte ich alles für ihn getan. Meine Antwort lautet also: Ja.« Sie sagte es bedächtig und fast schon gequält, aber ich wusste, es war ihr ernst damit. Sie würde meine Entscheidung verstehen, da war ich mir sicher. »Aber Rush hätte das anders gesehen«, fügte sie hinzu.
Ich spürte einen Kloß im Hals, und es fiel mir schwer zu antworten. »Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich … äh … muss jetzt Schluss machen. Ich rufe dich bald wieder an.« Ich beendete das Gespräch, ohne ihre Antwort abzuwarten, und ließ das Handy in meinen Schoß fallen. Dann hielt ich mir die Hände vors Gesicht und heulte los.
Ich weinte, weil ich mein Baby womöglich nicht lebendig auf die Welt bringen würde. Ich weinte, weil ich vielleicht nicht da sein würde, wenn es auf die Welt kam. Und ich weinte, weil ich befürchtete, dass ich das gemeinsame Leben mit Grant, das ich mir so sehr wünschte, nie bekommen würde. Ich weinte, bis ich keine Tränen mehr hatte. Dann legte ich mir die Hände auf den Bauch und ließ mein tränenfeuchtes Gesicht vom Wind trocknen. Ich musste endlich die nötige Kraft finden, um mein Vorhaben durchzuziehen. Es wäre gelogen gewesen zu sagen, dass ich keine Angst vor dem Sterben gehabt hätte. Ich hatte sogar eine Riesenangst davor, aber ich würde es tun, wenn das bedeutete, dass das Kind in mir dafür überlebte. Dieses kleine Leben gehörte zu mir und dem Mann, den ich liebte. Dem einzigen Mann, den ich je lieben würde.
Bevor ich Grant kennengelernt hatte, war mir nicht klar gewesen, wie es sich anfühlte, über beide Ohren verliebt zu sein. Ich hatte Paare beobachtet und mich irgendwelchen Träumereien über den Tag hingegeben, an dem mich ein Mann genauso innig und hingebungsvoll ansehen würde. Ich hatte mir vorgestellt, wie ich auf dem Weg zum Altar auf einen Mann zuschritt, der nur Augen für mich hatte und nur mich liebte. Einen Mann, der mich in aller meiner Unbeholfenheit liebte, mitsamt meinem fehlerhaften Herzen. Einen Augenblick lang war ich überzeugt gewesen, ich hätte ihn gefunden …
Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als Maryanns roter Dodge-Pick-up die Kiesstraße entlangfuhr, die von ihrem weißen Holzhaus zu Mase’ Blockhaus führte. In den letzten Tagen hatte Maryann sich gar nicht mehr blicken lassen, vermutlich, weil sie mit Major abgelenkt genug gewesen war. Ich wusste, dass der nächste Termin bei meinem Arzt anstand. Er wollte mich jede Woche sehen, weil ich als Risikoschwangere eingestuft worden war. Allerdings war ich mir nicht sicher, für welchen Tag sie meinen nächsten Besuch ausgemacht hatte.
Anstatt zum Essen nach vorn ins Haus zu gehen, war ich die letzten Tage hinten geblieben. Allein. Ich wusste, hier konnte mir nichts passieren. Außerdem wollte ich, dass Maryann mit Major in Ruhe über ihre Familienangelegenheiten reden konnte. Nachdem ich nicht zur Familie gehörte, hätte ich da nur gestört. Das einzige Problem war, dass es nichts gab, womit ich mir die Zeit hätte vertreiben können. Früher hatte ich viel gelesen, doch im Moment konnte ich mich auf keine Geschichte mehr so richtig einlassen.
So blieben mir nur noch meine Gedanken, und die drehten sich grundsätzlich um Grant und die Zukunft.
Der Pick-up hielt an, die Tür ging auf, und dann sprang auch schon Maryann heraus. Sie war eine natürliche Schönheit. Wann immer ich mir je ein Cowgirl vorgestellt hatte, hatte es wie Maryann ausgesehen. Groß und schlank, immer in engen Jeans, Reitstiefeln und einer karierten Hemdbluse. Der Cowboyhut auf dem Kopf gab dem Ganzen den letzten Schliff, obwohl er schmutzig und abgetragen war.
Sie kam die Treppe herauf und betrachtete mich mit dem besorgten Blick einer Mutter. Der Mutter, die ich eigentlich nie gehabt hatte. »Du willst wohl, dass ich mir Sorgen um dich mache, hm?«, fragte sie und musterte mich genau.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Es tut mir leid, ich hatte bloß keinen Hunger und brauche Zeit für mich.«
Ihre Stirn umwölkte sich noch mehr. »Mir sieht das eher danach aus, als hättest du dir die Augen ausgeheult. Dabei tun Tränen weder dir noch deinem Herzen oder dem Baby gut. Damit muss jetzt Schluss sein. Wenn du wegen Grant weinst, dann ruf den Burschen an und rede mit ihm! Du brauchst deine ganze Stärke und Willenskraft, wenn du das hier stemmen willst. Da kannst du doch nicht deprimiert herumhängen und ans Aufgeben denken!«
So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Aber wenn ich mit Grant redete, würde ich ihn mit der Wahrheit konfrontieren müssen. »Wenn er hört, dass ich ein Kind bekomme, kriegt er eine Riesenpanik. Das würde ich ihm lieber ersparen. Seine größte Angst im Leben ist es, einen geliebten Menschen zu verlieren.«
Maryann stemmte die Hände in die Hüften und verdrehte die Augen. »Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein! Ist dieser Kerl denn so ein Schlappschwanz, dass er mit dem Leben nicht zurechtkommt? Wenn er ein echter Mann ist, dann kommt er und ist der Fels in der Brandung, den du gerade brauchst! Und wenn er das nicht schafft, ist er deine Zeit nicht wert.«
Sie hatte ja keine Ahnung, wie gebrochen Grant ausgesehen hatte, als er von meinem Herzproblem erfahren hatte. Er war ein wunderbarer Mann, und er hatte mir vertraut. Wenn ich keine Geheimnisse vor ihm gehabt hätte, dann hätte ich ihm eine Menge Kummer erspart. Ich hätte ihm gleich an dem Tag, an dem er mit dem chinesischen Essen bei mir im Zimmer erschienen war, von meinem Herzen erzählen sollen. Dann hätte er sich wohl gar nicht erst auf mich eingelassen und würde jetzt nicht an einem gebrochenen Herzen leiden. In meiner Selbstsucht hatte ich ihm die Entscheidung abgenommen.
»Er hat was Besseres verdient als mich«, erklärte ich.
»Ach, so ein Quatsch! Wenn du ihn liebst, dann hat er doch das große Los gezogen! Hörst du? Er ist ein Glückspilz! Nichts sonst zählt. Du bist so schön, so schlau und so liebevoll und so natürlich. Wo du hinkommst, geht die Sonne auf, glaub mir!«
Ich lächelte zaghaft. »Danke!«
Maryann liebte mich wie eine Mutter. In meiner Kindheit hatte sie sie mir oft genug ersetzt. Oft fragte ich mich, wie mein Leben wohl unter anderen Umständen verlaufen wäre. Bis vor Kurzem hatte ich geglaubt, meine Mutter wäre bei einem Unfall ums Leben gekommen. Vor ein paar Monaten hatte ich dann erfahren, dass sie in einem Heim in Los Angeles lebte, wenn auch geistig stark eingeschränkt und nicht dazu imstande, die einfachsten Dinge zu verrichten. Als die Medien davon Wind bekommen hatten, erfuhren sie auch von meiner Existenz, und in der Folge war mein Gesicht auf den Fernsehmattscheiben in ganz Amerika zu sehen.
Maryann setzte sich zu mir auf die Schaukel. »Danke mir nicht dafür, dass ich ehrlich bin. So bist du einfach.«
Ich fragte mich oft, wie Maryann und mein Dad je zueinandergefunden hatten. Sie war so bodenständig, so lebenssprühend und so klug. Ihr jetziger Mann war wie geschaffen für sie. Dagegen konnte man sich Maryann und Kiro beim besten Willen nicht zusammen vorstellen.
»Du bist tough, und du bist stark, und zwar von Anfang an. Schon als Baby warst du so willensstark. Kiro hat dich über alles geliebt, aber du weißt ja, deine Mutter hat er auch angebetet. Sie war sein Licht. Sie entdeckte den Menschen in ihm, den niemand sonst je zu Gesicht bekommen hatte, und brachte ihn zum Vorschein. Es hat mich total baff gemacht, die beiden zusammen zu erleben. Ich konnte sie beim besten Willen nicht hassen. Im Gegenteil, ich habe sie bewundert. Sie war so ein lieber Mensch, genau wie du. In dir finde ich so vieles von ihr wieder. Genau wie dein Dad.« Sie verstummte und tätschelte mein Knie. »Wenn du dieses Kind bekommen möchtest, dann schaffst du das auch. Ich halte dich für stark genug. Deine Stärke ist mir schon immer aufgefallen, und ich glaube, du schaffst es, aber du musst dich auch wirklich ganz darauf einlassen. Lass dich nicht von Kummer und Angst beherrschen, sonst verlierst du.«
Ich ließ ihre Worte sacken und begriff, dass sie recht hatte. Es wurde Zeit, Stärke zu zeigen. Meinem Kind zuliebe. Und ich musste stark sein – uns allen zuliebe.
Das ist die siebenundfünfzigste Nachricht. Siebenundfünfzig Tage. Ich sitze hier und blicke aufs Meer hinaus, genauso, wie ich es mit dir immer getan habe. Ohne dich ist hier nichts mehr wie zuvor. Ich kann ja nicht mal in die Nähe der Küchentheke gehen, weil ich dann sofort daran denken muss, was wir darauf getan haben. Alles erinnert mich an dich. Harlow, wenn ich heute Abend deine Stimme hören könnte, wenn du mir nur sagen könntest, dass es dir gut geht … dann ginge es mir schon besser. Dann wäre ich imstande, mal wieder tief Luft zu holen. Und dann würde ich dich anflehen. Ich würde dich anflehen, mich zu lieben. Und mir zu verzeihen. Ich kann einfach nicht …«
Piep!
Ich stand auf dem Balkon und sah aufs Wasser hinaus, während die Mailbox mir das Wort abschnitt und die Verbindung trennte. Früher hatten mich die ans Ufer brandenden Wellen immer beruhigt. Jetzt erinnerten sie mich an die Angst, die zu den ganzen Problemen mit Harlow geführt hatte. Die Angst, die mich dazu gebracht hatte, Harlow Sachen zu sagen, die sie nicht verdient hatte.
Der Verlust von Jace hatte mich mehr getroffen, als mir klar gewesen war. Man lebt so dahin, ohne je daran zu denken, dass einem ein Freund oder eine geliebte Person jederzeit entrissen werden kann. Ich hätte nie damit gerechnet, einen guten Freund zu verlieren, indem er im Meer ertrank. Seitdem sah ich alles mit völlig anderen Augen. Auf keinen Fall wollte ich ein zweites Mal erleben, dass mir etwas derart naheging. Einfach so weitermachen wie bisher war mir nach dieser Erfahrung unmöglich. Dafür war Bethy, Jace’ Freundin, der beste Beweis. Sie war nun nur noch ein Schatten ihrer selbst, lächelte nie und sagte kaum je etwas. Das fröhliche Funkeln in ihren Augen war verschwunden. Ich mied ihre Nähe, da sie mich daran erinnerte, wie schnell das Schicksal zuschlagen konnte. Ohne Jace vegetierte sie eigentlich nur noch dahin.
Ich ließ die Hand sinken, mit der ich mir das Handy ans Ohr gehalten hatte. Stattdessen steckte ich es in meine Jeanstasche und ging wieder hinein. Weg von dem Wasser, das für mich und die anderen nahen Freunde von Jace alles verändert hatte. Keiner von uns würde je wieder derselbe sein. Aber ich wusste, dass ich mich vor dieser Art von Schmerz nicht schützen konnte. Ähnlich wie Bethy vegetierte ich nur noch vor mich hin. Ohne Harlow gab es für mich keinen Grund mehr zu lächeln. Dafür saß der Kummer viel zu tief. Auch der Versuch, sie zu vergessen, war von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen – wie hätte das denn gehen sollen?
Mein Handy klingelte, und ich riss es wieder aus der Tasche. Jedes Mal setzte mein Herz aus – in der Hoffnung, es könnte Harlow sein. Auf dem Display erschien Rushs Name. Am liebsten hätte ich das Handy frustriert gegen die Wand geschleudert, aber es war meine einzige Verbindung zu Harlow.
»Ja?« Ich schloss die Balkontür und ging in mein Schlafzimmer.
»Ich brauche deine Hilfe. Triff mich so bald wie möglich am Club. Ich bin schon auf dem Weg dorthin.«
Das konnte er vergessen. Es wurde Zeit für meine abendliche Routine, und ich wollte niemanden sehen. »Wozu? Ich bin erschöpft.«
Rush murmelte einen Fluch. »Beweg deinen Hintern in den Club! Tripp ist aufgetaucht, und anscheinend war Bethy in der Bar und hat dort einen über den Durst getrunken, und nun brüllt sie ihn an und wirft ihm die wildesten Sachen an den Kopf. Blaire wäre ja gern mitgekommen, aber Nate ist gerade nicht gut drauf und braucht seine Mama. Ich habe ihr gesagt, du und ich gucken uns die Sache mal an und nehmen Bethy dann mit zu mir nach Hause.«
Bethy und Tripp? Warum sollte sie Tripp anschreien? Jace hatte seinen Cousin heiß und innig geliebt. Immer schon. Mir fiel beim besten Willen kein Grund ein, weshalb Bethy sauer auf ihn sein sollte. »Okay, dann sehen wir uns gleich.«
»Na also, geht doch«, erwiderte Rush und beendete das Gespräch.
Ende der Leseprobe