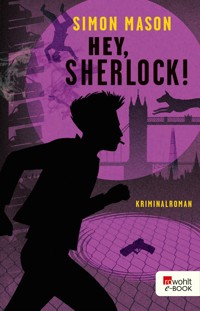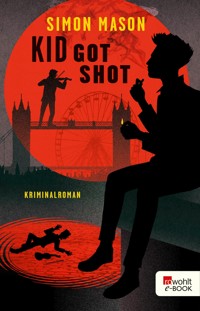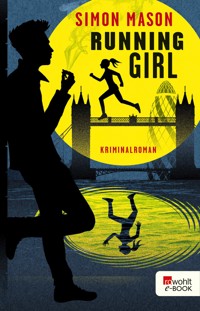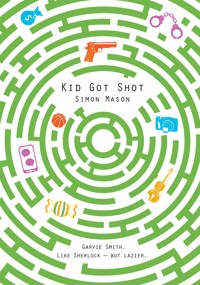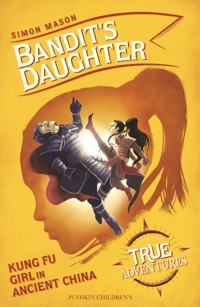13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für DI Wilkins
- Sprache: Deutsch
Der große SPIEGEL-Bestseller: die düstere Welt der Oxford University, eine Tote und zwei Ermittler wie Feuer und Wasser ...
DI Ryan Wilkins kennt die Universität Oxford nur aus der Ferne. Aufgewachsen in einem Trailerpark ist ihm diese elitäre Welt so fremd wie suspekt. Nun führt ihn der grausame Mord an einer jungen Frau ausgerechnet in die ehrwürdigen Hallen eines der Colleges – und an die Seite seines Namensvetters, des smarten DI Ray Wilkins, Spross einer wohlhabenden nigerianisch-britischen Familie und Oxford-Absolvent. Das ungleiche Team muss herausfinden, wer die Unbekannte ermordet hat, deren Leiche im Arbeitszimmer von Sir James Osborne, dem Prorektor von Barnabas Hall, gefunden wurde. Die Ermittlungen erfordern Takt und Fingerspitzengefühl, beides nicht gerade Ryans Stärken. Dafür ist er ein brillanter Beobachter. Gemeinsam mit Ray stößt er auf Verbindungen zwischen der Toten und einer alten Schuld, die bald weitere Opfer fordert ...
»Simon Mason feiert mit seinem einzigartigen Ermittlerpaar einen Triumph!« The Sun
Als bester Spannungsroman des Jahres für den Gold Dagger nominiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Ein Mord an der University of Oxford – der reinste Albtraum für Sir James Osborne, den Leiter von Barnabas Hall. Zumal das Opfer, eine unbekannte junge Frau, ausgerechnet in seinem Arbeitszimmer gefunden wird. Bei der Aufklärung des rätselhaften Verbrechens in den ehrwürdigen Hallen sind Takt und Feingefühl gefragt. Nicht gerade die Stärken von Ryan Wilkins. Aufgewachsen in einem Trailerpark am Stadtrand hat er es dank seines Talents zwar zum Detective Inspector gebracht, doch er eckt ständig an. DI Ray Wilkins, sein Partner und Namensvetter, stammt aus einer ganz anderen Welt: reiches nigerianisch-britisches Elternhaus, Eliteschulen, Maßanzüge. Die beiden müssen lernen, als Team zu funktionieren, um die Verbindungen zwischen der Toten, einem kostbaren Gegenstand und einer alten Schuld aufzudecken. Da geschieht ein zweiter Mord …
Autor
Simon Mason wurde in Sheffield geboren und studierte Englische Literaturwissenschaft in Oxford. Er schreibt heute sowohl Kinder- und Jugendbücher als auch Thriller und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Betty Trask Award für das beste Romandebüt. Neben seiner Schriftstellertätigkeit arbeitete Simon Mason einige Jahre als Verlagsleiter von David Fickling Books. Er lebt mit seiner Familie in Oxford. Ein Mord im November bildet den Auftakt einer Serie um das ungleiche Ermittlerduo Ray und Ryan Wilkins. Das Werk wurde als bester Spannungsroman des Jahres für den Gold Dagger nominiert.
Simon Mason
Ein Mord im November
Ein Fall für DI Wilkins
Kriminalroman
Aus dem Englischen
von Sabine Roth
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »A Killing in November«
bei Riverrun, an imprint of Quercus Editions Limited, London, an Hachette UK company
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2025
Copyright © der Originalausgabe
2021 by Simon Mason
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München,
nach einem Entwurf von Andrew Smith
Covermotiv: © Alamy, shutterstock (2)/Ihnatovich Maryia, Bernulius
Redaktion: Claudia Alt
AB · Herstellung: ik
Satz: KCFG-Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-32061-4V003
www.goldmann-verlag.de
Für Eluned
1
Vom Sicherheitsstandpunkt war Barnabas Hall ein Desaster, jeder sagte das.
Das College mit seinem anmutig verwinkelten Grundriss ein Stück abseits der High Street zählt zu den malerischsten von ganz Oxford. Zu seinen architektonischen Glanzpunkten gehören etwa die elisabethanischen Gebäude des Old Court, deren sanft geneigte Schieferdächer das Alter zu sachten Wellen gewölbt hat und deren Ziegelmauern rostrot schimmern, oder auch die Kapelle mit ihren spätmittelalterlichen Buntglasfenstern und dem Messingpult aus dem sechzehnten Jahrhundert in Gestalt eines Schwans. Aber die verschnörkelte schmiedeeiserne Pforte am Ende der Butter Passage rastet nicht richtig ein, und bei dem viktorianischen »Burgtor« zur Logic Lane mit seinem launischen Schließmechanismus genügt zum Öffnen zumeist ein beherzter Stoß. Den Haupteingang, dessen Torbogen mit Reliefs von Jesu Versuchung in der Wüste geschmückt ist, bewacht ein steifgliedriger Pförtner, der fast so antik wirkt wie seine Loge.
Der Inbegriff eines weltfernen Idylls, möchte man meinen. Doch der Eindruck trügt. Wie sämtliche Oxbridge-Colleges ist auch Barnabas Hall eingebunden in ein globales Netzwerk rasanten Informationsaustausches: ein millionenschwerer kommerzieller Betrieb, der mit Firmen und Regierungen weltweit interagiert und dessen Professoren ihr hoch spezialisiertes Fachwissen an Hunderte der verschiedensten Unternehmen verkaufen. Aus diesem Grund stand an einem verregneten Abend Mitte November, an dem die Nässe als wabernde Masse von den gemeißelten Fensterstürzen und Simsen troff, der Provost von Barnabas Hall in der Burton Suite und machte Konversation mit seinem hochwichtigen Gast, Scheich al-Medina.
Der Burton Dining Room, noch so ein College-Highlight: Am Ende von Aufgang IV im Nordflügel des Old Court gelegen, scheint er auf den ersten Blick aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt zu sein, das die Jahrhunderte geschwärzt und gehärtet haben. Alterskrumme Eichenbalken stützen die mit niederländischem Bandelwerk verzierte Stuckdecke ab, die sagenhaft historischen Holzdielen knarzen vom bloßen Hinschauen, und aus dem dunklen Firnis der Wandvertäfelung blicken die Gründerväter von Barnabas Hall: bleiche, gestrenge Herren in Tudorhauben, nüchterne Geschäftsmänner allesamt.
Für diese Gemälde, oder vielmehr die darauf Dargestellten, versuchte der Provost seinen Gast zu interessieren.
»Cropwell«, sagte er, angestrengt blinzelnd. »Bischof von Winchester unter Heinrich VI. Das war der König, der verrückt geworden ist, wie ich schon erwähnt habe. Ein höchst kurioser Fall.«
Der Scheich sagte nichts.
Der Provost, ein kleiner Mann mit großem, altersfleckigem Kahlkopf und einer weichen, aber nervösen Stimme, war Geograf und furchterregend belesen, jedoch von geringem praktischem Verstand und sich nicht zu gut, diesen Mangel durch ein aggressives Auftreten zu kompensieren. Seine kurzfingrigen Hände redeten ausladend mit, wenn er sprach. Der Scheich war groß und gebeugt, mit fleischiger Nase, Hängelidern und einer Neigung, sich in ein irritierendes Schweigen zu hüllen. Er war der Emir des am wenigsten bekannten der sieben Arabischen Emirate, ein Multimilliardär selbstredend, und seit drei Jahren arbeitete der Provost nun schon daran, ihn als Förderer des neu gegründeten Instituts für Friedensforschung zu gewinnen. Noch ließ sich nicht absehen, ob er Erfolg haben würde. Der Scheich war undurchschaubar. Und er war umstritten; hartnäckige Gerüchte sagten ihm Menschenrechtsverstöße im eigenen Land und Gräueltaten in anderen Staaten nach. An der Universität gab es denn auch heftigen Widerstand gegen seine Schirmherrschaft.
Es war schon halb acht. Der Provost geriet immer mehr ins Schwitzen. Das Gespräch mit al-Medina wollte nicht recht in Schwung kommen. Weder der Rundgang durch Barnabas Hall noch die Besichtigung der collegeeigenen Sammlung islamischer Kunst oder der Kapelle, wo ein Orgelschüler mehrere englische Fantasien zum Besten gegeben hatte, schienen den Scheich in irgendeiner Weise beeindruckt zu haben. Er war vor nicht allzu langer Zeit in Istanbul knapp einem Anschlag entgangen, und wenn er den Mund aufmachte, dann in der Regel, um die Sicherheitsvorkehrungen zu monieren; so hatte er die unzureichende Videoüberwachung im College gerügt. Der Provost, der gemeinhin über solch weltlichen Dingen stand, hatte das ungute Gefühl, seine Beteuerungen könnten den gewünschten Effekt verfehlt haben. Während er nun über den säuerlich dreinblickenden Bischof von Winchester dozierte, sah er voll Sorge, dass al-Medinas Leibwächter, ein gut aussehender Mann mit unruhigem Blick, am Kopf der Treppe erschienen war und dort auf und ab ging.
Mit einer minimalen Geste seiner halb unter dem weißen Gewand verborgenen Hand unterbrach der Scheich die historischen Ausführungen seines Gastgebers und trat zu seinem Leibwächter, um sich zum wiederholten Mal mit ihm zu beraten, und der Provost nutzte die Gelegenheit zu einem Telefonat.
In der Pförtnerloge neben dem Haupteingang saß der Pförtner, Leonard Gamp, bei einer Tasse Tee und blickte hinaus auf die Baustelle, deretwegen die Merton Street derzeit gesperrt war. Leonard war vierundsiebzig, ein Cockney, Veteran der Royal Gibraltar Police und der Londoner Polizei, der Met. Er hatte das untadelige Schuhwerk und den akkuraten Haarschnitt des kompromisslosen Traditionalisten. Seine Hochachtung vor der Institution Universität, der er seit nunmehr zwanzig Jahren diente, war grenzenlos. Als das Telefon klingelte, meldete er sich in seinem üblichen öligen Pförtnerston: »Barnabas Hall, die Pforte. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
Die Stimme des Provosts sagte ungeduldig: »Leonard, haben Sie heute Abend Dr. Goodman gesehen?«
»Da müsste ich lügen, Sir.«
»Wissen Sie, ob er im Haus ist? Ich habe ihn anzurufen versucht, aber er nimmt nicht ab.«
»Am Nachmittag war er auf jeden Fall hier und hat in sein Postfach geschaut. Hier bei mir ist er jedenfalls nicht raus. Soll ich rasch rüberlaufen und nachsehen?«
»Das wäre sehr nett. Ich kann nicht selber gehen, ich bin mit unserem Gast in der Burton Suite.«
»Selbstverständlich.«
»Vielleicht ist er ja noch in der Sammlung. Da könnten Sie es auch versuchen.«
»Sehr gern, Sir.«
»Noch etwas, Leonard. Wir warten auf unsere Getränke aus der Buttery, aber da muss etwas schiefgelaufen sein. Sie hätten vor mindestens einer halben Stunde gebracht werden sollen. Und wenn ich anrufe, hebt keiner ab.«
»Soll ich hingehen und nachfragen, Sir?«
»Wenn Sie so gut wären. Ein Sherry und Mineralwasser – das Blenheim vorzugsweise. Und bitte, Leonard, machen Sie ihnen Beine. Es ist doch bekannt, wie wichtig unser Gast ist.«
»Bin schon unterwegs, Sir.«
Dieses Küchenpack, dachte Leonard bei sich, als er auflegte, nichts kriegen sie hin. Da sitzt der Provost mit seinem Kameltreiber-Scheich-Dingenskirchen, und die vergessen ihn einfach. Er stellte einen Pappdeckel mit den Worten Komme gleich ins Fenster, trat durch den leeren Torbogen hinaus in das nassglänzende Dunkel des New Court und eilte steifbeinig in Richtung Buttery.
Zur gleichen Zeit irrte Ameena Najib, in den Händen ein Tablett mit einem großen Glas Sherry und einer Flasche Blenheim-Mineralwasser, durch die labyrinthischen Gänge zwischen dem mittelalterlichen Stable Yard Block und der neuen Fitzgerald Conference Suite. Sie war erst seit fünf Wochen im College angestellt, die erste Nutznießerin des Barnabas-Hilfsprogramms für syrische Flüchtlinge, und alles war noch fremd für sie. England generell war ihr fremd und in vielerlei Hinsicht unbefriedigend. In Syrien hatte sie Jura studiert; hier war sie eine Küchenhilfe, der man jede noch so niedere Aufgabe aufbürden konnte, die Öfen ausputzen, den Müll wegbringen. Nachher zum Beispiel würde sie noch einen Sack mit Altkleidern vor dem Haus des Provosts abholen müssen wie ein gewöhnliches Dienstmädchen.
Aber der heutige Abend würde anders ausgehen.
Sie hatte ein schmales Gesicht und ablehnende Augen. Ihr tiefbraunes Haar war unter einem eng anliegenden Hidschab verborgen, vom gleichen Dunkelblau wie der Küchenkittel, den sie über ihrer Jeans und dem T-Shirt trug. Nach rechts und links spähend hastete sie mit ihrem Tablett den Korridor entlang. Sie brauchte man nicht daran zu erinnern, wie wichtig der Gast war. Emir Scheich Fahim bin Sultan al-Medina, der Beschmutzer, der Schänder, war ihr bestens bekannt, auch wenn sie sich nie hätte träumen lassen, dass ihre Wege sich eines Tages kreuzen könnten. Ein Zufall freilich war diese Begegnung nicht. Gott war es, der über alle Gelegenheiten bestimmte. Außerdem hatte sie eine Nachricht von einem Landsmann empfangen, der von einem sicheren Ort in Dubai aus al-Medinas sämtliche Bewegungen überwachte.
Zunächst einmal musste sie aus der Conference Suite herausfinden. Das einzige brandneue Gebäude des Colleges, ein geschmackvoller Anbau aus der Hand einer renommierten französisch-marokkanischen Architektin, roch noch nach Holzöl und gehärtetem Glas. Wenige der Räume waren bisher mit Türschildern versehen. Auf der Suche nach dem Durchgang, der den Neubau mit dem Old Court verband, ging Ameena im Sturmschritt an schilderlosen Türen vorbei zu einem nächsten Korridor mit noch mehr schilderlosen Türen, bis sie an dessen Ende vor einer letzten schilderlosen Tür stand. Einen Moment lauschte sie daran, griff dann nach ihrem Schlüsselbund, nur um zu merken, dass er nicht mehr da war. Sie drehte den Knauf auf gut Glück – und die Tür öffnete sich.
Augenblicklich sah sie, dass sie am falschen Ort war. Dies war weder der Verbindungsgang, nach dem sie suchte, noch sonst ein Gang, sondern ein großer Raum mit Gemälden und Gobelins an den Wänden und Reihen von Vitrinen, die archäologische Fundstücke enthielten. Auf dem Boden kauerte ein Mann mit großen runden Brillengläsern und packte etwas in eine Kiste. Vage erkannte sie ihn als einen der »Dons«, der Dozenten. Telefon zwischen Schulter und Ohr geklemmt, hielt er jemanden an, sich keine Sorgen zu machen. Er lächelte ihr zu, und das Lächeln war so unerwartet und kalt, so voller Vorbehalt und vor allem so englisch, dass sie ohne ein Wort kehrtmachte und durch den Gang davoneilte. Es war viertel vor acht, und sie war ihrem Ziel ferner denn je.
In der Burton Suite nahmen der Provost und al-Medina ihre einseitige Unterhaltung wieder auf. Während er die säumige Buttery im Stillen mit Flüchen belegte, sann der Provost auf Wege, das Gespräch fort von den Porträts auf das verheißungsvollere Thema arabische Kunst zu bringen. Darüber wusste er wenig, aber die collegeeigene Sammlung islamischer Stücke, das Vermächtnis eines Ehemaligen, der in den 1930er Jahren Direktor der Iraq Petroleum Company gewesen war, konnte sich sehen lassen, und er hatte sie al-Medina ohne Zeitverlust vorgeführt. Über eine der Illuminationen hatte er sich sogar extra schlau gemacht. Sie entstammte einer spätmittelalterlichen persischen Gedichtsammlung, eine laszive junge Frau, die sich nach dem Bad rekelte; eine Reproduktion davon hatte er in seinem Arbeitszimmer hängen. Aber er wusste nicht recht, wie er ein so sinnliches Thema bei dem Scheich anschneiden sollte, über dessen religiöse Ansichten er sich im Unklaren war.
Er versuchte ein Lächeln, das spurlos in der steinernen Unbewegtheit von al-Medinas Miene unterzugehen schien.
Ehe er etwas sagen konnte, klingelte al-Medinas Handy. Der Scheich zog es aus den Falten seines Gewands und sah den Provost auf seine gewohnte schwerlidrige Art an, ohne zu sprechen.
»Bitte«, sagt der Provost. »Lassen Sie sich von mir auf keinen Fall abhalten.« Und mit einer verdeutlichenden Geste fügte er hinzu: »Wenn Sie ungestört sein möchten, gehen Sie gerne nach nebenan.«
Ohne eine Antwort verschwand der Scheich in dem angrenzenden kleinen Büroraum und schloss die Tür hinter sich, sodass nicht nur der Provost, sondern auch sein eigener Bodyguard das Nachsehen hatten.
Ameena Najib war mittlerweile im New Court gelandet. Sie blieb stehen und orientierte sich. In der vernebelten Dunkelheit ragte vor ihr die Kirche auf, eine gewaltige Steinschnecke mit einem Muster schwach schimmernder pflaumenblauer Fenster. Leer wie immer vermutlich; der Bau diente in erster Linie dekorativen Zwecken. Zu ihrer Rechten warf die Cranmer Library Rauten pelzigen Lichts auf den dunklen Rasen des Hofs. Schon wieder falsch. Mit einer so scharfen Drehung, dass die Getränke fast überschwappten, ging sie durch den Kreuzgang zurück und um die Ecke in den Old Court, wo sie, endlich, den Nordflügel vor sich sah.
Mit einer Willensanstrengung richtete sie ihre Gedanken auf den Emir, der auf seine Erfrischungen wartete. Im Gehen rief sie sich sein Bild vor Augen: ein massiger, schläfrig wirkender Mann, in ihrer Heimat berüchtigt für seine Fähigkeit abzuwarten, den richtigen Moment abzupassen. Und für noch anderes mehr. Im Geist unterlegte sie sein Foto mit einem Hintergrund zerbombter grauer Gebäude, der rauchenden Trümmer von Kafr Jamal, das sie einmal ihr Zuhause genannt hatte. Kein einziges solches Foto existierte; der Scheich war notorisch schwer zu fassen.
Aber Gott hatte ihn aufgespürt.
In der milden, feuchten Dunkelheit einer englischen Stadt fühlte sie sich plötzlich eins mit ihrer verlorenen Familie und mit all jenen, die in den Ruinen ihrer Häuser noch immer ihr Dasein fristeten. Sie war schwach, aber sie war nicht allein. Sie sah den Scheich, wie Gott ihn sah, mit unerbittlichem Urteil. Sie sah ihn, wie möglicherweise ihre Schwester Anushka ihn gesehen hätte, wäre sie am Leben geblieben. Mit unterdrückter Stimme begann sie die Worte zu murmeln:
Allāhu akbar, Gott ist der Größte. Ana la »kafr Jamal«, ich kann Kafr Jamal nicht vergessen.
Es war schon fast acht. Doch jetzt war sie bereit.
Der Provost, der einsam und gereizt zwischen der Festtafel und dem Porträt Bischof Cropwells herumstand, wählte ein weiteres Mal die Nummer der Buttery. Keine Reaktion. Er rief Dr. Goodman an, den College-Kurator, und diesmal meldete sich der Mann.
»Wo zum Teufel stecken Sie?«, zischte der Provost. »Sie sollten uns doch Gesellschaft leisten!«
Goodman sagte: »Zu viel zu tun. Eine Führung wie die heute Nachmittag bedeutet für mich eine enorme Mehrarbeit. Falls ich noch rechtzeitig fertig werde, komme ich zu dem Essen dazu.« Sein Ton war unverhohlen feindselig.
»Dann halten Sie sich ran«, sagte der Provost grob. »Und dieses Mal«, fügte er hinzu, »erwähnen Sie vielleicht einmal nicht diesen verdammten Koran. Wenn Sie glauben …«, echauffierte er sich, aber Dr. Goodman hatte schon aufgelegt, und der Provost stand da und starrte zornentbrannt auf sein Telefon. Der Farquar-Koran war Teil der Sammlung, eine der kostbarsten Antiquitäten von Barnabas Hall, aber die Saudis forderten ihn zurück, und Goodman, der einzige Arabist am College, zeigte Verständnis für ihren Wunsch. Der Provost wollte auf keinen Fall, dass das Thema beim Essen aufkam. Seine Stimmung, nie sonderlich gut, sank noch tiefer.
Er warf einen Blick zu der geschlossenen Tür hin, hinter der der Scheich telefonierte, sah dann auf die Uhr und trat, weil ihm nichts anderes einfiel, an den Tisch, um die Gläser und das Tafelsilber zu kontrollieren, die eigens für den Anlass hervorgeholt worden waren. Der Plan war, den prospektiven Gönner mit jener Art von entspannter, intimer, intellektuell hochkarätiger Geselligkeit zu umgarnen, für die Oxford berühmt war, ein abschließender Überzeugungsakt, der ihnen die Unterstützung des Scheichs für das neue Institut sichern sollte. Aber seine Unruhe wollte sich nicht legen. Vor allem wünschte er, sein Gast würde aufhören, sich über die Sicherheitslage zu beschweren. Das zeugte von einer negativen Grundhaltung. Der Leibwächter hatte die Räumlichkeiten der Burton Suite fast eine geschlagene Stunde inspiziert, bevor er den Scheich eintreten ließ, und sich dann in die Küche verfügt, um das Personal zu verhören und das Essen zu untersuchen. Mehrmals hatte sich der Provost versucht gefühlt, dem Mann zu sagen, dass er sich hier in einem Rechtsstaat befand.
Von diesen belastenden Gedanken erlöste ihn das lang überfällige Eintreffen der Getränke.
Die junge Frau trat mit einem Tablett durch die Tür.
»Gott sein Dank!«, rief der Provost, ohne den Ausdruck auf ihrem Gesicht zu bemerken. »Gab es Probleme?«
Sie beachtete ihn nicht. »Ist Mann draußen«, sagte sie mit starkem Akzent, »hat mich gefragt.« Ihr Gesicht war gerötet, ihre Brust hob und senkte sich, als wäre sie gerannt. Hübsche Person, dachte der Provost, gute Figur. Sie sah ihn nicht an, während er sie beäugte, sondern schaute im Raum hin und her, als suchte sie etwas, und murmelte dabei in einem fort rhythmische Silben in sich hinein, die er nicht verstand.
Hinter ihr in der Tür erschien der Leibwächter, aber der entnervte Provost ignorierte ihn. »Kümmern Sie sich gar nicht drum«, sagte er knapp zu der Frau. »Der Amontillado für mich, danke. Und das Mineralwasser …« Er zeigte auf das Nebenzimmer. »Unser Gast telefoniert. Bringen Sie es hinein und stellen es auf dem Tisch ab. Aber dass Sie ihn nicht stören.« Er winkte sie durch.
Ameena Najib atmete tief ein, ging leise durch die Tür und zog sie lautlos hinter sich zu.
Der Schänder saß mit dem Rücken zu ihr in einem Drehsessel und sprach auf Arabisch in sein Handy, sich ihrer Gegenwart so dicht hinter ihm offenbar in keiner Weise bewusst. Sie konnte seine Schultern sehen, die Wölbung seines Schädels, so verletzlich unter der weißen Kufija. Sie tat einen vorsichtigen Schritt auf ihn zu. Dann ließ der Klang ihrer eigenen Sprache sie zögern, ein gebannter Ausdruck trat in ihr Gesicht; wie in Trance lauschte sie.
Als spürte er ihre Nähe plötzlich doch, hörte der Scheich abrupt auf zu reden und drehte sich ruckartig mitsamt dem Stuhl, und sie fixierten einander stumm.
Der Gedanke überfiel ihn mit Macht: Sie haben mich gefunden.
Das Mädchen war nichts – ein bloßes Werkzeug, ein Gesicht ohne Bedeutung.
Mit einem Mal fühlte er sich matt. Erschöpft.
Das Mädchen sagte nichts, sie brauchte nichts zu sagen. Ihr starr auf ihn gerichteter Blick zwang ihn, ihre Gedanken zu lesen, die Worte zu hören, die sie im Geiste sprach. Ebenso gut hätte sie sie laut sprechen können.
Last wahida. Ich bin nicht allein. Tdhakkar annak batmut. Denk daran, du musst sterben. Und andere Parolen, andere Schmähungen.
Er beobachtete sie fasziniert, von Furcht gelähmt und doch zutiefst gespannt, wie es weitergehen würde. Sie musste Anweisungen von ihren Genossen haben. Was verbarg sich unter dieser Uniform? Immer noch tat sie nichts. Was war ihre Rolle?
Ein paar endlose, peinigende Sekunden lang rührte sich keiner von ihnen.
Dann weiteten sich ihre Augen jäh, sie sog scharf die Luft ein, und als würde sie ihn ein für allemal aus dieser Welt verweisen, machte sie kehrt und eilte aus dem Zimmer.
Der Provost bemerkte den aufgewühlten Zustand seines Gastes, der unmittelbar nach dem Mädchen aus dem Nebenzimmer kam, zunächst nicht. Er lächelte ihn an und hob sein Glas Amontillado. »Besser spät als nie«, sagte er. »Zum Wohl.«
»Wer ist diese Frau?«, wollte der Scheich wissen.
Der Provost sah ihn neugierig an. »Aus der Küche? Sie ist neu hier im College. Aneesha, glaube ich. Oder war es Anika?«
Der Scheich klatschte in die Hände, und sein Leibwächter kam mit langen Schritten auf ihn zu.
Warum interessierte er sich so für das Mädchen?, fragte sich der Provost, während er an seinem Sherry nippte und den beiden beim Reden zusah. Alle Schläfrigkeit war von al-Medina abgefallen; in heftigen arabischen Wortschwallen sprach er auf den Leibwächter ein, als hätte große Erregung ihn gepackt. Der Provost wusste nichts über al-Medinas Privatleben, gestattete sich jedoch die Annahme, dass der Scheich der Vielweiberei anhing. Er hatte einmal von einem Diplomaten, der sich für sein Thema sehr erwärmte, intime Details über die sexuellen Gepflogenheiten arabischer Fürsten geschildert bekommen und den Mann nicht gebremst.
Al-Medina beendete seine Rede im Befehlston, und der Leibwächter lief aus dem Zimmer und die Treppe hinunter.
Der Provost war verwirrt. »Sie ist geflüchtet«, sagte er, »aus Syrien. Wir haben ein Hilfsprogramm, das wir gerade erst aufgezogen haben. Sie ist erst seit Noughth Week bei uns«, fügte er hinzu. »Sie tut sich noch etwas schwer.«
Der Scheich reagierte nicht.
»Noughth Week«, erklärte der Provost, »ist sozusagen die Woche null, also die Woche unmittelbar vor Beginn des Trimesters. Des Michaelmas-Trimesters in diesem Fall«, fuhr er nach einer kurzen Pause fort, »das immer am ersten Sonntag nach dem Michaelistag beginnt.«
Seine Erläuterung machte wenig Eindruck. Er runzelte die Stirn. Konnte es irgendetwas damit zu tun haben, dass al-Medina Ausländer war? Er versuchte sich auf die obskuren Unterschiede zwischen Schiiten und Sunniten zu besinnen, die sich ihm noch nie so recht erschlossen hatten.
Der Scheich wandte sich um und funkelte ihn an. »Wie ist sie hierhergekommen?«
Der Provost war bestürzt über den scharfen Tonfall. Vorsichtig sagte er: »Einzelheiten kann ich Ihnen nicht nennen. Aber ihr Weg war zweifellos ein sehr mühsamer.«
»Wer sind ihre Genossen?«
Was sollte er mit dieser Frage anfangen? »Ich glaube, ihre Erfahrungen machen es ihr etwas schwer, Anschluss zu finden.«
Langsam fühlte er sich mit seinem Latein am Ende. Ihm fiel auf, wie bleich al-Medina war, wie angespannt seine ganze Haltung. Nun formulierte der Scheich seine Frage neu. »Sind noch andere von ihrer Art hier?«
Verspätet begriff der Provost. Der Mann hatte Angst vor dem Mädchen, er befürchtete ein Komplott von ihr. Wie paranoid! Er antwortete würdevoll: »Sie ist natürlich gründlichst durchleuchtet worden. Gründlichst.«
Der Scheich ging nicht darauf ein. Mit leiser Stimme fragte er: »Wem haben Sie von meinem Besuch erzählt? Wem?«
Der Provost, der sich zu Unrecht attackiert fühlte, erwiderte: »Überhaupt niemandem. Außer denen, die es angeht«, fügte er hinzu.
Al-Medina betrachtete ihn nur stumm. Mit einem leichten Übelkeitsgefühl verstand der Provost, dass der Mann drauf und dran war zu gehen – mitsamt über fünfunddreißig Millionen Pfund an Fördergeldern. Hilflos stand er da und sah al-Medina zu einer ungeduldigen Gebärde ansetzen, doch in diesem Augenblick kamen zu seiner grenzenlosen Erleichterung die übrigen Essensgäste, angeführt von seiner Frau, die Treppe herauf, und überhastet begann er, alle reihum vorzustellen. Seine Frau, die drei Jahre zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte, hinkte mit entschlossener Miene auf den Scheich zu und zog ihn mit einem Lächeln, das ihr Mann als gezwungen erkannte, ins Gespräch. Gefolgt wurden die Gäste von einer Kellnerin mit zwei Flaschen Mumm-Sekt und Kanapees auf einem kleinen Silbertablett. Die Turmuhr von Barnabas Hall schlug halb neun, und al-Medina war von seinen Gastgebern umzingelt und konnte nicht fliehen.
Ameena draußen im Hof sah den Leibwächter näher kommen. Nach allen Seiten um sich schauend, lief er den Kiespfad entlang Richtung Küche. Sie duckte sich in eine Nische im Mauerwerk der Great Hall; dennoch bremste er, als er ihre Höhe erreichte, abrupt ab und spähte in den Schatten. Er machte einen Schritt auf sie zu, noch einen, hielt inne. Ihre Blicke trafen sich, ein kurzer Moment des Erkennens, dann drehte er sich um und ging rasch davon. Sie hob das Gesicht zu dem milden, feuchten Himmel auf und spürte jetzt erst ihr Zittern. Sie war geprüft worden, und sie hatte bestanden. Der erste Teil ihrer Aufgabe war vollbracht. Sie zog ihr Handy hervor und tippte hastig eine Nachricht.
Hadha huwa. Er ist es. Ihna jahizeen. Wir sind bereit.
Doch bevor sie sie abschicken konnte, hörte sie ganz aus der Nähe ihren Namen – »Ameena? Bist du das?« – und fuhr erschrocken herum, Handy in der Hand, ihre Nachricht ungesendet.
In der Burton Suite wurde der Sekt in die Gläser geschenkt. Neben dem Provost und seiner Frau hatten sich noch vier weitere Gäste eingefunden, um den Scheich zu unterhalten. Dr. Goodman, der humorlose, aber unverzichtbare Arabist. Der Dekan des Colleges, dessen silberhaarige Eleganz der Öffentlichkeit von seinen vielen Fernsehauftritten her bekannt war. Eine Zoologin namens Arabella Parker, angetan mit einem bunten, wallenden Kaftan. Und ein jüngerer Gastdozent aus den Vereinigten Staaten mit Namen Kent Dodge, ein Kunsthistoriker aus Harvard, der ein Semester lang an der Universität von Abu Dhabi studiert hatte und sich bei der nachmittäglichen Führung durch die Kunstsammlung bereits als sehr nützlich erwiesen hatte. Allen fiel auf, wie unruhig der Scheich war, aber niemandem gelang es während des Aperitifs, ihn aus seinem Brüten herauszuholen. Er ging auf keinen der Gesprächsvorstöße seiner geistreichen, intelligenten Gastgeber ein – Fragen über den Nahen Osten, witziges Geplänkel über den Orientalismus, über die Malaisen der Globalisierung. Als sein Leibwächter zurückkehrte, begann er eine lange, erregte Unterhaltung mit ihm und nahm von niemandem sonst mehr Notiz. Alle atmeten auf, als das Essen kam und man zu Tisch gehen durfte.
Der Provost, der auf einen Neubeginn hoffte, erhob sich mit einem nervösen Lächeln auf seinem geröteten Gesicht und brachte einen Toast auf das enge Verhältnis zwischen Barnabas Hall und dem Hause al-Medina und auf die Fortsetzung ihrer gemeinsamen Bemühungen um den Weltfrieden aus. Aber die höfliche Zustimmung seiner Kollegen und ihr gedämpfter Beifall änderten nichts an der Teilnahmslosigkeit des Scheichs, der unempfänglich und reglos blieb, und aus der Stimme des Provosts klang ein Anflug von Panik, als er sich setzte und seinem Gast alles, was er sich über das Bild der jungen Badenden aus der persischen Gedichtsammlung angelesen hatte, wieder von vorn zu erzählen begann.
Ameena trat aus dem Schatten auf den Kiesweg, wo Jason Birch, das College-Faktotum, stand, täppisch grinsend. Er war ein gedrungener junger Mann mit großen Pranken, rötlichen Bartstoppeln und einem geradezu lachhaft bemühten Ausdruck im Gesicht. Er hatte ein Faible für Ausländerinnen generell und Ameena im Besonderen. Sie war ihm unheimlich, aber er hoffte dennoch. Komisch, dass sie so spät noch arbeitet, dachte er.
»In dem Loch da hast du doch keinen Empfang«, bemerkte er leutselig. Er sprach mit breitem Oxfordshire-Akzent, die Vokale trübe, die Konsonanten verschliffen.
Sie sagte nichts.
»Ich mein nur«, sagte er verlegen. »Weil ich dich da gesehen hab. Brauchst du Hilfe bei irgendwas?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich muss gehen.«
»Alles okay? Du schaust so bisschen … wie sagt man …?«
»Ich war verirrt.«
Er ließ sich durch ihre Kurzangebundenheit nicht abwimmeln. »Kein Wunder hier drin. Wohin wolltest du denn?«
»Burton Room.«
»Ah, dann warst du wahrscheinlich im Nordflügel. Neben der Kapelle. Mit diesen ganzen engen alten Gängen.«
»Nein«, sagte sie ungeduldig. »Conference Suite.«
»Noch schlimmer. Diese ganzen engen neuen Gänge … Ist echt alles okay? Behandeln die Leute dich anständig?«
Er merkte selbst, dass sie nicht reden wollte, aber er glaubte an die Kraft seiner gut gemeinten Zuwendung, und in der Tat wurde er belohnt, denn als brächen sich ihre aufgestauten Gefühle Bahn, sprudelte es plötzlich aus ihr hervor: »Nein, sie behandeln mich nicht!« Gestenreich berichtete sie vom Provost, von dem Ton, in dem er mit ihr sprach, von seinen Blicken.
Jason, beglückt über so viel Vertraulichkeit, verformte sein Gesicht zu übertriebenen Ausdrücken der Missbilligung. »Wundert mich gar nicht. Da ist er bekannt für. Der betatscht alle.«
Und dann der Mann in dem Raum voller Schätze, der ihr mit seinem bloßen Lächeln Angst eingejagt hatte. Ihre Finger deuteten Brillengläser an.
»In der Kunstsammlung? Das ist Goodman. Noch so ein Spinner. Von denen wimmelt’s hier, wenn du’s genau wissen willst. So, und jetzt pass auf, dass du von hier nicht gleich wieder falsch gehst.«
Zu seinem Erstaunen füllten sich ihre Augen mit Tränen, und er trat einen beschützerischen Schritt auf sie zu. »Was ist denn?«
Ihre Stimme klang brüchig vor Erregung. »Im Burton Room.«
Jasons Unterkiefer klappte ein Stück auf, als er sich zu ihr vorbeugte, wartend. »Ja? Was?«
»Der Scheich«, flüsterte sie. »Der Schänder.«
Sie war bleich, ob vor Angst oder Zorn, konnte Jason nicht sagen. Das Wort »Schänder« überforderte ihn.
»Dieser Mann«, murmelte sie in sich hinein. »Über was hat er telefoniert? Was hat er gemacht?« Und mit lauterer Stimme: »Er schändet das Heilige Buch.« Sie starrte Jason an.
»Äh – verstehe«, sagte er nach einer Pause. Er betrachtete Ameena unbehaglich. »Mach dir wegen dem keinen Kopf«, sagte er schließlich. »Das ist nur ein Typ wie jeder andere. Egal, wie viele Frauen er in seinem Harem hat«, fügte er aufs Geratewohl hinzu. Er machte ein mitfühlendes Schnalzgeräusch und blies die Backen auf, während er sein Hirn nach einer nächsten Bemerkung durchforstete. »Aber eins sag ich dir«, äußerte er zuletzt. »Ich hab das schon oft gedacht. Von der Sicherheit her ist das hier ein Witz. Du brauchst bloß reinspazieren. Was ist, wenn ihm was passiert? Dem Emir-Typ, mein ich.«
Sie sah ihn scharf an. »Warum sagst du das?«
»Nur so. Ich hab einfach gedacht …«
»Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden«, sagte sie. »Was tust du hier?«
»Nichts, ich wollte nur …«
»Ich habe zu tun. Du hältst mich auf.«
Bedröppelt sah er ihr nach, als sie über den New Court davoneilte, dann drehte er sich um und ging in die andere Richtung. Er sah nicht, wie sie durch den Torbogen in den Fellows’ Garden verschwand und dort im Schatten der Bibliothek stehen blieb, sich vorsichtig umschaute und dann endlich ihre Nachricht abschickte.
Sie seufzte erleichtert auf. Der Garten vor ihr war im Dunkeln verborgen, der Pfad um die Rasenfläche kaum zu ahnen im laternenglimmenden Nebel, dennoch glaubte sie am anderen Ende eine Gestalt in einem Küchenkittel weghuschen zu sehen, auf das Haus des Provosts zu. Ameena runzelte die Stirn. Vom Küchenpersonal war heute Abend außer dem Koch als Einzige Ashley Turner eingeteilt, und die bediente im Burton Room. Es verwirrte sie. Mit klopfendem Herzen schlug sie die gleiche Richtung ein.
Unterdessen ging im Burton Room das Festmahl seinen verheerenden Gang. Der Versuch des Provosts, den Scheich mit Betrachtungen über die sich rekelnde Badende aus der persischen Gedichtsammlung zu zerstreuen, endete in einer persönlichen Demütigung, als seine Frau ihn freundlichst bezüglich eines kleinen, aber entscheidenden Details korrigierte und er keinen Widerspruch wagte. Die Unterhaltung schleppte sich, erstarb dann und wurde durch die Kratzgeräusche des Tafelsilbers auf edlem Porzellan ersetzt. Die Foie Gras wurde auf- und wieder abgetragen, ebenso die Hummerravioli, doch bevor das Navarin vom Herdwick-Lamm serviert werden konnte, verkündete der Scheich abrupt, dass er gehen wolle.
Es war erst viertel vor zehn. Betretenheit machte sich breit.
Sein Leibwächter half ihm auf die Füße. Da stand er, schwerfällig und doch erhaben, und betrachtete einen Moment lang ungerührt die anderen Gäste, die alle verstummt waren. Er neigte den Kopf, hob kurz die Arme und wünschte ihnen eine gute Nacht.
Von der anderen Seite des Tisches fragte die Frau des Provosts: »Müssen Sie wirklich schon gehen? Wie schade.« Ihre halbseitige Lähmung verlieh ihrem Gesicht einen grämlichen Ausdruck, aber ihr Ton war aufrichtig und ermutigend.
Der Scheich beachtete sie nicht. Er besprach sich mit seinem Leibwächter. Sein Aufbruch fand früher statt als geplant; die Abläufe mussten vorverlegt werden.
Der Leibwächter trat auf den Provost zu. Der Wagen des Emirs würde in zwanzig Minuten vorfahren. Wie nahe am Collegetor konnte er parken? Die Merton Street war wegen der Bauarbeiten gesperrt.
Der Provost verspürte wenig Lust zu helfen. Ihm wurde immer klarer, dass die drei Jahre, die er den Scheich nun hofiert hatte, Zeitverschwendung gewesen waren. Es kostete ihn Überwindung, dem Mann ins Gesicht zu sehen.
»Sagen Sie dem Fahrer, er soll auf der High Street parken. Dann können Sie die Logic Lane vorgehen.«
Der Leibwächter fragte, ob die Gasse gut ausgeleuchtet sei.
»Nicht besonders.«
Ob es keine bessere Option gebe, wollte der Leibwächter wissen.
Der Provost konnte seine Entnervtheit kaum kaschieren. »Dann nehmen Sie eben das Tor beim Fellows’ Garden. Da kommen Sie mehr oder weniger auf der High Street raus. Ich gebe Ihnen den Code. Das Schloss klemmt etwas, aber Sie müssen der Tür einfach nur einen Stoß geben. Das werden Sie ja wohl schaffen.«
Der Leibwächter konferierte mit al-Medina, der sich widerwillig in diesen neuen Plan fügte. Er wirkte so unentspannt wie zuvor. Statt sich vom Provost zu verabschieden, machte er nur eine mehrdeutige Handbewegung und ging mit dem Leibwächter hinaus ins Vorzimmer, um dort die Ankunft des Wagens abzuwarten.
Die übrigen Gäste wussten nicht, was sie tun sollten. Also blieben sie sitzen und unterhielten sich leise, während der Provost ein Stück abseits stand und stumm den Schiffbruch seiner lang gehegten Pläne bedachte.
Nach einer Weile ging er hinüber zu seiner Frau.
»Ich werde hier wahnsinnig«, raunte er ihr zu. »Ich geh mal kurz raus.« Ehe sie etwas einwenden konnte, verließ er den Raum und lief die Treppe hinunter.
Ein nur zu bekannter Drang hatte sich seiner bemächtigt.
Der Regen war stärker geworden. Durch dichtes Geniesel eilte er den Nordflügel entlang und unter einem niedrigen Torbogen hindurch in den Benet’s Yard. Im Gemäuer eines Nebengebäudes dort, gleich neben der Butter Passage, war eine von tiefen Schatten verborgene Aussparung. In ihrem Schutz blieb er stehen und steckte sich mit zitternden Fingern – entgegen den College-Vorschriften und, schlimmer noch, gegen den erklärten Wunsch seiner Frau – eine dringend benötigte Parliament Light an.
Auf der anderen Seite des Old Court, in anderen Schatten, wartete derweil Ameena Najib in der feuchten Kälte. Sie zitterte noch immer, nicht weil sie fror, sondern vor Aufregung. Ihr innerer Aufruhr wollte sich nicht legen. Endlich sah sie eine Bewegung am Fuß der Treppe jenseits des Rasenovals und schickte, ohne zu zögern, eine weitere, letzte Nachricht.
Han al-waqt. Es ist Zeit.
Es war vollbracht. Ihre Aufgabe war erfüllt. Der Abend hatte viel mehr Schwierigkeiten bereitgehalten als erwartet, aber sie hatte sie alle gemeistert.
Mit einer enormen Kraftanstrengung lenkte sie ihre Gedanken fort vom Leid des Einzelnen, größeren Dingen zu: Tod und Gericht, Himmel und Hölle. Sie hatte zu Gott um Gerechtigkeit gebetet, und ER würde sie nicht enttäuschen. Sie war frei, sie durfte gehen. Sie verbannte jeden Ausdruck aus ihrem Gesicht, sah sich noch einmal nach allen Seiten um und verließ ihr Versteck.
Der Provost in seinem klammen Mauerwinkel sog den Rauch tief ein und hielt ihn so lange, bis das ersehnte Stillegefühl über ihn kam. Dann nochmals. Und nochmals.
Endlich wurde es ruhig in ihm.
Mehrere Minuten vergingen. Er starrte leeren Blicks in den dunklen Hof vor ihm und ließ seine Gedanken wandern. Einzelne Momente seines langen, zermürbenden Tages kamen zu ihm zurück, irritierende Gesten seitens des Scheichs, seine geringschätzige Miene, als der Provost Konversation über das Bild aus der persischen Gedichtsammlung zu machen versucht hatte; vor allem aber sein ständiges Herumreiten auf den angeblichen Sicherheitslücken.
Er rauchte und ließ dabei vor seinem inneren Auge das Bild des Mädchens auf der persischen Illumination erstehen. Wie immer befriedete es ihn. Er betrachtete es oft, wenn er an seinem Schreibtisch arbeitete, und bewunderte die selbstvergessene Schönheit der Frau. Umrahmt von einer Konzertina aus goldenen Rauten lag sie im Halbschlaf, um ihre Hüften ein blaues, mit goldenen Enten verziertes Tuch, über das die weißen Brüste fielen, ein zierliches Ohr gerade noch sichtbar unter der Kaskade dichten, dunklen Haars. Es war ein erotisches Bild, das er gern mit den Gesichtern verschiedener junger Forschungsstipendiatinnen überblendete. Er seufzte durch die Nase, den Blick ziellos in das nieselige Dunkel der Butter Passage gerichtet, aus dem nun lautlos vier schwarz vermummte Gestalten erschienen, die, aus der Richtung der unzureichend schließenden schmiedeeisernen Pforte kommend, an ihm vorbeitrabten, ohne ihn zu sehen, und einer nach dem anderen durch den Torbogen in den Old Court verschwanden.
Mehrere Sekunden lang rauchte der Provost träumerisch weiter, ohne zu schalten. Dann spie er mit einer Art Rülpser seine Zigarette aus. Vier maskierte Männer, unterwegs zur Burton Suite!
Wie gelähmt vor Entsetzen stand er da und dachte panisch an die anhaltenden Sicherheitsbedenken des Scheichs. Dann machte er einen schlingernden Satz aus seiner Nische, und mit einer unsauberen Drehung auf dem nassen Kies stürzte er ihnen nach.
Im Burton Room schleppten sich die Gespräche unterdessen dahin. Die Frau des Provosts, die mit Kent Dodge über seine Erfahrungen in Abu Dhabi redete, hatte einen unpassend neckenden Ton angeschlagen; der junge Mann genierte sich furchtbar. Er wusste nie, welche Partie ihres Gesichts er ansehen sollte – ihre Augen, die etwas unnatürlich Starres hatten, oder ihren schiefen Mund. Der Dekan und die Zoologin unterhielten sich in leisem, elegantem Murmeln über eine bevorstehende Wahl in der Fachschaft. Dr. Goodman hielt sich in verbittertem Schweigen abseits; sein Vertrag lief aus, und der Provost hatte ihm zu verstehen gegeben, dass man ihn nicht vermissen würde. Er beobachtete die anderen.
Alle vier waren sie überrascht, als auf der Treppe ein lautes Poltern wie von vielen trampelnden Füßen ertönte. Kent Dodge wich unwillkürlich ein Stück zurück, die Gattin des Provosts erhob sich alarmiert, als auch schon ihr Mann mit hochrotem Gesicht zur Tür hereintaumelte, wild im Zimmer hin und her sah und unartikulierte Laute ausstieß.
»Was um Himmels willen …?«, fragte sie.
Mit wütendem Gefuchtel bedeutete er ihr, still zu sein, zeigte dann auf den Vorraum. Er keuchte etwas hervor, das die Anwesenden schließlich als »Ist er in Sicherheit?« interpretierten.
Seine Frau runzelte die Stirn. »Der Emir? Er ist vor ein paar Minuten gegangen.«
»Aber …«
»Sein Wagen kam verfrüht. Ich habe ihm den Code für das Burgtor gegeben. Ich hätte nicht gewusst, was dagegen spricht. Meine einzige Sorge war, dass der Fellows’ Garden zu dunkel sein könnte, um sich als Fremder darin zurechtzufinden. Aber vielleicht zeigt ihnen ja jemand den Weg.«
Einen Moment lang starrte der Provost sie an. Dann warf er sich unter neuerlichem Aufstöhnen herum und stolperte die Treppe wieder hinunter, während die Zurückbleibenden ihm verdattert nachschauten.
Der Fellows’ Garden liegt nordöstlich des New Court. Seine eine Seite wird von der Kapelle flankiert, eine weitere von einem Ende der Bibliothek, die dritte von einem hohen Gebäude der Stadtverwaltung, das auf die High Street hinausgeht. An der vierten, zur Logic Lane hin gelegenen Seite zieht sich die niedrige Bruchsteinmauer entlang, die bis zum »Burgtor« und dem neoklassizistischen Torhaus reicht, in dem traditionell der Provost wohnt. Der Kiesweg, der um den Garten führt, mündet ebenfalls dort.
Auf diesem Weg bewegten sich al-Medina und sein Leibwächter vorsichtig vorwärts. Nachdem sie den New Court einmal hinter sich gelassen hatten, war es unerwartet finster. Nur zwei oder drei antike Laternenpfosten neben dem Pfad warfen einen schwachen Lichtschein. Die Nacht war bewölkt. Nebel und Sprühregen trübten die Sicht noch zusätzlich. Vor sich sahen sie nichts als die schwankenden, tintenschwarzen Silhouetten von Büschen und Bäumen in dem parkähnlichen Garten.
Sie gingen dicht nebeneinander, schweigend und horchend. Von Zeit zu Zeit legte der Leibwächter dem Scheich die Hand auf den Arm, um ihn zum Stehen zu bringen, bevor er Entwarnung signalisierte und sie auf die gleiche vorsichtige Art weiterpirschten.
Seit seiner Begegnung mit der jungen Frau aus der Küche hatte al-Medinas Unruhe stetig zugenommen. Die fatalistische Stimmung war dahin; jetzt wollte er die Bedrohung, egal worin sie bestand, um jeden Preis überleben. Seine Verärgerung über die mangelnde Sicherheit in dem englischen College hatte sich zu einem angsterfüllten Zorn ausgewachsen.
Kurz vor der letzten Biegung stoppte der Leibwächter ihn erneut. Er hatte ein Geräusch wie von Schritten gehört. Mehrere Minuten standen sie in dem klammen Dunkel und spähten über ein Eisengitter in ein kleines Gehölz von Ziersträuchern, schwarz und tropfend in der Düsternis. Dann setzten sie sich wieder in Bewegung.
Hinter der Biegung kamen endlich Tor und Torhaus in Sicht. Im selben Augenblick begann die letzte Laterne vor ihnen zu flackern und verlosch dann, worauf der Weg in nahezu vollständiger Finsternis lag.
Verwirrt blieben sie stehen.
Al-Medina fragte gepresst: »Was ist jetzt los?«
Der Leibwächter antwortete nicht sofort. »Nur die Elektrik. Nichts in England funktioniert.«
»Dieser Ort«, sagte al-Medina verächtlich. »Niemand liebt uns hier. Gehen wir weiter.«
Fürs Erste rührte sich keiner von ihnen. Dunkelheit umgab sie, schwarz und kompakt. Dann wurden durch den Dunst allmählich blasse Lichtpünktchen sichtbar: die Fenster des Torhauses. Sie begannen darauf zuzugehen. Für die nächsten zwanzig Meter war kein Laut zu hören außer dem Knirschen und Scharren ihrer Schritte auf dem Kiesweg und al-Medinas schwerem Schnaufen. Und dann brachen in die Stille, jäh und brutal, wildes Rufen und das Stampfen rennender Füße ein.
»Schnell!«, ächzte al-Medina, und sie stürzten beide vorwärts.
Sie rannten vor ihm weg! Der Provost sah es entgeistert. Noch immer abgerissene Warnrufe ausstoßend, so unverständlich wie Tierlaute, stolperte er mit wedelnden Armen den Kiesweg entlang, ihnen nach.
Aber er kam zu spät.
Ohnmächtig musste er zuschauen, wie vier maskierte Männer vor al-Medina aus dem Unterholz sprangen und ihm den Weg versperrten.
»Nein!«, brüllte der Provost, ein letztes verzweifeltes Aufbäumen.
Ein wildes Durcheinander folgte. Der Leibwächter warf sich mit einem Aufschrei vor al-Medina, der in die Knie ging wie ein Elefant, und alles verschwamm und verwirbelte in dem Dunkel, Schatten vermengten sich in einem langen, zerhackten Moment der Panik, bis das Bild endlich klar wurde – und voll Grauen sah der Provost, wie die vier Gestalten sich vornüberbeugten und dem Scheich ihre blanken Hintern zeigten, die blassen Pobacken schimmernd in dem schwachen Lichtschein, der aus den Fenstern des Torhauses fiel.
Als seine Frau ihn schließlich einholte, saß er zusammengesunken vor dem Eisenzaun, außerstande zu sprechen, und im ersten Moment dachte sie, der Schlag habe ihn getroffen.
Hinter ihr kam Kent Dodge, beladen mit einem Armvoll Silbergerät, das seinen Platz im Torhaus hatte. Zu zweit machten sie sich an dem gestürzten Provost zu schaffen, bis er sie beide wegscheuchte und selbst auf die Füße kam.
»Was ist passiert?«, fragte seine Frau ihn. »Bist du hingefallen? Fehlt dir etwas?«
Sein Blick war grimmig. »Diese Drecksstudenten«, murmelte er erstickt.
Seine Frau zog ihn von Kent weg, der verlegen ein paar Schritte zurücktrat.
»Wovon redest du?«
Schmallippig setzte er sie ins Bild. »Das ist nicht komisch«, fügte er hinzu.
»Ach je. War er sehr verstimmt?«
»Verstimmt?« Er rollte mit den Augen. »Würde mich nicht wundern, wenn er uns alle hinrichten ließe. Oder uns die Hände abhacken lässt. So verfahren sie da drüben mit Leuten, die sie in ihrer Ehre gekränkt haben.« Gereizt begann er in Richtung seines Hauses zu schlurfen. »Im besten Fall«, setzte er bitter hinzu, »steigt er einfach nur aus dem Projekt aus.«
»Glaubst du?«
Mit bösen Gesicht drehte er sich zu ihr um. »Du warst auch nicht gerade eine Hilfe.«
»Wie meinst du das?«
»Beim Essen. Als du mich bei dem Bild widerlegen musstest.«
Sie hütete sich, etwas zu erwidern. Nicht ohne Anstrengung erklomm sie die Stufen zu dem kleinen Säulenvorbau und der Außentür ihres Hauses, und der errötende Kent Dodge folgte ihr schüchtern mit dem Silberzeug.
»Jetzt ist es überstanden«, sagte sie über die Schulter zu ihrem Mann. »Du kannst dich entspannen.«
Er murrte etwas in sich hinein.
»Entspann dich«, wiederholte sie. »Er ist weg. In Sicherheit. Ihm kann jetzt nichts mehr passieren.« Sie drückte die Klinke, rüttelte daran. »Seltsam.«
»Was ist seltsam?«
»Es ist abgeschlossen.«
»Was soll daran seltsam sein?«
»Du lässt sie doch immer offen.«
Wieder ein wütender Blick. »Stimmt nicht, ich sperre sie fast immer ab.«
»Hast du sie heute denn abgesperrt?«
»Muss ich ja wohl, oder?«
Wieder biss sie sich auf die Zunge. Seufzend holte sie ihren Schlüssel hervor und schloss auf, ging den Männern voran durch den Vorbau, um auch die Innentür aufzuschließen, und dann traten sie alle drei ins Haus. Kent trug die Silbersachen weisungsgemäß ins Esszimmer. Der Provost stützte sich schwer auf die Kommode in der Diele.
»Dein Zustand gefällt mir gar nicht«, sagte sie zu ihm. »Denk an dein Herz. Du brauchst deine Medizin.«
»Mir geht’s gut.«
Aber sein Ton war einlenkend. Es erleichterte ihn ungemein, zurück in der vertrauten Umgebung seines Zuhauses zu sein. Hier war er Herr über alles, die Möbel, die klassischen Tapeten und hellfarbigen Teppiche, die Bilder an den Wänden.
»Komm schon. Die Tabletten sind in deinem Arbeitszimmer.«
Er nickte schwach. Es war alles zu viel gewesen. Er ließ sich die Fürsorge seiner Frau gefallen und duldete ihren stützenden Arm an seinem Ellbogen.
Sein Arbeitszimmer war ein quadratischer, elegant eingerichteter Raum mit hohen Fenstern, bodenlangen Vorhängen aus grauer Chenille und einem Mahagonischreibtisch, neben dem ein Ledersessel stand. An den cremefarben tapezierten Wänden hingen etliche Gemälde, darunter, etwas versetzt über dem Schreibtisch, ein gerahmter Druck des Bilds aus der persischen Sammlung, das beim Essen Gegenstand ihrer Meinungsdifferenz gewesen war. Doch weder der Provost noch seine Frau hatten Augen für das Bild.
Sie starrten auf den Boden.
Auf dem hellgrauen Teppich lag eine junge Frau in T-Shirt und Jeans. Das T-Shirt war hochgerutscht und gab die Bauchpartie frei. Einer ihrer Schuhe war ihr vom Fuß gefallen und ein Stück weggerollt. Sie lag auf dem Rücken, den Kopf seitlich zur Wand verdreht. Ihr Haar umfloss als tiefbraune Pfütze das Gesicht, das gedunsen und verfärbt war; aus dem weit aufgerissenen Mund zwängte sich dick geschwollen die Zunge hervor.
Sie war ohne jeden Zweifel tot.
Kent Dodge kam von hinten heran, um sich zu verabschieden, und auch ihm blieb der Mund offen stehen.
Die Frau des Provosts sah ihren Mann an. Nach einer Pause sagte sie in beherrschtem Ton: »Nun, mit dem Bild hatte ich recht, wie du siehst. Aber ansonsten kann ich dir nur zustimmen. Wenn das hier herauskommt, kannst du dem Geld dieses Arabers endgültig ade sagen.«
Hinter ihnen ertönte ein scharrendes Geräusch, dann ein Aufprall. Kent Dodge, dieser junge Mensch, war umgekippt.
2
Vier Stunden danach läutete fünf Meilen weiter, in einem unaufgeräumten Zimmer in einem gesichtslosen Backsteinhaus in Bayworth, ein Handy. Aufleuchtend zuckte es zum Beat des »Bad and Boujee«-Klingeltons auf den dunklen Dielenbrettern, und von einer Matratze streckte sich ein Arm und tastete herum. Endlich verstummte das Klingeln. Mit geschlossenen Augen brachte ein Jugendlicher mit dünnem Gesicht und glänzendem Narbengewebe auf der linken Backe das Telefon in Kopfnähe und schnaufte einen Moment lang hinein, bevor er »Ja?« raunzte.
Eine Stimme teilte ihm mit, dass Arbeit anstehe.
»Worum geht’s?«
Die Stimme begann zu erklären.
»Wie? Jetzt gleich?«
Die Stimme setzte ihn notdürftig ins Bild, dann war das Gespräch beendet.
Der Jugendliche setzte sich mit hängendem Kopf auf und stöhnte. Mit dem Daumenballen rieb er an der juckenden Narbe herum. Dann hielt er sich das Handy dicht vor die Augen und las blinzelnd die Zeit ab.
»Habt ihr den Arsch offen?«, sagte er laut.
Er wählte eine Nummer, wartete, Augen geschlossen, bis abgehoben wurde.
»Ich bin’s«, sagte er gähnend. »Du, ich muss rüberkommen. Ja, jetzt sofort. Ich weiß selber, dass es mitten in der Nacht ist.«
Er stemmte sich von seiner Matratze hoch, stand dann da, eckig und ungelenk in seinem Carling Black Label-T-Shirt, kratzte sich den Schritt und starrte durch das vorhanglose Fenster hinaus auf die Äcker und Wiesen, die jenseits der Straße anstiegen bis zur Hügelkuppe, wo sich Viehunterstände aus Wellblech gegen den Nachthimmel abhoben. Alles war ruhig und still.
Er tappte zu dem Waschbecken in der Ecke, spritzte sich Wasser ins Gesicht und spülte den Mund aus, strich sich mit den noch nassen Händen das Haar glatt und wischte sie dann am T-Shirt ab. Es war kalt im Zimmer, er schauderte beim Anziehen. Pulli über das T-Shirt, Trainingshose, seine Nikes. Die Loop-Jacke.
Mit neuerlichem Gähnen trat er an eine Kommode und holte eine Pistole heraus, eine Glock 26, schwarz und unecht aussehend, so klein und leicht, dass sie in seine Jackentasche passte. Dann ging er leise über den Flur ins zweite Schlafzimmer.
Dieses Zimmer ähnelte in nichts seinem eigenen. Es hatte bunte Möbel und leuchtend gelbe Wände mit einem frisch gemalten Teddybär-Fries auf halber Höhe. In einem Kinderbettchen, unter einer Decke mit roten Treckern auf grünem Grund, schlief ein blonder kleiner Junge von etwa zwei Jahren, und der Ältere bückte sich und hob ihn heraus.
»Hallo«, flüsterte er. »Hallo.«
Das Kind maunzte leise und drückte das Gesicht gegen den Arm des Jugendlichen.
»Hey, Ry, du musst aufwachen. Daddy bringt dich zu Tante Jade. Komm, ja, so ist’s brav.«
Aber der Kleine wurde nicht wach. Seine Gliedmaßen waren so schlaff, als wären keine Knochen darin. Fast eine Viertelstunde geduldigen Hantierens war nötig, um ihm Jacke, Schuhe, Mütze und Handschuhe überzuziehen, und es war halb vier vorbei, bis der Jugendliche das schlafende Kind endlich die Treppe hinunter und zu dem Peugeot 306 tragen konnte, der auf einem räudigen Grünflecken vor dem Haus stand.
Das Motorbrummen erschien ihm überlaut, als er den dunklen, stillen Weg zur Foxcombe Road hochfuhr und dort nach rechts bog, an den Villen der Neureichen vorbei Richtung Ring. Im Norden, hinter den undeutlichen Wellenlinien der Felder, kam die Stadt in Sicht, winzig unter dem wolkenverhangenen Himmel, ein Nest trüber, vereinzelter Lichtpunkte. Der Motor spuckte und rasselte, als er auf der leeren Straße Gas gab.
»Hörst du das?«, fragte er den schlafenden Jungen neben sich. »Echt ein Dreck, diese Schüssel.«
Er knatterte den Hinksey Hill hinunter zum Kreisverkehr, über den Ring bis zur Abzweigung und vorbei am Hinksey-Point-Trailerpark, der komatös hinter seinem Wall aus Müll lag. Knatternd fuhr er das lange gerade Band der Kennington Road entlang, rumpelte über die Bremsschwellen alle hundert Meter, die die Raser abschrecken sollten, und erreichte schließlich die Kenville Road, eine kurze Seitenstraße mit verlotterten Doppelhäuschen.
Seine Schwester wartete in der Küche, in einem kurzen Frotteebademantel, eine schmächtige junge Frau mit der gleichen Hakennase wie ihr Bruder und blondem, straff aus dem Gesicht gebundenem Haar.
»Nicht mal vier«, sagte sie bitter.
Er erwiderte nichts.
»Von vier Uhr früh war nie die Rede«, sagte sie.
Sie streckte die Arme nach dem Jungen aus, und ihr Bruder übergab ihn ihr.
»Anruf ist Anruf«, sagte er. »So läuft das nun mal. Die rufen an, und du fährst. Ob du Lust hast oder nicht.«
»Was ist denn passiert?«
»Darf ich nicht sagen. Weißt du doch.«
Sie zog ein Gesicht. »Solang du’s nicht wieder verbockst wie beim letzten Mal.«
Er zuckte die Achseln. Dann beugte er sich vor, küsste seinen Sohn auf die Mütze und ging zur Tür.
»Wann holst du ihn ab?«, fragte seine Schwester.
»Nicht so spät.«
»Vor fünf jedenfalls. Dann muss ich arbeiten.«
»Okay.«
»Und wenn du zurückkommst, fährst du rüber und schaust nach Mam.«
»Ja, ja. Morgen.«
»Heute. Du hast es versprochen. Er hat sie wieder in der Mache gehabt.«
Grummelnd drehte er sich um und trat hinaus auf die stille Straße.
Sie rief ihm nach: »Und versieb’s nicht, du Knallkopf!«
Er zeigte ihr lässig den Finger. Wieder im Auto, nahm er die Glock aus dem Handschuhfach und steckte sie in die Tasche seiner Trainingshose. Es fühlte sich falsch an, also nahm er sie wieder heraus und klemmte sie sich stattdessen in den Hosenbund. Auch das fühlte sich verkehrt an. Er schob sie in die Jackentasche, wo sie gegen sein Bein drückte.
»Scheiß drauf«, sagte er leise und packte sie zurück ins Handschuhfach.
Dann legte er den Gang ein und knatterte die Kennington Road wieder zurück.
In der Pförtnerloge von Barnabas Hall humpelte Leonard Gamp mit einem Becher Tee auf und ab und überdachte die Lage. Obwohl er jetzt seit über fünf Stunden in Aktion war, empfand er keinerlei Müdigkeit. Im Gegenteil, ihn erfüllte sogar etwas von dem alten Schwung und Selbstvertrauen, mit dem er als Jüngerer in Gibraltar und in Tottenham agiert hatte, wenn es brenzlig wurde.
Der Anruf des Provosts war um halb elf bei ihm eingegangen. Seine erste Aufgabe war es gewesen, sich um den Provost und dessen Frau sowie vor allem um den jungen Amerikaner zu kümmern, der unter Schock stand und verarztet werden musste (kleine Schramme an der Stirn). Den Amerikanern, so seine Erfahrung, fehlte es häufig an Standvermögen. Zu seiner Enttäuschung war Leonard nicht in den Raum vorgelassen worden, in dem die Leiche lag, aber der Provost hatte ihn mit einer sehr ausführlichen Beschreibung entschädigt. Er hatte Leonard sogar um Rat gefragt, seine Antwort jedoch nicht abgewartet. Der Mann war durch den Wind, und kein Wunder. Zweimal hatte er Leonard seltsamerweise als »Wachmann« angesprochen. Sein Anblick war fast zum Fürchten gewesen, die Augen glupschend und unstet, die Stimme heiser. Zuletzt hatte seine Frau ihn mit einem Glas Brandy in einen Sessel verfrachtet und Leonard zurück in die Pförtnerloge geschickt, um den allentscheidenden Anruf bei den Behörden zu tätigen. Ab diesem Zeitpunkt war Leonard unaufhörlich im Einsatz gewesen, erst mit den Kollegen vom Kriminaldauerdienst, die den Tatort gesichert hatten, dann für mindestens eine Stunde mit dem Team von der Spurensicherung, während er gleichzeitig laufende Bulletins an den Provost und seine Frau liefern musste, die ihr Haus geräumt hatten und nun in dem neuen Büro des Provosts im Old Court auf den Ermittlungsbeamten warteten, dessen Ankunft aus unerfindlichen Gründen noch immer ausstand.