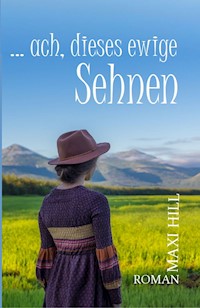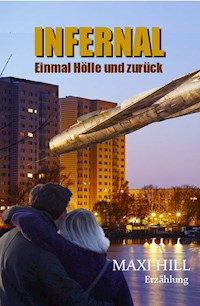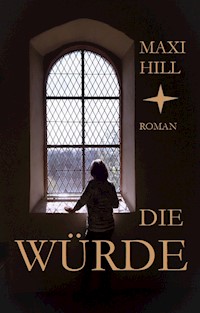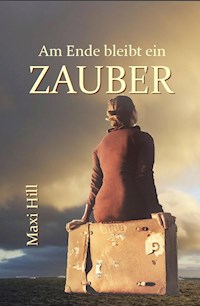Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Pechvogel Felix R. kommt unter mysteriösen Umständen in den Besitz eines als verschollen geltenden unersetzbar wertvollen Buches. Erst gerät er wegen Kunstraub in die Fänge der Polizei, und als das Schicksal ihn hart gebeutelt hatte, wird er eine neugierige Schreiberseele nicht los... Die Entdeckung der Buchautorin Isa B. setzt etwas in Gang, was sie nicht mehr aufhalten kann. Trotz vieler Warnungen will sie über einen Mann schreiben, den das Schicksal gebeutelt hat. Je mehr sie sich mit ihm beschäftigt, desto feindseliger wird er. Letztlich erfährt sie seine unglaubliche Geschichte - nicht ohne eigene Folgen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maxi Hill
Ein Pechvogel im Visier der Schnüffler
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die Story
Zitat
Der Anfang vom Ende
Teil I — Isa-Kathrin Benson
Erster Versuch
Gutes Leben — schlechtes Leben
Felix, der Pechvogel
Im Straßen-Café
Judith
Im Obdachlosenhaus
Die Leidenschaft des Schreibens
Teil II — Das Dilemma des Felix R.
Hinnerk Petersen
Die Kehrseite vom Glück
Der Spürsinn einer Schreiberseele
Ein neuer Anlauf
Das alles Entscheidende
Teil III — Das Unvorhersehbare
Wahrheitssuche in Sankt Peter Ording
Freundschaften und andere Werte
Unumkehrbar?
Ein Ende mit Schrecken?
Teil IV — Judith in Sorge
Frühlingsgefühle
Teil V — Alles fügt sich
Maxi Hill
Demnächst
Impressum neobooks
Die Story
Der Pechvogel Felix R. kommt unter mysteriösen Umständen in den Besitz eines als verschollen geltenden unersetzbar wertvollen Buches. Erst gerät er wegen Kunstraub in die Fänge der Polizei, und als das Schicksal ihn hart gebeutelt hatte, wird er eine neugierige Schreiberseele nicht los...
Die Entdeckung der Buchautorin Isa B. setzt etwas in Gang, was sie nicht mehr aufhalten kann. Trotz vieler Warnungen will sie über einen Mann schreiben, den das Schicksal gebeutelt hat. Je mehr sie sich mit ihm beschäftigt, desto feindseliger wird er. Letztlich erfährt sie seine unglaubliche Geschichte - nicht ohne eigene Folgen ...
Zitat
Ich kann nicht müßig sein und kann doch
auch nichts tun.
(J. W. von Goethe)
Der Anfang vom Ende
Wiesbaden / Berlin: Schlag gegen Kunsträuber
Neue Spur führt in die Lausitz
Die weltweiten Ermittler, die den Raub wertvoller Schätze der Weltliteratur aufzuklären versuchen, haben eine neue Spur. In einer Lausitzer Grenzstadt wurde ein Mann verhaftet, der drei offenbar gestohlene, sehr kostbare Bücher besitzt. Eines davon ist eine lange vermisste, unschätzbare Handschrift, die in den Kriegswirren aus dem Ahmed Baba Institut in Timbuktu verschwunden sein soll: »De Lithis«, ein Kompendium über die magischen Kräfte von Steinen.
»De Lithis« ist ein schwer mit Metall beschlagener Folio von 360 Seiten, auf dessen Titel die i-Punkte mit einem Onyx und einem Rubin gebildet sind. Der Inhalt ist reich illustriert und mit Regionalkarten ergänzt. Das Werk wurde um 700 vom Magier Isfaleon von Rommilys verfasst und gilt als die ausführlichste Sammlung von Erkenntnissen über magische Kräfte von Steinen und Metallen. Dem Autor dichtet man an, er sei zusammen mit dem Original im mystischen Land der Schwarzen Sichel verschollen.
Wahr ist, dass einzelne Fragmente in mehreren Abschriften in namhaften Bibliotheken und Sammlungen der Welt kursieren, der Verbleib des Gesamtwerkes war allerdings bisher umstritten.
Nun wird geprüft, ob es sich bei dem beschlagnahmten Exemplar um das Original handelt. Weil das Buch wechselweise in Bosparano und einem schwer verständlichen Garethi abgefasst ist, dürfte eine sichere Expertise einige Zeit in Anspruch nehmen. Solange bleibt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei des Täters habhaft wurde, ist der Redaktion unbekannt. Fest steht aber, dass man Felix R. in den Rang der Kenner einordnet.
Teil I — Isa-Kathrin Benson
Drei Jahre später.
Da läuft er mit großen Schritten die Straße entlang. Unter der Last seines bunten Beutels ist sein Körper nach vorn gebeugt. Er ist einer von denen, für die es nur unwürdige Namen gibt.Penner. Aussteiger. Vagabund. Stromer. Bettler?
Die meisten sind bettelarm. Dieser immerhin bettelt nicht. Sie sieht ihn hin und wieder – immer allein – nie mit denen, die an den Hecken sitzen und trinken, die lallen und pöbeln, die Wut und Missmut streuen gegen die scheelen Blicke derer, die sich vom schäbigen Anblick belästigt fühlen.
Für Isa-Kathrin Benson ist es schwer zu sagen, was diesen einen so einzig macht. Sie schätzt sein Alter zwischen vierzig und fünfzig. Sein schwerer Gang vergreist die schmale Gestalt. Das dunkle Haar, dem etwas Glanz geblieben ist, stößt wellig bis zum Nacken, doch die Furchen in seinem Gesicht zerkratzen das letzte Bild von Jugend.
An einem kalten Wintertag hatte sie ihn im Buchhaus «Am Stadtbrunnen» gesehen. Es saß auf der roten Lesecouch wie selbstverständlich vertieft in eine kleine Lektüre. Sein schäbiges Hab und Gut lag zu seinen Füßen. Den graugrünen Parka hatte er geöffnet, nicht abgelegt. Vielleicht schamvoll, vielleicht glücklich, im Warmen sitzen zu dürfen und etwas von dem Leben zu erfahren, aus dem er ausgeschlossen ist. Momentan. Oder länger? Im Gesicht eine goldene Brille, die er zuvor niemals trug, die er auf der Straße nicht trägt. Ein Mann, mittendrin und doch am Rand der Gesellschaft?
An jenem Tag fühlte sich Isa-Kathrin Benson machtlos ihn anzusprechen. Wie eine Gesunde am Bette des Kranken, dem eine Buchautorin, wie sie eine ist, nichts bieten kann als bloße Worte, aufgereiht in Zeilen aneinandergefügt zu Seiten?
Für einen Moment legte der Mann das grüne Büchlein aus der Hand. Etwas stach in ihre Augen. Etwas, was nicht zu ihm gehören konnte.
Ihre Lippen öffneten sich stumm; ihre Wangen erschlafften. Dann ist sie gegangen. Staunend. Grübelnd.
Verblüfft ist sie noch immer: Warum liest einer von denen Goethe?
War es nur das Werk Goethes, das sie nachsinnen ließ? Hätte sie sich gedankenlos abgewendet, wäre er ihr so begegnet, wie sie ihn bisher kannte: Mit hängenden Schultern unterm abgenutzten Mantel. Mit ausgetretenen Schuhen. Mit prall gefülltem Plastik-Beutel. Wäre ohne Goethe ihr Denken anders?
Sie war nie ein Ignorant. Sie setzte Prioritäten. An erster Stelle kam ihr eigen Fleisch und Blut. In ihrem Leben gab es Unerfülltes und es gab Unerfüllbares. Zwar hat fremde Wohlstands-Gier in ihrer eigenen Familie Schatten hinterlassen, die durch ihre Kraft nicht zu erhellen waren, aber es hat niemanden von ihnen auf die Schattenseite des Lebens gedrängt wie diesen Mann, den sie tief in sich drin Vagabundo nennt. Keines der Schimpfworte lässt sie zu. Vagha Nbundho hieß einer in diesem fernen Land, das in ihrem Inneren Spuren hinterlassen hat. Dieser Afrikaner war kein Vagabund. Vermutlich war sein Name, den sie nie geschrieben sah, einer wie hierzulande Werner, Wolfgang, Waldemar oder Meier, Müller, Schulze. Er war ihr afrikanischer Nachbar und gutsituiert, wie es vielleicht auch Vagabundo einmal war.
Isa hatte für Vagha Nbundhos Frau Rosalia Gardinen aus Deutschland mitgebracht. Einen ganzen Koffer voll. Freilich war ihr Ärger groß, als Rosalia den Stoff in lauter kleine Fetzen teilte und vor alle Türen in ihrer Wohnung hängte, um lästige Moskitos fernzuhalten. Afrikanische Logik und europäische Denkart sind so weit voneinander entfernt wie die Kontinente.
Angesichts der Hungernden im bairro - wie man die Elendsviertel dort nannte - waren Gardinen purer Luxus, das wusste sie, aber sie brauchte gegen den übergroßen Mangel in diesem Land den Vorteil, den Rosalia ihr bot. Die Eheleute gehörten zur privilegierten Schicht, die nicht darbte. Auch deshalb fiel es Isa leichter, den Ärmsten in den bairros etwas abzugeben. Auf diese Idee wäre Rosalia nicht gekommen, und sie sollte davon auch nichts wissen. Immer wieder fragte sich Isa damals, warum die Landsleute, denen es besser ging, keine Notiz vom Elend nahmen? Ein Umstand, der unter die Haut ging.
Für einen Moment hebt sich die Erinnerung aus all den Bilder heraus. Dort in der Fremde war sie selbstlos. Sehend. Entschieden. Das fehlt ihr angesichts hiesigen Unrechts, wie es denen dort gefehlt hatte. In dieser Welt ist gar nichts so verschieden wie man glaubt. Den Riss an der eigenen Tür übersieht der Blick in die Ferne.
Ihr Fuß setzt heftiger auf als normal. Muss man sich einmischen, ohne gebeten zu sein? Der sollte etwas tun, der ein Elend zu verantworten hat. Sie hat es nicht zu verantworten. Sie hat das Elend hierzulande sogar kommen sehen, wie im Märchen vom Fischer und seiner Frau. Im Überfluss erkennt man die Sorge nicht, die in den Augen des Nächsten liegt.
Sie will nicht müßig sein und kann doch auch nichts tun.
Vom Dasein ohne feste Bleibe – die einer von denen auch Platte machen nennt - hat sie nur nebelhafte Vorstellungen. Konkrete Bilder findet sie nicht, nicht so konkret, wie vom Elend am anderen Ende der Welt, wo sie hinter die Zäune der dürftigen Hütten sehen konnte, ins offene Herz der Familien …
Zäher Nebel umhüllt die Häuser und kriecht feucht und kalt in Hals und Ärmel. Sie schreitet schneller aus. Der Marsch tut dem Körper gut, klärt auch den Kopf, und genau das ist der Grund, warum sie täglich ihr Pensum läuft. Bei jedem Wetter. Vielleicht gibt die Stadt mit den grünen Parks eine kühlere Sicht auf ihre glühende Idee, die ihr Mann Gary so vehement kritisiert.
Vagabundo ist längst im Nebel verloren. Wohin mag er gehen bei diesem Wetter? Es wäre zu früh, ihn anzusprechen. Sie braucht erst innere Klarheit.
Tiefer Atem strömt in die Lunge. Sie liebt es, in Ruhe über etwas nachzudenken. Freilich muss sie sensibel mit der Sache umgehen. Nicht stocksteif, um nichts zu gefährden. Auch nicht zu biegsam, um die eigene Achtung zu bewahren. Mit dem Kopf durch die Wand ist nicht ihr Stil.
Meistens fällt sie Gary mit ihrem rituellen Ernst auf die Nerven, so wie ihr kaum ein Scherz von ihm gefällt. Dieses Mal aber scherzt er nicht. Er lässt keinen noch so winzigen Zweifel, ihr Vorhaben als absurd zu erklären.
Sie ist sich selbst nicht sicher, ob ihr soziales Denken so weit gehen muss. Bücher mit latenter Sozialkritik – wer will die noch lesen?
Sollte sie diesem Mann stattdessen ein paar Kleidungsstücke bringen? Von Gary? Oder etwas zu essen? Einen Rucksack vielleicht für sein Hab und Gut, damit man ihn nicht als Vagabund erkennt?
Sie hadert mit sich. Gary ist Pragmatiker. Wenn er warnt, sie weiß nicht, worauf sie sich einlässt, steckt meistens ein Fünkchen Wahrheit dahinter.
»Denke an Afrika«, hat er gesagt. »Du kriegst die Hungerleider nicht mehr los, wenn sie erst Blut geleckt haben. Und glaub mir, hier denken die Leute wie dort. Die hat ΄s, der fallen die Tausender nur so in den Schoß. Oder willst du jedem erzählen, wie die Buchbranche wirklich tickt?«
Das von der Buchbranche will sie nicht hören, und über ihre Zeit im Land der roten Erde will sie auch nicht mehr nachdenken. In beides hatte sie ihre Ideale gelegt. Beides lief nicht ideal.
Im fernen Land sah sie das Unrecht in Krieg und Korruption. Der Krieg ist vorbei. Der Rest ist geblieben. Die erste Milliardärin der Welt ist hiesigen Gazetten zufolge die Tochter des dortigen Staatschefs, während im Lande noch immer millionenfach gehungert wird. Der Ursprung vom Reichtum wird nicht hinterfragt — Blutdiamanten und reiche Schätze aus blutgetränkter Erde. Dass es allein der Krieg war, der dort den Hunger brachte, bezweifelte sie schon damals. Woran aber soll sie hier zweifeln? Was treibt einen Menschen heute und hier in ein solches Elend, das keiner sehen will? Wenn menschliches Elend nur stört, ist man abseits des Menschlichen.
Seit langem hat sie keine Ideale mehr. In diesem Teil der Welt, in ihrem Land, sind Ideale, Nächstenliebe und Verantwortung zur Lächerlichkeit mutiert. Der geldwerte Vorteil ist das Maß allen Denkens. Es gibt kein einzig Volk von Brüdern, keine Gerechtigkeit und noch weniger Gleichheit.
Die Beobachtung in diesem Buchhaus hatte bei Isa-Kathrin Benson Gedanken geboren, über die sie früher gelächelt hätte, die ihr in den letzten zwei Nächten den Schlaf raubten — ohne Ergebnis. Verpflichtet fühlt sie sich zu nichts, aber die Jahre unter afrikanischer Sonne, und dennoch auf der Schattenseite der Welt, haben noch Zugriff auf ihren Verstand.
Eines hat sie nächtelang herausgefiltert: Wenn Gary in seiner kühlen Logik davon abrät, dann macht sie das wütend. Er ist Pragmatiker, und genau das ist es schließlich, was sie zuweilen enttäuscht. Ein wenig mehr Innenleben darf auch ein Mann zeigen. Auf dieser Welt gibt es vermutlich mehr Psychologen als es Männer gibt, die sich selbst eine Seele zugestehen.
Der Wind sprüht feinen Regen bis unter die Kleidung. Sie reckt ihr Gesicht dem Niesel entgegen. Ihre glühenden Gedanken kühlt er nicht.
Erster Versuch
Am Mittwoch-Nachmittag geht sie den Weg durch die Stadt bis zur Kirche hin, wo sie ihn zuletzt gesehen hat. Wie von unsichtbarer Hand gehalten steht sie auf der Stelle und rührt sich nicht vom Fleck. Beim Anblick des großen Gotteshauses will die Denkart ihrer ungläubigen Mutter nicht aus ihrem Kopf:
Warum um alles in der Welt hat man den Kraftquell des menschlichen Willens in den Himmel verlegt? Warum besinnt sich der Mensch nicht auf sich selbst, auf seinen starken Willen, auf Menschlichkeit? Warum geschieht im Namen Gottes so viel Unrecht?
Ein Rollstuhlfahrer kommt auf seinem Vehikel herbeigesurrt. Ein Kirchendiener. Sie kennt ihn aus der Nachbarschaft, spricht oft mit ihm, leiht ihm bisweilen ihr Geschick, wenn seine Not es erfordert. Sein fragender Blick aus der Ferne beschämt sie in ihrem Warten. Wie kann sie erklären, hier auf einen zu lauern, den ein Unglück getroffen hat — ein anderes als ihn. Noch weniger, warum sie sich dieses Ortes besinnt, dessen Bestimmung sie aus Überzeugung meidet.
Mit kräftigem Schritt läuft sie um die Kirche herum. Ihre Religion trägt ein altes Proletarierlied über die stummen Lippen: » ... uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.«
Sie hat lange verdrängt, wie trügerisch Lebensweisheiten sein können. Logisch, dass sie mit den Jahren vergessen hat, wie sie als Kind erfahren musste, was Hunger ist, und wie Verzicht auf ganz profane Dinge ein Kind scheu gegen das Leben macht. Es ist lang her und die Zeiten waren andere.
Seit langem war ihr klar, dass die Jahre, die noch vor ihr lagen, den Bildern aus ihrer Kindheit in nichts mehr gleichen würden. Ein Déjà-vu ist nie ausgeschlossen. Der Strom der Zeit schwemmt irgendwo etwas an und reißt irgendwo etwas mit sich fort. Entscheidend ist, ob die Menschen sich im Strudel des Lebens die helfende Hand reichen. Dazu müssen sie einander verstehen. Genau hier steckt ihr Problem: Wird dieser Mensch ihre Hand als helfend erkennen? Kann er verstehen, was sie von ihm will?
Isa hält den Atem an. Sie sieht ihn, aber sie weiß nicht, was da in den äußeren Nischen am Kirchenschiff gerade vorgefallen ist. Etwas muss geschehen sein, derweil sie in alten, nutzlosen Gedanken verfangen war. Sie nimmt sich vor, den Mann darauf anzusprechen, das ist besser, als ihn mit ihrer Idee zu überfallen. Wie sollte sie auch etwas in kluge Worte kleiden, was sie in bloße Gedanken zu ordnen noch gar nicht in der Lage ist.
Sie sieht sein Gesicht, das die Spuren der Straße trägt. Sein schmaler Körper ruckt und zuckt beim Richten seiner Kleidung. Alles deutet darauf hin, dass er sich gerade gegen etwas zu erwehren hatte. Er wischt mit den Händen über die Ärmel seiner Jacke und an den Längen entlang, schlägt wütend über die Hosenbeine und zupft seinen Beutel zurecht, während sie einen Kerl in einer auffällig großkarierte Jacke und einen zweiten in brüchigem Leder hinter die ehrwürdigen Mauern verschwinden sieht.
Vagabundo stapft derweil vorwärts. Sein Kopf ist gesenkt, bis er beinahe vor ihr steht.
»Was ist mit Ihnen passiert?«
Als er begreift, dass sie ihn meint, zieht er den Kopf in den Nacken. Jedenfalls vermeidet er, Isa anzusehen. Sie steht im Schutz des Gotteshauses und wartet auf ein Zeichen eines von Gott Vergessenen, auf das erste Wort, das gewöhnlich vieles klärt. Vielleicht müsste sie ein anderer Typ Mensch sein, um das stumpfe Gesicht zu verstehen, das sie sieht. Weniger leidenschaftlich müsste sie sein, weniger mitfühlend, angepasst an das Maß der Elle, die den Nächsten fern hält. Ein solches Erlebnis, wie er es gerade glimpflich überstanden hat, bewirkt nicht selten, ein düsterer Mensch zu werden. Ein Eigenbrötler. Ein Unnahbarer. Ein Hasser?
Ohne Zweifel macht einer wie er eine Menge durch und wird eine Menge zu erzählen haben. Es ist seine Sache, wenn er noch schweigt. Aber ist sie deshalb hier? Kaum traut sie sich, ihn genauer anzusehen. Blicke verraten zu viel. Es ist wie eine Prüfung, die sie zu bestehen hat. Wer länger aushält, ist der Sieger.
Ein schwaches Kopfschütteln wühlt sein Haar herum. Doch Isa spürt, dass etwas in ihm vorgeht. Als er endlich die Lippen öffnet, klingt der Satz wie von Skepsis zerfressen und doch so wohlgeformt für ihre Ohren:
»Was geht die Welt mein Leben an?« Zögerlich kommen die Worte aus trockenem Mund; seine Augen sind weder trocken, noch zögert sein Blick. Er eilt hinweg und kehrt zurück. Er huscht mal hier- und mal dahin und findet doch nicht in ihr Gesicht. Gegenüber an der Suppen-Bar stehen zwei Gaffer. Offenbar haben sie mit Schlimmerem gerechnet. Enttäuscht, dass nichts weiter passiert, trollen sie sich davon.
»Ist es nicht schlimm genug, wenn keinen das Leben des anderen rührt?«, sagt sie schnell. »Aber wenn man schon direkt dabei ist …«
Ihre pure Anwesenheit scheint ihm zuwider. Ihr Drang, mit ihm zu reden, ihm zu zeigen, dass es auch gutherzige Menschen gibt, ist stärker. Noch muss sie für sich behalten, dass sie eine Idee ausbrütet, die sein Leben ändern könnte. Zu unnahbar ist er.
Hat sie auf so morschem Grund gebaut? Was ist sein Leben? Sein Durch-die-Stadt-Ziehen, ohne Sinn und ohne Ziel, sein Nur-den-Tag-Überstehen. Ist das noch Leben?
»Ich sehe Sie oft in der Stadt. Eigentlich bin ich Ihretwegen hier.«
Der Blick des Mannes hält inne. Im nächsten Moment nimmt sein Körper eine drohende Haltung ein.
»Sie hatten mich also auf dem Schirm«, spucken die schmalen Lippen aus. Der Ton ist spröde, als redet er für einen anderen.
»Wer nicht beobachtet, kann keine guten Bücher schreiben. Ich bin Buchautorin und schreibe gerade über … Menschen wie Sie.«
Isa glaubt, ihre letzten Worte haben eine gewisse Wirkung auf ihn. Sofort greift sie nach der Mappe und zieht ein Papier hervor, ein paar Blätter nur, ein Entwurf vom Beginn ihrer Erzählung.
Seine Augenbrauen heben sich: »Das also ist des Pudels Kern.«
Bis zu dem Moment hat sie geglaubt, es sollte nicht schwer sein, einen Mann wie ihn von ihrer guten Absicht zu überzeugen. Grad jetzt ist sie ärgerlich, auf Gary gehört zu haben. Es wäre leichter gewesen, ihn mehrmals still zu beschenken und damit sein Vertrauen zu erwirken. Das hat sie nun verspielt. Kein Wunder, wenn sie stottert: »Ich schreibe in allen meinen Büchern … entweder, wie die gesellschaftlichen Umstände auf einzelne Menschen, auf deren Schicksal zurückwirken. Oder wie jemand unverschuldet in Not gerät und …«
Er lässt ihr nicht die Zeit, die sie braucht. Sein schmaler Mund zwängt ein paar Worte heraus, die ihr sehr gut bekannt sind: »In dieser Welt ist es selten mit dem Entweder-Oder getan.«
Sein Körper muss in dieser Welt zurechtkommen, sein Geist lebt in einer andern. Ist es das, was die geborgten Worte ihr zu sagen versuchen?
»Auch Goethe hatte damit seine Not«, sagt sie wie nebenbei, ohne genau zu wissen, ob sie sich im Verfasser irrt. Mit einem wie Goethe kann sie nicht punkten. »Ich verstehe, dass Sie niemandem vertrauen. Vielleicht auch nicht können. Ich …« Mein Gott, sie kann noch ich sagen. »Ich will meinem Buch etwas Wahrhaftiges geben. Wahrheit ist nie zum Nachteil. Wenn ein Stoff ein reales Leben in sich birgt, kann dieses reale Leben enorm verändert werden …«
»Wahrheit ist schwächer als Unrecht«, sagt das versteinerte Gesicht nach langem Zögern und doch mit so viel Abscheu, dass sie nichts zu erwidern weiß und einfach weiterredet. Viele farblose Worte vom gegenseitigen Geben und Nehmen, von der Zweck-Gemeinschaft, die man eingehen kann, ganz ohne Pflichten.
»Ich kann Sie nicht befreien vom Unrecht, das Sie zerstört hat, aber ich kann mit meiner Art Kunst …«
»In der Kunst ist die Form alles, der Stoff gilt nichts«, sagt er sehr rasch in ihre Atempause hinein und drängt an ihr vorbei.
»Nicht jede Kunst«, hält sie ihn auf, mit Worten nur, nicht deutlicher. »Manchmal ist es die Form und manchmal der Stoff. Guter Lesestoff spürt dem Unrecht nach. «
Ihre zitternde Hand hält mit Mühe das Papier, ihr Mund verstummt, weil seine Faust bedrohlich wird. Sein Ton ist es auch: »Das mit dem Unrecht …«, seine Hand fällt mit dem ersten Wort schwer und trostlos herunter, »hat sich für mich erledigt. Endgültig.«
Isa atmet auf. Noch nie ist ihr ein Mensch begegnet, dem sie so zwiespältig gegenüberstand. Vor Minuten noch trieb sie die eigene Leidenschaft in seine Nähe, und nun treibt sie eine rasch erhobene Hand so sehr ins Grübeln, dass sie an Schlimmes denkt?
Isa widerstrebt es, schlechte Gedanken zuzulassen. Es fällt ihr auch nicht schwer, trotz allem das Gute in ihm zu suchen.
Was wir gestern wussten, zählt heut nicht mehr. Was wir heute wissen, wissen wir morgen besser. An allem ist zu zweifeln.
»Seit ich herumgetrieben werde und sehe, was man tut und wie man ΄s treibt, stehe ich viel besser zu mir selbst«, faucht er atemlos. Sie hört es wohl, aber sie sieht mit neuer Angst seine Augäpfel aus den Lidern schwellen.
Isa schlägt ihre Augen nieder. Auch wenn er Goethe benutzt, dieser Kerl zerrt an einer empfindlichen Stelle. Sie war viel zu lange eine von denen, die die Wirklichkeit als unabänderlich hinnahm, ohne Aufbegehren, ohne Kritik zu üben. Das bereitete ihr seit Jahren Unbehagen. Warum sie nie wieder so sein will, liegt auf der Hand. Sie bewundert Menschen, die deutlich sagen, was sie denken. Frei heraus erhöht das eigene Selbstwertgefühl. Dieser Mensch aber sagt nicht freiheraus, was in ihm umgeht. Er rechtfertigt sein Denken nach den Büchern, die sein Geist zu fassen kriegt. Wie soll sie einen solchen Menschen zu fassen kriegen?
Nicht alles hält sie für aussprechbar. Sie hätte schließlich auch ehrlich sagen können, was sie beobachtet hat und was sie an ihm seither interessiert. Sie kann es nicht, weil das nur eine Seite des Menschen berührt, eine, von der sie nicht weiß, wie er selbst sie empfindet.
»Dieses Papier ist der Anfang meiner Geschichte. Ich bitte Sie … lesen Sie es in Ruhe und entscheiden Sie dann, ob Sie mit mir reden wollen?«
So flehentlich kommt sie sich erbärmlich vor. Er zögert, das spürt sie, deshalb verbietet sie sich jedes weitere Wort. Vielleicht gehen ihm ähnliche Gedanken durch den Kopf. Zaudernd greift er nach dem Papier, das sie zusammengefaltet seit Tagen mit sich herumträgt. Vielleicht, weil er auf diese Weise wieder etwas zu lesen bekommt?
Für den blauen Geldschein, der zwischen den Seiten liegt, schämt sie sich jetzt und fürchtet zugleich, er landet mitsamt dem Papier im nächsten Abfallkorb. Die erste Silbe, die ihr dazu einfällt, verliert sich in seinem Protest: »Der Worte sind genug gewechselt …«
Sie wartet, dass noch etwas folgt, aber es folgt nichts. Nur sein schleppender Gang entfernt sich durch die Kirchenpforte.
Als wäre sie von innen ausgehöhlt steht sie da und kann nichts anderes denken: Menschen ertragen Schlimmes, um noch Schlimmeres zu vermeiden? Was ist noch schlimmer für einen intelligenten Mann?
Lange brütet sie vor sich hin, dann setzt auch sie den ersten Fuß und geht zweifelnd: Welchem von den beiden Menschen, die sich nicht finden, sollte sie jetzt zürnen?
Sie hat sie nicht kommen sehen. Jetzt sind sie neben ihr und halten Schritt. Der kleine weißhäuptige Mann mit dem stocksteifen Gang. Und die gebeugte Frau an seiner Seite, unscheinbar, aber scheinbar nicht uneins mit ihrem Mann.
»Wo sind wir nur hingekommen«, dröhnt der Bass des Mannes, der einmal Rechtsanwalt gewesen ist. »Jetzt werden wir ehrbaren Leute schon am helllichten Tage angebettelt.«
Erschrocken blickt sie in sein lauerndes Gesicht. Sie weiß nicht, warum der Mann wir sagt, und sie weiß noch weniger, ob er ehrbar ist. Sie nimmt es an und bleibt höflich.
»Er hat nicht gebettelt.« Sie ist klug genug, nicht zu erklären, wer wen gebettelt hat.
»Diese Penner betteln doch alle«, mischt die Frau sich ein. »Mehr haben die doch nicht im Kopf, als sich Fusel zu beschaffen. « Die Frau kommt Isa ziemlich nah. »So etwas braucht unsere Welt nicht.«
Die Worte der Frau sind seelenlos, wenn auch nicht weit von denen entfernt, die ein gewisser Charles Darwin schon um 1830 gebrauchte, als er von natürlicher Selektion gesprochen hatte. Es war nur sein Erkennen von Gesetzmäßigkeiten, keine Willkür, keine Präferenz der Stärke. Die Natur als Schöpfung ist so eingerichtet. Wenn aber die Krone der Schöpfung an diesem Ort, zu dieser Zeit, ein anderes Kapitel aufschlägt, dann müssen andere Gesetzmäßigkeiten wirken. Das Gesetz des Habens, nicht des Seins.
»Er scheint sogar ein intelligenter Mann zu sein«, sagt sie in einem Ton, als spreche sie zu sich selbst.
»Im Schnorren sind die alle clever.«
Isa lässt Menschen gerne gelten. Jetzt macht es sie krank, am Rechtsempfinden eines Rechtsapostels zweifeln zu müssen. Sie kennt diese Leute. Ihr Weg würde sie noch ein gutes Stück in gleiche Richtung führen. Sie muss jetzt seitwärts gehen.
»Aber nicht alle sind an ihrem Elend selber schuld«, kann sie noch sagen.
»Recht haben Sie«, doziert der Mann, der die klaren Worte seiner Frau mit ungewisser Miene zur Kenntnis genommen hat. »Das hätte es früher nicht gegeben.«
Früher, das meint die Zeit, wo es trotz Wohnungsnot keine Obdachlosen gab, und der man heut ein großes Maß kollektiver Schuld nachsagt. Jeder hätte etwas tun können gegen das Unrecht. Jeder? Gut, dann aber damals wie heute. Zu keiner Zeit will einer eine Pflicht erkennen, notfalls gegen den Strom zu schwimmen.
Als sie sicher ist, der Weg der Leute zielt direkt der Heimstatt zu, schwenkt sie kurzerhand ab und lässt die beiden mit sich und ihrer Abscheu vor dem Elend allein.
Sie leben im selben Viertel der gleichen Stadt, im selben Staat der gleichen Welt. Sie hören dieselben Nachrichten, erleben dieselben Ereignisse. Sie sollten in derselben Lage sein, so nüchtern wie möglich zu analysieren. Und dann zeigt sich, wie völlig anders sich das Leben in den Hirnen spiegelt. In klugen wie in begrenzten. Keiner will für die Auswüchse der Zeit etwas können. Jeder ist sich seines Rechts sicher. Das Unrecht findet immer eine Quelle, aus der es sprudelt, und die ist weit entfernt von einem jeden.
So klare Worte gelingen ihr nicht, wenn sie ins Angesicht der Arroganz schaut. Es ist beschämend, dass sie fernab ihrer wohl durchdachten Zeilen so wenig deutlich werden kann. Sie ist erbittert über sich und ihre Verwirrung, in die sie ein «Rechtloser» gebracht hat. Sie ist verbittert über den Mann aus ihrer Nachbarschaft, der einst für das Recht einstand, viele Jahre seines Lebens. Wo ist er hin, sein wissender Blick auf das Recht.
Je länger sie über gewisse Minuten des Tages nachdenkt, desto drängender wünscht sie, genau an diesem Buch weiterzuschreiben. Ihre Gefühle, die das Denken im Griff haben, könnten schwinden und dann würde es eine völlig andere Story werden.
Am Abend liest sie im «Werther» und recherchiert im Faust. Die Zitate des Vagabundo waren alle nicht ganz korrekt und kaum vollständig. Aber sie kamen frei aus einem Munde, dem man gewöhnlich nicht ein Quäntchen davon zutraut. Umso mehr muss sie seinem Schicksal nachspüren. Irgendwo muss etwas Ungewöhnliches zu finden sein …
Gutes Leben — schlechtes Leben
Samstagabend. Sie laufen am Bauzaun entlang, Isa und ihr Mann Gary. Seit Jahren kaschieren Bretter das Unvermögen der Stadtoberen, ein Bauvorhaben zu Ende zu führen. Der Abriss der Pavillons aus den siebziger Jahren war rasant gegangen. Jetzt zerfurchen öde Narben das Gesicht der Stadtmitte. Einst krümmte sich eine Brücke über das satte Grün der Wiese. Üppige Blütenrabatten zogen sich darunter durch und weiter längs der Stadtmauer entlang. Dann forderten einige Meinungsmacher, die Relikte aus der ungeliebten Epoche der Arbeiter- und Bauernmacht müssten weg. Jetzt erträgt man seit Jahren klaglos den löchrig-hölzernen Bauzaun, von dem zwischen abscheulichen Graffitis zerfetzte Plakate herabhängen.
Es ist ruhig in der Stadt.
»Wo bleiben die vielen Menschen?«, fragt Gary. »An eine Großstadt kann man nicht mehr glauben.«
Früher flanierten viele Leute in der Abendstunde durch die grünen Promenaden, erfreuten sich an den kunstvoll gestalteten Schaufenstern oder suchten einen Platz in einem Restaurant. Freilich reichten die Plätze nie aus.
»Mir macht es nichts aus«, sagt Isa. »Den Luxus, sofort einen freien Tisch zu bekommen, haben wir damals immer ersehnt.«
Gepflegt essen zu gehen war ein Luxus, den sich jeder bisweilen leistete. Eine Frage des Preises war es nicht. Auf die edlen Zutaten kam es an, für die man diverse Beziehungen brauchte.
»Ich mag den Überfluss genauso wenig wie den Mangel«, bekennt Isa. Gary zieht die Schultern an, zumindest heute gibt er ihr Recht:
»Wer hätte damals gedacht, wie Überfluss die Beziehungen der Menschen hemmen kann. «
»Sag nicht, im Mangel liebten wir uns mehr …«
»Nein. Nachbarn und Kollegen waren enger miteinander. Man redete mehr und gab sich ehrliche Tipps, wo etwas zu ergattern war, oder wie das Leben leichter ging. Wer redet heute im Fahrstuhl noch über mehr als über Lapidares: Das verrückte Wetter. Die heutige Jugend. «
Isa hakt sich bei Gary unter und versucht, seinen Schritt zu halten.
»Veränderung bringt immer auch Ungewolltes mit sich«, sagt sie. Worte über die Zeit, wenn das Nachtleben pulsiert, wenn die Bars und Diskotheken öffnen, erspart sie sich. Es ist nicht ihre Zeit. Seit Langem meidet sie die Stadt zu später Stunde. Es ist zu unsicher geworden. Schlägereien gehören zur Nacht genauso wie Überfälle, Diebstähle und Einbrüche. Daran will sie heute nicht denken. Wie lange waren sie nicht mehr aus. Gary fehlt gänzlich die Lust und ihr fehlt die Kraft, ihn mitzureißen. Heute hat er überraschend seine übliche Nörgelei über die Anzugordnung gelassen: Krawattenzwang ist ein Fall für die Menschenrechtskommission. Diese Ignoranz ist sie gewöhnt. Er beherrscht sie genauso, wie er aufmerksam sein kann. Die Krawatte hat er umgebunden, ihr zuliebe. So ist er eben.
Die tief stehende Sonne taucht den Altmarkt in goldrotes Licht. Es ist mild, und es ist die Zeit, wo man bald wieder unter den Bäumen vor den alten Giebelhäusern sitzen kann. Isa nimmt sich selten die Zeit dafür, obwohl ihr gerade der Altmarkt gut gefällt, seit man ihm — gegen die vielen Kritiker — neuen Charme eingehaucht hat.
Sie laufen ostwärts. Bei der Kirche war in einem der prächtigen Bürgerhäuser bis vor zwei Jahren eines der vielen Bankhäuser zu finden. Heute ist ein Grieche der Hausherr, und den hat Gary für diesen Abend ausgesucht.
Sie überqueren die Gertraudtenstraße, als Isa zusammenzuckt. Da steht einer mit einem großen bunten Beutel neben den hohen Pflanzkübeln. Den dunkelhaarigen Kopf in den Nacken gelegt, so fixiert sein Blick den Glaskasten an der Wand. Die Speisenkarte? Noch ehe sie näher kommen, trottet der Mann davon — nach vorn gebeugt, als ziehe ihn der schwere Plastikbeutel hinab. Mit ausgetretenen Schuhen, mit hängenden Schultern unter dem graugrünen Mantel, mit einer stauchenden aber sauberen Hose. Schamvoll, weil sie ihn gesehen hat? Ihr ist, als gäbe er seinen Schritten mehr Kraft. Er schaut sich nicht um, geht seinen Weg der ungewissen Nacht entgegen. Am Gerichtsplatz schwenkt er gänzlich aus ihrem Blick.
»Das war er«, tuschelt Isa aufgeregt. »Dieser Obdachlose, von dem ich dir erzählt habe.«
Gary scheint sie gar nicht gehört zu haben. Er hält die Tür und lässt sie eintreten.
»Wer weiß, ob der heute schon etwas gegessen hat.«
Keine Reaktion. Gary ist bemüht, einen angenehmen Platz für sie zu suchen.
Im Restaurant ist es noch geruhsam. An zwei Tischen flackern Kerzen. Die kleinen Lampen an den Wänden der Nischen leuchten den Raum nicht aus. Sie bleibt einen Moment stehen, um sich zu gewöhnen.
»Guten Abend.« Vom Tresen her hört sie den fremden Akzent in der Stimme des Kellners. Kaum kommt sie zu Atem, da erscheint der Mann mit zwei eiskalten Schnäpsen und fragt nach der Bestellung.
»Für mich bitte einen weißen Martini«, sagt Isa. Und dann fragt sie den Mann, warum es in einem griechischen Restaurant keine Mousakka gibt.
»Weil Deutsche zu wenig essen Mousakka. Wir wollen nicht jeden Abend Mousakka aufessen. Wir können nicht nächsten Tag noch einmal aufwärmen, und für Schweine ist zu teuer.«
Sie drückt stets ein Auge zu, wenn ein Fremder nicht korrekt spricht. Sie selbst hat drei Fremdsprachen gelernt und kann nicht eine nur annähernd so gut.
Inzwischen empfiehlt der Kellner ein Gericht aus den gleichen Zutaten — Hackfleisch, Auberginen, Creme Bechamél. Es sei als Einzelportionen in Fett gebacken und heiße Paputsaki. Das nimmt sie, und Gary entscheidet sich für Bifteki.
Es war zu erwarten, dass sie vorzeitig passen muss. Diese Portionen sind selten zu schaffen, aber Gary zuliebe verzichtet sie darauf, eine Portion für den kleinen Hunger zu verlangen. Er — der stadtbekannte Hochschuldozent — möchte nicht als Pfennigfuchser gelten.
Vor ihrem noch halbvollen Teller sitzend, bemerkt sie, dass auch Gary vorzeitig streikt. Ihre Wangenmuskeln verhärten sich.
»Mundwinkel nach oben, mein Schatz!« Da ist wieder dieser Satz, der sie bisweilen aus der Fassung bringt. Sie weiß, wie wenig sie es noch immer beherrscht, die bleierne Schwerkraft ihrer ärmlichen Kinderstube einfach hinwegzulächeln. Und es macht sie wütend, wenn ausgerechnet er das missdeutet.
»Ja. Es macht mich wütend …Es macht mich so wütend …«, zischt sie. »Wir schaffen unsere Portionen nie, aber da draußen hungern Menschen. «
»Ich hab schon gemerkt. Kein guter Tag heute?«
»Der Tag ist gut. Diese Welt ist es nicht.«
»Ach. Noch immer das Afrika-Syndrom? Du kannst nicht die ganze Welt retten. Das hast du doch gelernt.«
»Die Welt vielleicht nicht, aber den einen oder anderen.«
Gary blinzelt schadenfroh: »Hättest ihn wohl gerne mitgenommen.« Er grinst dabei, aber nicht das erbost sie. Er hatte sie also genau verstanden, vorhin, als er sich taub stellte.
Sie liebt ihren Mann, wenngleich mit den Jahren das Begehren der Verantwortung Platz macht. Bisweilen stellt sie sich gegen ihn, weil ihre Überzeugung eine andere ist. Gerade ist es mal wieder soweit, aber Gary ist mit seiner Ironie noch nicht am Ende. Mit listigem Augenschlag sagt er: »Sieh es mal so: Der Kerl hatte doch gar keinen Schlips um. «
Ihre Augen blicken weder feurig noch matt; sie sehen kühl aus, aber nicht feindselig. Nur ihr Mund hat etwas von der Verbissenheit behalten und ihre Tonlage ähnelt dieser. Obwohl sie bei seinem Seitenhieb ihre Lippen breit zieht, klingt zwischen ihren Worten große Besonnenheit mit, um die sich Isa stets müht. Jetzt ist nicht der Moment, wo sie mit ihm in Wortgefechte verfallen möchte. Wenigstens ihre Augen lässt sie schimpfen, als sie flüstert:
»In Afrika haben wir geholfen, weil denen unser Verstehen schon Hoffnung machte. Solange Hoffnung in ihnen war …«
Er muss spüren, wie sie das wir widerwillig herausquetscht.
Gary wird deutlicher. Wieder einmal.
»Ging es dirwirklich um deren Hoffnung? Ging es nicht vielmehr um deine Selbstbestätigung? Und jetzt wieder. Eigensinn ist ein schlechtes Almosen.«
Im Handumdrehen spürt sie kein Schlagen mehr in ihrer Brust. Es ist ein wildes Rütteln, ein Getöse zwischen den Rippen, das ihre Bestürzung verstärkt. Es ist wie ein Déjà-vu. Alles kehrt wieder zurück. Nur an einem anderen Ort, in einer anderen Zeit.
Garys Feststellung hat zweifellos Berechtigung. Im gleichen Maße, wie sie ihre Ohnmacht damals im schwarzen Land zu hassen begann, war sie auch von einem Gefühl erfüllt, das man schlechthin Gewissensnot nennt. Nicht sosehr, weil sie in der Fremde nicht über die Mittel verfügte, die nötig gewesen wären, sondern weil sie nicht wusste, was wirklich sinnvoll war. Und wieder einmal weiß sie es nicht. Heute und hier noch weniger.
Die Familie der Flüchtlingsfrau Ntumba nahm damals alles dankbar hin, was sie ihr heimlich brachte, aber sie erbat sich nichts. Niemals. Sogar auf die immer gleiche Frage, was sie ihr bringen soll, erwiderte sie, es sei gut, was sie bringe. Warum sollte dieser Mann mit dem schleppenden Gang anders sein? Ob er schon den Text gelesen hat?
Mit einem Schlag wird ihr etwas klar, was sie nie offen eingestehen wird. Gary hat Recht. Ihr geht es nicht um fremde Hoffnung. Ihr geht es um ihr eigenes Seelenheil. Sie muss etwas tun, um ihrer selbst willen.
»Ich habe längst begonnen zu schreiben. Manchmal löst das für einen von denen etwas aus. «
Gary lacht, wie er manchmal lacht und wie es ihr nicht gefällt. Im Tonfall gleicht es einem seiner Scherze, die ihm bisweilen sehr leicht von den Lippen rutschen. In der Bedeutung sind es Peitschenhiebe. Isa versteht sie genau als solche. Ihr glühendes Gesicht hätte sie verraten müssen, doch Gary sieht nichts darin als weibliche Vermessenheit.
»Ich wusste es.« Er streckt seine Hand über den Tisch und legt sie auf ihre.
»Schreib, wenn es dir hilft. Aber recherchiere nur dort, wo du sicher bist. «
Sie mag diese kranke Vorsicht nicht, die in allen Menschen steckt, wenn sie von Obdachlosen hören. Aber Gary und kranke Vorsicht, das passt nicht zusammen. Zwar mag sie auch seine Art nicht, mit ihr umzugehen, aber es ist weder die Zeit noch der Ort, um hitzig weitere Grundsätze auszutauschen.