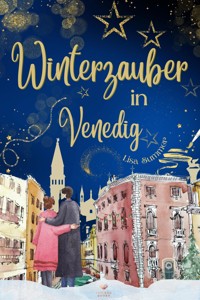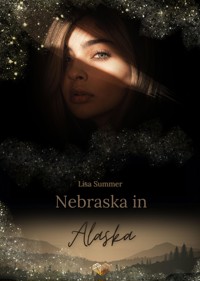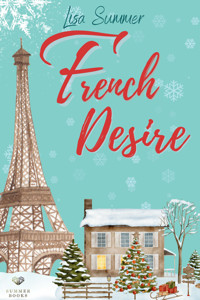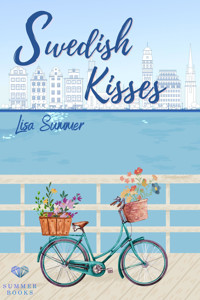5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Summer Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An Weihnachten kreuzen sich ihre Wege – sie, die Ruhe sucht, und er, ein Popstar auf der Flucht vor sich selbst.
Ein Kuss, ein Skandal – und ein Winter, der alles verändert.
Weihnachten alleine sein? Nicht mit Silvie.
Zumindest war das ihr Wunsch, der eigentlich hoffnungslos schien – bis am Morgen des Festtags er zur Tür hereinschneit: Nico Harrington, der Popstar, von dem halb London träumt.
Was als harmloser Cappuccino beginnt, endet in einer Nacht voller Lichter, Küsse und gefährlicher Nähe.
Doch zwischen Schneeflocken und Scheinwerfern lauern Geheimnisse, die Silvie das Herz brechen könnten.
Während draußen der Schnee fällt, muss sie sich entscheiden:
Kämpft sie für die wahre Liebe – oder ist sie nur ein Weihnachtsflirt in seinem Leben?
Alle Romane von Lisa Summer sind in sich abgeschlossen und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Weitere Weihnachtsromane von Lisa Summer:
French Desire
Liebespost vom Weihnachtsmann
Winterzauber in Venedig
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ein Popstar unterm Weihnachtsbaum
Lisa Summer
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1:
Silvie:
Kapitel 2:
Silvie:
Kapitel 3:
Silvie:
Nico:
Silvie:
Kapitel 4
Nico
Silvie
Nico
Kapitel 5
Silvie
Silvie
Nico
Kapitel 6
Silvie
Nico
Silvie
Nico
Kapitel 7
Silvie
Nico
Silvie
Kapitel 8
Silvie
Kapitel 9
Silvie
Nico
Silvie
Kapitel 10
Nico
Silvie
Kapitel 11
Nico
Kapitel 12
Silvie
Nico
Silvie
Kapitel 13
Silvie
Kapitel 14
Silvie
Nico
Silvie
Kapitel 15
Silvie
Nico
Silvie
Kapitel 16
Nico
Silvie
Epilog
Silvie
Impressum
Kapitel 1:
Silvie:
Die kleine Glocke über der Tür bimmelte ein letztes Mal, als Mrs. Ashworth mit ihrem roten Wollschal und dem dampfenden Pappbecher in der Hand das Café verließ. Sie lächelte mir zu – dieses warme, mütterliche Lächeln, das mir jedes Mal ein bisschen das Herz drückte – dann zog sie die Tür hinter sich zu. Das Geräusch verklang, und plötzlich war es still. Nicht Mucksmäuschenstill, sondern diese Art von Stille, bei der man sich einfach nur allein fühlte.
Ich stand noch einen Moment da, die Hände auf der Theke abgestützt, und hörte dem Summen der Kaffeemaschine zu. Es klang wie ein leiser Atemzug in einem Raum, der zu groß war für so wenig Leben.
Langsam drehte ich mich um und ließ den Blick durch mein kleines Reich schweifen. Der Christbaum in der Ecke flackerte träge, die Zuckerstangen an den Lichterketten hingen schief. Auf zwei Tischen standen noch halbvolle Tassen nebst zerknitterten Servietten und einem zerbrochenen Zimtstern.
Ich hätte längst schließen sollen, schon vor zwanzig Minuten. Aber ich hatte keine Eile. Es wartete niemand auf mich.
Mit einem müden Seufzer griff ich nach dem Weinglas im Regal, goss mir ein, was von der Flasche Merlot übriggeblieben war, und ließ mich auf meinen Platz am Fenster sinken – Tisch vier, mein Lieblingsplatz. Mein Ort, wenn das Café nur mir gehörte.
Draußen tanzten ein paar Schneeflocken über den Gehweg, federleicht und langsam, als hätten sie es nicht eilig, irgendwo anzukommen. Der Verkehr war fast zum Erliegen gekommen. Nur eine einzelne rote Rückleuchte glitt durchs Bild, dann herrschte wieder Dunkelheit, unterbrochen vom Licht der Laterne vor dem Haus.
Ich hob mein Glas.
»Cheers, Silvie«, murmelte ich. Es klang seltsam laut in der Stille.
Achtzehn Uhr zwanzig. Letztes Jahr war das die Zeit, in der Marc mit seinem Truthahn aufgetaucht war. Stolz wie ein Fünfjähriger mit einem selbst gebastelten Drachen. Und ich hatte gelächelt, auch wenn der Vogel zu trocken war und seine Mutter mir denselben Pullover wie schon zum Geburtstag überreicht hatte.
»Du übertreibst wieder«, hatte er gesagt, als ich vor vier Monaten erwähnte, dass ich mich in meiner eigenen Wohnung wie ein Gast fühlte. Drei Tage später war er weg. Nur eine Nachricht auf dem Küchentisch blieb mir. Kein Gespräch. Kein Blick zurück.
Seitdem war ich nicht mehr dieselbe.
Mein Handy vibrierte auf dem Tisch. Mum.
Ich atmete tief ein, trank einen Schluck und hob ab. »Hallo, Mum.«
»Silvie, mein Schatz! Ich wollte dir nur schnell frohe Weihnachten wünschen. Ich weiß ja gar nicht, wie spät es bei dir ist. Wir machen uns gleich auf den Weg zu den Turners. Wir wollen die Nacht durchfahren. Du erinnerst dich, oder?«
»Die mit dem schielenden Hund?«
Sie lachte. Es klang leicht und weit entfernt.
»Ja, genau. Und du? Alles gut in London? Arbeitest du noch in diesem schnuckligen Café? Du hast doch längst Feierabend, oder?«
Ich hätte lügen können. Stattdessen sagte ich: »Ich arbeite hier nicht nur. Es ist mein Café, Mum.« Letzteres zog ich extra lang. Ich mochte es nicht, wenn sie so tat, als wäre ich eine Barista und keine Unternehmerin. »Der Tag war okay. Ein paar Gäste, viel Zimt und eine Schneeflocke, die an der Tür festklebte und nicht mehr loswollte. Ich hab gerade erst zu gemacht, hier ist es kurz nach sechs.« Ich stieß einen leisen Seufzer aus und nahm noch einen Schluck.
Mom lebte in Kanada. Manchmal frage ich mich, ob es besser gewesen wäre, wenn ich bei ihr geblieben wäre. Marc war der Grund gewesen, wieso ich damals nach London zog. Nicht nach Großbritannien, aber nach hier, in die Großstadt. Vorher hatte ich an der Küste gejobbt. Nach dem College wollte ich etwas Aufregendes erleben, deswegen zog es mich nach Europa. Jetzt war ich hier, und meine Familie feierte Weihnachten auf der anderen Seite der Erde. Ohne mich. Ich hatte einen Onkel in Manchester, aber auch der hatte sich seit über einem halben Jahr nicht mehr gemeldet. Und ich mich auch nicht bei ihm. Ich hatte alle sträflich vernachlässigt, seit ich wieder alleine war.
»Du mit deinen Bildern«, sagte Mum und riss mich aus meinem Trübsal. Ein kurzer Moment der Stille entstand, als keiner von uns sprach. »Bist du ... morgen allein?« Sie klang mitfühlend und bedauernd zu gleich.
Ich schwieg kurz. »Ja«, seufzte ich. Dieses Mal lauter.
»Ach Silvie ... nächstes Jahr kommst du einfach wieder her, okay? Nur zu Besuch.«
»Vielleicht.«
Ich hörte sie laut ausatmen und im Hintergrund meinen Vater etwas rufen, dass ich nicht richtig verstand.
»Wir müssen jetzt los, Liebling. Acht Stunden Fahrt. Pass auf dich auf, ja? Und vergiss nicht – Weihnachten ist auch nur ein Tag.«
»Sagt sich leicht, wenn man nicht allein ist.«
Doch sie hatte schon aufgelegt. Ich hasste es, wenn sie das machte. Kein zusätzliches Tschüss, einfach weg.
Ich starrte das leere Display an, dann das halbvolle Glas und stand auf. Ich bewegte mich langsam durch das Café, als würde jeder Schritt einen Schatten hinterlassen. Ich strich über die Holzlehnen der Stühle und über das alte Samtsofa am Fenster. Die Wunschzettelbox auf der Theke war gefüllt mit buntem Papier. Darin waren die Kinderwünsche meiner jüngsten Gäste: Ein Hund. Eine Schwester. Frieden für die Welt.
Ich wollte nichts Großes. Nur ... nicht allein sein. Ich schob den Riegel an der Tür vor, drehte das Schild auf ›geschlossen‹ um und blieb dann stehen.Draußen fielen jetzt dickere Flocken. Die Welt war weichgezeichnet und still. Ich atmete gegen die Scheibe, die sofort beschlug, und zeichnete mit dem Finger einen kleinen Stern hinein. Nur für mich.
Dann lehnte ich die Stirn ans Glas und hielt mein Weinglas fest, als wäre es eine Hand. Und wartete. Worauf, wusste ich nicht genau. Aber irgendwo da draußen, im Schneetreiben, war vielleicht noch etwas – oder jemand − für mich übrig.
Vielleicht.
Ich stellte das Radio ein. Wham − warum musste jedes Mal Last Christmas laufen, wenn ich es wagte, die Musik aufzudrehen? Letztes Weihnachten ... tja, da war auch bei mir noch die Welt in Ordnung. Ich schnaubte leise, schob das Weinglas zur Seite und räumte weiter auf. Die Servietten von Tisch drei klebten noch leicht vom Karamellsirup. Ich schob sie zusammen und warf sie in den Eimer. Dann stellte ich die Gläser in die Spüle und die Stühle hoch, damit ich den Boden wischen konnte. Das Licht dimmte ich auf ein Minimum. Nur die Lichterkette hinter dem Tresen leuchtete noch – warm und golden, viel zu friedlich für das Chaos in meinem Kopf.
So sehr ich Weihnachtslieder gerade hasste, ich konnte nicht anders, als mit zu trällern. Jetzt lief All I want for Christmas is you. Ich schnappte mir den Stiel des Schrubbers und sang mit. Als ich mich schwungvoll umdrehte, passierte es und die metallene Dose krachte von der Theke herunter und sprang auf.
Die vielen kleinen, handgeschriebenen Zettel, verteilten sich über den feuchten Boden. Wunschzettel ans Christkind stand in krakeliger Schrift auf dem Deckel der Box, der unter einen Tisch gerutscht war. Neben die Schrift hatte ein Kind mit einem schimmernden Marker kleine Sterne gemalt.
Normalerweise war es mein Lieblingsritual zum Abschluss des Tages: Die Wunschzettel der Kinder lesen und sie heimlich beantworten − manchmal mit einem Lolli, manchmal mit einem handgeschriebenen Brief, den ich unter den Kamin neben der Tür zur Küche legte. Ich hatte sogar einmal einem kleinen Jungen aus der Nachbarschaft ein gebrauchtes Skateboard besorgt – weil er geschrieben hatte: Ich wünsch mir, dass ich schneller weglaufen kann, wenn mein Bruder mich wieder ärgert.
Heute aber ... fühlte sich selbst das Lesen der Briefe falsch an. Ich hob die aktuellen Zettel auf, es waren bloß sieben, die ich gleich am neuen Papier erkannte, und legte sie zurück in die Box, ehe sie ganz feucht auf dem gewischten Boden wurden.
Ein Hund, ein Fahrrad, Mama sollte aufhören zu weinen.Viel mehr erhaschte ich nicht. Es schnürte mir die Kehle zu. Zu viel Hoffnung und gleichzeitig zu viel Trauer. Ich wollte schreien, dass vermutlich nichts davon wahr werden würde. Stattdessen griff ich nach einem leeren Zettel vom Stapel neben der Kasse. Weiß und unbeschrieben lag er da und starrte mich voller Unschuld an. Ich zögerte einen Moment, dann nahm ich den Kuli.
Ich wusste nicht mal, warum ich ihn beschrieb. Vielleicht, weil ich es satt hatte, meine Gedanken nur mit mir zu teilen. Vielleicht, weil selbst ein dummer Wunschzettel besser war als nichts.
Meine Hand begann zitternd zu schreiben, noch bevor mein Kopf mit Denken fertig war:
Ich wünsche mir jemanden, der mich liebt, ohne mich ändern zu wollen. Der bleibt, wenn ich nicht funktioniere. Jemand, der nicht davonläuft, wenn es wehtut. Der mich sieht – nicht, wie ich aussehe, nicht, was ich leiste. Mich. Einfach nur mich.
Ich starrte auf die Zeilen. Konnte kaum glauben, dass ich das war, die das geschrieben hatte. Eine Träne lief mir über die Wange und ich wischte sie rasch mit dem Handrücken weg, ehe sie aufs Papier tropfen konnte.
Ohne meinen Namen draufzuschreiben, drehte ich den Zettel um, faltete ihn und hielt ihn einen Moment lang in der Hand. Dann – fast trotzig – warf ich ihn zu den anderen in die Box. Er landete oben drauf, direkt über einem knallrosa Wunschzettel mit Glitzerherzen, auf dem jemand: ›Ich will ein Einhorn, das pupsen kann‹ geschrieben hatte. Der Zettel war nicht einmal gefaltet worden.
Ich lachte kurz. Aber es blieb mir im Hals stecken.
»Wahrscheinlich wird morgen dann wirklich alles vom Putzwasser weggespült«, murmelte ich, als ich den Deckel der Kiste schloss. Doch etwas in mir hoffte, er würde dort drinbleiben.
Kapitel 2:
Silvie:
Der Weihnachtstag fühlte sich jedes Jahr gleich an: wie eine Mischung aus Frieden und Leere. Die Londoner Straßen rund um mein kleines Café waren still, fast gespenstisch leer. Kein roter Bus, kein hupendes Taxi, nicht einmal das übliche Stimmengewirr. Nur das Knirschen meiner Schritte im dünnen Schneematsch, als ich die paar Schritte von meiner Haustür zur Tür des Cafés ging, um den Schlüssel im Schloss umzudrehen.
Es war kalt, aber nicht die angenehme Kälte, bei der es irgendwie einfach himmlisch nach Winter und Weihnachten roch, bei der alles weiß glitzerte. Sondern die eklige, graue Kälte, mit tiefhängenden, drückenden Wolken am Himmel, die einen eher in Depressionen stürzte als Stimmung zu verbreiten.
Drinnen empfing mich der vertraute Duft nach frisch gemahlenem Kaffee, dazu der süße Rest von Vanille und Zimt aus den Plätzchen, die ich gestern früh gebacken hatte. Ich stellte ein paar Kerzen auf die Fensterbretter und schaltete das Radio leise ein – Weihnachtsklassiker, natürlich – ich redete mir ein, dass ich nicht allein war, sondern Gastgeberin. Vielleicht würde ja noch jemand anderes, so wie ich, Gesellschaft brauchen.
Ich erwartete allerdings nicht, dass dieser ›Jemand‹ schon nach wenigen Minuten die Tür öffnen würde.
Die Glocke bimmelte und im nächsten Moment stand er da: groß, schlank, in einen dunklen Mantel gehüllt, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, dazu eine Sonnenbrille auf. An Weihnachten, um neun Uhr morgens!
Ich zog die Brauen hoch und sah ihn verwirrt an. Mein erster Gedanke war: Das musste ein Einbrecher sein, der sich verlaufen hatte. Mein zweiter: Ein Mann, der etwas zu verbergen hatte.
»Ähm ... guten Morgen«, brachte ich verwirrt hervor, während mein Puls beschleunigte.
Er nickte knapp, als müsse er sich erst überwinden, das Café wirklich zu betreten.
»Morgen.« Seine Stimme überraschte mich – sie war warm und tief, irgendwie vertraut. Ich hatte mehr etwas in Richtung Batman erwartet, oder Darth Vader ...
Der Mann blieb dicht an der Tür stehen. Ich fragte mich kurz, ob er gleich wieder verschwinden würde. Doch dann trat er langsam an die Theke heran. »Haben Sie Kaffee?«
Ich musste grinsen. War das sein Ernst? Was sollte ich sonst verkaufen? Autos, Computer? »Das hier ist ein Café«, sagte ich mit sarkastischem Unterton, der unhöflicher klang als geplant, und bereute es sofort.
Doch zu meiner Überraschung huschte so etwas wie ein Lächeln über seine Lippen. »Dann einen Schwarzen, bitte.«
»Americano oder Long Black?«
»Americano.«
Ich nickte und schaltete die Maschine ein. Während sie vor sich hin zischte, musterte ich den Unbekannten verstohlen. Seine Hände waren gepflegt, fast zu sehr für jemanden, der gerade durch den Schnee gestapft war und sich benahm wie jemand von der Mafia oder wie irgendein Superinfluencer. Oh Gott, hoffentlich fing er nicht an, irgendwelche Bilder vom Kaffeepott zu schießen.
Sein Mantel wirkte teuer, ein Schnitt, den ich höchstens in Schaufenstern in Kensington gesehen hatte. Alles an ihm wirkte ... falsch in meinem kleinen, unscheinbaren Café. Und trotzdem stand er hier, mit einer Nervosität, die ihn irgendwie menschlicher machte.
»Sind Sie aus der Gegend?«, fragte ich beiläufig, während ich den Siebträger einsetzte und die Tasse unter stellte.
Er zögerte. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, er müsse eine Rolle spielen. »Mehr oder weniger. London fühlt sich jedoch manchmal fremder an als jeder andere Ort.«
Seltsame Antwort. Doch irgendwie traf sie mich. Ich kannte das Gefühl nur zu gut – die Einsamkeit inmitten von Menschen, die Gleichgültigkeit einer großen Stadt.
»Das kenne ich«, sagte ich leise. »Man kann mitten im Trubel sein und sich trotzdem verloren fühlen.«
Sein Kopf wandte sich mir zu und er legte ihn leicht schräg. Nun musterte er mich. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte ich das Gefühl, er sähe direkt durch seine dunklen Gläser durch mich hindurch und in meine Gedanken hinein. Rasch widmete ich mich wieder der Maschine vor mir, gab heißes Wasser in eine andere Tasse und füllte den Espresso hinzu.
»Genau«, murmelte er.
Die Kaffeemaschine zischte erneut, als wolle sie das Schweigen füllen. Ich stellte die Tasse vor ihm hin, und in dem Moment, als seine Finger die Porzellanhenkel berührten, spürte ich eine merkwürdige Spannung.
Er betrachtete mich. Intensiv. Prüfend. Und obwohl ich seine Augen nicht sehen konnte, jagte mir dieser Blick einen Schauer über den Rücken.
»Sie erinnern mich an jemanden«, sagte er leise.
»Wasser dazu?«, fragte ich im selben Augenblick.
»Tschuldigung.«
Er nickte, während mein Herz stolperte. Schnell drehte ich mich um und sprach fast flüsternd weiter. »Ich hoffe, an jemand Guten?«, fragte ich auf seinen Kommentar hin und befürchtete, zu neugierig zu wirken. Ich goss etwas Wasser aus einer Kanne in ein Glas und reichte es ihm.
Seine Mundwinkel zuckten, als würde er etwas sagen wollen und sich dann doch bremsen. »Vielleicht zu gut.«
Ich schluckte. Der Mann war seltsam.
Er zog sich endlich die Sonnenbrille aus und legte sie neben sich ab. Blaue Augen, wie die Lagunen um Capri, strahlten mir entgegen. Er kam mir so bekannt vor, doch mir wollte nicht einfallen, woher.
Er nippte an seinem Kaffee und stellte die Tasse dann wieder leise auf den Tisch. Die blauen Augen, die mich gerade so unvermittelt getroffen hatten, hafteten weiter an mir. Ich spürte sie wie einen Scheinwerfer, der mich von weitem anstrahlte; nur wärmer, fast zu nah.
Ich zog die Schürze enger, als wäre sie ein Schutzschild. »An wen erinnere ich sie denn? Jemanden aus London?« Meine Stimme war fester als erwartet. Ich erwischte mich dabei, wie ich mit einem Finger an einer meiner Haarsträhnen, die leicht gelockt herunterfiel, herumspielte.
Er schüttelte kaum merklich den Kopf, die blonden Haare unter der Kapuze bewegten sich. »Eher«, er machte eine Pause, »jemanden aus einer Erinnerung.«
Etwas in seiner Stimme ließ mich frösteln, und ich wusste nicht, ob es am Winter lag oder an ihm. »Nun, Erinnerungen täuschen oft. Vor allem an Weihnachten.« Ich stieß unweigerlich einen Seufzer aus, als mir ein Bild von Marc in den Kopf schoss und versuchte die Erinnerung an letztes Weihnachten – wir vor dem Kamin − abzuschütteln.
Der Mann schwenkte seine Tasse und sah gedankenverloren hinein, als würde er dort auf alle Fragen des Lebens Antworten finden. »Vielleicht. Aber manchmal sind sie das Einzige, was echt ist«, murmelte er leise.
Ich wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte. Also ging ich vor die Theke und stellte mich an den Nebentisch. Ich ordnete Servietten, als hätte das nicht bis später Zeit gehabt. Aber ich spürte, wie die Luft zwischen uns pulsierte.
»Sie wirken einsam«, hörte ich ihn schließlich sagen. Es war nicht neugierig. Nicht wertend. Nur feststellend.
Mein Kopf schoss hoch. »Und das sehen Sie ... woran?«
Er hob den Blick, und plötzlich war da kein Fremder mehr, sondern jemand, der mich zu kennen schien.»Weil ich genauso aussehe.«
Mir stockte der Atem. Meine Finger krampften sich um die Servietten. »Und deswegen sind Sie hier? Am Weihnachtsmorgen? In einem kleinen Café am Fluss, statt bei ... was auch immer Sie sonst tun?« Ich bekam das mit dem Neugierde verstecken weniger gut hin als er.
Er lächelte schief, doch es wirkte alles andere als glücklich. »Na ja, hier fragt niemand nach meinem Namen. Oder schlimmer: posaunt ihn laut herum. Das ist manchmal ganz angenehm.«
Ein seltsames, weiches Schweigen breitete sich aus. Für einen Augenblick fühlte ich mich gesehen. Erschreckend gesehen.
Und genau in diesem Moment riss jemand die Tür auf und ein Windstoß wirbelte Schneeflocken herein. Ein kleines Mädchen hüpfte ins Café, die Mütze halb ins Gesicht gerutscht. Ihr Blick fiel sofort auf ihn – und sie erstarrte.
Ihre Augen wurden rund wie Teller, dann glitzerten sie aufgeregt. »Mama!«, quietschte sie und zeigte direkt auf meinen geheimnisvollen Fremden. »Das ist doch Nico Harrington!«
Mir rutschte fast das Herz in die Hose.
Der Fremde verdrehte die Augen und setze sich rasch wieder die Brille auf. »Ich würde dann zahlen«, sagte er bitter.
Ich wollte gerade nachhaken, da kam die Mutter hinterher.
»Psst!«, zischte die Frau, doch es war zu spät.
»Doch, das ist er! Das ist Nico Harrington! Ich hab ihn heute Morgen im Fernsehen gesehen. Du standest doch daneben!« Das Mädchen sah seine Mutter fast schon zornig an. Voller Trotz drückte es sich die Hände in die Hüften und trat, den Mann musternd, auf die Theke zu.
Nico Harrington. Hatte sie etwa recht?
Natürlich kannte ich den Namen. Wer nicht? Seine Lieder liefen ständig im Radio, diese eine Ballade hatte mir letzten Winter sogar die Tränen in die Augen getrieben. Ich erinnerte mich, wie ich beim Backen leise mitgesummt hatte, ohne zugeben zu wollen, dass ich die Melodie liebte. Seine Stimme war ein Teil des Soundtracks meines Lebens, ohne dass ich es je bewusst bemerkt hatte. Und jetzt saß er hier, an Weihnachten, in meinem Café, mit Sonnenbrille und Kapuze.
Ich starrte ihn an, während in meinem Kopf Bilder von Plakaten, Konzertmitschnitten und Magazinartikeln aufblitzten. Kein Zweifel – er war es wirklich.
Nico Harrington.
Er beugte sich vor und flüsterte mit einem Ausdruck purer Panik: »Bitte. Sagen Sie nichts. Nicht zu ihr, nicht zu irgendwem. Geben Sie mir einfach die Rechnung.« Seine Stimme klang eindringlich, aber auch verzweifelt. Ganz anders als die kraftvolle Bühnenstimme, die ich kannte.
Das Mädchen lief auf uns zu und zupfte an meiner Schürze. »Kann ich ein Foto mit ihm machen?«
Mein Herz schlug so schnell, dass ich kaum denken konnte. Ein Teil von mir wollte kichern, ein anderer wegrennen. Aber ich sah den Ausdruck in Nicos Gesicht – dieses Flehen – und wusste instinktiv, dass er mehr brauchte als Kaffee. Er brauchte Schutz.
»Ähm ...«, begann ich und zwang ein Lächeln hervor, während ich zurück hinter die Theke ging, um die Quittung auszudrucken. »Liebes, du verwechselst ihn. Das ist Thomas, ein alter Schulfreund von mir. An Weihnachten ... na ja, da glaubt man manchmal, jemandem zu begegnen, weil man es sich vielleicht gewünscht hat.«
Die Mutter lachte gezwungen und zog ihre Tochter weg. »Komm, Schatz. Nicht jeder Mann mit Kapuze ist ein Popstar.«
Widerwillig ließ sich das Mädchen zu einem Tisch ziehen. Ich spürte Nicos Erleichterung förmlich wie einen warmen Luftzug.
»Danke«, hauchte er.
»Schon gut«, murmelte ich, obwohl mir schwindelig war.
Er sah mich an. »Bitte. Niemand soll wissen, dass ich hier war. Ich brauche nur einen Ort, um ... zu atmen. Ohne Kameras. Ohne Mikrofone. Ohne Erwartungen.«
In meinem Kopf rauschten die Gedanken durcheinander. Da stand er – dieser Mann, den Millionen verehrten, und bat ausgerechnet mich, eine einfache Barista, um ein Geheimnis. Ich dachte an all die Bilder von ihm: auf Bühnen, im Blitzlicht, mit strahlendem Lächeln. Und dann sah ich den echten Nico vor mir, müde, gehetzt und verletzlich.
Und zu meiner eigenen Überraschung wollte ich ihm helfen.
»Ihr Geheimnis ist bei mir sicher«, flüsterte ich und legte ihm die Quittung hin. »Das macht 3,90.«
Er nickte und zog seinen Geldbeutel hervor. Die Anspannung wich nur minimal aus seinen Schultern. Er drückte mir einen Fünfer in die Hand. »Stimmt so.«
»Danke.«
Dann sah er sich kurz um, und ein kleines Lächeln huschte über sein Gesicht. »Vielleicht sind Geheimnisse gerade hier bei Ihnen gut aufgehoben ... Ihr Café erinnert mich an Zuhause.«
Sein Blick ruhte auf meinen Kerzen, der kleinen Schale mit Zimtsternen, der altmodischen Kaffeemühle auf dem Regal. Und plötzlich sah ich mein Café mit seinen Augen: unscheinbar, aber warm, wie eine kleine Insel im kalten, grauen London.
Ein Teil von mir – der rationale – wusste, dass das absurd war. Ich war niemand. Und er ... er war Nico Harrington.
Aber ein anderer Teil, der stillste und vielleicht aufregendste dachte nur: Vielleicht ist es Schicksal, dass er ausgerechnet hier hereingekommen ist.
Ich drehte ihm den Rücken zu und nahm die Bestellung der Mutter mit ihrer Tochter auf. Im Hintergrund hörte ich, wie die Tür aufging und spürte, wie kalte Luft hereinwehte. Als ich mich umdrehte, war er verschwunden.
Ich schritt zur Theke zurück und räumte sein Geschirr weg. Sofort fiel mir die kurze Notiz auf seiner Quittung auf. Tee um 17 Uhr?
Kapitel 3:
Silvie:
Das Café roch nach einer Mischung aus frisch gemahlenem Kaffee und den Plätzchen, die ich am Nachmittag auf die Theke gestellt hatte. Es war kurz nach vier, als ich den Schlüssel ins Schloss steckte, das ›geschlossen‹-Schild nach außen drehte und einmal tief durchatmete. Normalerweise bedeutete Feierabend Routine: Tische abwischen, Stühle hochstellen, die Kaffeemaschine rückspülen, den Kassenbestand zählen. Aber heute war nichts normal.
Meine Hände arbeiteten mechanisch, doch mein Kopf war ein einziges Karussell. Seit Stunden lief ich innerlich im Kreis um die Frage: Würde er wirklich kommen? Oder war die Nachricht auf der Quittung nur eine spontane Laune gewesen, eine Notiz, die man wieder vergaß?
Ich wischte die letzten Kaffeeflecken vom Tresen, stellte eine Vase mit roten Amaryllis gerade und versuchte, mir einzureden, dass er mir völlig egal war. Dass er ein Popstar war und ich ... nur ich. Eine Frau mit einer Kaffeemühle aus den Sechzigern in einem Café, das an den meisten Tagen mehr leer als voll war.
Doch mein Herz hörte nicht auf zu rasen. Ich blickte im Minutentakt auf die Uhr über der Tür, um lediglich zu bemerken, dass die Zeiger sich quälend langsam fortbewegten.
16:45 Uhr. Noch fünfzehn Minuten. Ich schob einen Stuhl zurecht, nur um ihn gleich wieder wegzuziehen. Alles musste perfekt aussehen. Und gleichzeitig wollte ich nicht, dass es so wirkte, als hätte ich mich vorbereitet.
16:59 Uhr. Ich stand mitten im Raum, den Lappen noch in der Hand, und fühlte mich wie eine Teenagerin, die auf ihre erste Verabredung wartete.
Dann klopfte es endlich; Leise und zögernd. Kein energisches Pochen, eher ein vorsichtiges Anklopfen, als wollte derjenige sicher sein, nicht zu stören. Mein Herz setzte einen Schlag aus.
Ich legte den Lappen zur Seite, strich mir hastig eine Haarsträhne hinters Ohr und ging zur Tür. Draußen stand er. Nico Harrington. Er hatte die Mütze tief ins Gesicht gezogen und trug eine hellere Jacke als heute früh, deren Kragen jedoch fast bis zu seinem Kinn reichte. Und doch erkannte ich ihn dieses Mal sofort. Seine Haltung, dieses nervöse Umsehen, als fürchte er, jemand anderes könnte ihn ebenfalls erkennen, verriet ihn.
Ich entriegelte die Tür und bat ihn herein.»Sie sind gekommen«, hörte ich mich sagen. Meine Stimme klang atemloser als mir lieb war.