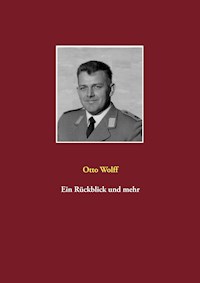
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kurzer Überblick über mein Leben, vom pommerschen Landjungen zum Unteroffizier. Weiter habe ich eine kleine Geschichte der Philosophie verfasst und gebe mit Aphorismen Einblicke in meine Gedanken. Zwei Reiseberichte über Afrika und Buchbesprechungen runden diesen Titel ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Rückblick auf ein langes Leben
Ergänzt mit ausgewählten schriftlichen Aussagen über meine geistige Auseinandersetzung mit unserer Umwelt in über fünfzig Jahren. Die Ergänzungen und Auszüge füge ich deswegen bei, weil sie als meine Hobby-Arbeit mithelfen könnten, zu dem Lebensrückblick eine Gesamtübersicht über meine Gedankenwelt zu erschließen.
Zwei gegensätzliche Anmerkungen mögen als eine grundsätzliche Begleitung zu all meinen Aussagen dienen:
Da ich mich zu den Halbgebildeten zählen muss, kann ich mich mit der Aussage Nietzsches gut zufrieden geben. Während ich bei der Aussage Stegers stark ins Nachdenken gerate.
Nietzsche: „Werke“ Bd. II, Seite 257 /578/
„Das Halbwissen ist siegreicher als das Ganzwissen: es kennt die Dinge einfacher, als sie sind, und macht daher seine Meinung fasslicher und überzeugender.“
Dagegen:
Steger: „Das Wagnis des Denkens – Eine Einführung in die Philosophie ...“ Seite 92
„Das Ganze ist das Wahre. Wo dieser Blick für das Ganze getrübt ist, ... da herrscht jenes trübe Dämmerlicht, das den Wahn, die Lüge und den Selbstbetrug ausbrütet. Hier liegen auch die Gefahren aller Halbbildung. ... Philosophisches Denken ist immer dialektisch, das Denken der Halbgebildeten ist immer undialektisch, ist ein Punktdenken, kann keine polaren Spannungen ertragen, nicht den Gegensatz mitdenken, nicht zum höheren Ausgleich, nicht zur Synthese gelangen.“
Geschrieben und zusammengestellt
für meine Enkelsöhne Patrick und Pascal
Inhaltsverzeichnis:
I. Ein Rückblick auf ein lange Leben
II. Aphorismen (Gedankensplitter, geistreicher Gedanke)
Aphorismen 1 von 1967 bis 1971
Aphorismen 2 von 1971 bis 1991
Aphorismen 3 ab Januar 1992
III. Eine Einführung in die Philosophie von den Anfängen bis heute
IV. Zweite Rabengeschichte: Der Seniorentreff
V. Urlaub in Sambia
Bericht aus Sambia 1993
Bericht aus Sambia 1995
Ein sambisches Erlebnis
Eine sambische Vision
VI. 1. Rede am 13.11.2005 am Ehrenmal in Uckerath
VII. Ansprache (Predigt) im Gottesdienst der ev. Gemeinde, 12.10.2003
VIII. Ein Glückwunschgruß für meinen Bruder zu seinem achtzigsten Geburtstag von meiner Schwester und mir
IX. Ausgewählte Zitate aus dem Buch „Täter“ von H. Welzer über den Mord von über 33 Tausend Juden aus Kiew in der Schlucht von Babij Jar 1941
X. Buchvorstellung über das Buch „Notwendige Abschiede – auf dem Weg zu einem glaubwürdigen Christentum“ von Klaus-Peter Jörns, 2004
XI. Buchbeschreibung: „Gefahr Gentechnik – Irrweg und Ausweg – Experten klären auf“, Manfred Gössler, 2005
XII. Vortrag im Seniorenkreis im Mai 2007: „Die Methusalemformel – Der Schlüssel zur ewigen Jugend“, Johannes v. Buttlar, 1994
XIII. Ausgewählte Zitate aus meiner Zitatensammlung aus Religion, Philosophie, Geschichte und Naturwissenschaft
XIV. Abschließende Betrachtungen über den Kulturmenschen, wie er sich in der ihn umgebenden Natur eingerichtet hat
XV. Dank
Ein Rückblick auf ein langes Leben
Die nun folgenden Ausführungen schreibe ich aus folgenden Gründen:
Meine beiden Enkelsöhne Patrick und Pascal haben mich schon vor einigen Jahren gebeten, über mein Leben zu berichten und das schriftlich zu belegen. Bisher habe ich mich nicht getraut, mich dieser geistigen Herausforderung zu stellen. Ich bin gesundheitlich stark behindert. Vor allem eine Herzschwäche macht mir zu schaffen, so dass ich während des Tages sehr oft einschlafe. Um dagegen anzukämpfen habe ich mir gedacht, während du schreibst, schläfst du nicht. So habe ich nun endlich den Mut gefunden, mich am Spätnachmittag an den Computer zu setzen, um die Zeit der größten Müdigkeit nutzbringend zu überwinden.
Da ich zu einer Generation gehöre, die in einer Diktatur aufgewachsen ist, bin ich der Meinung, dass es angebracht ist, auch darüber zu berichten. Damals herrschten andere Erziehungsmethoden. So forderte unser damaliges Staatsoberhaupt Adolf Hitler: Die deutsche Jugend muss „zäh wie Leder, flink wie die Windhunde und hart wie Kruppstahl sein“! Das waren keine leeren Forderungen. In dem Deutschen Jungvolk (zehn bis vierzehn Jahren) und in der Hitlerjugend (vierzehn bis achtzehn Jahren) wurden diese Forderungen durchgesetzt. Ich habe zum Beispiel auf einem Unterführerlehrgang für Hitlerjungen dies auch intensiv erfahren dürfen.
Von 1939 (da war ich zehn Jahre) bis 1945 (da war ich sechzehn Jahre) habe ich den II. Weltkrieg mit all seinen Auswirkungen kennen lernen dürfen. Das war eine Erfahrung, die uns junge Menschen für ein Leben lang geprägt hat. Die damalige Jugend war, wenn auch nicht als Soldaten, doch eingespannt in ein System, welches zum Ziel hatte, die Vorherrschaft des deutschen Volkes in Europa zu gewährleisten. Die arische Rasse wurde zur Herrenrasse erklärt. Andere Rassen wie zum Beispiel Juden, Sinti und Roma wurden von den zuständigen Machthabern und deren ausführenden Mitarbeiter zu Untermenschen erklärt. Wie sich dann später herausstellte, wurde diese Ansicht durch eine Tötungsorgie in die Tat umgesetzt.
In einem Anhang möchte ich mit Berichten und Auszügen davon berichten, womit ich mich in meiner Freizeit beschäftigt habe und wie weit gefächert meine Bemühungen waren, dem Sinn des Lebens auf die Spur zu kommen. Hier geht es mir nicht darum, meine Arbeiten als etwas Besonderes herauszustellen, sondern zu zeigen, dass ich mich mit großer Mühe diesen Aufgaben gestellt habe. Bei diesen Arbeiten über Jahrzehnte habe ich mir ein gutes Allgemeinwissen angeeignet.
Meine Kindheit:
Meine Eltern waren Kleinbauern und haben den Hof von unserem Großvater väterlicherseits geerbt. Ich war das vierte Kind von insgesamt sieben Geschwistern. Als Bauernkinder sind wir ausreichend und gesund ernährt worden. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir auch nur einen Tag haben hungern müssen.
Im Grunde waren wir Kinder nicht anders als heute: Wir wollten spielen, um uns so unbewusst Kenntnisse fürs Leben anzueignen. Eines war für uns Kinder, zumindest in den Dörfern, anders: Unsere Spielzeuge waren einfacher als heute. Wir hatten keine Autos, Trecker, Eisenbahnen, Helikopter und so weiter. Unsere Spielgegenstände waren: Kastanien, Eicheln, Steine und Murmeln. Bestenfalls gab es zu Weihnachten vom Opa mütterlicherseits einige geschnitzte Pferde, Kühe und Schweine. Die Einfachheit dieser Spielzeuge haben aber unserem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt. Gerade die Einfachheit spornte meine Fantasie auf Äußerste an. So habe ich ab zehn Jahren mir Dinge erdacht, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Geräte, die unsere Arbeit auf dem Land erleichtern sollten, Maschinen, die von Windkraftspeicher angetrieben wurden und allerhand Geräte für den täglichen Gebrauch. Wenn es auch Hirngespinste waren, so ist es mir nie langweilig geworden. Zu bereuen gab es auch nichts, denn meine Gedanken haben niemand geschadet. In meinem ganzen Leben war ich mit einer regen Fantasie ausgestattet, so dass in meiner Welt das Wort Langeweile keinen Platz hatte. Auch heute fehlt es mir nicht an Vorstellungen und Einfällen in bezug auf unser gegenwärtiges und zukünftiges Leben. Es sei denn, ich bin wieder eingeschlafen.
Mein erster Schultag:
Vorweg: unsere Schule war eine buchstäblich hinterpommersche Dorfschule. Sie bestand aus zwei Klassenzimmern: Eins für das erste bis vierte Schuljahr, diese vier Schuljahre wurden von einem Junglehrer geleitet, der bei uns Schülern als sehr umgänglich galt. Dem fünften bis achten Schuljahr stand der schwer behinderte Schulleiter vor, der sehr streng, aber auch gerecht war. Er scheute auch nicht davor zurück, den Rohrstock als Erziehungsmittel zu benutzen.
Krankheitsbedingt (Gelbsucht) wurde ich einige Wochen später eingeschult. In der Klasse setzte der Lehrer mich auf sein Pult und fragte mich, was ich denn einmal werden möchte. In meiner nun herausgehobenen Stellung antwortete ich äußerst zuversichtlich, dass ich auch mal Lehrer werden möchte. Außer mir glaubte wohl niemand, dass ich einmal Lehrer würde. Wussten doch alle – ob jung oder alt, dass es sehr schwer war, aus unseren Dörfern auf eine höhere Schule in die nächste Stadt zu kommen und dass die Ausstattung mit finanziellen Mitteln unserer Eltern eher bescheiden war. Mir blieb dann auch weiter nichts anderes übrig als mein Bestreben, Jahr für Jahr das nächste Schuljahr zu erreichen.
Eine Erziehungsmaßnahme:
Als Kinder mussten wir schon mit jungen Jahren mithelfen. Da gab es immer viel zu tun auf so einem kleinen Bauernhof. So musste ich im Sommer zum Beispiel die Gänse hüten, damit sie zu Weihnachten auch ordentlich Fleisch angesetzt hatten. Ich musste dann mit den Gänsen etwa einen Kilometer zu einem Weideplatz ziehen und dort aufpassen, dass sie nicht in die Kornfelder der Bauern gingen. Eines Tages, ein Nachbarjunge war auch mit seinen Gänsen auf dem Weideplatz, überfiel uns der Übermut und wir spielten im Kornfeld eines Bauern Verstecken. Der Bauer hatte das beobachtet, ist zu unseren Vätern gegangen und hat sich über uns beschwert.
Als ich gegen Abend mit meinen Gänsen nach Hause kam, sagte mein Vater „komm noch mal mit zum Gänseplatz“. Dort angekommen, zeigte er mir das zertrampelte Kornfeld und fragte, ob ich auch darin rumgetrampelt hätte. Nun ich konnte das nicht leugnen. Er nahm dann seinen Hosenriemen und ich musste die Hose runterlassen und es gab eine ordentliche Tracht Prügel mit dem Lederriemen. Als mein Vater glaubte, es wäre genug, fragte er: Wirst du noch mal ein Kornfeld zertrampeln? Nun, aufgrund der gewaltigen Tracht Prügel habe ich tränenreich „Nein“ gesagt. Gut, sagte meine Vater, dann können wir wieder nach Hause gehen. Und unter viel Schmerzen kam ich zu Hause an und mochte mich nirgendwo hinsetzen. Eines hatte diese Erziehungsmaßnahme zur Folge: Nie wieder habe ich ein Kornfeld zertrampelt oder eine ähnliche Dummheit begangen.
Eine Brudergeschichte:
Als ich noch ein kleiner Junge von acht Jahren war, hatte ich einen kleinen Bruder. Er hieß Hans, er war ein ganz lieber und fröhlicher Bub. Er ging noch nicht zur Schule als er sehr krank wurde und an dieser Krankheit starb. Wir, die ganze Familie mussten ihn dann auf unserem Friedhof begraben. Die ganze Familie war sehr traurig, denn es tat allen sehr weh, dass dieser unschuldige Junge von uns gehen musste. Wenn ich das damals auch gar nicht alles so begriffen habe, war es für mich doch sehr schlimm und mir fehlte dieser kleine Spielgenosse doch sehr.
Der II. Weltkrieg:
Inzwischen war ich zehn Jahre alt. War Mitglied des Deutschen Jungvolkes. Für uns Jungen begann nun eine bewegende Zeit: In der Nacht zum 31. August 1939 wurde mein Vater alarmiert und wurde zur Wehrmacht einberufen. Er war 1919 aus der Gefangenschaft entlassen worden und hatte keine einzige Wehrübung abgeleistet. Welch eine mangelhafte Vorbereitung für einen Kampfeinsatz? Ausgerüstet mit einem Gewehr und einem Fahrrad, marschierte er mit nach Polen ein. Über uns flogen nun die deutschen Kampfflugzeuge nach Osten. Direkt neben unserem Hof führte die Reichsstraße 2 vorbei. Hier war schon seit Tagen ein reger Verkehr unserer Wehrmacht zu beobachten. Unser Großvater väterlicherseits war von dieser Entwicklung überhaupt nicht erbaut. Er warnte vor den Gefahren der nun kommenden Ereignisse. Wie recht er hatte stellte sich 1945 bei Kriegsende heraus als Deutschland total besiegt und zerstört am Boden lag.
Für uns aber war nach ein paar Wochen der Sieg über Polen ein Zeichen der Unbesiegbarkeit unserer Wehrmacht. England und Frankreich hatten uns sofort nach dem Einmarsch nach Polen den Krieg erklärt. Nun reihte sich Sieg an Sieg. Deutschland hatte halb Europa unter seine Herrschaft gebracht: Von Norwegen bis zum Mittelmeer, von Polen bis Frankreich. Sogar in Nordafrika gewann das Afrikakorps alle Kämpfe. Im Atlantik versenkten deutsche U-Boote viele der Schiffe, die England mit Nachschub versorgen sollten. Die deutsche Luftwaffe hatte sich die Lufthoheit erkämpft.
Der Einmarsch in die Sowjetunion:
Am 22. Juni 1941 marschierte die deutsche Wehrmacht mit voller Wucht in das sowjetische Reich ein. In gewaltigen Panzerschlachten wurden die westlichen sowjetischen Provinzen überrannt. Große Teile des deutschen Volkes wurden in ihrem Glauben an die Unbesiegbarkeit der deutschen Wehrmacht so gestärkt, dass dem Endsieg nichts mehr im Wege zu stehen schien. Schon im Herbst 1941 standen die deutschen Truppen kurz vor Moskau. Ein harter Winter stoppte den Vorwärtsdrang. Im Frühjahr 1942 traten die deutschen Truppen wieder zum Angriff an. Im Spätsommer erreichten sie die Wolga und besetzten die Stadt, die den Namen des sowjetischen Führers trug: Stalingrad. Hier begann nun das Drama um eine Stadt tief im russischen Reich: Stalin wollte die Stadt nicht als verloren ansehen und Hitler wollte sie nicht wieder hergeben. Stalin schickte neue starke Kampfverbände in das Ringen und schloß die deutsche 6. Armee in einem riesigen Kessel ein. Die deutsche Luftwaffe konnte durch ihre Einsätze die Verluste nicht mehr ausgleichen. Ein Entlastungsangriff der deutschen Wehrmacht konnte den Kessel nicht aufbrechen. Hitler verbat den Ausbruch der 6. Armee aus dem Kessel und forderte zum Durchhalten auf. Die Übermacht der russischen Truppen wurde immer stärker. Von Kälte und Hunger geplagt, ohne Nachschub wurde die 6. Armee und die ihr unterstellten Verbände so geschwächt, dass sie aufgeben musste. Generalfeldmarschall Paulus kapitulierte am 31. Januar 1943 bedingungslos. Die noch verbliebenen 110 000 Soldaten gingen in Gefangenschaft. Davon kehrten, wie wir später erfuhren, nur 6000 in ihre Heimat zurück. Stalingrad wurde zur Wende des Krieges zugunsten der Sowjetunion. Und wir, die sieggewohnte Heimatbevölkerung, wurden mit Phrasen wie „heldenhafter Verteidigungswille, Heldenkampf einer Armee, Entlastungskampf für andere Frontabschnitte“ abgespeist. Wir, die Hitlerjugend wurden propagandistisch so bearbeitet, dass wir weiter an den Endsieg der Deutschen glaubten. Mit dieser raffinierten Propaganda wurden wir immer wieder in die Irre geführt. Und wir, das deutsche Volk, glaubten trotz Bombenterror, trotz der immer größer werdenden Zahl der gefallenen Soldaten dieser Propaganda.
Der „Heldentod“ meines Bruders:
Ich hatte einen Bruder, der war fünf Jahre älter als ich, er hieß Fritz. Er wusste schon so viel und war mir ein wahrer älterer Freund. Ich weiß noch als 1939 mein Vater (euer Uropa) Weihnachten wegen des Krieges als Soldat nicht bei uns sein konnte, übernahm er mit seinen fünfzehn Jahren die Vaterstelle und sorgte mit unserer Mutter (eure Uroma) zusammen, dass wir jüngeren Kinder alle eine Kleinigkeit zu Weihnachten bekamen und dass ein Weihnachtsbaum vorhanden und geschmückt war. Zwei Jahre später – mein Vater war vom Militär wieder freigestellt – meldete sich Bruder Fritz freiwillig zum Kriegseinsatz. Er war erst achtzehn Jahre als er 1942 in Russland gefallen ist. Als wir die Nachricht von seinem Tod bekamen, war in unserer Familie die Trauer groß. Da habe ich das erste Mal gesehen, wie unser Vater geweint hat und er sich Vorwürfe machte, weil er die Freiwilligenmeldung unterschrieben hatte. Unsere Mutter wurde vor Schmerz krank. Unser Bruder Fritz war nicht ein einziges Mal in Urlaub bei uns zu Hause. Lediglich unsere Eltern haben ihn einmal während seiner Ausbildung besucht. Für mich mit meinen dreizehn Jahren war es eine bittere Erfahrung, zu sehen, dass auch dieser Bruder für mich endgültig verloren war und ich für immer auf seinen Rat und seine Hilfe verzichten musste.
Für uns alle war es eine bittere Erfahrung, dass eine Familie nach der anderen vom Tod ihrer Söhne und Väter erfuhren. Schon die Tatsache, dass der Tod so erbarmungslos in die Familien getragen wurde, zeigte uns an, wie verbissen um die Herrschaft gerungen wurde. Wenn ich mir heute überlege, dass trotz allem wir Hitlerjungen nicht schnell genug das Alter erreichen konnten, um uns als Soldat für den Sieg zu bewähren, so wird mir heute die Wirkung der Propaganda des Dritten Reiches deutlich vor Augen geführt.
Das Jahr 1943 war dann auch noch geprägt von einem unbedingten Siegeswillen. Es gab aber auch unter den Älteren (die wehrpflichtigen Jahrgänge waren an der Front), etliche denen aufgrund der Niederlage in Stalingrad Zweifel aufkamen. Öffentlich geäußert haben sich aber die wenigsten. Sie wussten, dass das Äußern von Zweifeln an der Kriegsführung bittere Folgen nach sich ziehen würde. So behielten sie ihre Zweifel für sich und taten das, was man von ihnen erwartete, sie taten die ihnen aufgetragene Pflicht.
Die Wende des Kriegsgeschehens:
Stalingrad war die erste größere Niederlage, die unsere Wehrmacht verbuchen musste. Im Osten begannen nun die großen Abwehrschlachten, die nicht immer zu unseren Gunsten ausgingen. England hatte inzwischen den U-Boot-Code geknackt und eine neue Ortungstechnik entwickelt, die unseren U-Booten zu schaffen machte und den Erfolg der Boote stark minderten. Dadurch konnte England sich mit Hilfe der USA wirtschaftlich und militärisch erholen. Die englische Luftwaffe wurde stark und übernahm im Westen die Luftherrschaft. Deutschlands Städte mit ihren Industrieanlagen wurden verstärkt bombardiert, minderten unsere Wirtschaftskraft und brachten der Zivilbevölkerung Tod und Verderben. Die großen Städte wurden in Schutt- und Aschelandschaften verwandelt und vergrößerten die Wohnungsnot. In Nordafrika ging die deutsche Vorherrschaft verloren. Mein Bruder Helmut wurde eingezogen und nach seiner Ausbildung an die Front geschickt.
Goebbels rief „zum totalen Krieg“ auf und fragte die Berliner „Wollt ihr den totalen Krieg?“ Sie wollten ihn.
Die Gegner Deutschlands werden übermächtig:
Das Jahr 1944 brachte dann entscheidende Vorteile für die Alliierten im Westen und der sowjetischen Wehrmacht im Osten. Am 6.6.1944 landeten die alliierten Truppen an der Küste Frankreichs mit starken Verbänden und drangen immer tiefer nach Frankreich ein. Kurze Zeit nach dem Angriff der Alliierten eröffneten am 22.6. die sowjetischen Truppen ihren Großangriff auf unsere Heeresgruppe Mitte. Ende 1944 standen die Alliierten im Westen und die sowjetischen Truppen im Osten an den Grenzen Deutschlands.
Die deutsche Wehrmacht wehrte sich verzweifelt gegen die militärische Übermacht der Feindmächte. Anfang 1945 begannen unsere Gegner die deutschen Grenzen zu überschreiten. Unser Vater wurde nun zum Volkssturm eingezogen und wurde sofort im Kampf gegen die Sowjetarmee eingesetzt. Er wurde im Februar als vermisst gemeldet und ist aus dem Krieg nicht mehr zurückgekehrt.
Für mich bedeutete dies, dass ich nun die Hauptverantwortung über den Hof zu übernehmen hatte. Ich versorgte nun das gesamte Vieh: Füttern und ausmisten. Eine wichtige Arbeit war das Tränken der Pferde, der Kühe und des Jungviehs: Es gab einen Brunnen auf dem Hof, aus dem ich nun das viele Wasser heraufpumpen musste und in den Stall zu dem Vieh trug. Hinzu kam dann auch das Heranschaffen von Rüben und Kartoffeln aus den Mieten auf den Feldern. Der Mist musste auf die Felder gefahren werden; Holz musste aus dem Wald geholt werden. Hinzu kam der Dienst in der Hitlerjugend. Einen Vorteil hatte ich: Ich hatte mit vierzehn Jahren auf unserem Hof eine landwirtschaftliche Lehre bei meinem Vater begonnen. So waren mir die anfallenden Arbeiten bekannt. Anfang Januar war ich immerhin noch fünfzehn. So wie mir ging es vielen von uns Jugendlichen. Wir wurden zu einer Jugend degradiert, denen die Väter abhanden gekommen waren.
Im Februar wurde die Kriegslage immer bedrohlicher. Ich war nun 16 Jahre alt und auf mich kam eine neue Herausforderung zu: Mit Absprache meiner Mutter begann ich mit den Vorbereitungen zur Flucht. Als erstes besorgte ich aus dem Wald bei unseren Heuwiesen lange biegsame Äste von den hohen Nadelbäumen. Während meiner Hütezeit der Kühe im Herbst bin ich in den Bäumen herumgeklettert und ich wusste, wo ich die besten Äste heraussägen konnte. Zuhause habe ich die Äste sauber geglättet. Dann habe ich die große Plane vom Dreschkasten geteilt und ein Hälfte der Bauernfamilie Zillmer übergeben mit der wir die Dreschmaschine angeschafft hatten. Mit einem Teil der Plane habe ich den Boden ausgelegt, damit nicht zu viel Kälte von unten in den Kastenwagen gelangen konnte. Dann habe ich die Äste an den Seitenbrettern so befestigt, dass sie nicht verrutschen konnten. Darüber wurde dann die Plane gespannt. Zusätzlich habe ich für das Jungpferd eine dritte Zugvorrichtung zurecht gezimmert, damit es den beiden anderen Pferden beim Ziehen des schweren Wagens helfen konnte. Zu bedenken war auch, dass wir neben meiner Mutter und den beiden Schwestern eine bombengeschädigte Frau mit drei Kindern mitnehmen mussten. Diese bombengeschädigten Familien wurde auf die Fahrzeuge der Bauernfamilien verteilt. So das jedes Fahrzeug einer zusätzlichen Belastung ausgesetzt war. Als zusätzliche Maßnahme ließ Mutter noch ein Schwein schwarz schlachten, so dass neben den schon vorhandenen Lebensmitteln genügend Vorrat mitgenommen werden konnte.
Ende Februar und in den ersten Tagen im März verstärkten sich die Flüchtlingstrecks; nun auch vermehrt durch die Trecks der pommerschen Landsleute. Vermehrt zogen nun auch zurückweichende deutsche Einheiten auf der vorbeiführenden Straße und vermehrten das Chaos auf den Fluchtwegen. Im unserem Dorf gab es dann öfter Einquartierungen von Soldaten, die uns nichts Gutes zu berichten wussten. Eine Gruppe hatte dann bei uns in der Scheune Munition und Handgranaten liegen lassen. Ich habe mir dann noch erlaubt, einen Teil dieser Handgranaten vom fahrenden Pferdewagen aus auf unseren Feldwegen mit dem Aufzählen von 21, 22, 23 nach hinten vom Wagen zu werfen, so wie wir es bei der HJ gelernt hatten. Ich muss aber zugeben, dass ich sehr schnell gezählt habe, damit sie mir nicht in der Hand explodierten. Welch ein jugendlicher Unfug!
Am vierten März bekamen wir wieder eine Einquartierung. Diesmal waren es Soldaten vom Sicherheitsdienst. Das waren raue Gesellen. Sie wurden von Mutter und den beiden Schwester mit Essen versorgt. Ich erinnere mich, wie der Anführer der Gruppe zu Mutter respektlos sagte: „Mutter morgen geht es auf die Walz“.
Am nächsten Vormittag kam dann die Anweisung vom Ortsgruppenleiter, die letzten Vorbereitungen zur Flucht zu treffen. Das galt für die Orte, die zu seiner Ortsgruppe gehörten. Ich habe dann als erstes die Munition und die restlichen Handgranaten aus dem Versteck geholt und sie in unserem Dorfsee geworfen. Ich tat das, um Großvater zu schützen. Der Fund von Handgranaten und Munition auf dem Hof hätten schwerwiegende Folgen für ihn haben können. Großvater weigerte sich, mit auf die Flucht zu gehen. Er wollte neben dem Grab seiner Frau, unserer Oma, begraben werden. Als ich mit dem Wagen von Hof fuhr, bat Mutter ihn nochmals eindringlich, doch mit auf die Flucht zu gehen. Wenn er auch ein gealterter Mann war, so war er doch ein Mann mit einer großen Lebenserfahrung, die uns von Nutzen sein konnte. Aber er wollte nicht. Was uns dann sehr überraschte, war, dass er begann mit der Kreissäge Holz zu sägen. Ein Wunder war, dass es noch Starkstrom gab. Ich denke, er wollte uns zeigen, dass er sich nun wieder verantwortlich für das Geschehen auf dem Hof fühlte. Dabei war er altersbedingt sehr geschwächt und hatte wirklich nicht die Kraft, die nun anfallenden Arbeiten zu leisten.
Wenn ich heute daran denke, dass ein Großteil der Bevölkerung all ihren Besitz mit all den Tieren, dem umfangreichen Gerät und ihre Wohnstätten aufgaben und Haus und Hof verließen, um nicht in die Hände von, wie immer wieder berichtet wurde, einem wütenden und rachsüchtigen Feind zu fallen. Es war ein Trauerspiel allergrößten Ausmaßes, eine Zumutung an Grausamkeit für die Bevölkerung der betroffenen Gebiete. Welch ein Seelenschmerz für den einzelnen Menschen, der das ertragen musste, obwohl man den Wenigsten von ihnen eine Schuld für dieses unfassbare Geschehen zuweisen konnte. Was in unserer Familie zu Buche schlug, war dass unser Vater überzeugter Parteigenosse war. Dafür hätten wir ganz gewiss büßen müssen. Hier möchte ich hinzufügen, dass unser Vater ein sehr hilfsbereiter Mann war und jedem Hilfe gewährte, der sie benötigte. Nun er hat, wenn er aber doch fehlerhaft gehandelt haben sollte, dies mit seinem Leben bezahlen müssen. Mir war er ein guter Vater und ein Vorbild.
Das bittere Lebensende meines Großvaters:
An dieser Stelle möchte ich vom Lebensende meines Großvaters berichten, da ich denke, dass ich es hier am besten einflechten kann. Ihm war kein gutes Leben mehr gegeben. Wie wir später erfahren haben, hat er viel unter der polnischen Herrschaft leiden müssen. Er wurde geschlagen und gedemütigt. Einmal musste er sein eigenes Grab ausheben. Als er damit fertig war, hat er zu seinem Herr gebetet (Opa war ein frommer Christ). Die Polen, selbst fromme Leute, haben ihn dann wieder gehen lassen. Mit der ersten Vertreibungswelle aus Pommern ist er dann ausgewiesen worden. Über das Rote Kreuz erfuhren wir, dass er in Kiel im Krankenhaus liegt. Wir Enkel haben ihn dort besucht. Er befand sich in einem erbärmlichen Zustand, war total abgemagert. Trotz seiner Trauer um den Verlust seiner Heimat, war seine Freude, uns zu sehen, sehr groß. Als wir ihn nach etwa drei Wochen wieder besuchen wollten, war er verstorben. Niemand konnte uns sagen, wo er begraben lag. Nun liegt er irgendwo in Kiel in fremder Erde, fern vom Grab seiner Frau. Sein inniger Wunsch, neben dem Grab seiner Frau eine Ruhestätte zu finden, ist ihm nicht gegönnt worden. Sein Lebensende gehört zu den vielen Opfern, welche die Verantwortlichen dieses wahnsinnigen Kriege zu verantworten haben.
Die Flucht aus Pommern:
Unsere Treckwagen wurden nun beladen und auf der Dorfstraße aufgereiht. Am frühen Nachmittag kam dann die Anordnung, dass sich der Dorftreck in die Trecks der Reichsstraße 2 eingliedern konnte. Dazu wurde die Reichsstraße solange gesperrt, bis wir eingegliedert waren. Nun gehörten wir zu dem Menschenstrom, der hoffte, noch rechtzeitig über die Oder zu kommen. Schon nach wenigen Kilometern wurden wir von der Reichsstraße 2 abgeleitet und auf eine Straße gewiesen, die in nordwestlicher Richtung verlief. Der Fluchtweg, direkt über Altdamm die Oder zu erreichen, war nun nicht mehr gegeben. Unser neue Fluchtweg zeigte uns nun die Möglichkeit an, nördlich vom Stettiner Haff über Swinemünde in den westlichen Teil Pommerns zu gelangen. Sehr mühsam kamen wir vorwärts. Immer wieder wurden neue Trecks aus den Nebenstraßen auf unsere Straße geleitet. Nach anderthalb Tagen und zwei Nächten sind wir etwa 30 Kilometer vorangekommen. Die Wehrmachtsfahrzeuge, die auch alle Richtung Westen zurückfluteten, hatten immer Vorfahrt. Gott sei Dank hatten die Soldaten aber Mitleid und nahmen all die ausgebombten Familien auf ihren Fahrzeugen mit, so dass wir nun doch mehr Platz auf dem Wagen hatten und wir der Verantwortung für diese Menschen entbunden waren.
Am dritten Tag unser Flucht wurde die Lage für uns immer bedrohlicher. Von der Ostsee her war der Russe weiter durchgestoßen und die Frontlinie befand sich rechts von unserem Treckweg. Etwa zwei Kilometer nördlich von uns konnten wir dann einen Angriff deutscher Sturzkampfbomber (Stukas) beobachten, als sie die sowjetischen Panzerspitzen mit ihren Bordwaffen angriffen. Wie viel Erfolg sie damit hatten, war für uns nicht feststellbar.
Bald darauf wurde in unseren Treck hineingeschossen. Wir waren nun im direkten Kampfgebiet. Von Panik ergriffen, versuchten die Wagenführer mit eine Flucht über das freie Feld davonzukommen, aber da ging nichts mehr. Die ermüdeten Pferde waren nicht in der Lage, die Wagen durch den tiefen Schnee zu ziehen. Meine Mutter hatte einen klaren Kopf behalten und ordnete an, sofort zu Fuß zu fliehen. Ich wollte die Pferde nicht im Stich lassen, aber Mutter drang darauf, alles stehen zu lassen. Und so habe ich heute noch den Blick zurück zu den Pferden in meiner Erinnerung, die ich einfach stehen lassen musste. Diese Zumutung war für mich noch trauriger als das Herunterfahren vom Hof. Wenn ich heute davon sprechen möchte, versagt mir sofort die Stimme und ich werde in einen Gemütszustand versetzt, gegen den ich vollkommen machtlos bin.
Nun waren wir getrennt von dem letzten Hab und Gut, waren Habenichtse geworden, die nun um ihr Leben liefen. Nach etwa zwei Kilometern erreichten wir eine deutsche Stellung. Wir waren dem unmittelbaren Kampfgeschehen entkommen. Hier standen Schützenpanzer und ein Königstiger. Ich fragte den Kommandanten des Tigers:
„Warum kann man den Russen denn nicht mehr aufhalten“ Er sagte mir, wenn wir 60 solcher Panzer hätten, die immer genug Benzin und Munition hätten, würden sie die Russen wieder dahinjagen, wo sie hergekommen sind. Sie hätten aber weder die Panzer noch Benzin noch Munition, so dass sie den Russen nichts Ernsthaftes entgegenzusetzen hätten. Die Panzer wurden dann immer nach dem Verschießen der letzten Munition kampfunfähig gemacht. Die Besatzung eines Schützenpanzers hat uns dann bis Altdamm mitgenommen. Zurück blieb der Königstiger und ein Schützenpanzer. Warum sie zurückblieben konnte ich nur ahnen: Ich glaube, dass der Königstiger keinen Kraftstoff mehr hatte, aber noch einige Schuss Munition, um sie auf die wohl bald erscheinenden sowjetischen Panzer abzufeuern. Danach wohl den großen Panzer zerstören und mit dem Schützenpanzer zu fliehen. Was da aber wirklich geschehen ist, das wissen nur die Panzersoldaten.
Unterwegs sahen wir dann links und rechts eine Menge 8/8 Geschütze. Neben der Luftabwehr waren diese Geschütze auch für die Panzerabwehr gut geeignet. Wie sich später herausstellte, gehörten diese Kampftruppen der 10. SS-Division Frundsberg an, wo unser späterer Schwager Egon als Richtschütze eingesetzt war. Am nächsten Tag sind wir dann von Altdamm aus mit einem der letzen Züge über die Oder gekommen. Wir wurden dann mit der Reichsbahn in die Nähe von Rostock gefahren und dort in einem Flüchtlingslager untergebracht.
Zwei Brotgeschichten:
Die erste Brotgeschichte begann auf der Fahrt mit dem Schützenpanzer nach Altdamm: Ein Soldat gab mir, wohl aus Mitleid, eine Schnitte Quarkbrot. Ich war bis dahin gewohnt, als Bauernsohn immer reichlich und gut belegt zu essen. Aber dieses Quarkbrot entsprach überhaupt nicht meinen Vorstellungen; ich konnte es einfach nicht herunterbekommen. Ich ließ es unauffällig an der Bordkante des Schützenpanzers in den Schnee fallen. Aber schon am nächsten Tag, als kein Soldat oder sonst jemand kam, um mir ein Schnitte Brot anzubieten, begann der Hunger zu nagen. Und so blieb es nun tage- und wochenlang, nie konnte ich mich mal wieder richtig satt essen.
Die zweite Brotgeschichte spielte sich in dem Flüchtlingslager in der Nähe von Rostock ab. In diesem Lager, wir wohnten mit 28 Personen in einem Raum, war der Hunger unser tägliche Begleiter. Eines Tages bekam jede Familie eine Brotmarke, mit der man in einem drei Kilometer entfernten Dorf bei einer Bäckerei ein Brot kaufen konnte. Ich wurde von meiner Mutter beauftragt, das Brot dort zu kaufen. Ich bekam das Brot. Es war noch ofenwarm. Unterwegs konnte ich nicht widerstehen und aß das halbe Brot auf. Beschämt habe ich die andere Hälfte meiner Mutter übergeben. Meine Mutter und meine beiden Schwestern hatten nun zu dritt nur ein halbes Brot. Eine ziemlich ungerechte Teilung: Für eine Person ein halbes Brot und für die drei verbleibenden ein halbes Brot.
Die weggeworfene Schnitte und das gegessene halbe Brot sind mir mein Leben lang nicht aus dem Sinn gekommen. Ich weiß seitdem den Wert des Brotes, sehr gut einzuschätzen. Ich weiß aber auch, was es heißt, wochenlang nicht richtig satt zu werden. Jedenfalls haben diese beiden Brotgeschichten eine lebenslange lehrreiche Bedeutung für mich eingenommen: In Notsituationen ist ein gerechtes Teilen des Wenigen unbedingt erforderlich, um nicht schuldig zu werden an seinen Mitmenschen. Die Gedanken an die beiden Brotgeschichten haben mein Leben so geprägt, dass ich stets mit dem zufrieden war, was mir an materiellen Gütern zur Verfügung gestellt wurde.
Die Weiterreise nach Niedersachsen und Fluchtende:
Der Krieg war immer noch nicht zu Ende. Von Westen und Osten drangen unsere Gegner immer tiefer in unser Deutschland ein. Die russischen Truppen waren über die Oder gedrungen und hatten sich als nächstes Ziel die Besetzung Berlins vorgenommen. Ihr Bestreben war, Berlin vor den Alliierten zu erreichen. Der Raum um Rostock war nun auch durch die sowjetischen Truppen bedroht. Uns war es recht, als wir weiter nach Westen verlegt wurden. Damit hatten wir die berechtigte Hoffnung, endgültig aus dem sowjetischen Bereich zu gelangen. Uns war es wichtig, dass wir uns nun in einem Gebiet befanden, das höchstwahrscheinlich von alliierten Truppen besetzt werden würde.
Wir wurden dann in Harsefeld (einem größeren Dorf im Kreis Stade) untergebracht. Zuerst in einem Kinosaal. Hier wurden wir entlaust und in einem lausfreien Zustand einer Familie zugewiesen. Die Familie stellte uns ein etwa zwölf Quadratmeter großes Zimmer zur Verfügung. Im Zimmer hatten wir ein Bett, eine Matratze, einen Schrank, einen kleinen Tisch und zwei Stühle. Vom Roten Kreuz hatten wir vier Decken bekommen. Vom Gemeindeamt bekamen wir Verpflegungsmarken, die es uns erlaubten, nicht zu verhungern.
Unsere Flucht aus Pommern war nun beendet. Wir hatten die Heimat, Haus und Hof, Pferd und Wagen verloren. Wir waren nun bettelarme Menschen geworden. Von nun an lebten wir in der Hoffnung, irgendwann wieder zufrieden unser Leben gestalten zu können.
Es fehlte endlich ein Kriegsende. Das ließ aber immer noch auf sich warten. Unsere Führung fand nicht den Mut, dem Blutvergießen ein Ende zu setzen. Nachdem ich in Pommern gemustert worden bin, wurde ich dann ein zweites Mal in Rostock und nun nochmals in der Kreisstadt Stade gemustert. Kurz darauf bekam ich einen Einberufungsbescheid. Meine Mutter sagte traurig zu mir: „Nun muss ich dich auch noch hergeben, was für ein Elend für uns!“ Mit anderen Hitlerjungen mussten wir uns in Schleswig-Holstein bei einer Einheit melden. Es waren etwa 120 Heranwachsende, die sich dort einfanden. Überraschend stellte sich uns ein SS-Offizier vor. Er forderte uns auf, wieder zurück in unsere Wohnstätten zu gehen. Wir könnten am Kriegsgeschehen auch nicht mehr das geringste ändern. Der Krieg ist verloren. Was für eine Information von einem SS-Offizier! Nun wurden wir nicht mit der Bahn zurück befördert, sondern mussten zu Fuß über die Elbe zurück in unsere Wohnorte. Unterwegs wurden wir mehrmals von englischen Jagdflugzeugen mit Maschinengewehrfeuer beschossen. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Was ist das für ein Krieg? Wir werden von einem SS-Offizier nach Hause geschickt und nun behandelt, als wären wir Soldaten, die vernichtet werden müssen. Hier kam uns unsere vormilitärische Ausbildung zugute: Wir waren geschult worden, schnell eine Deckung zu finden und haben den feindlichen Piloten keine Chance gegeben, uns zu treffen. Unsere Mutter und die beiden Schwestern waren hoch erfreut, als ich mich wieder bei ihnen einfand.
Die Front hatte bald darauf auch unser Dorf erreicht. Englische Panzer fuhren unweit des Dorfes in Stellung und forderten von den deutschen Soldaten ihre Kapitulation. Diese lehnten das zum Bedauern der Bewohner des Dorfes ab. Darauf eröffneten die Panzer den Beschuss und setzten einige Häuser in Brand.
Als der Beschuss aufhörte, bin ich auf die Straße gegangen, um zu erforschen, was nun weiter geschehen würde. Ein deutscher Leutnant schrie mich an, ich solle von der Straße verschwinden. Als ich nicht gleich ging, legte er seine Maschinenpistole auf mich an und schoss mir eine Geschossgarbe dicht am Kopf vorbei. Nun war ich sehr schnell von der Straße. Meine Neugierde war gestillt. Auf diese Art und Weise – von einem deutschen Leutnant erschossen zu werden und so den Krieg zu beenden, war nun wirklich nicht mein innigstes Begehren. Einen nächsten Schreck bekam ich, als ich den Hof betrat: Hinter einer Hecke sah ich einen englischen Soldaten mit seiner Maschinenpistole im Anschlag. Im Gegensatz zum deutschen Leutnant schoss er aber nicht und ließ mich ins Haus gehen. Als ich meiner Mutter erzählte, was da draußen vonstatten geht, hat sie mir ordentlich ihre Meinung über die Gefahren meiner Neugierde gesagt. Nun durfte ich das Haus nicht mehr verlassen. Inzwischen hatten die Panzer, begleitet von Infanterie das Dorf in Besitz genommen. Die deutschen Soldaten hatten sich zurückgezogen. Das Dorf war nun im Besitz der Engländer. Englische Soldaten durchsuchten nun die einzelnen Häuser nach Wehrmachtsangehörigen. So schauten sie auch in unser Zimmer. Sie freuten sich offensichtlich über das Dasein zweier junger Mädchen, grüßten freundlich und verließen lächelnd unser Zimmer. Welch eine überraschende erste Begegnung mit der Besatzungsmacht!
Für uns alle hier in diesem Dorf war der Krieg beendet. Ein paar Dörfer weiter setzten sich deutsche Soldaten wieder erneut zu Wehr. Unsere Wehrmacht gab immer noch nicht auf. Die Sinnlosigkeit ihres Kampfes war doch offensichtlich. Ende April sickerte vom deutschen Rundfunk die Nachricht durch, dass Adolf Hitler im Kampf um Berlin am 29. 4. 1945 den Heldentod gefunden hätte. Für mich als nun gewesener Hitlerjunge, eine Nachricht, die doch wehmütig machte, dass der Mann, auf den wir alle Hoffnungen gesetzt hatten, nun nicht mehr wirken würde. Dann erfuhren wir aber, dass er sich durch Selbstmord der Verantwortung für sein Tun entzogen hatte. Heute, nachdem ich mich ausreichend über das Dritte Reich und seiner Führung informiert habe, ist mir bewusst, dass wir Deutschen einem Despoten in die Hände gefallen waren, der mit Hilfe seiner Genossen eine Gewaltherrschaft aufgebaut hat, die Deutschland anfangs wieder zu einem souveränen Staat machte und unser Land aufblühen ließ, die sich dann aber verheerend für Deutschland und für andere Völker ausgewirkt hat.
Eine unbegreifliche Tat meiner Mutter:
Nun noch zu einer Handlung meiner Mutter, die noch mit dem Kriegsgeschehen in einem Zusammenhang steht: Als in Harsefeld nach der Einnahme des Dorfes für deutsche Soldaten auf einer Wiese unter freiem Himmel ein mit Stacheldraht und Wachposten gesichertes Gefangenlager eingerichtet wurde, musste ich auf Anweisung meiner Mutter von den vier Wolldecken, die wir, wie weiter oben berichtet, vom Roten Kreuz bekommen hatten, mit den Worten: „Wir haben ein Dach über dem Kopf“ drei Decken zum Lager tragen und über den Zaun werfen. Was ist in meiner Mutter vorgegangen, die heimatlos, nichts außer dem hatte, was sie und wir drei heranwachsenden Kinder auf dem Leib trugen, mir so einen Auftrag zu geben? War es nur ein Mitleiden mit Menschen, die buchstäblich im Dreck leben mussten, war es ein stilles Gedenken an den gefallenen Sohn, den vermissten Ehemann und den vermissten zweiten Sohn oder war es einfach christliche Nächstenliebe? Etwas später hat sie mir von der vierten Decke einen Anzug genäht.
Die Erinnerungen an diese Zeit haben bei uns allen Spuren hinterlassen, die uns demütig haben werden lassen. Sie haben unsere Bedürfnisse auf ein sehr niedriges Niveau sinken lassen. Im Vordergrund stand die Überlegung: Wir haben trotz all der Verluste von Angehörigen, der Heimat und unserem ganzen Besitz überlebt. Wir haben wieder eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft bekommen. Armut ist kein Grund, aufzugeben. Hunger ist, wenn er nicht zum Verhungern führt, eine gute Voraussetzung das folgende Leben genügsam und zufriedener bis ins hohe Alter zu verbringen.
Die deutsche Kapitulation und die Frage nach der Schuld:
Am achten Mai 1945 war der Krieg endlich vorbei. Die Wehrmacht beugte sich endlich der Tatsache, dass sie machtlos geworden war, dass aller heldenmütiger Einsatz der deutschen Soldaten und der deutschen Zivilbevölkerung die Niederlage nicht haben verhindern können. Nun begannen die Fragen nach der Schuld für all die Kriegstoten, den Toten der Gewaltherrschaft, des Bombenkrieges und der Flucht und der Vertreibung.
Alle, die heute sagen: Ihr hättet euch wehren und aufschreien müssen. Sie vergessen, dass dies dann auch ihr Todesurteil gewesen wäre. Sie vergessen auch, dass das deutsche Volk bis 1933 aus vielerlei Gründen nicht gerade auf Rosen gebettet war und Hitler, indem er die Parteien, die Gewerkschaften und alles, was ihn hinderte, ausgeschaltet hat, einen Aufbruch in Gang gesetzt hat, der einmalig in der Geschichte des deutschen Volkes war. Es ging sogar soweit, wie Sebastian Haffner, ein Gegner Hitlers, in seinem Buch „Anmerkungen zu Hitler“ Seite → schreibt, „dass SPD- und KPD-Leute gesagt haben, ´Der Mann mag seine Fehler haben, aber er hat uns wieder Arbeit und Brot gegeben´ – das war in diesen Jahren die millionenfache Stimme der ehemaligen SPD- und KPD-Wähler, die noch 1933 die große Masse der Hitlergegner gebildet hatten.“ Ein besonderes Lob erfuhr Hitler von dem ehemaligen Premier-Minister Englands Lloyd George indem er ihn mit Heil Hitler begrüßte und hinzufügte: „Jawohl „Heil Hitler“, das sage ich auch, denn er ist wirklich ein großer Mann!“ Weiter auf der nächsten Seite: „Hitler habe Deutschland ganz allein und ohne fremde Hilfe aus der Tiefe empor geführt. Er sei ein geborener Menschenführer, eine dynamische Persönlichkeit mit entschlossenem Willen und unerschrockenem Herzen, dem die Alten vertrauten und dem die Jugend zu ihrem Idol gemacht habe.“ Aus dem Buch „Adolf Hitler“ von John Toland, Seite 532f. Churchill hat noch am 7. November 1938, ... in der Montagsausgabe der Londoner ´Times´, Hitler öffentlich als ´großen Mann´ mit Vorbildcharakter erscheinen lassen.“ ... Aus dem Buch von Werner Maser: Zwischen Kaiserreich und NS-Regime, Seite 341
Waren wir die Schuldigen, die Jugend und die ältere Generation, dass Hitler sich so eine Macht aufbauen konnte? Und so frage ich mich immer wieder: Welche Schuld habe ich: Ich war vier Jahre im Deutschen Jungvolk und zwei Jahre bei der Hitlerjugend. Ich habe fest und ohne jeden Zweifel an die Fähigkeiten des Führers geglaubt. Er war für uns Hitlerjungen das Symbol für Freiheit und Gerechtigkeit im eigenen Land und gegenüber der Außenwelt. Er hat aus einem niedergeschlagenen Volk wieder eine selbst bewusste Nation und eine aufblühende Wirtschaftsmacht gemacht.
Heute weiß ich, dass Schuld immer dann anfängt, wenn man – auch als junger Mensch – unkritisch und ohne darüber nachzudenken, das glaubt, was politische Heilsverkünder in die Welt setzen. Ob das eine Schuld ist, die dazu beigetragen hat, Millionen von Menschen umzubringen, mag ich nicht beurteilen. Ich war zu ungebildet, nur auf eine Richtung festgelegt: Deutschland, Deutschland über alles... Ich hatte kaum eine Chance, andere Denkweisen aufzunehmen. Eine Grundfrage bewegt mich bis heute: Wie hätte ich mich verhalten, wenn ich etwas älter gewesen wäre und einem Sonderkommando der SS zur Erschießung von Juden zugeteilt worden wäre? Hätte ich den Mut aufgebracht, mein eigenes Leben zu opfern oder hätte ich feige mitgemacht? Diese Frage dürfen sich auch Menschen in unserer Demokratie stellen: Wie hätten sie sich damals verhalten als der Tod bei Verweigerungen eine unmittelbare Gefahr war?
Ein großer Teil der Bevölkerung waren Nationalsozialisten; und die, die anders dachten, hielten ihren Mund. Fest steht, dass die damalige Bevölkerung einer Propaganda ausgesetzt war, die gut organisiert und sehr effektiv war. Hinzu kam eine ständige Todesbedrohung für diejenigen, die diese Propaganda durchschauten und sich querstellten.
Das nationalsozialistische Regime hat es fertig gebracht, das deutsche Volk auf einen Weg zu führen, der anfangs danach aussah, als ob Hitler uns zu ungeahnten Höhen führen würde, der dann aber doch in einem Chaos endete: Unsere großen Städte lagen in Schutt und Asche, Millionen Menschen waren heimatlos geworden, Millionen Menschen sind im Krieg umgekommen: Soldaten in einem erbarmungslosen Kampf, zigtausend Zivilpersonen im Bombenhagel, allein zwei Millionen Personen kamen während der Flucht und Vertreibung um, ein Viertel des deutschen Staatsgebietes war verloren; und, was sehr schmerzlich und so sehr beschämend ist, dass durch Hitlers Politik unsere Nachbarvölker schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden und er durch seine Rassenpolitik eine wahnsinnige Tötungsmaschinerie in Gang gesetzt hatte, denen sieben Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind, weil sie der jüdischen Rasse angehörten.
Heute wissen wir, dass im Nürnberger Prozess und während der Zeit der Entnazifizierung überführte Täter zur Rechenschaft gezogen wurden. Todes- und Haftstraßen wurden gefällt. Ob alle Schuld damit getilgt wurde, ist anzuzweifeln. Viele Nationalsozialisten haben sich durch eine Flucht ins Ausland ihrer Verantwortung entzogen. Viele sind nicht entdeckt worden oder haben durch Mitbürger ein Alibi bekommen. Und nun nennen sich bis auf wenige Ausnahmen alle Demokraten. Der Ausgang des II. Weltkrieges 1945 mit all seinen Auswirkungen hat im deutschen Volk eine grundlegende Bewusstseinsänderung hervorgerufen. Die Zeit der Diktatur war beendet. Nun diktierten die militärischen Befehlshaber der Siegermächte, was zu geschehen hatte.
Die Nachkriegszeit:
Die Siegermächte versuchten intensiv das Denken der Besiegten zu ändern:
Wir gewöhnen uns schnell daran, dass die Kampfeinsätze der Feindmächte uns nicht mehr in Angst versetzten, keine Bedrohung mehr durch Maschinenpistolen, Panzerkanonen und Bombenangriffe. Dafür nun das Wirken der Besatzungsmächte mit neuen Gesetzen und Anordnungen, mit Maßnahmen zum Auffinden von Nazi-Verbrechern, das auch durch Mithilfe der eigenen Bevölkerung geschah. Dadurch, dass vermehrt über die Verbrechen des Nazi-Regimes berichtet wurde, kam es zu einem gründlichen Nachdenken in der Bevölkerung über die Art und Weise der Menschenführung im Dritten Reich. Mit der ganzen Macht der Sieger wurde versucht, uns klar zu machen, welchem diktatorischem Regime wir gefolgt sind. Unter anderem wurde das gesamte Volk beschuldigt, die Diktatur erst möglich gemacht zu haben. Um es klar auszudrücken: Die Besatzungsmächte begannen nun intensiv, die deutschen Menschen zu Demokraten umzuerziehen.
Was mich in der Nachkriegszeit sehr beunruhigt hat, ist dass unsere Wehrmachtssoldaten pauschal als Mordinstrumente von unseren eigenen Leuten gebrandmarkt wurden. Dass unsere gefallenen Soldaten auf den Ehrenfriedhöfen von Mitbürgern verachtet und verunglimpft wurden. Keine andere Nation geht so mit ihren gefallenen Soldaten um. Und was ist mit der Bundeswehr, deren Soldaten als Mörder bezeichnet werden dürfen. Die Politiker, die alle Einsätze der Bundeswehr anordnen, halten sich vornehm zurück und lassen es zu, dass alle, die sich berufen fühlen, den Mördervorwurf ohne Strafe von sich geben können. Was für eine Staatsführung, die eine neue Streitkraft per Gesetz ins Leben ruft, sie dann aber den Spott der Welt preisgibt?
Für mich beginnt nun für drei Jahre ein neues Leben als Knecht:
Für unsere Familie stand nun die Aufgabe an, unser Leben neu zu organisieren. Viel Auswahl hatten wir nicht. Wir entschlossen uns für das nächstliegende: Die beiden Mädchen wurden Mägde und ich Knecht auf einen der Bauernhöfe. Unsere Mutter bekam ein Zimmer bei dem Bauern, bei dem die jüngste Schwester Trudchen und ich eingestellt wurden. Schwester Ilse kam bei einem anderen Bauern unter. Magd und Knecht waren damals die Namen für die Kräfte, die den Bauern bei der Bewältigung der vielen Arbeiten zur Hand gingen.
Erschwerend war für uns Flüchtlinge, das wir oft nur das besaßen, was wir anhatten. So waren bei mir meine Schuhe, die ich noch von zu Hause hatte, total verschlissen. Ich habe eine Zeit mit Säcken, die ich um die Füße gewickelt habe, meine Arbeit verrichtet. Durch Vermittlung bekam ich dann ein Paar passende Militärschuhe. Allmählich wurde die Bekleidungssituation etwas gemildert. Vorwegnehmend: Einen Anzug mit dem ich auch ausgehen konnte, bekam ich etwa zwei Jahre später von dem Bauern, bei dem ich zu dieser Zeit war.
Inzwischen war auch mein Bruder Helmut durch die Vermittlung durch des Roten Kreuz aus der Gefangenschaft zurück in den Schoß der Familie gekehrt. Wir haben dann mehrmals unseren Wohnsitz gewechselt. Gründe dazu gab es verschiedene: Einmal zogen wir in einen Ort, wo eine Familie aus unserem Heimatort untergekommen war. Zwei bis dreimal wechselte ich den Arbeitsplatz, weil ich mich benachteiligt gefühlt habe. Ich hatte in den letzten Kriegsmonaten und danach gelernt, selbständig zu handeln, mich aber nicht bevormunden zu lassen. Die Arbeit auf den Bauernhöfen hatte den Vorteil, immer satt zu werden und in geheizten Häusern zu wohnen. Das galt für viele Teile der Bevölkerung in den ersten Nachkriegsjahren nur mangelhaft. Es gab immer noch viel Elend und Not in manchen Bevölkerungsschichten. Die Wohnungsnot wurde durch den enormen Zustrom von Heimatvertriebenen immer größer und es fehlte immer noch an einer ausreichenden Verpflegung. Viele quälten sich von Tag zu Tag. Erst als die Männer und Söhne vermehrt aus der Gefangenschaft zurückkehrten und wieder Verantwortung übernahmen, wurden die Ehefrauen und Mütter entlastet.
Eine Wettfahrt mit einem Polizisten:
Unsere Mutter wohnte zu dieser Zeit mit ihrer verheirateten Tochter Trudchen und Schwiegersohn Egon im Nachbardorf, etwa sieben Kilometer von meinem Arbeitsort entfernt. Ich hatte vom Bauern einen Sack Zuckerrüben bekommen. Den wollte ich meiner Mutter bringen, damit sie daraus Sirup kochen konnte. Ich bekam vom Bauern ein Fahrrad geliehen, habe den Rübensack aufs Lenkrad gelegt und bin nach Feierabend losgefahren. Auf der Landstraße kam mir mit einem Fahrrad ein Polizist entgegen. Da es Herbst war, war es schon dunkel. Der Polizist forderte mich auf, stehen zu bleiben. Ich hatte aber keinen Drang darauf, mich lange mit dem Polizisten auseinander zu setzen und stieg kräftig in die Pedale. Mit der Kraft meiner achtzehn Jahre bin ich ihn schnell davongefahren. Die Rüben habe ich dann bei meiner Mutter abgeliefert. Sie hat daraus einen guten Sirup gemacht, der dann wochenlang als Brotaufstrich vorgehalten hat. Gewissensbisse wegen der Flucht vor der Polizei hatte ich nicht.
Meine erste Bergmannszeit:
Im Juni 1948 wurde auf Anordnung der westlichen Besatzungsmächte und in Absprache mit der deutschen Regierung die bisherige Währung „Reichsmark“ auf die „Deutsche Mark“ umgestellt. Jeder der Bundesbürger konnte vierzig Reichsmark in vierzig D-Mark umtauschen. Hinzu kamen noch andere Regelungen, die uns Arme aber kaum betrafen, da wir keine großen Reichsmark-Beträge hatten, die wir zum Wert von ein zu zehn hätten umtauschen können. Jeder Bürger hatte nun einen Betrag von vierzig D-Mark zur Verfügung. Dieses Geld hat nun auch einen Wert, für den man im Gegensatz zur Reichsmark einen entsprechenden Warenwert bekommen konnte.
Die Enttäuschung folgte von Seiten meines Bauern sofort. Er teilte mir mit, dass er mir keine fünfzig D-Mark mehr geben könne, sondern nur dreißig. Wenn ich daran denke, das ich bisher für sechs Tage in der Woche von sechs bis sechs (abzüglich der Mahlzeiten: Zweitfrühstück, Mittagessen und Kaffeezeit) plus jeden zweiten Feier- und Sonntag Stalldienst hatte für fünfzig R-Mark gearbeitet habe. Nun, wo für das neue Geld einen guten Warenwert gab, kürzte er mir meinen Lohn um zwanzig D-Mark. Das hat mich so geärgert, dass ich einen Tag Urlaub verlangte, um am nächsten Tag nach Stade zu fahren. Auf dem Arbeitsamt meldete ich für den Bergbau.
Vierzehn Tage später fuhr ich dann auf der Zeche Klärchen II in Recklinghausen zu meiner ersten Schicht ein. Aus dem Knecht war nun ein Gedingeschlepper geworden. Die ersten Eindrücke waren geprägt von der schnellen Fahrt mit dem Personenförderkorb bis in eine Tiefe von achthundert Metern. Unten war es bis zu dreißig Grad warm. Ich wurde einem älteren Bergmann zugeteilt, dem ich beim Ausbessern von Bruchstellen in der Strecke zu Hand gehen musste. Mein Lohn für diese Arbeit waren achtzehn D-Mark pro Schicht. Nachdem ich etwa vier Wochen dieser Arbeit nachgegangen bin, wurde ich in einem Kohlenstreb eingesetzt. Ich lernte nun, wie man die Kohle mit dem Abbauhammer löst und auf ein Förderband schaufelt. Ich wurde einen Kumpel zugeteilt, der etwa so alt war wie ich. Wir arbeiten in einem modernen Streb. Das Förderband bestand aus einer flachen etwa fünfzig Zentimeter breiten und zehn Zentimeter tiefen Eisenkonstruktion in der eine Doppelkette mit Stege lief. Diese transportierte dann die gelöste Kohle an das untere Ende des Strebes. Hier wurde sie in Loren verladen und zu den Förderschacht gefahren.
Der sogenannte Panzerförderer lief genau an einer Eisenstempelreihe vorbei. Auf den Stempeln waren Eisenkappen verlegt, die wir immer, wenn wir einen Streifen von etwa achtzig Zentimetern Kohle freigemacht hatten, eine neue Kappe über das freigemachte Feld hängen mussten. Diese Kappen hatten eine Vorrichtung, womit sie stabil unter dem Hangenden befestigt werden konnten.
Ich habe diese Arbeiten deshalb etwas ausführlicher berichtet, weil sie ein Anlass zu einem schweren Unfall waren. Mein Kumpel war ein etwas leichtsinniger junger Mann. Ich musste ihn immer wieder auffordern, vorsichtiger mit der Absicherung umzugehen. Alle Kumpel im Streb wussten, dass es hier die sogenannten Sargdeckel gab, die mehrere Zentner wogen und nicht ganz fest mit dem Hangenden verbunden waren. Wenn die Kappen nicht rechtzeitig eingefügt wurden, lösten sich diese Platten durch das Gedröhne der Abbauhämmer aus der Deckplatten und stürzten nach unten. Ich war im hinteren Teil des Knapps und machte die Sohle frei. Er boxte im vorderen Teil wie wild weiter und hörte nicht auf mich. Er hatte nun schon ein Fläche von zwei Metern freies Hangende über sich. Da fing es an zu rieseln. Er versuchte schnell über den Panzerförderer zu kommen. Als der Sargdeckel herunterknallte, war er noch mit dem linken Bein über der Kante vom Förderer. Ich habe dann das Förderband durch einen Seilzug angehalten. Als wir dann mit mehreren Kumpel den Sargdeckel zerkleinert haben, sahen wir, das sein Bein nur noch durch die Haut gehalten wurde. Durch die inzwischen eingetroffenen Rettungskräfte wurde er nach über Tage gebracht. Sein Bein war er los und bekam dafür ein Holzbein. Später hat er dann über Tage eine andere Arbeit bekommen und ich bekam einen neuen Kumpel.
Wir, die wir aus allen Teilen Westdeutschlands kamen, wohnten in einer großen Schule, die unsere Zechenleitung für die zugereisten Arbeitskräfte angemietet hatte. Geschlafen wurde zu mehreren in größeren Zimmern. Durch den Schichtbetrieb der Zeche war es immer ziemlich unruhig. Gekocht wurde in Gemeinschaftsküchen. Wir mussten uns selbst versorgen. Es war ein typisches Junggesellenleben. Ein junger Mensch, der körperlich gesund ist, gewöhnt sich schnell an die neue Situation. Wir konnten, wenn wir wollten, aus der Zechenküche ein Mittagessen bekommen, was ich oft in Anspruch nahm, da meine Kochkünste sehr beschränkt waren. Wir Kohlenhauer arbeiteten im wöchentlichen Wechsel in der Frühschicht und Nachmittagsschicht an sechs Tagen. Im Gegensatz zur Landwirtschaft wurde die Arbeit gut bezahlt.
Nach anderthalb Jahren bat meine Mutter mich, dass ich wieder in den Kreis Stade kommen sollte, um hier Arbeit aufzunehmen. Sie war durch Meldungen im Radio unruhig geworden, da immer wieder von Toten im Bergbau berichtet wurde. Außerdem hatte sie Bedenken, dass ich dort im Ruhrgebiet auf eine schiefe Bahn geraten könnte. Ich habe ihre Bitte Folge geleistet und bin in den Schoß der Familie zurückgekehrt.
Wie ich Knecht auf einem Obstbauernhof wurde:
Inzwischen arbeiteten mein Bruder und meine älteste Schwester im Alten Land (Ein großes Obstanbaugebiet an der Elbe). Meine neue Arbeitsstelle war nun ein Obstbauernhof auf Hohenfelde. Mein Lohn betrug nun achtzig D-Mark im Monat plus wohnen in einer Knechtkammer und einer Vollverpflegung. Meine Arbeit bestand nun in der Pflege der Obstbäume. Hinzu kam, dass zu dieser Zeit die Obstbauern auch noch Milchkühe besaßen, die versorgt werden mussten.
Wie ich meinen ersten Führerschein machte:
Die Obstbauern im Alten Land waren finanziell besser gestellt als die Ackerbauern auf der Geest. So hatte mein Bauer statt Pferden einen Trecker. So war es erforderlich, dass ich den Führerschein Klasse 4 für das Fahren mit dem Trecker machen musste. Dazu musste ich eine mündliche Prüfung ablegen. Nachdem ich diese bestanden hatte, bekam ich den Führerschein. Nun sollte ich den Trecker auch fahren. Nun war der Bauer ein nicht sehr begnadeter Fahrlehrer. Ich habe ihn jedenfalls missverstanden und den Trecker vor die Garagenwand gefahren indem ich meinen Fuß nicht vom Gaspedal bekam. Ich hatte nun zwar einen Treckerführerschein, aber außer der Fahrt vor eine Wand keine weitere Treckerfahrpraxis bekommen. Ich wurde nicht für würdig gefunden, Treckerfahrer auf dem Hof zu sein.
Irgendwann im Juni begann die Kirschernte. Nun hieß es Tag für Tag von morgens bis abends Kirschen auf Akkord pflücken, sechs Pfennig für das Pfund. Das Pflücken riss nun bis in den Herbst nicht ab. Nachdem die Kirschen von den Bäumen waren kamen verschiedene Pflaumen- Äpfel- und Birnenarten. Ein Problem waren dabei damals die hohen Bäume. Zum Teil brauchten wir dazu Leitern mit bis zu 48 Sprossen. Diese mussten rund um den Baum gestellt werden, um an das Obst heranzukommen. Für Frauen und schwache Männer unmöglich.
Die Jugendzeit eurer Oma Wolff:
Hier an dieser Stelle möchte ich euch die Lebensgeschichte eurer Oma aus ihrer Jugendzeit wiedergeben, die sie eurem Papa, Anja und mir am Heiligen Abend erzählt hat. Für mich ist das sehr wichtig, dass die Zeit, die vor unserem gemeinsamen Leben war mit in mein Lebensaufzeichnung einbezogen wird. Eure Oma ist für mich die wichtigste Person, die auch meinen Lebensablauf wesentlich mitbestimmt hat.
Omas Erzählung:
Geboren bin ich am 31.08.1933 in Guderhandviertel im Alten Land als älteste Tochter des Ehepaares Klaus und Katharina Ostmeier. Nach mir wurden innerhalb der nächsten zehn Jahre noch vier Schwestern und ein Bruder geboren. Unser Vater war als Landarbeiter eingestellt. Wir wohnten zuerst in Guderhandviertel. Noch vor dem Krieg zogen wir nach Ruschwedel. 1939 wurde bei Kriegsbeginn mein Vater eingezogen und war Soldat bis zur seiner Entlassung aus der russischen Gefangenschaft 1949. 1940 ging ich bis 1945 in Ruschwedel zur Schule. Hier erlebten wir die vielen Luftangriffe auf Hamburg. Für uns war das eine ständige Belastung, denn jedes Mal mussten wir immer in einen Keller bei unserem Bauern, wo Mutter anstatt Vater für den Bauern arbeiten musste. Schlimm wurde es für uns alle als die feindlichen Jagdflugzeuge mit Maschinengewehren auf uns schossen. Wir waren froh als der Krieg bei uns endlich vorbei war.
Kurz nach dem Krieg starb meine Mutter an einer schweren Krankheit. Wir waren traurig und fühlten uns verlassen. Unser Vater, der in Russland in Gefangenschaft war, hatte auf das folgende Geschehen keinen Einfluss. Wir sollten nun bis zur Rückkehr das Vaters in einem Waisenhaus untergebracht werden. Aber auf Beschluss von einem Onkel und einer Tante wurden wir immer zu zweit bei Verwandten untergebracht. Meine Schwester Annerose und ich wurden unserer Tante Adele und Onkel Jan in Guderhandviertel zugeteilt. Wir haben es verhältnismäßig gut gehabt. Dass wir bei der Arbeit mitgeholfen haben, war für Kinder in dieser Zeit nicht ungewöhnlich. Jetzt ging ich hier in Guderhandviertel bis 1948 zur Schule und wurde mit dem achten Schuljahr entlassen. Konfirmiert wurde ich in Steinkirchen.
Nun wurde ich, trotzdem ich nur leichte Arbeiten verrichten sollte, zu einem Bauern in Guderhandviertel zugeteilt. Aus der leichten Arbeit wurde schnell eine Vollzeitkraft. Ich musste mit aufs Feld, lernte das Melken von Kühen unter erschwerten Umständen. Der Bauer scheute sich nicht, mir den Melkschemel auf den Hinterkopf zu hauen bis ich melken konnte.
1949 kam endlich unser Vater zurück aus der Gefangenschaft. Für mich gab es dann eine Änderung, Vater brachte mich bei einem Obstbauern in Hohenfelde unter. Auch hier musste ich alle Arbeiten verrichten: Haushalt, Melken der Kühe und Pflücken von Obst. Erinnern kann ich mich noch sehr gut, dass bei einem schweren Gewitter eine Kuh auf dem Nachbargrundstück erschlagen wurde. Ich flog dabei durch die Gegend. Seitdem habe ich eine große Angst bei Gewittern.
Hier möchte ich meine Erzählung beenden, denn hier traten wir beide, mein späterer Mann und ich unsere gemeinsame Zeit an.
Martha Wolff
Wie der Herrgott mir eine Ehefrau zuteilte:
Eines Tages sollte auf unserem Hof eine neue Magd anfangen. Es hatte sich eine gewisse Spannung aufgebaut, denn nicht jeden Tag erschien eine neue Magd auf dem Hof. Als ich zum Feierabend auf den Hof kam, sah ich, wie ein junges Mädchen Zwiebeln sortierte. Ein wohlgestaltetes, hübsches Mädchen von fast 17 Jahren. Das war ein Anblick, der das Herz höher schlagen ließ. Nur ganz kurz blickte sie mich schüchtern an. Im gleichen Moment reifte in mir der Entschluss: Das wird einmal meine Frau.
Ich habe dann solange um sie geworben, bis auch sie davon überzeugt war, dass das Niedersachsenmädchen und der pommersche Dickschädel für immer zusammengehören.
Geklaute Rosen zum 17. Geburtstag:
Auf dem Heimweg von meinem Bruder habe ich mir aus einem Vorgarten die schönsten Rosen angeeignet und habe sie meinem Mädchen an ihr Kammerfenster gebracht.
Nun am nächsten Tag stellte sich dann heraus, dass die Rosen aus dem Vorgarten entwendet waren, der zu dem Anwesen gehörte, wo die Seniorbäuerin herstammte. Für mein Mädchen war die Rosen gerade aus diesem Garten nun etwas unangenehm. Ich dagegen fühlte mich stark genug und habe meine Geburtstagsrosen trotz allem für eine gute Tat empfunden, galten sie doch dem Mädchen, das ich so sehr liebte und das ich heiraten wollte.
Wie ich wieder Bergmann wurde:
Inzwischen war ich bei einem anderen Obstbauern eingestellt worden. Hier bekam ich nun 100 D-Mark. Wie es damals in der pillenlosen Zeit oft geschah, gerieten die Mädchen durch das stürmische Begehren ihrer Verehrer in andere Umstände. So erging es auch uns beiden. Wir haben uns dann in Gegenwart von Omas Vater verlobt.
Nun gab es im Alten Land keine Wohnung, die für uns angemessen war. Von meinem Bauern wollte ich eine Lohnerhöhung von 20 D-Mark haben. Sie wurde nicht gewährt. Ich besuchte wieder das Arbeitsamt. Anfang Januar reiste ich wieder ins Ruhrgebiet. Ich wurde Bergmann in der Zeche Waltrop. Wieder bekam ich eine Arbeit als Kohlenhauer in einem Streb 800 Meter unter der Erde.
Ich ließ meine achtzehn Jahre alte mir anvertraute Frau zurück. Um sie unterzubringen, habe ich sie zu meiner verheirateten Schwester nach Estorf gebracht. Sie hatte eine kleine Wohnung, in der ihr Mann, ihre zwei Kinder und unsere Mutter wohnten. Bei ihrem Vater konnten wir sie nicht unterbringen, da er mit einer anderen Frau zusammenlebte und in deren Wohnung seine eigenen und die Kinder der anderen Frau wohnten. Es war also eine absolute Notlösung. Ich bin heute noch meiner Schwester und unserem Schwager für die geleistete Hilfe dankbar. Ich selbst habe in Waltrop dann wieder in einer Gemeinschaftsunterkunft gewohnt.
Im Februar wurde unsere älteste Tochter geboren – ohne mich. Im April konnte ich dann beide zu mir nach Waltrop holen. Wir bekamen eine Barackenwohnung mit Mäusemitbewohnern und direkt an der Zechenmauer. Es war ein Behelf, der uns aber zusammen wohnen ließ und wir, trotz der ärmlichen Verhältnissen lernten, eine Familienleben zu entwickeln.
Ein halbes Jahr später bekamen wir eine Neubauwohnung mit Schlaf-, Kinderzimmer, Wohnküche und Bad (das waren für uns paradiesische Verhältnisse).
Die Hauerprüfung:
Nachdem ich nun zusammen mit meiner ersten Bergmannzeit als Gedingeschlepper größtenteils im Kohlenstreb gearbeitet hatte, meldete ich mich zur Hauerprüfung. Das bedeutete, dass ich neben der Arbeit nun auch lernen musste. Die Prüfung bestand in einem theoretischen und einen praktischen Teil. Nach dem Erhalt des Hauerbriefes war ich ein vollwertiger Bergmann. Hinzufügen möchte ich hier, dass sich nur wenige dazu entschlossen, den Hauerbrief zu erwerben. Das galt zumindest für die Bergleute, die von überall in den Zechen anheuerten. Sie wollten nur eins: Geld verdienen.
Nun war ich offiziell ein Hauer im Kohlenstreb. Bei meinem Reviersteiger war ich seitdem gut angesehen, denn nur ganz wenige waren bereit, den Aufwand für die Hauerprüfung auf sich zu nehmen.
Beförderung zum Rutschenbär (Vorarbeiter):





























