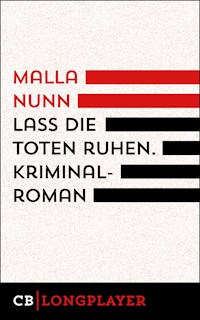9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Band 1 des Zyklus um Detective Sergeant Emmanuel Cooper. 1952: Detective Sergeant Emmanuel Cooper wird nach Jacob’s Rest gerufen, ein Burenstädtchen im südafrikanischen Veld nahe der Grenze zu Mosambik. Der Kriminalermittler aus Johannesburg weiß nicht, was ihn erwartet, denn auf dem Land sind Telefone rar, und die Polizeizentrale hat nur unklare Angaben über ein »mögliches Gewaltverbrechen« erhalten. Es könnte auch falscher Alarm sein. Doch im Fluss treibt wirklich eine Leiche – in Polizeiuniform. Und was Emmanuel Cooper in Jacob’s Rest zutage fördert, wird sein Leben verändern … »Intelligenter kann man Geschichte und Literatur nicht zusammenbringen!« Marius Müller, Buch-Haltung »Malla Nunn ist eine Meisterin darin, die Unterdrückung noch in der leisesten Körpersprache darzustellen. Eine starke Schreibe, aus der der Duft der Regenzeit des südlichen Afrikas aufsteigt.« Christiane Müller-Lobeck, taz »Behutsam, fein und klug: Nunn.« Tobias Gohlis, Die Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Ein schöner Ort zum Sterben ist die Eröffnung des Zyklus um Detective Sergeant Emmanuel Cooper.
1952: Detective Sergeant Emmanuel Cooper wird nach Jacob’s Rest gerufen, ein Burenstädtchen im südafrikanischen Veld nahe der Grenze zu Mosambik. Der Kriminalermittler aus Johannesburg weiß nicht, was ihn erwartet, denn auf dem Land sind Telefone rar, und die Polizeizentrale hat nur unklare Angaben über ein »mögliches Gewaltverbrechen« erhalten. Es könnte auch falscher Alarm sein. Doch im Fluss treibt wirklich eine Leiche – in Polizeiuniform. Und was Emmanuel Cooper in Jacob’s Rest zutage fördert, wird sein Leben verändern …
»Malla Nunn ist eine Meisterin darin, die Unterdrückung noch in der leisesten Körpersprache darzustellen. Eine starke Schreibe, aus der der Duft der Regenzeit des südlichen Afrikas aufsteigt.« Christiane Müller-Lobeck, taz
Über die Autorin
Malla Nunn wurde in Swasiland geboren. In den 1970ern emigrierte ihre Familie nach Australien, um der Apartheid zu entgehen. Malla Nunn studierte Englisch, Geschichte, Theaterwissenschaften und schuf als Drehbuchautorin drei preisgekrönte Dokumentarfilme, darunter Servant of The Ancestors. Malla Nunn lebt und arbeitet in Sydney.
Malla Nunn
Ein schöner Ort zum Sterben
Kriminalroman
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2022
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
eBook-Herstellung: CulturBooks
Printausgabe: © Argument Verlag 2022
Titel der Originalausgabe: A Beautiful Place to Die
© 2008 by Malla Nunn
Die deutsche Erstausgabe erschien 2009 bei Rütten & Loening, Berlin.
Rütten & Loening ist eine Marke der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG.
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2009
Erscheinungsdatum: Juni 2022
ISBN 978-3-95988-222-4
Vorbemerkung von Else Laudan
Ein schöner Ort zum Sterben ist die Eröffnung des Zyklus um Detective Sergeant Emmanuel Cooper. Er soll in einer Kleinstadt einen Polizistenmord aufklären, doch Dünkel, Rassismus und Repressalien erschweren die Wahrheitsfindung, die Geheimpolizei will Kommunisten jagen, es gibt ständig Machtgerangel. Cooper, behindert durch strukturelle Eiertänze und kriegstraumatische Halluzinationen, folgt mit dickschädeliger Konsequenz und mit zunehmendem Risiko den Spuren von Gewalt und Gier.
Der Emmanuel-Cooper-Zyklus verbindet den Reiz historischer Romane mit exzellenter Kriminalliteratur und zeigt das Alltagsgesicht der Apartheid. Immer neue Segregationsgesetze verstärken die soziale und ökonomische Kluft zwischen Nachkommen europäischer Kolonialherren und eingeborenen sowie eingewanderten »Nichtweißen«. Erkennbar wird, wie das sich von Ungleichheit nährende System Alltag und Entscheidungen Einzelner beherrscht, von Lügen und kleinen Fehltritten bis zu großen Verbrechen.
Band 1 und 2 von Malla Nunns Edgar-nominierter Krimireihe über die südafrikanische Apartheid waren lange vergriffen und werden jetzt nachträglich ins Ariadne-Programm eingereiht, wo bereits Band 3 und 4 erschienen sind. Es sind ›Fenster zur Welt‹, epische Spannungsromane mit intensiven Bildern: Lektüre, die den Horizont weitet und der Vorstellungskraft auf die Sprünge hilft.
Else Laudan
Ein kurzes Glossar befindet sich am Ende des Buchs.
1 Südafrika 1952
Detective Sergeant Emmanuel Cooper stellte den Motor ab und sah durch die schmutzige Windschutzscheibe. Er steckte im tiefsten Nirgendwo. Tiefer ging es nicht, es sei denn, man drehte die Zeit zurück bis zu den Zulu-Kriegen. Doch zwei Ford-Pickups, ein weißer Mercedes und ein Polizeitruck rechts neben ihm stellten klar, dass er sich im 20. Jahrhundert befand. Auf einer Anhöhe weiter vorn stand von ihm abgewandt eine Gruppe schwarzer Landarbeiter. Was dahinter lag, war von ihren angespannten Schultern verdeckt.
Emmanuel schaute hinaus auf die heißen grünen Hügel und entdeckte zwischen fünfzehn abgemagerten Kühen einen scheuen Hirtenjungen, der den für eine solch gottverlassene Gegend ungewöhnlichen Menschenauflauf anstarrte. Es handelte sich wohl nicht um blinden Alarm, wie die Polizeizentrale vermutet hatte – die Farm war tatsächlich ein Tatort. Emmanuel stieg aus dem Wagen und lüpfte den Hut vor den Frauen und Kindern, die im Schatten eines wilden Feigenbaums kauerten. Einige von ihnen nickten höflich zurück, schweigsam und besorgt. Emmanuel vergewisserte sich, dass er sein Notizbuch, seinen Federhalter und seine Waffe dabeihatte.
Ein alter Schwarzer in einem zerlumpten Overall trat aus dem Schatten des Polizeitrucks. Mit seiner Baumwollmütze in der Hand kam er näher.
»Sind Sie der Baas aus Jo’burg?«
»Bin ich«, sagte Emmanuel, warf einen Blick zurück zum Wagen und steckte die Schlüssel in seine Jackentasche.
»Der Polizist sagt, Sie sollen zum Fluss kommen.« Mit einem knochigen Finger deutete der Alte in Richtung der Landarbeiter, die auf der Kuppe standen. »Sie müssen bitte mit mir kommen, ma’Baas.«
Der Alte ging voraus, und Emmanuel folgte ihm auf die Landarbeiter zu, die sich nun zu ihm umwandten. Beim Näherkommen studierte er ihre Gesichter und versuchte die Stimmung abzuschätzen. Hinter ihrem Schweigen spürte er Angst.
»Sie müssen da lang, ma’Baas.« Der Alte wies auf einen schmalen Pfad, der sich durchs hohe Gras bis ans Ufer eines breiten, glitzernden Flusses schlängelte.
Emmanuel nickte dankend und folgte dem Trampelpfad. Eine Brise raschelte im Buschwerk, zwei Gimpel flogen auf. Er roch feuchte Erde und zertrampeltes Gras. Was mochte ihn erwarten?
Am Ende des Pfades erreichte er den Fluss und schaute hinüber zum anderen Ufer. Unter dem klaren Himmel schimmerte eine Ebene flachen Buschlands, das Veld. In der Ferne ragten am Horizont die zerklüfteten blauen Gipfel einer Bergkette auf. Afrika pur. Wie die Fotos in englischen Zeitschriften, wenn sie die Vorzüge der Auswanderung priesen.
Langsam ging Emmanuel am Ufer entlang. Zehn Schritte weiter sah er die Leiche.
Eine Armlänge vom Flussufer trieb ein Mann im Wasser, Gesicht nach unten, die Arme ausgebreitet wie ein Fallschirmspringer im freien Fall. Sofort erkannte Emmanuel die Polizeiuniform. Ein Captain. Breitschultrig und kräftig, das blonde Haar kurz geschoren. Kleine silbrige Fische umtanzten etwas, das aussah wie ein Einschussloch im Kopf und eine zweite klaffende Wunde mitten im breiten Rücken der Leiche. Ein Schilfgestrüpp hielt den Körper in der Strömung fest.
Am Ufer deuteten eine blutgetränkte Decke und eine umgekippte Laterne mit niedergebranntem Docht auf einen Angelplatz. Im groben Sand lagen aus einem Marmeladenglas verschüttete Würmer, jetzt vertrocknet.
Emmanuels Herz hämmerte gegen seine Rippen. Man hatte ihn allein losgeschickt, solo im Einsatz beim Mord an einem weißen Police Captain.
»Sind Sie der Detective?« Die auf Afrikaans gestellte Frage klang, als spräche ein mürrischer Schuljunge den neuen Direktor an.
Emmanuel drehte sich um und sah einen schlaksigen Teenager in Polizeiuniform. Ein breiter Ledergürtel fixierte die blaue Baumwollhose und die Jacke an den schmalen Hüften. Auf den Wangen spross spärlicher Flaum. Die Politik der National Party, verstärkt Afrikaaner in den öffentlichen Dienst zu holen, war auf dem Land angekommen.
»Ich bin Detective Sergeant Emmanuel Cooper.« Emmanuel streckte die Hand aus. »Sind Sie der für den Fall zuständige Polizist?«
Der Junge errötete. »Ja, ich bin Constable Hansie Hepple. Lieutenant Uys ist noch zwei Tage auf Urlaub in Mosambik, und Captain Pretorius … also … der ist … tot.«
Sie schauten beide zum Captain, der im Fluss der Ewigkeit trieb. Aus dem seichten Wasser winkte ihnen eine tote weiße Hand zu.
»Haben Sie die Leiche entdeckt, Constable Hepple?«, fragte Emmanuel.
»Nein.« Dem halbwüchsigen Afrikaaner schossen Tränen in die Augen. »Irgendwelche Kaffernjungs aus der Location haben den Captain heute Morgen gefunden … er war die ganze Nacht hier draußen.«
Emmanuel wartete, bis Hansie sich wieder fing. »Haben Sie die Kriminalpolizei verständigt?«
»Ich bin nicht zur Zentrale durchgekommen«, erklärte der allzu junge Polizist. »Da hab ich meiner Schwester gesagt, sie soll es weiter versuchen, bis sie durchkommt. Ich wollte den Captain nicht allein lassen.«
Ein Stück weiter oben am Ufer standen drei Weiße dicht beieinander und ließen einen zerbeulten silbernen Flachmann kreisen. Es waren massige Hünen, die Sorte Männer, die den Planwagen selbst durchs Veld zog, wenn die Ochsen längst tot waren.
»Wer sind die?« Emmanuel nickte hinüber zu der Gruppe.
»Drei von den Söhnen des Captains.«
»Wie viele Söhne hat der Captain denn?« Im Geiste stellte Emmanuel sich die Mutter vor, eine breithüftige Frau, die zwischen Brotbacken und Wäscheaufhängen Kinder gebar.
»Fünf Söhne. Es ist eine gute Familie. Echtes Stammvolk.«
Der junge Polizist vergrub die Hände in den Hosentaschen und trat mit den beschlagenen Stiefeln einen Kiesel weg. Acht Jahre nach den Stränden der Normandie und den Ruinen von Berlin erging man sich in der afrikanischen Savanne immer noch über den Volksgeist und die Reinheit der Rasse.
Emmanuel musterte die Söhne des ermordeten Captains. Waschechte Afrikaaner, keine Frage. Muskelbepackte Blondschöpfe, die geradewegs vom Sieg in der Schlacht am Blood River zu kommen schienen und im Voortrekker-Denkmal verherrlicht wurden. Jetzt löste sich das Grüppchen auf, und die Söhne des Captains kamen auf ihn zu.
Bilder aus seiner Kindheit erwachten zum Leben. Jungs, die vom Hals abwärts und von den Ellbogen aufwärts so weiß waren wie die Milch ihrer Mutter. Zerbeulte Nasen von Kämpfen mit Freunden, mit den Indern, den Engländern oder auch farbigen Jungs, die dreist genug waren, ihnen den Platz an der Spitze streitig machen zu wollen.
Die Brüder traten so nah an ihn heran, dass sie ihn hätten wegstoßen können. Der vorderste und größte der drei war ganz klar der Boss. Rechts von ihm stand mit mahlenden Kiefern der Vollstrecker des Trios, einen Schritt dahinter der dritte, der auf Instruktionen von weiter oben wartete.
»Wo ist der Rest der Einsatztruppe?«, wollte der Boss in kantigem Englisch wissen. »Wo sind Ihre Leute?«
»Die Einsatztruppe bin ich«, gab Emmanuel zurück. »Sonst ist keiner da.«
»Machen Sie Witze?« Der Vollstrecker half mit einem ausgestreckten Zeigefinger nach. »Da wird ein Police Captain ermordet, und die Kriminalpolizei schickt nur einen lausigen Detective?«
»Ich sollte streng genommen nicht allein hier sein«, räumte Emmanuel ein. Bei einem toten Weißen war ein Ermittlerteam üblich. Bei einem toten weißen Polizisten eine ganze Abteilung. »Die Zentrale hat eine unklare Meldung erhalten. Keinerlei Angaben über Hautfarbe, Geschlecht oder Beruf des Opfers –«
Der Vollstrecker unterbrach ihn. »Lassen Sie sich was Besseres einfallen.«
Emmanuel beschloss, sich auf den Boss zu konzentrieren.
»Ich habe gerade den Mordfall Preston bearbeitet. Das weiße Paar, das in seinem Gemischtwarenladen erschossen wurde. Wir haben den Mörder auf der Farm seiner Eltern eine Stunde westlich von hier gestellt und verhaftet. Major van Niekerk hat mich angerufen und gebeten zu überprüfen, ob hier möglicherweise ein Gewaltverbrechen verübt wurde –«
»Möglicherweise ein Gewaltverbrechen?« Der Vollstrecker ließ sich nicht beiseiteschieben. »Was zum Teufel soll das heißen?«
»Das heißt, die Zentrale hat vom Anrufer nur einen einzigen brauchbaren Hinweis bekommen, nämlich den Namen der Stadt, Jacob’s Rest. Mehr Informationen hatten wir nicht.«
Die These vom blinden Alarm ließ er tunlichst weg.
»Wenn das stimmt«, sagte der Vollstrecker, »wie haben Sie dann hergefunden? Das hier ist nicht Jacob’s Rest, sondern die Farm vom alten Voster.«
»Ein Schwarzafrikaner hat mich an der Hauptstraße rausgewinkt, und ein anderer hat mir den Weg zum Fluss gezeigt«, erklärte Emmanuel. Die Brüder wechselten einen verdutzten Blick. Sie hatten keinen Schimmer, wovon er redete.
»Kann doch nicht sein.« Der Boss sprach den halbwüchsigen Polizisten an. »Hansie, du hast ihnen doch gesagt, dass ein Police Captain ermordet worden ist, oder?«
Der Teenager zog sich hinter Emmanuel zurück. In der plötzlich eintretenden Stille hörte man ihn schwer atmen.
»Hansie …« Der Vollstrecker witterte Blut. »Was hast du denen erzählt?«
»Ich …«, antwortete der Junge mit belegter Stimme, »ich hab Gertie gesagt, sie soll alles erzählen. Sie soll erklären, was passiert ist.«
»Gertie … deine kleine Schwester hat angerufen?«
»Ich bin nicht durchgekommen«, jammerte Hansie. »Ich hab’s ja versucht …«
»Domkop!« Der Boss trat zur Seite, um ausholen und Hansie eine verpassen zu können. »Bist du wirklich so dämlich?«
Mit geballten Fäusten groß wie Kohlköpfe rückten die Brüder in geschlossener Front vor. Der Constable klammerte sich an Emmanuels Jackett und duckte sich hinter seine Schulter.
Emmanuel wich nicht zurück und sah dem vordersten Bruder fest in die Augen. »Wenn Sie Constable Hepple verprügeln, fühlen Sie sich danach vielleicht besser, aber hier geht das nicht. Das ist immer noch ein Tatort, und ich muss meine Arbeit machen.«
Die Pretorius-Brüder hielten inne und richteten ihre Blicke auf die Leiche ihres Vaters, die im klaren Flusswasser trieb.
Emmanuel nutzte die Pause und streckte die Hand aus. »Detective Sergeant Emmanuel Cooper. Mein Beileid zum Tod Ihres Vaters.«
»Henrick«, sagte der Boss, und Emmanuels Hand verschwand in seiner fleischigen Pranke. »Das sind meine Brüder Johannes und Erich.«
Die beiden Jüngeren nickten zum Gruß und beäugten argwöhnisch den Detective aus der Stadt mit seinem gebügelten Anzug und dem grün gestreiften Schlips. In Jo’burg mochte er darin wie ein smarter Profi aussehen, aber hier im Veld bei Männern, die nach Land und Diesel stanken, wirkte er eindeutig fehl am Platz.
»Constable Hepple sagt, Sie sind insgesamt zu fünft.« Emmanuel erwiderte die Musterung der Brüder und bemerkte die roten Flecken um Augen und Nasen.
»Louis ist zu Hause bei unserer Ma. Er ist zu jung für so einen Anblick.« Henrick nahm einen Schluck aus dem Flachmann und wandte sich ab, um seine Tränen zu verbergen.
Erich, der Vollstrecker, sprang ein. »Paul hat von der Armee Sonderurlaub bekommen. Wir rechnen morgen oder übermorgen mit ihm.«
»In welcher Einheit ist er?«, fragte Emmanuel unwillkürlich. Seit sechs Jahren war er Zivilist, doch noch immer hatten seine Hosen und Hemdsärmel so scharfe Bügelfalten, dass der Sergeant Major zufrieden gewesen wäre. Die Armee hatte ihn entlassen, doch losgelassen hatte sie ihn nicht.
»Paul ist bei der Aufklärung«, erklärte Henrick, dessen Gesicht jetzt vom Branntwein glühte.
Emmanuel überschlug kurz die Wahrscheinlichkeit, dass Bruder Paul zur alten Garde des Geheimdienstcorps gehörte – Leute, die Finger brachen und Köpfe einschlugen, um an Informationen zu kommen. Genau die Sorte, die man bei einer sauberen Mordermittlung am wenigsten brauchen konnte.
Er prüfte die Körpersprache der drei Brüder, hängende Schultern und schlaff geöffnete Hände, und entschied, die Situation unter Kontrolle zu bringen, solange er Gelegenheit dazu hatte. Er war allein ohne Verstärkung und hatte einen Mord aufzuklären. Er begann mit der klassischen Eröffnungsfrage, auf die man immer eine Antwort bekam, von Idioten wie von Genies: »Fällt Ihnen jemand ein, der Ihrem Vater das angetan haben könnte?«
»Nein. Niemand«, gab Henrick voller Überzeugung zurück. »Mein Vater war ein guter Mann.«
»Auch ein guter Mann hat mal Feinde. Besonders als Police Captain.«
»Kann sein, dass Pa Leuten in die Quere gekommen ist, aber was Ernstes gab es nie«, beteuerte Erich. »Alle haben ihn respektiert. Keiner, der ihn kannte, hätte das tun können.«
»Sie glauben also, es war ein Fremder?«
»Schmuggler benutzen diesen Flussabschnitt, um nach Mosambik rein- und wieder rauszukommen«, sagte Henrick. »Waffen, Schnaps, sogar kommunistische Propaganda, das ganze Zeug kommt ins Land, wenn keiner hinschaut.«
Zum ersten Mal meldete sich Johannes zu Wort: »Wir dachten, vielleicht hat Pa einen Kriminellen überrascht, der nach Südafrika reinwollte.«
»Gesindel mit Zigaretten oder Whiskey, Diebesgut von den Docks in Lorenzo Marques.« Erich nahm Henrick den Flachmann ab. »Ein Kaffer, der nichts zu verlieren hat.«
»Das grenzt die Sache nicht gerade ein«, sagte Emmanuel und spähte das Ufer entlang. Ein Stück flussaufwärts saß ein älterer Schwarzer im gefleckten Schatten eines Indonibaums, er trug einen schweren Wollmantel und eine Khakiuniform. Zwei verängstigte schwarze Jungen kuschelten sich dicht an ihn.
»Wer ist das?«, fragte er.
»Shabalala«, antwortete Henrick. »Der ist auch Polizist. Halb Zulu und halb Shangaan. Pa sagt, der Shangaan in ihm spürt jedes Tier auf, und der Zulu in ihm bringt es zur Strecke.«
Die Pretorius-Brüder lächelten versonnen in Erinnerung an den Spruch des Captains.
Dienstbeflissen trat Hansie vor. »Das sind die Jungs, die die Leiche gefunden haben, Detective. Sie haben es Shabalala erzählt, und der ist in die Stadt geradelt und hat uns verständigt.«
»Ich würde gern hören, was sie zu sagen haben.«
Hansie förderte aus seiner Brusttasche eine Trillerpfeife zutage und ließ einen schrillen Ton erklingen. »Constable Shabalala! Bringen Sie die Jungs her. Beeilung!«
Bedächtig erhob sich Shabalala zu seiner ganzen Größe von über einem Meter neunzig und kam auf sie zu. In seinem Schatten folgten die beiden Jungen. Emmanuel wurde unvermittelt klar, dass dies der Polizist sein musste, der die Kette von Eingeborenen postiert hatte, um ihn zum Tatort zu leiten.
»Schneller, Mann«, rief Hansie. »Sehen Sie das, Detective Sergeant? Da sagt man ihnen, sie sollen sich beeilen, und das ist das Ergebnis.«
Emmanuel drückte mit den Fingern auf den Knochen über seiner linken Augenhöhle, wo ein Kopfschmerz pochte. Das gleißende Licht hier draußen, ungetrübt vom Dunst der Fabriken, brannte auf seiner Netzhaut wie eine Lötlampe.
»Detective Sergeant Cooper, das ist Constable Samuel Shabalala«, stellte Hansie vor und versuchte so erwachsen wie möglich zu klingen. »Shabalala, der Detective ist den ganzen Weg aus Jo’burg gekommen, damit wir mit seiner Hilfe herausfinden, wer den Captain umgebracht hat. Seien Sie ein guter Mann und sagen Sie ihm alles, was Sie wissen, okay?«
Shabalala, ein paar Köpfe größer und ein bis zwei Jahrzehnte älter als sämtliche Weißen vor ihm, nickte und schüttelte Emmanuels ausgestreckte Hand. Sein Gesicht, glatt wie ein stiller See, verriet nichts. Emmanuel sah ihm in die dunkelbraunen Augen und erblickte nur sein eigenes Spiegelbild.
»Der Detective ist Engländer.« Henrick sprach Shabalala direkt an. »Du musst Englisch sprechen, okay?«
Emmanuel wandte sich zu den Brüdern um, die in einem Halbkreis hinter ihm standen.
»Bitte treten Sie zwanzig Schritte zurück, während ich die Jungen befrage«, sagte er. »Ich rufe Sie, wenn wir so weit sind, dass wir Ihren Pa da rausholen können.«
Henrick grunzte, und die Brüder zogen sich zurück. Emmanuel wartete, bis sie sich ein Stück entfernt aufgestellt hatten.
Er ging in die Hocke, um mit den Jungen auf Augenhöhe zu sein. »Uno bani wena?«, fragte er Shabalala.
Shabalalas Augen weiteten sich überrascht, dann hockte er sich neben Emmanuel auf Kinderhöhe und berührte nacheinander beide Jungen sanft an der Schulter. Auch er sprach Zulu, als er Emmanuels Frage beantwortete. »Dieser hier ist Vusi und das hier ist sein kleiner Bruder Butana.«
Die Jungen mochten neun und elf Jahre alt sein, sie hatten fast glatt geschorene Schädel und riesige braune Augen. Runde Bäuche wölbten sich unter den zerlumpten Hemden.
»Ich bin Emmanuel. Ich bin ein Polizist aus Jo’burg. Ihr seid tapfere Jungs. Könnt ihr mir erzählen, was passiert ist?«
Butana hob die Hand und wartete, dass man ihn drannahm.
»Yebo?«, ermunterte ihn Emmanuel.
»Bitte, Baas.« Butanas Finger bohrte sich durch ein Loch in seiner Hemdbrust. »Wir sind zum Angeln hergekommen.«
»Von wo seid ihr gekommen?«
»Vom Haus unserer Mutter in der Location«, sagte der Ältere. »Wir sind im ersten Licht des Tages gekommen, weil Baas Voster nicht mag, wenn wir hier angeln.«
»Voster sagt, die Einheimischen stehlen die Fische«, sagte Hansie, der sich dazuhockte, um nichts zu verpassen.
Emmanuel ignorierte ihn. »Wie seid ihr zum Fluss gekommen?«, fragte er.
»Über den Weg da.« An der Decke und der Laterne im Sand vorbei deutete Vusi auf einen schmalen Trampelpfad, der im grasbestandenen Veld verschwand.
»Wir kamen her und ich sah, dass da ein Weißer im Wasser lag«, sagte Butana. »Es war Captain Pretorius. Tot.«
»Was habt ihr da gemacht?«, fragte Emanuel.
»Wir sind weggerannt.« Vusi fuhr mit einer Handfläche über die andere und erzeugte ein sausendes Geräusch. »Ganz schnell. Ohne anzuhalten.«
»Nach Hause?«
»Nein, Baas.« Vusi schüttelte den Kopf. »Wir sind zum Haus des Polizisten gelaufen und haben ihm erzählt, was wir gesehen haben.«
»Um wie viel Uhr?«, fragte Emmanuel Shabalala.
»Es war nach sechs Uhr morgens«, antwortete der schwarze Polizist.
»Die wissen einfach, wie spät es ist«, half Hansie eilfertig aus. »Uhren wie unsereiner brauchen die nicht.«
Die Schwarzen in Südafrika brauchten ja so wenig. Und jeden Tag noch ein bisschen weniger, das war die allgemeine Devise. Kriminalermittler waren von den neuen Gesetzen ausgenommen, die den Kontakt zwischen Menschen verschiedener Hautfarbe verboten. Kriminalermittler gingen den Fakten nach, schrieben einen Bericht und sagten vor Gericht aus, um die Anklage zu untermauern. Ob Weißer, Schwarzer, Farbiger oder Inder – Mord war ein Kapitalverbrechen, unabhängig von der Hautfarbe des Täters.
Emmanuel wandte sich an den älteren Jungen. »Als ihr heute Morgen an den Fluss gekommen seid, hast du da etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört?«
»Das Ungewöhnliche war die Leiche vom Captain im Wasser«, sagte Vusi.
»Und du?«, fragte Emmanuel den Kleineren. »Ist dir etwas aufgefallen, das anders war als sonst? Außer dem Captain im Wasser?«
»Nein, nichts«, sagte der kleine Bruder.
»Als ihr den Toten entdeckt habt, musstet ihr da an jemanden denken, den ihr kennt und der Captain Pretorius wehgetan haben könnte?«
Angestrengt dachten die Kinder über die Frage nach.
Vusi schüttelte den Kopf. »Nein. Ich dachte nur, heute ist kein guter Tag zum Angeln.«
Emmanuel lächelte. »Es war genau richtig, dass ihr beide Constable Shabalala erzählt habt, was ihr gesehen hattet. Aus euch werden eines Tages gute Polizisten.«
Vusi warf sich stolz in die Brust, aber sein kleiner Bruder fing an zu weinen.
»Was hast du denn?«, fragte Emmanuel.
»Ich will gar kein Polizist werden, Nkosana«, sagte der Kleine. »Ich will Lehrer werden.«
Endlich hatte das Entsetzen über die Entdeckung der Leiche den kleinen Zeugen eingeholt. Shabalala legte dem weinenden Jungen eine Hand auf die Schulter und wartete auf das Signal, dass er die beiden gehen lassen konnte. Emmanuel nickte.
»Wenn du Lehrer werden willst, musst du zuerst in die Schule gehen«, sagte der schwarze Polizist und gab einem der Landarbeiter auf der Anhöhe ein Zeichen. »Musa bringt euch nach Hause.«
Shabalala führte die Kinder an den Pretorius-Brüdern vorbei zu einem Mann, der oben auf dem Pfad stand und die Jungen zu sich winkte.
Emmanuel musterte das Flussufer. Nur üppiges frühlingsgrünes Veld und weiter Himmel, wohin er auch sah. Er zog sein Notizbuch hervor und schrieb das Wort »idyllisch« hinein, weil ihm dies bei der Betrachtung des Tatorts und der Umgebung als Erstes einfiel.
Es dürfte einen Moment gegeben haben, in dem der Captain, nachdem er die Decke ausgebreitet und die Laterne angezündet hatte, über den Fluss blickte und dieser schöne Ort ihm ein Gefühl der Freude bescherte. Vielleicht hatte er sogar gerade gelächelt, als die Kugel ihn traf.
»Und?« Es war Erich, immer noch gekränkt, dass man ihn von der Vernehmung ferngehalten hatte. »Haben Sie etwas herausbekommen?«
»Nein«, sagte Emmanuel. »Nichts.«
»Der einzige Grund, warum wir Pa noch nicht nach Hause gebracht haben«, sagte Henrick, »ist, weil er gewollt hätte, dass wir uns an die Vorschriften halten …«
»Aber wenn Sie sowieso nichts rausfinden«, diesem Erich konnten jeden Moment die Sicherungen durchbrennen, »gibt es ja wohl keinen Grund, dass wir hier rumstehen wie Ameisenhaufen, statt uns um Pa zu kümmern.«
Die lange Warterei auf den Großstadtbullen, der die Tat aufnehmen sollte, hatte die Brüder zermürbt. Emmanuel ahnte, wie sie gegen den Impuls ankämpfen mussten, den Captain auf den Rücken zu drehen, damit er Luft bekam.
»Ich sehe mir noch die Decke an, danach bringen wir Ihren Vater zurück in die Stadt«, versprach er, als Shabalala wieder zu ihnen stieß. »Hepple und Shabalala, Sie bleiben bei mir.«
Sie beugten sich über die blutige Decke. Der Stoff war grau, grob und kratzig, zum Sitzen etwa so gemütlich wie ein verrostetes Eisenblech. Trotzdem kam keine Veranstaltung im Freien, kein Truck und kein Braai ohne solche Decken aus.
Blut war als rostbraune Flecken im Gewebe eingetrocknet und über den Rand in den Sand gelaufen. Tiefe Schleifspuren, an mehreren Stellen unterbrochen, führten von der Decke bis hinunter zum Wasser. Der Captain war erschossen, danach zum Fluss gezogen und ins Wasser gezerrt worden. Ein ziemlicher Kraftakt.
»Was schließen Sie daraus?« Emmanuel deutete auf den blutdurchtränkten Stoff.
»Woll’n mal sehen«, meldete sich Hansie. »Der Captain ist zum Angeln hergekommen, wie eigentlich jede Woche, und dann hat ihn jemand erschossen.«
»Ja, Hepple, so weit, so gut.« Emmanuel warf einen Blick zu Shabalala. Wenn der Captain recht behielt, mochte die Shangaan-Seite des schweigsamen Schwarzen mehr wahrnehmen als das, was an der Oberfläche lag. »Nun?«
Der schwarze Polizist zögerte.
»Sagen Sie mir, was Ihrer Ansicht nach geschehen ist«, ermunterte ihn Emmanuel, dem bewusst war, dass Shabalala nur ungern Hansies unterentwickelte Beobachtungsgabe bloßstellen wollte.
»Der Captain wurde hier auf der Decke angeschossen und dann über den Sand ins Wasser gezogen. Aber der Mörder ist nicht stark.«
»Wieso?«
»Er musste sich viele Male ausruhen.« Shabalala deutete auf die flachen Mulden im Sand, wo die Schleifspur auf dem Weg von der Decke zum Wasser unterbrochen war. »Diese Abdrücke stammen von den Stiefeln des Captains. Hier wurde seine Leiche abgesetzt. Hier war sein Kopf.«
In der Mulde lag in einer getrockneten Blutlache ein verfilztes blondes Haarbüschel. Die Mulden tauchten immer öfter auf, und die größer werdenden Blutlachen lagen jetzt dichter beieinander, weil der Mörder öfter haltgemacht hatte, um zu verschnaufen.
»Da wollte jemand ganz sichergehen, dass der Captain nicht mehr zu den Lebenden zurückkehrt«, murmelte Emmanuel. »Sind Sie sicher, dass er keine Feinde hatte?«
»Ja«, antwortete Hansie ohne Zögern. »Der Captain ist mit jedermann gut ausgekommen, sogar mit den Eingeborenen, oder, Shabalala?«
»Yebo«, bestätigte der schwarze Constable und starrte auf den Tatort, der eine andere Geschichte erzählte.
»Anderswo gibt es oft Ärger zwischen den verschiedenen Gruppen, aber bei uns nicht«, beharrte Hansie. »Das muss ein Fremder gewesen sein. Jemand von auswärts.«
Bisher hatten sie nicht viele Anhaltspunkte. Wenn es ein Verbrechen im Affekt gewesen war, hatte der Mörder vielleicht Fehler begangen: kein Alibi, die Mordwaffe an einem offensichtlichen Ort versteckt oder getrocknetes Blut an den Schnürsenkeln. Bei einem vorsätzlichen Mord hingegen konnte der Täter nur durch penible Ermittlungsarbeit gefasst werden. Ob Fremder oder Einheimischer, auf jeden Fall brauchte es Mumm, einen weißen Police Captain umzubringen.
»Durchkämmen Sie das Flussufer!«, wies Emmanuel Hansie an. »Laufen Sie bis zu dem Pfad, den die beiden Jungen hinaufgestiegen sind. Gehen Sie langsam. Wenn Sie etwas Außergewöhnliches finden, fassen Sie es nicht an. Rufen Sie mich!«
»Jawohl, Sir.« Hansie rannte los wie ein Labrador.
Emmanuel nahm noch einmal den Tatort in Augenschein. Der Mörder hatte den Captain bis ans Wasser gezogen, ohne irgendetwas fallen zu lassen.
»Hatte er Feinde?«, fragte er Shabalala.
»Die Bösen mochten ihn nicht, aber die guten Leute schon.« Das Gesicht des Mannes verriet nichts.
Emmanuel sah ihn eindringlich an. »Was ist hier Ihrer Meinung nach wirklich passiert?«
»Es hat heute Morgen geregnet. Viele Spuren sind weggespült worden.«
Emmanuel ließ sich nicht abwimmeln. »Sagen Sie es mir trotzdem.«
»Der Captain hat hier gekniet, mit Blick nach dort.« Shabalala zeigte in die Richtung, in die Hansie davongehastet war. »Die Stiefelspuren eines Mannes kommen von hinten. Eine Kugel in den Kopf, der Captain fiel nach vorn. Dann noch eine in den Rücken.«
Ein deutlicher Abdruck, die Umrisse eines Stiefels mit tiefen, geraden Profilrillen, hatte sich in den Sand gedrückt.
»Wie zum Teufel konnte der Mörder im Dunkeln einen so sicheren Schuss abgeben?«, fragte Emmanuel.
»Gestern Nacht hatten wir Vollmond, es war hell. Außerdem brannte die Laterne.«
»Wie viele Leute mag es geben, die selbst bei Tageslicht einen solchen Treffer landen könnten?«
»Viele«, antwortete der schwarze Polizist. »Die weißen Männer lernen das Schießen mit dem Gewehr in ihrem Club. Captain Pretorius und seine Söhne haben viele Preise gewonnen.« Shabalala dachte einen Moment nach. »Und Mrs. Pretorius auch.«
Wieder drückte Emmanuel gegen seine linke Augenhöhle, wo der Kopfschmerz sich meldete. Er war in einem Nest voller inzüchtiger Afrikaaner-Scharfschützen gelandet.
»Wo ist der Mörder hin, nachdem er die Leiche im Wasser hatte?«
»In den Fluss.« Shabalala trat ans Ufer und wies auf die Stelle, wo die Schleifspur des Captains und die Abdrücke des Mörders in der Strömung verschwanden.
Emmanuel spähte hinüber auf die andere Seite und entdeckte dort Binsen, deren Stängel abgeknickt waren. Dahinter verschwand ein schmaler Pfad im Veld.
»Da drüben ist er rausgekommen?« Er deutete auf die niedergetrampelten Halme.
»Ich nehme es an.«
»Wessen Farm ist das?«, fragte Emmanuel und spürte den vertrauten Adrenalinstoß der Erregung, die eine heiße Spur bei jedem neuen Fall auslöste. Vielleicht konnten sie den Mörder bis zu seiner Türschwelle verfolgen und den Fall noch heute abschließen. Mit ein bisschen Glück war er zum Wochenende wieder in Jo’burg.
»Keine Farm«, kam die Antwort. »Mosambik.«
»Sind Sie sicher, Mann?«
»Yebo. Mo-Sam-Bik.« Shabalala wiederholte den Namen langsam und deutlich, schloss jedes Missverständnis aus. Die drei Silben stellten klar, dass da drüben ein anderes Land lag, mit eigenen Gesetzen und eigener Polizei.
Eine Weile standen Emmanuel und Shabalala nebeneinander und blickten über den Fluss. Vielleicht könnten sie am anderen Ufer binnen fünf Minuten einen Hinweis finden, der zur Lösung des Falles führte. Emmanuel überschlug rasch die Lage. Wenn man ihn jenseits der Grenze erwischte, würde er die nächsten zwei Jahre damit zubringen, in den öffentlichen Toiletten für Weiße die Ausweise zu kontrollieren. Selbst der schlaue Major van Niekerk, ein gewiefter Taktiker, der über allerbeste Verbindungen verfügte, würde einen vermasselten Grenzübertritt nicht ausbügeln können.
Emmanuel wandte sich wieder der südafrikanischen Seite zu und konzentrierte sich auf die Indizien vor seiner Nase. Die fehlenden Spuren am Tatort und die wie von einem Scharfschützen abgegebenen Schüsse auf Kopf und Wirbelsäule des Opfers ließen auf eine ruhige, überlegte Vorgehensweise schließen. Auch der Fundort der Leiche schien bewusst gewählt. Warum hatte der Täter die Leiche ins Wasser gezogen, wenn er sie ebenso gut im Sand hätte liegen lassen können?
Die Schmugglertheorie der Brüder war nicht stichhaltig. Wenn es ein Schmuggler gewesen war, warum war er dann nicht einfach ein Stück weiter flussaufwärts marschiert, um aller Aufmerksamkeit und jedem Ärger zu entgehen? Und nicht nur das – warum hätte er seinen geheimen Grenzübergang auffliegen lassen sollen, indem er hier einen Mord beging?
»Ist der Mörder aus dem Fluss gekommen?«, fragte Emmanuel.
Der schwarze Polizist wiegte den Kopf. »Als ich kam, waren schon die Hirtenjungen mit ihren Ochsen zum Tränken da gewesen. Falls es Spuren gegeben hat, sind sie jetzt weg.«
»Detective Sergeant.« Hansie kam anmarschiert, das Gesicht puterrot vor Anstrengung.
»Was gefunden?«
»Nur Sand, Detective Sergeant.«
An den Pretorius-Brüdern vorbei blickte Emmanuel auf die im Fluss treibende Leiche. Ein Frühlingsregen hatte eingesetzt, sanft wie Sprühnebel.
»Lassen Sie uns den Captain bergen«, sagte Emmanuel.
»Yebo.«
Er sah einen Anflug von Traurigkeit über das Gesicht des Schwarzen huschen, doch schon im nächsten Moment war sie verschwunden.
2
Der Kaffee war heiß und schwarz und mit einem ordentlichen Schuss Brandy versetzt, der ausreichte, um den Schmerz in Emmanuels Muskeln zu betäuben. Eine volle Stunde hatte es die Männer gekostet, den Captain aus dem Fluss zu ziehen und zu bergen. Jetzt saßen sie wieder in ihren Autos, die Schultern und Beine zitterten vor Erschöpfung. Den Captain vom Tatort wegzuschaffen war kaum einfacher gewesen, als einen Sherman-Panzer aus einem Schlammloch zu ziehen.
»Koeksister?«, fragte die Gattin des alten Voster, eine froschgesichtige Frau mit lichtem grauem Haar.
»Danke.« Emmanuel nahm ein klebriges Gebäckstück und lehnte sich an den Packard.
Er beobachtete die Ansammlung von Menschen und Fahrzeugen um sich herum. Zwei schwarze Mägde gossen frischen Kaffee aus und verteilten trockene Handtücher, indessen schürte eine Gruppe Landarbeiter das Feuer für heißes Wasser und heiße Milch. Der im Rollstuhl sitzende Voster und seine Familie, ein Sohn und zwei Töchter, waren mit den Pretorius-Brüdern ins Gespräch vertieft, während zu ihren Füßen eine Rotte drahtiger Rhodesian Ridgebacks am Boden schnüffelte. Lärmend rannten schwarze und weiße Kinder gemeinsam zwischen den Wagen hin und her und spielten Verstecken. Der Captain lag, eingewickelt in saubere weiße Laken, auf der Ladefläche des geländegängigen Polizeitrucks.
Emmanuel trank den letzten Schluck Kaffee aus und trat zu den Pretorius-Brüdern. Die Ermittlung musste schleunigst in Gang kommen. Alles, was sie bislang hatten, waren eine Leiche und ein Mörder, der frei in Mosambik herumlief.
»Zeit zum Aufbruch«, sagte Emmanuel. »Wir bringen den Captain ins Krankenhaus, damit ein Arzt ihn sich anschauen kann.«
»Wir bringen ihn nach Hause«, widersprach Henrick. »Meine Ma hat lange genug gewartet.«
Die drei Brüder starrten Emmanuel an. Er spürte ihre Entschlossenheit, doch er hielt ihren Blicken stand und ließ die von Alkohol und Erschöpfung noch verstärkte Anspannung und Wut an sich abprallen.
»Wir brauchen ein medizinisches Gutachten über den Zeitpunkt und die Ursache des Todes. Und einen unterschriebenen Totenschein. Das ist Standard-Polizeiroutine.«
»Verdammt, sind Sie blind und taub?«, blaffte Erich. »Brauchen Sie einen Arzt, um zu erkennen, dass er erschossen wurde? Was für ein Ermittler sind Sie denn, Detective?«
»Ich bin die Art Ermittler, die Fälle aufklärt, Erich. Deshalb hat Major van Niekerk mich hergeschickt. Wäre es Ihnen lieber, alles ihm zu überlassen?« Er zeigte zum Feuer, wo Hansie im Schneidersitz saß, mit einem Teller Koeksisters im Schoß. Während er sich ein neues Stück aussuchte, summte er leise vor sich hin.
»Wir lassen nicht zu, dass ein Doktor unseren Vater aufschneidet wie ein Stück Vieh«, sagte Henrick. »Auch wenn seine Seele seinen Körper verlassen hat, ist er trotzdem noch ein Geschöpf Gottes. Pa hätte dem nie zugestimmt, und wir tun es auch nicht.«
Waschechte Afrikaaner und auch noch fromm. Schon an Geringerem hatten sich Kriege entzündet. Die Pretorius-Söhne wären imstande, ihren Glauben mit der Waffe zu verteidigen. Jetzt war Vorsicht geboten. Emmanuel war hier draußen auf sich allein gestellt. Eine oberflächliche Untersuchung des Leichnams war besser als gar keine.
»Keine Autopsie«, sagte er. »Nur eine Leichenbeschau, um Ursache und Zeitpunkt des Todes zu bestimmen. Damit wäre der Captain bestimmt einverstanden, da bin ich mir sicher.«
»Jaa, na gut.« Erichs Aggressivität verebbte.
Emmanuel fügte hinzu: »Sagen Sie Ihrer Ma, dass wir ihn so bald wie möglich nach Hause bringen. Constable Shabalala und ich werden gut auf ihn aufpassen.«
Henrick reichte ihm die Schlüssel des Polizeitrucks, die er in der Hosentasche des Captains gefunden hatte, als sie ihn aus dem Fluss gezogen hatten.
»Hansie und Shabalala zeigen Ihnen den Weg zum Krankenhaus und danach zum Haus meiner Eltern. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit, Detective, sonst kommen meine Brüder und ich nachsehen, wo Sie bleiben.«
***
Emmanuel warf einen Blick durch den Rückspiegel des Polizeitrucks und sah, dass Hansie ihm im Packard folgte. Auf dem Dach war Shabalalas Fahrrad festgezurrt. Hinter dem Steuer taugte der Junge was, er war reaktionsschnell und sicher. Wenn der Mörder zufällig Rennfahrer ist, dachte Emmanuel, dann bekommt Hansie womöglich zum ersten Mal Gelegenheit, sein Gehalt bei der Polizei auch wirklich zu verdienen.
Über die Piet Retief Street, die einzige geteerte Straße in der Stadt, fuhren die beiden Wagen nach Jacob’s Rest ein. Ein Stück weiter bogen sie auf einen Feldweg ab und passierten eine Reihe niedriger, in den Schatten mehrerer purpurroter Jacarandabäume geduckter Häuser. Shabalala dirigierte Emmanuel auf eine kreisrunde, mit weiß getünchten Steinen gepflasterte Einfahrt. Emmanuel stellte den Motor ab und warf einen Blick auf den Haupteingang des Grace of God-Krankenhauses.
In die hölzernen Eingangstüren waren plumpe Darstellungen von Christus am Kreuz geschnitzt. Emmanuel stieg aus dem Polizeitruck und warf einen Blick auf die verdreckte Motorhaube. Schlammbespritzt und schweißfleckig, wie sie waren, stanken sie förmlich nach Hiobsbotschaft.
»Was jetzt?«, fragte er Shabalala. Es war fast Mittag, und der Captain hinten im Truck wurde langsam gargekocht.
Die Krankenhaustüren schwangen auf, und eine riesige Dampfwalze von einer Schwarzen in Nonnentracht erschien oben an der Treppe. Neben ihr tauchte eine zweite Nonne auf, so bleich und winzig wie ein Zwerghuhn. Unter ihren Kopfbedeckungen hervor starrten sie herüber.
»Schwestern.« Emmanuel lüpfte den Hut wie ein Landstreicher, der sich in guten Manieren übt. »Ich bin Detective Sergeant Emmanuel Cooper. Der andere Polizist hier ist Ihnen sicherlich bekannt.«
»Natürlich, natürlich.« Die zierliche Nonne flatterte die Treppe herunter, gefolgt von ihrem robusten Schatten. »Ich bin Schwester Bernadette, und das ist Schwester Angelina. Bitte verzeihen Sie unsere Überraschung. Wie können wir Ihnen behilflich sein, Detective?«
»Wir haben Captain Pretorius hinten auf dem Truck …«
Die Schwestern schnappten nach Luft, und Emmanuel unterbrach sich. Als er es erneut versuchte, bemühte er sich um einen freundlicheren Ton.
»Der Captain ist –«
»Tot«, plärrte Hansie. »Er ist ermordet worden. Jemand hat ihn in den Kopf geschossen und in den Rücken … da ist ein Loch …«
»Constable.« Emmanuel legte dem Jungen schwer die Hand auf die Schulter. Unnötig, dass schon so früh Details über den Fall herausposaunt wurden. Die Stadt war klein. Die blutigen Einzelheiten würden sich bald genug herumsprechen.
»Der Herr schenke seiner Seele Frieden«, sagte Schwester Bernadette.
»Möge Gott seiner Seele gnädig sein«, fiel Schwester Angelina ein.
Emmanuel wartete, bis die beiden sich bekreuzigt hatten, dann kam er zur Sache.
»Der Arzt muss Captain Pretorius für uns untersuchen, damit Ursache und Zeitpunkt des Todes eindeutig geklärt sind. Außerdem muss er den Totenschein ausstellen.«
»Oje, oje, oje«, murmelte Schwester Bernadette leise, ihr irischer Akzent war jetzt deutlich hörbar. »Ich fürchte, wir können Ihnen nicht helfen, Detective. Der Herr Doktor ist heute Morgen zu seiner Visite aufgebrochen.«
»Wann ist er wieder zurück?« Emmanuel schätzte, dass ihm höchstens vier Stunden blieben, bevor die Pretorius-Brüder aufkreuzten und den Toten haben wollten.
»In zwei oder drei Tagen«, antwortete Schwester Bernadette. »In einem Internat bei Bremer ist Bilharziose ausgebrochen. Je nach Anzahl der Erkrankungen bleibt er vielleicht auch länger weg. Es tut mir ehrlich leid, Detective.«
Also nicht Stunden, sondern Tage. Für Emmanuels Geschmack ging es auf dem Lande eindeutig zu gemächlich zu.
»Was würden Sie tun, wenn der Captain schwer verletzt, aber noch am Leben wäre?«, fragte er.
»Sie nach Mooihoek schicken. Im dortigen Krankenhaus ist rund um die Uhr ein Arzt vor Ort.«
Das machte ihm nicht gerade Hoffnung. Die Situation war fubar, wie die Ami-Soldaten so gern sagten: fucked up beyond all recognition. Also beschissen. Er versuchte es trotzdem. »Wie lange fährt man dahin?«
»Wenn die Straße in gutem Zustand ist, knapp zwei Stunden.« Schwester Bernadette begleitete die Auskunft mit einem scheuen Lächeln und hielt Ausschau nach einem freundlicheren Gesicht oder wenigstens jemandem, der die Geografie hier kannte. »Das ist doch richtig, Constable Shabalala?«
Shabalala nickte. »So lange dauert es, wenn die Straße in Ordnung ist.«
»Und ist sie in Ordnung?«, fragte Emmanuel. Unvermittelt versprühte der Schmerz hinter seiner linken Augenhöhle rotweiße Fünkchen. Er wartete, dass irgendwer ihm eine Antwort gab.
»Bis zu ver Maaks Farm geht es«, übernahm Shabalala, als er erkannte, dass sonst niemand sprechen würde. »Ver Maak hat dem Captain neulich erzählt, dass ein Donga die Straße unterspült. Er konnte die Stelle umfahren, als er in die Stadt gekommen ist.«
Der unterspülte Straßenabschnitt war also passierbar, trotzdem würde sie das zusätzlich Zeit kosten. Ein Polizeitruck mit einem toten Polizisten fiel mit Sicherheit auf, besonders in Mooihoek, wo schon ein einziger Anruf ausreichte, um in null Komma nichts die Presse am Hals zu haben.
»Detective …« Schwester Bernadette berührte das silberne Kreuz an ihrem Hals, und Jesu scharfkantige Rippen machten ihr Mut. »Sonst gäbe es noch Mr. Zweigman.«
»Wer ist Mr. Zweigman?«
»Nur ein alter Jude«, referierte Hansie eilig. »Er hat an der Bushaltestelle einen Krämerladen. Die Kaffern und die Farbigen kaufen da ein.«
Emmanuel konzentrierte sich auf Schwester Bernadette, Gottes Taube im schwarzen Habit, die beim geringsten Geräusch davonflog. »Was ist mit Mr. Zweigman?«
Schwester Bernadette stieß den angehaltenen Atem aus. »Vor ein paar Monaten wurde ein Eingeborenenjunge überfahren, und Mr. Zweigman hat ihn am Unfallort behandelt. Später kam der Junge her, und man konnte sehen … er war von einem behandelt worden, der viel davon verstand.«
Emmanuel warf Shabalala einen Blick zu. Shabalala nickte. Die Geschichte stimmte also.
»Ist er Arzt?«
»Er sagt, er war Sanitäter in deutschen Flüchtlingslagern, aber …« Ganz fest umklammerte Schwester Bernadette ihr Kreuz und bat den Herrn um Vergebung für den Vertrauensbruch, den zu begehen sie im Begriff stand. »Ein- oder zweimal, als Dr. Kruger nicht da war, haben wir Mr. Zweigman gebeten, sich einen Patienten anzusehen. Ganz inoffiziell, Sie verstehen schon. Nur einen kurzen Blick, nichts weiter. Es wäre uns lieb, wenn der Doktor das nicht erfährt.«
»Der alte Jude ist doch kein Doktor.« Hansie sträubte sich gegen die Vorstellung. »Jeder hier weiß, dass Dr. Kruger der einzige Arzt im Distrikt ist. Was erzählen Sie da für Blödsinn?«
Schwester Angelina trat mit engelsgleichem Lächeln vor. Leicht hätte sie Hansie in ihrer riesigen schwarzen Pranke zerquetschen können, doch sie war bereit, sich vor dem aufgeblasenen Polizeibübchen klein zu machen. »Aber natürlich«, sagte sie warm. »Der einzige richtige Arzt ist Dr. Kruger, da haben Sie völlig recht, Constable. Mr. Zweigman ist eher für uns Eingeborene gut, die nicht so sorgsam medizinisch behandelt gehören. Nur für Eingeborene.«
Emmanuel wusste immer noch nicht, ob der alte Jude nun Arzt war oder ein Krämer mit Erste-Hilfe-Kenntnissen. »Shabalala.« Er winkte den Polizisten hinter den Polizeitruck, wo sie beide außer Hörweite waren. »Was halten Sie von der Sache?«
»Der Captain hat mir gesagt, wenn du krank bist, geh zum alten Juden. Der flickt dich besser zusammen als Dr. Kruger.«
Besser, nicht schlechter. Das war die Ansicht des Captains, und dies war seine Stadt. Emmanuel zog die Schlüssel zum Packard aus der Hosentasche.
***
»Hier.« Shabalala deutete auf eine Reihe Läden, die sich unter rostigen Blechdächern duckten. Jeder hatte seine Tür zur Straße hin weit geöffnet, und der mit Schlaglöchern übersäte Trampelpfad davor verstärkte den Eindruck von Schäbigkeit. Khan’s Emporium verströmte einen beißenden Geruch nach Gewürzen. Nebenan residierte Feine Spirituosen, bemannt mit zwei gelangweilten Mischlingsjungs, die davor Karten spielten. Dann kam noch Poppies General Store, der gefährlich danach aussah, als würde sein hölzernes Fundament zum leeren Nachbargrundstück hin wegrutschen.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite lag eine ausgebrannte Werkstatt mit einer angekokelten Benzinpumpe und Stapeln blasiger Autoreifen. Geduldig arbeitete sich ein schlaksiger walnussbrauner Mann durch die Trümmer, hob Ziegelsteine und verbogene Metallteile auf und warf sie in eine Schubkarre.
Eine schwarze Eingeborene lief vorbei, ihren Säugling hatte sie sich auf den Rücken geschnürt. Ein Mischling, ein kleiner »farbiger« Junge schob ein aus Draht gebasteltes Spielzeugauto den Pfad entlang. Keine Engländer oder Afrikaaner weit und breit. Sie waren nicht mehr im Afrika der Weißen.
»Der hinterste Laden gehört dem alten Juden.« Shabalala zeigte auf Poppies General Store. Emmanuel stellte den Motor ab und legte seinen Optimismus auf Eis. Eine Bruchbude auf der falschen Seite der Hautfarbengrenze war wohl kaum der passende Ort für einen studierten Mediziner, außer er hatte einen Sprung in der Schüssel oder war achtkantig aus der Ärztekammer geflogen.
Drinnen war Poppies General Store vollgestopft mit Mais in Jutesäcken, Konserven und Pökelfleisch. Emmanuel atmete den Geruch roher Baumwolle und sah am hinteren Ende einer langen hölzernen Theke ballenweise ungefärbte und gemusterte Stoffe. Hinter der Theke stand ein Männlein mit Nickelbrille und dichtem schneeweißem Haarschopf, der wie ein Ausrufezeichen von seinem Kopf abstand.
Ein Spinner, urteilte Emmanuel rasch, und der »alte Jude« war gar nicht so alt, wie er ihn sich vorgestellt hatte. Trotz seiner Haarfarbe und des gebeugten Rückens dürfte Zweigman die fünfzig kaum überschritten haben. Seine braunen Augen, aus denen er jetzt unbeteiligt die beiden schlammbespritzten Männer musterte, glänzten hell wie die einer Kuh.
»Womit kann ich Ihnen helfen, Officer?«, fragte Zweigman mit einem Akzent, den Emmanuel gut kannte. Bildungsdeutsch, transplantiert in ein holpriges, schmuckloses Englisch.
»Holen Sie Ihre medizinische Ausrüstung und Ihre Zulassung. Wir brauchen Sie im Krankenhaus.« Er klatschte seinen Dienstausweis auf die Theke, direkt vor Zweigmans Nase.
»Einen Augenblick bitte«, erwiderte Zweigman höflich und verschwand in einem Hinterzimmer, das durch einen gelb-weiß gestreiften Vorhang vom Laden abgetrennt war. Das mechanische Summen von Nähmaschinen drang heraus und erstarb plötzlich. Emmanuel hörte Stimmen, die leise und dringlich aufeinander einredeten, dann tauchte der Ladenbesitzer wieder auf, eine Arzttasche unterm Arm. Eine dunkelhaarige Frau im eleganten blauen Satinkleid, das auf die üppigen Kurven ihres Körpers maßgeschneidert war, folgte ihm dichtauf.
Der alte Jude und die Frau passten zueinander wie ein Gummistiefel zu einem Ballkleid. Zweigman sah aus wie ein x-beliebiger alter Mann hinter einer staubigen Verkaufstheke irgendwo in Südafrika, diese Frau hingegen gehörte an einen klimatisch kühleren Ort mit Perserteppichen und einem Flügel in der Ecke.
Gebetsmühlenartig wiederholte die Frau das Wort »Liebchen« und hörte erst auf, als Zweigman ihr sanft einen Finger auf den Mund legte. Die beiden standen dicht beieinander, umflort von einer solchen Traurigkeit, dass Emmanuel sich in der Defensive fühlte.
Der Kopfschmerz meldete sich wieder, glühte heiß hinter dem Augapfel. Er presste sich eine Handfläche aufs Auge, um den Schleier loszuwerden, und sah plötzlich ein Bild von seiner Ehefrau Angela vor sich, als wäre es in seine Netzhaut gestanzt. Bleich und schemenhaft rief sie aus einem dunklen Winkel der Vergangenheit nach ihm. Hatten sie beide je so vertraut beieinandergestanden wie der alte Jude und seine besorgte Frau?
»Gehen wir«, sagte Emmanuel und wandte sich zur Tür.
Das Licht draußen war von einem milchigen Weiß, durchwebt mit kleinen Staubpartikeln. Die farbigen Jungen vor dem Schnapsladen sahen auf und konzentrierten sich dann schnell wieder auf ihre Karten. Es war besser, wenn ein Polizist einfach vorbeiging, als wenn er anhielt und Fragen stellte.
Emmanuel glitt auf den Fahrersitz, ließ den Motor an und wartete, bis Zweigman sich neben ihn gesetzt hatte, die Arzttasche auf den Knien. Niemand sprach, als der Wagen sich vom Straßenrand löste und in Richtung Krankenhaus rollte.
»Wo haben Sie Ihre medizinische Ausbildung gemacht?«, fragte Emmanuel schließlich. Bevor Zweigman sich an der Leiche des Captains zu schaffen machte, ging er besser die ganze Checkliste durch.
»Am Universitätskrankenhaus Charité in Berlin.«
»Sind Sie befähigt, in Südafrika als Arzt zu praktizieren?« Kaum vorstellbar, dass die National Party ausgerechnet eine deutsche Ausbildung nicht anerkannte, selbst wenn es sich bei der betreffenden Person um einen Juden handelte.
Zweigman tippte mit einem Finger auf das harte Leder seiner Arzttasche und schien über die Frage nachzudenken.
Sie bogen von der Piet Retief Street mit ihren Geschäften nur für Weiße in die General Kruger Road ein. In Jacob’s Rest war wohl jeder Straßenname die Antwort auf eine Prüfungsfrage zur Geschichte der Buren.
»Dürfen Sie hier praktizieren?«, fragte Emmanuel nochmals.
Mit einer wegwerfenden Handbewegung tat der Krämer die Frage ab. »Ich fühle mich nicht mehr befähigt, überhaupt zu praktizieren, egal in welchem Land.«
Emmanuel ging vom Gas und machte sich bereit, den Wagen zu wenden. »Hat man Sie in Deutschland oder Südafrika aus der Ärztekammer ausgeschlossen, Dr. Zweigman?«, fragte er.
»Nein, nie. Und den Doktor können Sie sich sparen. Nennen Sie mich einfach ›alter Jude‹ wie alle anderen.«
»Das würde ich ja.« Emmanuel hielt vor dem Grace of God-Krankenhaus. »Aber so alt sind Sie gar nicht.«
»Ahhhh …«, machte Zweigman, und es klang wie vertrocknetes Pergament. »Lassen Sie sich von meiner jugendlichen Erscheinung nicht täuschen, Detective. Tief drinnen bin ich in Wahrheit der uralte Jude.«
Seltsame Formulierung, aber exzentrisches Gerede mochte einer der Gründe sein, warum dieser kauzige Kraut hier neben ihm saß statt in einer protzigen Praxis in Kapstadt oder Jo’burg.
»Ich würde Sie eher als ›sonderbarer Jude‹ bezeichnen. Das trifft es besser. Und jetzt möchte ich Ihre Papiere sehen.« Freundschaftlicher Umgang mit einem Mann, der verrückt genug war, lieber Krämer als Arzt sein zu wollen, stand auf Emmanuels Prioritätenliste ganz unten. Er wollte nur die Frage der Zulassung abhaken und dann die hämmernden Schmerzen in seinem Kopf loswerden.
Ein Sonnenstrahl traf auf den silbrigen Rand von Zweigmans Brille, als er sich vorbeugte, dadurch war Emmanuel nicht sicher, ob in den braunen Augen kurz ein Lachen aufgeblitzt war. Zweigman reichte ihm seine Papiere, die ersten waren auf Deutsch abgefasst. »Können sie Deutsch lesen, Detective?«
»Nur die Speisekarte im Brauhaus.« Emmanuel blätterte weiter zu den südafrikanischen Urkunden, las sie gründlich durch und dann gleich noch einmal. Ein Chirurg, gar ein Mitglied des Royal College of Surgeons. Es war, als fände man in einer dreckigen Socke eine Goldmünze.
Emmanuel warf Zweigman einen scharfen Blick zu, der starrte ungerührt zurück. Es musste eine einleuchtende Erklärung geben, warum dieser weißhaarige Deutsche sich in Jacob’s Rest verkroch. Das Hinterland war ideal als Versteck für einen Chirurgen mit zittrigen Händen. Sprach der gute Doktor vielleicht dem Alkohol zu?
»Nein, Detective Sergeant.« Zweigman erriet seine Gedanken. »Ich greife niemals zur Flasche.«
Achselzuckend reichte Emmanuel ihm die Papiere zurück. Zweigman war mehr als befähigt für das, was er jetzt tun sollte. Und nur das war für den Fall relevant.
***
Eine Rundhütte aus Gras und Ziegeln, weit genug vom Hauptgebäude entfernt, um eine Pufferzone zwischen Lebenden und Toten zu gewährleisten, diente als Leichenschauhaus und zugleich als Geräteschuppen.
Emmanuel blieb im Schatten eines Jacarandabaums stehen und ließ Shabalala und Zweigman vorgehen. Über einen Teppich herabgefallener Jacarandablüten schritten der gebeugt gehende Arzt und der hochgewachsene Schwarze zum Leichenschauhaus. Am Ende des Weges flößten Schwester Angelina und Schwester Bernadette einer Reihe zerlumpter Kinder Lebertran ein. Hansie schlief derweil den festen Schlaf des Dorftrottels, sein Kopf ruhte an der Tür zum Leichenschauhaus.
Das ist also meine Mannschaft, dachte Emmanuel. Er trat aus dem Schatten und sofort stach wieder der Kopfschmerz zu. Das Strohdach der Hütte blutete in den Himmel aus und ihre weißen Mauern verschwammen im Gras, sodass ihm alles vorkam wie ein mit Wasserfarben gemaltes Kinderbild. Er presste die Handfläche gegen den Augapfel, doch die verschwommene Sicht und der Schmerz blieben. Bis zum Abend dürften die Kopfschmerzen sich in einen heißen Lichtstrahl verwandeln, der das Auge komplett lahmlegte. Nach der Untersuchung des toten Captains würde er sich von den Schwestern eine dreifache Dosis Aspirin besorgen. Zwei Tabletten für sofort und eine, die er vor dem Zubettgehen mit einem Schluck Whiskey herunterspülen konnte. Wenigstens wusste er jetzt, wo der Schnapsladen war.
»Schlafen im Dienst.« Emmanuel schlug Hansie unsanft auf die Schulter. »Das könnte ich melden, Hepple.«
Hansie sprang in Habachtstellung, um seine Wachsamkeit unter Beweis zu stellen. »Ich habe gar nicht geschlafen, nur meine Augen ein bisschen ausgeruht«, beteuerte er. Dann entdeckte er Zweigman. »Was macht der denn hier? Ich dachte, Sie wollten die Söhne des Captains holen.«
»Wir haben uns verfahren.« Emmanuel stieg über Hepple hinweg und drückte die Tür zum Leichenschauhaus auf. Drinnen war es kühl und dunkel. Er warf einen Blick über die Schulter und sah Zweigman zu den Schwestern treten, die erröteten und unbehaglich wirkten in Gegenwart des Mannes, dessen Geheimnis sie preisgegeben hatten.
»Schwester Angelina und Schwester Bernadette.« Der weißhaarige Deutsche machte keinerlei Andeutung, dass die Polizei ihn quasi zwangsverpflichtet hatte. »Ob Sie mir bitte zur Hand gehen könnten?«
»Ja, Doktor«, sagte Schwester Bernadette. »Entschuldigen Sie uns kurz, wir bereiten alles vor.«
Die Schwestern brachten die Kinder ins Hauptgebäude, wo sich gleich darauf schwarze und braune Gesichter an die Fensterscheiben drückten. Der nur für Weiße bestimmte Trakt war leer. Heute Nachmittag würden die Nichtweißen ihren Besuchern etwas zu erzählen haben. »Der Captain, der große Boss Pretorius ist tot!«
»Doktor?« Hansie war jetzt hellwach und funkelte Zweigman wütend an. »Das ist der alte Jude. Der ist kein Arzt. Er verkauft Bohnen an Kaffern und Farbige.«
»Er ist befähigt, Eingeborene, Farbige und Tote zu untersuchen«, gab Emmanuel zurück und suchte Zuflucht im dämmrigen Leichenschauhaus. Das Pulsieren hinter seinem Auge ließ eine Spur nach, aber nicht genug. Als er die Untersuchungslampen einschaltete, traten Hansie und Shabalala ein und postierten sich an der Wand. Wenn die Schwestern wiederkamen, würde er sich als Erstes ein Schmerzmittel geben lassen. Ohne hatte er keine Chance, in diesem stickigen Leichenschauhaus und bei dem grellen Licht die Untersuchung durchzustehen.
Er schlug das Laken zurück und entblößte den uniformierten Körper des Captains. Zweigman sah aus, als würde er im nächsten Moment seinen Mageninhalt auf dem Betonboden verteilen. An den Knöcheln seiner Finger, die die Arzttasche umklammerten, trat das Weiße hervor.
»Waren Sie mit dem Captain befreundet?«, fragte Emmanuel.
»Wir waren miteinander bekannt.« Zweigmans Stimme klang schwächlich, der kehlige Akzent trat deutlicher zutage als vorher. »Eine Bekanntschaft, die nun, wie es scheint, ein jähes Ende gefunden hat.«
Zweigman bekam wieder Farbe im Gesicht und begann mit mechanischer Präzision einen Klapptisch abzuräumen. Hatte in seiner Bemerkung zum jähen Ende ein hauchfeiner Unterton von Befriedigung gelegen?
»Also keine Freunde«, sagte Emmanuel.
»Es gibt hier nur wenige Weiße, die mich als Freund bezeichnen würden«, sagte Zweigman, ohne sich umzudrehen. Gelassen krempelte er sich die Ärmel hoch und ließ seine Arzttasche aufschnappen.
»Wie kommt das?«
»Ich bin nicht auf einem der ersten Trekboer-Planwagen hergekommen und ich begreife nicht, wie man Rugby spielt oder auch nur warum.«
Emmanuel schirmte seine Augen vor dem grellen Licht ab, um Zweigman deutlicher zu sehen. Sein Kopfschmerz pochte hinter dem Augapfel. Zweigman hatte im Bruchteil einer Sekunde von Schock zu vollkommener Ruhe gefunden.
»Wohin damit, Doktor?« Schwester Angelina kam mit einer riesigen Schüssel heißen Wassers in ihren muskulösen Armen herein. Eine gestärkte weiße Schürze, die bis zu den Knien reichte, bedeckte jetzt ihren Nonnenhabit.
Zweigman zeigte auf den freigeräumten Klapptisch. Schwester Bernadette schleppte einen Stapel Handtücher und Lappen herein, unter dem sie fast verschwand. Wie Tänzerinnen in einem gut einstudierten Ballett bereiteten die Frauen schweigend alles vor. Zweigman schrubbte sich Hände und Unterarme und trocknete sich mit einem kleinen Handtuch ab.
»Doktor?« Schwester Bernadette hielt ihm einen weißen Arztkittel hin, auf dem in Dunkelblau der Name Kruger eingestickt war. Zweigman schlüpfte hinein und gestattete Schwester Bernadette, die Bändel am Rücken zu verknoten. Es war deutlich zu merken, dass sie schon öfter zusammengearbeitet hatten.
»Was brauchen Sie von mir?«, fragte Zweigman.
»Den Todeszeitpunkt. Die Todesursache und einen unterschriebenen Totenschein. Keine Obduktion.«
Emmanuel zückte sein Notizbuch, doch die Kopfschmerzen verwandelten seine Schrift in dunkles Geschmier.
»Detective?«
Emmanuel stellte seine Sicht scharf und sah, dass Schwester Angelina vor ihm stand, in einer Hand ein Glas Wasser und in der ausgestreckten anderen vier weiße Pillen. »Der Doktor sagt, die sollen Sie sofort nehmen.«
Er schluckte die Tabletten und spülte mit dem Wasser nach. Doppelte Dosis, so wie er es immer machte, wenn die Sehstörungen nicht besser werden wollten. Vielleicht passte »kluger Jude« als Benennung noch besser.
»Danke.«
»Keine Ursache.« Zweigman wandte sich dem Leichnam zu. Das Licht der nackten Glühbirne verlieh dem Gesicht einen geisterhaften Schimmer. »Beginnen wir mit der Kleidung.«
Schwester Angelina nahm eine Gartenschere und schnitt an der steifen Knopfleiste entlang vom Hals bis zur Taille, dann pellte sie den Stoff ab wie die Schale einer Frucht und legte den bleichen aufgedunsenen Torso des Captains frei.
Emmanuel trat näher. Solange die Sehtrübung anhielt, musste er es langsam angehen und ganz grobe Stichpunkte festhalten. Für Eindeutiges würden ein oder zwei Wörter im Notizbuch reichen müssen – zumindest bis er wieder richtig sehen konnte.
Schwer war das erste Wort, das er notierte. Die Pretorius-Brüder hatten Größe und Stärke von ihrem Vater geerbt. Der Captain war deutlich über eins achtzig mit einem von körperlicher Aktivität gestählten Körper.
»Hat der Captain noch Sport getrieben?«, fragte Emmanuel in die Runde. Die Nase des Mannes, sichtlich mehrfach gebrochen und unbeholfen wieder gerichtet, dürfte diese Spuren den schlammigen Spielfeldern verdanken, die man überall im Afrikaanerland fand.
»Er hat das Rugby-Team trainiert«, sagte Hansie.
»Und er hat Dauerlauf gemacht«, ergänzte Schwester Bernadette. »Durch die ganze Stadt ist er gelaufen und manchmal auch übers Land.«
»Jeden Tag? Immer um dieselbe Zeit?«
»Jeden Tag außer sonntags, weil das der Tag des Herrn ist.« Man hörte Schwester Bernadette ihre Bewunderung an. »Manchmal ist er morgens gelaufen, manchmal haben wir ihn vorbeilaufen sehen, wenn es längst dunkel war.«
Das war eine Erklärung dafür, warum der Captain – anders als so viele ältere Kollegen – kein Fett angesetzt hatte. Es verstieß ja geradezu gegen die Polizei-Etikette, nach mehr als zehn Dienstjahren immer noch Normalgewicht zu haben.
»Ja.« Zweigman löste einen Schnürsenkel. »Frühmorgens oder spät am Abend. Man wusste nie, wann der Captain vorbeikam. Oder wann er stehen bleiben würde, um ein bisschen nett zu plaudern.«
Emmanuel schrieb Zweigman vs. Captain? in sein Notizbuch. Er meinte in den Worten des Arztes eine Spitze wahrgenommen zu haben. Genaueres konnte er später noch herausfinden.
»Ach, ja.« Schwester Bernadette seufzte. »Der Captain machte immer bei uns halt, wenn er Zeit hatte. Sämtliche unserer kleinen Waisen kannte er mit Namen.«
»Hose.« Zweigman trat beiseite, und Schwester Angelina schnitt mit der Gartenschere ein Hosenbein nach dem anderen auf. Die oberen Knöpfe des Hosenstalls standen offen, auch die Schließe des ledernen Gürtels schien in der Strömung des Flusses aufgegangen zu sein.
»Schwester Bernadette, bitte entfernen Sie die Hose, wenn wir ihn anheben.« Er ging hinter dem Captain in Position.
»Herr Doktor, ich bitte Sie!« Schwester Angelina wedelte ihn mit einer Handbewegung beiseite und hievte allein das ganze Gewicht des Captains in Sitzhaltung, während ihre zierliche irische Kollegin die verdreckte Uniformjacke auszog und auf den Boden warf. Anschließend machten sie dasselbe mit der Hose, dann lag der Captain nackt und bleich auf der Bahre. Diskret warf Schwester Angelina ein Handtuch über die entblößten Genitalien.
»Armer Captain Pretorius.« Schwester Bernadette legte einen herunterhängenden Arm zurück auf die Bahre. »Ganz gleich, wie schlimm seine Leiche zugerichtet ist – ihn würde ich immer wiedererkennen.«
Am Körper des Mannes waren keine unveränderlichen Merkmale zu sehen. Gab es an dem nackten Captain etwas, das nur die kleine Nonne erkennen konnte?
Schwester Bernadette hob eine tote Hand hoch. »Nie, nicht ein einziges Mal habe ich ihn ohne diese Uhr gesehen. Die hat der Captain immer getragen.«
»Er hat sie nie abgelegt.« Hansie bekam feuchte Augen. »Mrs. Pretorius hat sie ihm zum vierzigsten Geburtstag geschenkt. Das Armband ist echtes Krokodilleder.«
Trotz der Schmutzschichten war die Qualität der Uhr leicht zu erkennen. Mattiertes Gold und das deutlich strukturierte Armband. Elegant. Nicht gerade ein Wort, das einem in Zusammenhang mit dem bulligen Captain oder seinen Söhnen als Erstes in den Sinn kam. Emmanuel hob die Hand an und besah sie sich näher. Über den Fingerknöcheln waren frische Prellungen. Captain Pretorius hatte erst kürzlich mit voller Kraft zugeschlagen. Auf der großen Handfläche verteilten sich einige Schwielen.
»Was für körperliche Arbeit hat der Captain verrichtet?«
»Er hat gern mit Louis an Motoren herumgeschraubt. Die beiden haben zusammen ein altes Motorrad aufgearbeitet.« Hansie schniefte.
»Das meine ich nicht«, sagte Emmanuel. Ein paar der Schwielen hatten weiche, ausgefranste Ränder wie von verheilten Blasen. Das war die Hand eines Arbeiters, der bis zu seinem letzten Tag auf Erden richtig zugepackt hatte. »Ich meine schwere körperliche Arbeit. Bei der man ins Schwitzen kommt.«
»Manchmal hat er Henrick auf der Farm ausgeholfen«, sagte Hansie leise. »Wenn das Vieh desinfiziert oder markiert werden musste, war er gern dabei, weil er selbst auf einer Farm aufgewachsen war und ihm das Landleben fehlte …«
Shabalala sagte nichts. Er hielt die Augen starr auf den Betonboden gerichtet, wo achtlos die zerschnittene Uniform des Captains lag. Falls der schwarze Polizist die Antwort kannte, war er nicht geneigt, sie mitzuteilen.
Emmanuel drehte die kalte Hand wieder um und trat zurück. Vielleicht wussten die Söhne ja etwas. Er schrieb harte Arbeit/Schwielen in sein Notizbuch. Die schwarze Zeile geriet ihm einigermaßen gerade. Die Wirkung der Pillen hatte eingesetzt.
Zweigman verschaffte sich einen ersten Überblick über die Leiche. »Schwere Verletzung am Schädel. Scheint die Eintrittswunde einer Gewehrkugel zu sein. Abschürfungen an Schultern, Ober- und Unterarmen …«
Weil der Tote weggeschleift wurde, dachte Emmanuel. Der Mörder musste fest zugepackt und wie ein Maultier gezogen haben, um bis zum Wasser zu gelangen. Wozu die ganze Mühe? Warum hatte er nicht einfach abgedrückt und war in der Nacht verschwunden?
Zweigman arbeitete sich weiter den Körper hinab und achtete auf jedes Detail. »Schwere Verletzung am Rückgrat. Offensichtlich die Eintrittswunde einer weiteren Gewehrkugel. Hämatome an den Fingerknöcheln. Blasenbildung an den Handflächen …«
Der deutsche Chirurg war ganz in seine Aufgabe versunken, sein konzentrierter Blick wirkte nahezu erfüllt. Warum verschanzte er sich bei all seiner Kompetenz hinter der Theke eines heruntergekommenen Krämerladens?
»Waschen wir den Körper«, sagte Zweigman.
Schwester Angelina wrang warmes Wasser aus einem Waschlappen und machte sich daran, die bleiche Haut abzuschrubben, resolut wie eins der Kindermädchen, die in jedem englischen und Afrikaaner-Haushalt Südafrikas anzutreffen waren. Nach über vierzig Jahren auf Erden schied der Captain genauso aus dem Leben, wie er zur Welt gekommen war: unter den kundigen Händen einer schwarzen Frau.
»Nein, nein, nein!« Schwer atmend drängte sich Hansie nach vorn. »Das wäre dem Captain nicht recht.«
»Was denn, Hepple?«, fragte Emmanuel.
»Dass eine Kaffernfrau ihn da unten anfasst. Gegen so Sachen hatte er was.«
Eine angespannte Stille trat ein, hässlich verdüstert von den Schatten der jüngsten Geschichte. Das Unsittlichkeitsgesetz, das jeden sexuellen Kontakt zwischen Weißen und Nichtweißen strikt verbot, war mittlerweile in Kraft getreten, Verstöße wurden mit öffentlicher Demütigung und Gefängnisstrafen geahndet.
»Gehen Sie nach draußen und schnappen Sie ein wenig Luft«, sagte Emmanuel. »Ich rufe Sie, wenn ich Sie brauche.«
»Bitte, Detective Sergeant. Ich will helfen.«
»Sie haben schon geholfen. Jetzt machen Sie eine Pause. Raus an die frische Luft.«
»Jaa.« Mit verkrampften Schultern schlurfte Hansie zum Ausgang. Das Bild des nackten Captains, an dem sich eine schwarze Frau zu schaffen machte, dürfte ihn eine Weile verfolgen.
Emmanuel wartete, bis die Tür wieder zu war, erst dann wandte er sich an Schwester Angelina und Zweigman, die bei dem Koller des jungen Polizisten vom Leichnam zurückgetreten waren. Ein weißes Bürschchen mit Uniform und Marke hatte fraglos mehr Autorität als ein ausländischer Jude und eine schwarze Nonne.
»Machen Sie weiter«, sagte er und versuchte, die Verlegenheit im Raum zu bezwingen. Die Stimmen der Afrikaaner hatten die National Party zur Regierungspartei gemacht. Die Rassentrennung gehörte zu Leuten wie Captain Pretorius und seinen Söhnen. Ein Detective musste sich nicht so strikt an die neuen Gesetze halten. Mord hatte keine Hautfarbe.
»Vielleicht besser so«, sagte Zweigman und murmelte den Schwestern eine Anweisung zu. Sie entfalteten ein weißes Laken und hielten es vor den Leichnam des Captains, sodass er vor Blicken von der Tür aus geschützt war. Zweigman griff nach dem Fieberthermometer, zögerte und warf Shabalala einen besorgten Blick zu.