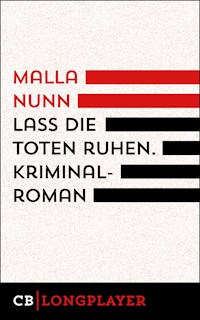19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist die Erde hart, tanzen die Frauen. Januar 1965 in Swasiland: Schulbeginn an der Keziah Christian Academy, einem Internat ausschließlich für ›Mischlinge‹. Adele Joubert ist gut darin, nicht anzuecken: immer lächeln, die Regeln befolgen, keinen Ärger machen. Doch nun kommt eine Neue aufs Internat, und Adele büßt ihren Platz in der Gruppe der privilegierten Mädchen ein. Sie muss mit der Querulantin der Schule in die Kammer der toten Lorraine ziehen, wo es spukt … Mit Hilfe der Lektüre von Jane Eyre entflieht Adele ins ferne nasskalte England, doch die Internatswirklichkeit holt sie bald wieder ein, und sie sieht sich um ihre Wahrheiten kämpfen. Bildstark, mit Drama und leisem Humor: Malla Nunn erzählt Apartheidsgeschichte aus Sicht einer Heranwachsenden. Fühlbar wird, wie Menschen die Bruchlinien in sich selbst ignorieren, um unter Druck zu überleben – und das ist nicht nur historisch relevant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Januar 1965 in Swasiland: Schulbeginn an der Keziah Christian Academy, einem Internat ausschließlich für ›Mischlinge‹. Adele Joubert ist gut darin, nicht anzuecken: immer lächeln, die Regeln befolgen, keinen Ärger machen. Doch nun kommt eine Neue aufs Internat, und Adele büßt ihren Platz in der Gruppe der privilegierten Mädchen ein. Sie muss mit der Querulantin der Schule in die Kammer der toten Lorraine ziehen, wo es spukt …
Mit Hilfe der Lektüre von Jane Eyre entflieht Adele ins ferne nasskalte England, doch die Internatswirklichkeit holt sie bald wieder ein, und sie sieht sich um ihre Wahrheiten kämpfen.
Bildstark, mit Drama und leisem Humor: Malla Nunn erzählt Apartheidsgeschichte aus Sicht einer Heranwachsenden. Fühlbar wird, wie Menschen die Bruchlinien in sich selbst ignorieren, um unter Druck zu überleben – und das ist nicht nur historisch relevant.
Über die Autorin
Malla Nunn wurde im britischen Protektorat Swasiland geboren und ging dort zur Schule. In den 1970ern emigrierte ihre Familie nach Australien, um der Apartheid zu entkommen. Malla Nunn studierte in Perth Englisch und Geschichte. Als Dokumentarfilmerin wurde sie mit Preisen geehrt, insbesondere für Servant of the Ancestors (1999). 2009 erschien ihr erster Roman, Band 1 des Krimizyklus um Detective Sergeant Emmanuel Cooper, gekürt mit zwei Edgar Award-Nominierungen und zahlreichen Preisen. Sie lebt mit ihrer Familie in Sydney.
Malla Nunn
Ist die Erde hart
Roman
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2022
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
eBook-Herstellung: CulturBooks
Printausgabe: © Argument Verlag 2022
Titel der Originalausgabe: When the Ground is Hard
Erschienen bei G. P. Putnam’s Sons, New York
© 2019 by Malla Nunn
Übersetzung: Else Laudan
Lektorat: Iris Konopik
Erscheinungsdatum: August 2022
ISBN 978-3-95988-225-5
Ist die Erde hart, tanzen die Frauen.
1 Sterbende Tage
Es ist Donnerstagabend, also gehen wir auf der Lebe-lang-Straße zur öffentlichen Telefonzelle an der Kreuzung der drei Wege namens Linker Pfad, Rechter Pfad und Mittelpfad. Der Strahl meiner Taschenlampe hüpft auf der ungepflasterten Straße voraus und kennzeichnet Unebenheiten und Schlaglöcher, davon gibt es viele. Mrs. Button, die in dem rosa Haus hinter der Autowerkstatt wohnt, sagt, alle Straßen sollten gepflastert sein wie in England, aber wir sind nicht in England – wir sind im britischen Protektorat Swasiland, ringsum eingeschlossen von Mosambik und der Republik Südafrika – also was weiß sie schon?
»Geh schneller«, drängt Mutter flüsternd. »Wir dürfen uns nicht verspäten.«
Wir eilen vorbei an Häusern aus Betonquadern mit Lichtritzen unter verschlossenen Vordertüren. Hunde bellen in umzäunten Höfen. Ein Vorhang zuckt, und durch einen handbreiten Spalt späht ein Gesicht heraus. Es gehört Miriam Dube, der Frau des Pastors, die es für ihre Pflicht hält, uns beim allwöchentlichen Pilgergang zur Telefonzelle zu bespitzeln. Es ist dunkel, aber ich stelle mir vor, dass Mrs. Dubes Miene selbstgerechte Missbilligung ausdrückt.
Mutter hält den Kopf so hoch, als trüge sie eine schwere eiserne Krone oder einen schmerzhaften Dornenkranz. Die Nachbarn sind neidisch, sagt sie. Neidische Klatschmäuler, rümpfen die Nasen über ihre hohen Absätze und ihre Kleider aus Johannesburg, die zu viel Bein zeigen. Sie wissen, dass wir im Wohnzimmer Teppichboden haben, sagt sie. Wir haben auch seit Weihnachten Fahrräder mit blitzenden Chromteilen im Hinterhof stehen und nagelneue Bata-Schuhe unterm Bett, die noch nach Fabrik riechen.
Die anderen haben Fußböden aus Beton, und wo mal ein Teppich liegt, ist er auf jeden Fall hässlich verglichen mit dem flauschigen Feld aus violetten Blumen, die unter unseren Füßen blühen, wenn wir von der Couchecke zur Küche gehen. Und darum hassen sie uns. Darum hält niemand an und nimmt uns mit, wenn sie uns am Straßenrand laufen sehen, niedergedrückt vom Gewicht unserer Einkaufstaschen. Der Manzini-Markt ist drei Meilen von unserem Haus weg, sagt Mutter. Drei Meilen über dürre Erde, gespickt mit Schlangen- und Skorpionlöchern. Ein gefährlicher Fußmarsch. Ein christlicher Mensch würde unsere Mühsal erblicken und uns mitnehmen. Aber unsere Nachbarn, die sich Christen nennen und jeden Sonntag auf den Kirchenbänken drängen, die fahren vorbei und lassen uns ihren Staub schlucken.
Die Telefonzelle taucht im Strahl meiner Taschenlampe auf: ein Rechteck aus silbernem Blech, einzementiert in die rote Erde. Rechter Pfad, Linker Pfad und Mittelpfad trennen sich hier und verschwinden in der Einöde, wo nur Gräser wuchern. Gelangweilte Kinder und Betrunkene haben an den Glaswänden ihre Initialen und Stiefelabdrücke hinterlassen, aber wie durch ein Wunder spendet die Zellenbeleuchtung immer noch ein funzliges Glimmen, das eine wirbelnde Wolke aus weißen Nachtfaltern anzieht.
Mutter steckt vier Silbermünzen in den Geldschlitz und wählt eine Nummer. Ihre Hände zittern und sie ist außer Atem, weil sie den unebenen Weg in hohen Absätzen gelaufen ist. Sie verlässt unser Haus grundsätzlich nie in flachen Sandalen oder gar, Gott bewahre, den losen Baumwollslippern der Frauen, denen Bequemlichkeit mehr bedeutet als Modebewusstsein. Die Münzen fallen, und sie formt ihren Mund zu einem Lächeln.
»Ich bin’s«, sagt sie mit einer rauchigen Stimme, die sie nur am Telefon benutzt.
Die Stimme am anderen Ende sagt etwas, das sie zum Lachen bringt, und sie wirft mir einen triumphierenden Seitenblick zu. Siehst du?, sagt ihr Blick. Ich rufe jeden Donnerstagabend an, um zu besprechen, wie es hier läuft mit dir, mir und deinem Bruder Rian, und er geht einfach so ran …
Mutter will, dass ich weiß, egal, wie die Kirchgängerinnen sie nennen, ihre Beziehung mit ihm ist etwas Besonderes. Sie hat da einen guten Mann, auf den sie sich verlassen kann, wie viele »lockere Frauen« und »Flittchen« können das bitte von sich sagen? Nicht eine. So ist das nämlich. Mutter will, glaube ich, dass ich stolz bin auf unseren wöchentlichen Gang zur Telefonzelle.
Ich zupfe einen zuckenden Nachtfalter aus meinem Haar und puste ihn in die Luft. Seine Flügel hinterlassen ein feines weißes Pulver auf meinen Fingerspitzen, und ich wische es an der Vorderseite meines Rocks ab, während Mutter leise und sanft in den Hörer spricht.
»Natürlich. Adele steht direkt neben mir.« Sie schnippt mit den Fingern, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. »Sie will unbedingt mit dir sprechen.«
Ich nehme den Hörer von ihr entgegen und sage: »Hallo … Mir geht’s gut. Wie geht es dir?«
Die Stimme erzählt mir, er ist müde, aber es tut gut, meine Stimme zu hören und die von Mutter. Ist der Rest der Weihnachtsferien noch gut verlaufen? Bin ich bereit für mein vorletztes Jahr an der Highschool, und überhaupt, Herr im Himmel, wo ist nur die Zeit geblieben? Er zahlt mein Schulgeld, also sage ich: »Ja, ja, ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Keziah Christian Academy zu gehen.« Es ist der 21. Januar, noch drei Tage bis Schulbeginn, aber meine Sachen sind schon gepackt. »Es wird toll, meine Freundinnen wiederzusehen.« Telefonierzeit ist kostbar. Ich darf keine Sekunde davon vergeuden, indem ich das miese Essen erwähne oder die scharfe Stahlkante von Mr. Newmans Lineal, das er mir über die Fingerknöchel zieht, wenn ich eine falsche Antwort gebe oder zu lange durchs Fenster des Klassenraums auf die Berge schaue. Mutter sagt: Wahre deinen Stolz, Mädchen. Niemand möchte sich deine Probleme anhören. Mach deinen Kummer mit dir selbst aus wie wir anderen auch. Sie schnippt zweimal mit den Fingern, um mir anzuzeigen, dass meine Zeit um ist.
»Bis bald, hoffe ich.« Ich überlasse ihr den Hörer und gehe beiseite, damit sie ungestört ist. Eine Wolke aus Nachtfaltern schlägt einen weißen Kreis um die Telefonzelle, andere liegen mit gebrochenen Flügeln am Boden.
Ich rupfe mir am Straßenrand einen Halm Wildgras ab und kaue auf dem süßen Ende, während Mutter Versprechungen ins Telefon raunt. Ihre rechte Hüfte und Schulter pressen sich gegen das Glas, und in diesem Augenblick, umringt von der raschelnden Savanne und unter dem niedrigen Nachthimmel, wirkt sie klein und vollkommen allein. Nur sie und die Nachtfalter, die im fahlen Licht miteinander tanzen, während die Dunkelheit alles um sie herum verschluckt.
Minuten vergehen. Sie hängt ein und schreitet über die löchrige Straße, ihre hohen Absätze klackern und ihre Hüften wiegen sich zu einer Melodie, die nur sie hören kann. Eine lose Korkenzieherlocke schwingt gegen ihre gerötete rechte Wange wie immer, wenn sie mit ihm telefoniert hat. Ich kann nicht sagen, ob es eine unbewusste Angewohnheit ist oder ob sie sich damit beruhigt, eine Haarsträhne um ihren Zeigefinger zu wickeln. Sie breitet die Arme weit aus und umarmt mich fest. Luft weicht mit einem Röcheln aus meinen Lungen.
»Er kommt«, flüstert sie mir ins Ohr.
»Wann?« Ich will ein Datum und eine Uhrzeit. Auf die eine oder andere Art ist er immer auf dem Weg. Er sagt uns, er wird in Mkuze sein, nur fünf Stunden Fahrt von uns entfernt. Oder er hat ein Geschäftstreffen in Golela vor sich, und dann ist es nur ein Sprung über die Grenze von Südafrika zu uns. Als Nächstes fährt er mit den anderen Kindern in den Kruger Park und kommt vielleicht für ein paar Stunden vorbei. Möglicherweise schafft er es. Vielleicht kommt er dieses Wochenende …
»Samstag.« Mutter ist kribbelig vor Freude. »Er will dich noch sehen, bevor du ins Internat fährst. Und er will Rian sehen. Du weißt ja, was für Sorgen er sich wegen Rians Asthma macht. Dem Fehlen in der Schule. Er sorgt sich um uns, mein Mädchen, aber du weißt ja, wie es nun mal läuft.«
Ja, ich weiß, »wie es nun mal läuft«. Ich bin Expertin für die ungeschriebenen Regeln, die über unsere Familie herrschen, und für die Grenzen, die man nicht überschreiten oder auch nur laut erwähnen darf. Ich wurde in dieses Wissen hineingeboren. Mutter erinnert mich regelmäßig daran, »wie es nun mal läuft«, damit ich nie vergesse, dass manches im Leben nicht zu ändern ist.
»Komm.« Mutter ergreift meinen Arm, und wir folgen unseren Fußspuren im Staub zurück nach Hause. Das offene Land ringsum wimmelt von Geräuschen: verhuschte Stachelschweine graben Wurzeln aus, die leisen Tapser einer Hauskatze, die im Busch kleine Kreaturen jagt, der sich hochschaukelnde Gesang einer Nachtschwalbe. Mutter summt »Oh Happy Day« vor sich hin. Früher hat sie im Kirchenchor gesungen, und sie hat auch jetzt noch eine herrliche Stimme.
Autoscheinwerfer biegen vom Mittelpfad ab, und zwei helle Strahlen beleuchten die zerklüftete Lebe-lang-Straße. Wir springen automatisch von der Straße ins hohe Gras, das am Wegrand üppig wuchert. Ein Pickup brettert vorbei, und wir bergen das Gesicht in der Armbeuge, um nicht am Staub zu ersticken. Der weiße Ford Pickup mit dem zerbeulten Kotflügel gehört Fergus Meadows, der im Haus gegenüber von unserem wohnt und vor fünf Jahren den Holzplatz seines Vaters geerbt hat.
Ein Stein prallt an mein Bein, und ich sehe eine Platzwunde. Mit weiß gepuderten Fingern wische ich das Blut weg und trete zurück auf die Straße. An dieser Stelle sagt Mutter normalerweise: Dieser Hooligan! Sein Vater würde gleich noch mal sterben, wenn er wüsste, was aus dem Jungen geworden ist. Er hat uns gesehen, zu Fuß im Dunkeln. Denk ja nicht, dass er uns nicht gesehen hat. Zwei Frauen. Allein. Und er fährt nicht mal langsamer. Stell dir das vor!
Aber heute Abend ist es anders. Statt Fergus Meadows’ Manieren zu beanstanden, schnippt sie Staub von ihrem Rock und fädelt ihren Arm durch meinen. Sie summt und lächelt den Halbmond am Himmel an. Der Nachbarschaftstratsch und die hämischen Blicke in den Gängen des neuen Hypermarkets in der Louw Street können ihr nichts anhaben. Sie ist kugelfest. Ihre Rüstung ist eine schlichte Tatsache:
Er kommt.
***
Ich liege wach, nebenan rasselt der asthmatische Atem meines kleinen Bruders, und aus der Küche dringt das harte Kratzen von Stahlwolle auf Herdoberfläche. Mutter putzt zur Vorbereitung auf den Besuch. Ein Hausmädchen kommt jeden Tag außer sonntags, aber denen ist nicht zu trauen, sagt Mutter. Sie wissen nicht, wie man mit schönen Dingen umgeht. Sie sind nachlässig, und man muss aufpassen, dass sie nicht die feinen Porzellantassen zerbrechen oder Schlieren an den Fenstern lassen.
Was wichtig ist, machst du besser selbst, sagt sie. So weißt du, dass es richtig gemacht wird. Seine Ankunft ist das Wichtigste von allem. Das Haus muss tipptopp sein, wenn er am Samstag durch die Tür kommt, also kümmert sich Mutter um jede Kleinigkeit. Sie reinigt den Herd, putzt die Böden und staubt die Porzellanengel auf der Anrichte neben der Couch ab. Morgen, am Freitag, wird sie unsere Sachen für seinen Besuch aussuchen: ein hübsches Kleid mit Riemchensandalen für mich, ein Paar Khakishorts und ein Hemd mit Kragen für Rian. Wir werden sauber und adrett aussehen, passend zum Haus.
Die Ofenklappe wird geöffnet, und das Kratz, Kratz, Kratz der Stahlwolle geht weiter. Soweit ich weiß, hat er noch nie in den Ofen geguckt oder die Schränke aufgemacht. Vielleicht tut er es ja bei diesem Besuch, also muss Mutter vorbeugen.
Ich wälze mich herum und blinzele den Aufziehwecker auf meinem Nachttisch an. Es ist zwölf Minuten vor Mitternacht.
Rian hustet und Mutter putzt, und ich denke an die Nachtfalter, die über der Telefonzelle schweben, ihre zarten Flügel schlagen die Luft bis zum Morgengrauen.
***
Sechzehn ist vier Jahre zu alt, um auf seinem Knie zu sitzen, aber als er sich in den Sessel fallen lässt, zerknittert und verschwitzt vom Fahren auf Teerstraßen und Schotterpisten und schmalen Feldwegen, um zu uns zu gelangen, tue ich genau das. Ich nehme sein rechtes Knie und Rian das linke, und wir setzen ihm gleichzeitig Küsse auf beide Wangen: ein Ritual, das es schon länger gibt, als meine Erinnerung zurückreicht. Bartstoppeln piken meine Lippen und mir geht durch den Kopf, dass er müde ist, dass er älter ist als fünf Tage vor Weihnachten, da brachte er unsere Geschenke. Er wollte die Feiertage mit uns verbringen, sagt Mutter, aber du weißt ja, wie es nun mal läuft.
»Lass dich ansehen«, sagt er zu Rian, der blass und erschöpft ist vom Asthmaanfall der letzten Nacht. »Bald bist du größer als ich.«
Das könnte stimmen. Rian ist dreizehn und schießt schnell in die Höhe, während unser Vater jedes Jahr kleiner wird, die schwarzen Haarsträhnen überwuchert von Grau. Was ihm an Muskeln und Jugend fehlt, macht er mit Köpfchen wett, sagt Mutter. Er ist Ingenieur. Er baut die Dämme, die das Wasser stauen, das die Maisfelder tränkt und die Badewannen der Leute füllt, die in der Stadt leben und vergessen haben, wie man sich im Fluss wäscht.
»Und du.« Er zwickt mich in die Wange. »Du bist noch schöner als beim letzten Mal. Ich werd mir eine Schrotflinte kaufen müssen, um die Jungs fernzuhalten.«
Die Vorstellung, dass er mit etwas anderem bewaffnet ist als einem Stift und einer Landkarte, bringt mich zum Lachen. Er liebt Bücher lesen, Scotch trinken und mit Rian im Anbau hinter der Küche Holzblockpuzzles schnitzen. Und was soll ein Gewehr nützen, wenn er doch gar nicht hier ist, um auf die gelenkigen Nachtschwärmer zu schießen, die vielleicht, eines Tages, über meinen Fenstersims krabbeln? Er lebt im fernen Johannesburg bei den anderen Kindern, die ich mir rothaarig und klug vorstelle, mit einer Haut so weiß wie Qualm. Bekannte der Familie halten sie an der Straßenecke an und staunen über die Ähnlichkeit. »Meine Güte«, sagen sie. »Ihr kommt ganz nach eurem Vater. Es ist verblüffend.«
Die anderen stehen natürlich an erster Stelle. Sie sind als »Europäer« eingestuft, und Europäer sind die Könige und Königinnen von allem. Wir sind keine Europäer. Unsere Haut hat Farbe. Unser Haar hat Locken, wenn auch nicht die Stahlwolle-Krause, durch die man kaum einen Kamm ziehen kann, und gelobt sei Gott, sagt Mutter, für diese kleine Gnade. Unsere grünen Augen leuchten zu hell in unseren braunen Gesichtern, wie um die Zusammensetzung aus weißem und schwarzem Blut zu bekräftigen, die in unseren Adern fließt.
Wenn er hier ist, erzählt er uns mit Vorliebe die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Er bei einem Arbeits-Abstecher zum Grundbuchamt in Mbabane, sie im Kartenraum beim Wegsortieren uralter Landkarten in die richtigen Fächer. Mutter in einem blauen Kleid mit Punkten, wie sie Ordnung ins Chaos bringt. Sie lächelte ihn an. Ein Lächeln wie ein Pfeil in mein Herz, sagt er. Wunderschön und ein Schock, alles auf einmal. Und wie er blitzartig erkannte: Komme, was wolle, Mutter würde Teil seines Lebens sein. Und das ist sie auch. Kein großer Teil, das vergisst er hinzuzufügen, aber ein kleines, helles Stückchen seines Lebens, versteckt in Swasiland. Wir sind eine Zugabe zu Vaters alltäglichem Dasein. Wir sind der geheime Brunnen, aus dem er trinkt, wenn sonst niemand hinschaut.
Mutter sitzt im Schneidersitz auf dem Blumenteppich und strahlt bei dem Anblick, wie wir auf seinem Schoß hocken. Sie würde die Szene in Bernstein tauchen, um sie zu konservieren, wenn sie könnte. Wir sind für einen Tag und eine Nacht zusammen, und das muss reichen bis zum nächsten Mal.
»Hast du Durst?«, fragt sie.
»Jaa … ich bin ganz ausgedörrt. Die Fahrt hat länger gedauert, als ich dachte, und diese Swasi-Straßen …« Er schüttelt den Kopf wie im Rückblick auf die hohen Gebirgspässe und gefährlichen Haarnadelkurven. »Sowie man über die Grenze kommt, fühlt man sich fünfzig Jahre zurückversetzt. Überall Kühe und Leute und mehr Schlaglöcher als Teer.«
»Hol ein Bier aus dem Eisschrank, Adele.« Mutter streicht sich eine frisch geplättete Haarsträhne hinters Ohr und setzt eine tragische Miene auf. »Daddy muss sich den Swasi-Staub aus der Kehle spülen.«
Vater lächelt über ihren ulkigen Gesichtsausdruck, wie er ihre Züge verzerrt, ohne ihre Schönheit anzutasten. Wer auch immer zuständig ist für die Kombination aus Hautfarbe, Augenfarbe und Gestalt, hat Mutter genau richtig hingekriegt. Sie ist ein Mischling, wie wir, mit goldbrauner Haut, blitzenden grünen Augen und wohlgeformten Kurven.
Ich gehe in die Küche, das Bier holen. Das Hausmädchen steht hinten im Garten und hängt meine blau karierte Schuluniform und die dazu vorgeschriebenen weißen Kniestrümpfe auf die Leine. Weiße Strümpfe weiß zu halten ist bei dem verflixten Staub und der roten Erde der Keziah Christian Academy so gut wie unmöglich. Ich stecke die Hand tief in den Eisschrank, und der Schock der kalten Flasche an meiner Handfläche reißt meine Gedanken fort von den sterbenden letzten Ferientagen. Schüsseln mit zähem Haferbrei und altbackener Toast kommen noch bald genug auf mich zu.
Ich schüttele sie ab, meine Verstimmung wegen der Rückkehr zur Schule. Er ist hier, und Schmollen ist verboten. Wenn er da ist, sind wir glücklich. Wenn er da ist, sind wir dankbar und wohlerzogen, liefern ihm gute Gründe, zurückzukommen und uns wieder zu besuchen. Du fängst mehr Fliegen mit Honig als mit Essig, sagt Mutter, und glaub ja nicht, was die Leute sagen, Fräulein. Miesepeter liebt Gesellschaft, ja, aber Miesepeter muss lernen, den Mund zu halten und sich am Riemen zu reißen.
Ich hebele den Kronenkorken mit einem Metallöffner von der Flasche, und weißer Schaum kränzt den oberen Rand. Ich trete ins Wohnzimmer, und ich denke daran, zu lächeln.
2 Die Ersten werden die Letzten sein
Wir sind spät dran. Von allen Orten und Anlässen, wo man spät dran sein kann, ist der Busbahnhof Manzini der allerschlimmste. Männer zerren Ziegen durch das Gewirr von Bussen, Frauen halten lebende Hühner mit zusammengebundenen Füßen fest. Die Frauen drängeln sich durch die Menge, die Hühner flattern und gackern. Kinder und Frauen verkaufen an Fahrgäste, die gleich in die verqualmten Busse einsteigen, gerösteten Mais, gekochte Erdnüsse und Tüten mit frittierten Fettkuchen aus Pfannen, die sie unhandlich auf den Armen balancieren. Fahrgäste kaufen auch Ananas, Mangos und Bananen aus geflochtenen Körben, die Händlerinnen auf dem Kopf tragen. Pickup-Trucks schieben sich rückwärts aus engen Lücken, laut hupend, die abgefahrenen Reifen plattgedrückt vom Gewicht der Mitfahrenden, die dichtgedrängt Schulter an Schulter auf der offenen Ladefläche hocken.
Überall ist Staub. Die violetten Köpfchen der Bougainvillea ersticken den Maschendrahtzaun vor B&B Farm Supplies: Was immer Sie brauchen, wir haben es. Roter Schmutz drückt die Blüten nieder. Eine Million in der Luft schwebender Staubpartikel fängt die frühe Morgensonne ein.
Tiere blöken, Kinder brüllen, Busschaffner rufen im Singsang ihre Routen aus. »Schnell, ganz schnell nach Johannesburg. Ohne Zwischenhalt. Bester Sitzplatz für dich, Mama.« »Ganz bequem nach Durban über Hlatikulu, Golela und Jozini. Brüder, Schwestern … alle sind willkommen.«
Wir hasten durch Staub und Lärm bis ganz ans Ende der Busreihen. Mein Herz hämmert gegen meine Rippen. Wir kommen zu spät. Alle guten Plätze sind längst belegt. Wenn mir Delia, meine beste Schulfreundin, keinen Sitzplatz freigehalten hat, muss ich in die Mitte vom Bus, wo die Unterklasseschüler in ihren schäbigen weitergereichten Klamotten sitzen, oder, noch schlimmer, ich muss durchgehen bis ganz nach hinten, wo die bettelarmen und stinkenden Schüler aufeinanderhocken wie Vieh. Ich laufe schneller, die Kante meines Koffers knallt gegen meine Knie.
»Da.« Rian zeigt auf einen klapprigen Bus mit einer verblichenen blauen Welle an der Seite.
Sämtliche Busse haben Namen. Da gibt es den Thunder Road, den True Love, den Lightning Fast und zu guter Letzt den Ocean Current, der die Schüler zu Beginn der Schulsaison an der Keziah Christian Academy abliefert und am ersten Ferientag wieder einsammelt. Es ist zwar ein öffentlicher Bus, aber heute fast komplett belegt mit Schülern des Internats, das ausschließlich für Mischlinge ist. Schwarze mit gesundem Menschenverstand warten lieber auf den nächsten Bus, der nach Süden in den verschlafenen Teil von Swasiland fährt. Sie wissen, dass Mischlingskinder nur für Weiße aufstehen.
Auf dem Papier sind wir alle Bürger des britischen Protektorats Swasiland, aber in Wirklichkeit ist unser Volk in drei strikt getrennte Gruppen aufgeteilt: Weiße, Mischlinge und Swasis. Jede Gruppe hat ihre Vereine und Clubs, ihre Schulen, ihre Traditionen und Regeln. Grenzübertritte zwischen den Gruppen sollen vorkommen, sind aber selten und Stoff für endloses Gerede an den Straßenecken und in Bellas Beautysalon für jeden Typ.
Meine schwitzigen Handflächen umklammern den Griff meines Koffers, und meine Schultern tun weh, nachdem ich das schwere Ding von der Kreuzung, wo Vater uns auf dem Rückweg nach Johannesburg abgesetzt hat, bis hierher geschleppt habe.
»Siehst du? Der Bus steht noch da.« Mutters Atem geht schnell. Sie ist verärgert, dass ich uns so gehetzt habe. »All die Aufregung wegen nichts, Adele. Wir haben reichlich Zeit.«
Ich übergebe meinen Koffer einem dünnen schwarzen Mann, der wirft ihn aufs Dach des Ocean Current, wo ein anderer dünner Schwarzer, barfuß und schweißgebadet, meine Fracht zu einem Gebirge aus Gepäck hinzufügt, das sich dort schon auftürmt. Gesichter äugen durch die staubigen Scheiben. Fieberhaft blicke ich von der ersten Reihe bis nach hinten. Ich sehe keinen freien Fensterplatz.
»Hier.« Mutter gibt mir eine kleine Pappschachtel mit Impago, speziell für lange Reisen gedachter Proviant, der mich auf der achtundachtzig Meilen langen Fahrt über die Runden bringen soll. Darin dürften hartgekochte Eier sein, Streifen aus luftgetrocknetem Rindfleisch, dicke Scheiben gebuttertes Brot, vielleicht eine Orange. Was immer der Küchenschrank gerade hergab.
Ich sage: »Entschuldige mein Gehetze.«
Der wahre Grund, warum ich uns so eilig zum Busbahnhof gescheucht habe, bleibt mein Geheimnis. Mutter ist in einer Hütte mit Lehmboden aufgewachsen, und das bettelarme Mädchen, das sie damals war, verfolgt sie immer noch: zwei Schlüpfer aus alten Mehlsäcken, die ihr die Haut aufrieben, ein kaputter Kamm mit sechs ungleichen Zähnen zum Kämmen, der tägliche Fußmarsch von der Lehmhütte zur Keziah Academy in Schuhen, die aus mehr Löchern als Leder bestanden. Sie ist nie mit dem Ocean Current zur Schule kutschiert worden, deshalb hat sie keine Ahnung, wie die Sitzordnung im Bus aussieht. Wenn sie es wüsste, würde sie mich ohrfeigen, weil ich dazu beitrage, die Kluft zwischen den reichen und den armen Schülern aufrechtzuerhalten, also sage ich ihr nichts davon.
»Sei brav.« Sie streicht mir eine Haarsträhne hinters Ohr und blinzelt Tränen weg. »Hör auf deine Lehrerinnen und sorg für gute Noten.«
»Mach ich.« Ich lasse zu, dass sie mich vor dem vollen Bus umarmt. Aus den offenen Fenstern dringt Gekicher. Umarmen ist was für Kleinkinder. Ich liebe das Gefühl, fest in den Arm genommen zu werden, aber ich passe auf, dass mein Gesicht ausdruckslos bleibt. Wenn ich meine Gefühle zeige, werde ich noch wochenlang von den tonangebenden Strolchen getriezt.
Ich löse mich aus Mutters Umarmung und will Rian durchs Haar wuscheln. Er tritt einen Schritt zurück und hält mir stattdessen die Hand hin. Schon ganz der Mann im Haus. Rians Eigenständigkeit wurmt mich, denn bei ihm wäre es sogar statthaft, vor aller Augen Zuneigung zu bekunden. Alle wissen, dass Rian schwerkrank ist. Sein letzter richtig schlimmer Asthmaanfall war voriges Jahr mitten im zweiten Quartal. Am 12. Mai. Ich habe mir das Datum gemerkt. Mr. Vincent, der weiße Ami-Direktor der Keziah Academy, fuhr uns mit aufgeblendetem Fernlicht und durchgetretenem Gaspedal über die unbefestigte Piste von der Schule zum norwegischen Krankenhaus in Mahamba. Steile Gebirgspässe stürzten rechts und links in die Dunkelheit, Steine knallten gegen die Unterseite des Wagens. Der Tod fuhr mit uns mit. Wir hörten, wie er Rian die Luft abschnürte, ihn zum Aufgeben zwingen wollte. Dazu, nicht mehr zu atmen.
Mrs. Vincent sang das Halls of the Holy-Gesangbuch von der ersten bis zur letzten Seite durch, während ich die Hand meines Bruders umklammerte und betete – nicht bloß so tat, wie in der Kirche, sondern ernstlich. Bitte, Gott. Nimm ihn nicht von uns. Nimm einen anderen Jungen. Nimm einen von den fiesen. Nimm Richard B. oder Gordon Nummer drei oder Matthew mit dem Schielauge. Bitte. Die verdienen solches Leid.
Der Arzt im norwegischen Krankenhaus sagte, Rian habe schweres Asthma – bis dahin hatten wir das, was er hatte, »die Schinderei« genannt –, und er brauche mütterliche Pflege und eine Klinik in der Nähe. Unser Haus liegt drei Meilen entfernt vom Christus-der-Erlöser-Krankenhaus, wo die katholischen Schwestern den Kranken Spritzen verpassen und verfaulte Zähne mit der Zange ziehen.
Nun bleibt Rian zu Hause und bekommt seine Lektionen per Post. Er ist sowieso zu zart, um die Schikanen der Streithammel zu verkraften, die über den Jungenschlafsaal herrschen, und insgeheim bin ich erleichtert, dass er nicht mehr mit nach Keziah kommt. Ich sage zwar, dass ich ihn in der Schule vermisse, aber für mich ist es einfacher jetzt, wo ich ihn nicht mehr vor Richard B., Gordon Nummer drei oder Matthew mit dem Schielauge in Schutz nehmen muss.
»Sei ein guter Junge für Mommy«, sage ich. »Sieh zu, dass sie nicht zu einsam ist, und lies unbedingt alle Bücher, die Daddy dir aus Johannesburg mitgebracht hat.«
»Natürlich!« Rian findet meine Ratschläge beleidigend, und eigentlich plappere ich auch nur nach, was ich Erwachsene zu Kindern sagen höre.
Der Schaffner lehnt sich aus dem Bus, mit einer Hand hält er sich an der Chromleiste über der Tür fest. Er pfeift, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. »Ocean Current nach Durban, Abfahrt jetzt, jetzt, jetzt!«
Ich klemme mir die Impago-Schachtel unter den Arm, werfe Mutter und Rian einen letzten Blick zu und klettere in den Bus. Mir ist ganz schlecht vor Anspannung, denn ich weiß, was mich erwartet, wenn ich die Stufen hochkomme: Reihe um Reihe belegte Sitzplätze bis zu den Lumpenkindern ganz hinten. Wenn Delia mir keinen Platz reserviert hat, bin ich zu vier Stunden in rauer Gesellschaft verdammt. Mit dem Geld, das Mutter mir gegeben hat, kaufe ich eine Fahrkarte und stecke das Wechselgeld ein. Es ist genug, um einmal pro Woche etwas im Schulladen zu kaufen.
Ich trete in den Gang und mustere kurz die ersten zwei Reihen. Beide sind besetzt mit schwarzen Lehrern vom Nazareth-Kreuz, einer Eingeborenenschule fünfzehn Meilen von der Academy entfernt. Mr. Vincent, unser amerikanischer Schulleiter, hat uns ermahnt, höflich zu den schwarzen Lehrern zu sein und ihnen Respekt zu erweisen. Wir tun wie geheißen, nicht weil wir glauben, dass Eingeborene uns gleichgestellt sind – das sind sie nicht –, sondern weil wir Angst haben, sonst wegen Ungezogenheit bestraft zu werden.
Ab Reihe drei starren mich Mischlingsschüler in allen Schattierungen an, von eierschalenweiß bis kohlrabenschwarz. Sie warten auf etwas, aber ich weiß noch nicht, worauf. Ich gehe los und sehe Delia in der fünften Reihe am Gang. Neben ihr ist ein leerer Sitz. Sie hat mir einen Platz freigehalten. Dem Himmel sei Dank. Ich eile auf sie zu, um mich an ihren Knien vorbeizuquetschen und den Fensterplatz zu erobern.
Schon packe ich den Haltegriff an der Lehne, dann blinzele ich verdattert, denn ein zimtbraunes Mädchen mit vaselineglänzenden Zöpfen zieht eine Tüte Pfefferminz-Kaubonbons aus der Kiste zu ihren Füßen und richtet sich in dem Sitz auf, der für mich bestimmt ist. Ich kenne sie nicht, aber ihr minzgrünes Kleid ist nagelneu und das herzförmige Medaillon um ihren Hals aus schimmerndem Silber.
»Ach.« Delia verzieht das Gesicht und gibt einen leisen entschuldigenden Laut von sich. »Tut mir leid, hey. Sandi war vor dir da. Kein Platz mehr frei.«
Lügnerin. Delia tut es kein Stück leid. Sie genießt es, mich vor einer ganzen Busladung Mitschüler abblitzen zu lassen. Sie ist das beliebteste Mädchen in meinem Jahrgang. Sie ist die, mit der alle befreundet sein wollen, und bis jetzt war sie meine Freundin. Tränen steigen mir in die Augen, aber ich kann nichts sagen, die Tränen schnüren mir auch den Hals zu.
»Das ist Sandi Cardoza.« Der Name schmiegt sich wie Samt in Delias Mund. »Sandis Eltern haben sich in Mosambik kennengelernt und geheiratet. Sie sind kurz vor Weihnachten nach Swasiland gezogen. Sandis Mutter ist Lolly Andrews, das sind die Andrews mit dem Heavenly Rest-Beerdigungsunternehmen in Manzini, und ihrem Vater, Mr. Cardoza, gehört der Hypermarket an der Louw Street. Den kennst du doch?«
Ich heuchle ein Lächeln. »Ich hab davon gehört«, sage ich.
Eine gewaltige Untertreibung. Der Hypermarket ist das neueste und das schönste Geschäft in ganz Swasiland. Es führt die allerneuste Mode aus Südafrika und hat einen richtigen Kosmetikstand. Dort will man gesehen werden, wie man Geld ausgibt. Kein Wunder, dass Delia so strahlt. Die Tochter eines portugiesischen Geschäftsmannes und einer Mischlingsfrau, deren Familie ein Beerdigungsunternehmen besitzt, ist ein großer Fang. Zusammen werden sie und Sandi die Königinnen der Schule sein.
Fallengelassen für ein reiches Mädchen mit Silberkettchen und Pfefferminz-Kaubonbons in ihrer Impago-Schachtel. Ich erröte vor Scham darüber, abgemeldet im Gang zu stehen, und drehe mich weg, um mein Gesicht zu verstecken.
***
Ich haste vorbei an neun vollen Reihen mit Schülern, deren »Manchmal-Väter« und »Immer-da-Väter« das Schulgeld im Voraus bezahlt haben. Sie tragen gute, frisch gebügelte Sachen. Ihre Koffer sind gefüllt mit neuen Schuluniformen und neuen Schuhen samt unbenutzten Schnürsenkeln. Ihre Gesichter und Fingernägel sind sauber. Sie sind die Oberliga, und der Kloß in meinem Hals macht mir das Schlucken schwer. Es ist ungerecht. Ich gehöre zu ihnen. Mein »Manchmal-Vater« ist ein weißer Ingenieur. Mein Schulgeld ist komplett bezahlt, und meine Haut duftet nach Pond’s Cold Cream und Lavendelseife.
Es nützt nichts. Die Plätze im ersten Rang sind weg. Niemand bietet an, nach hinten umzuziehen. Warum sollten sie? Ihre Spitzenposition aufzugeben, das wäre dasselbe wie ein Bekenntnis, dass sie minderwertig sind. Ich rücke vor in die zweite Klasse.
Hier tragen Schüler mit »Manchmal-Vätern« und »Immer-da-Vätern« ein Mischmasch aus weitergereichten und neuen Klamotten von unegaler Güte und Benutztheit. Ihr Schulgeld wird in Raten beglichen oder immer dann, wenn Geld übrig ist. Sie sind das Mittelfeld, und in diesem Augenblick würde ich das Leckerste aus meiner Impago-Schachtel dafür geben, mich bei ihnen niederlassen zu können.
Claire Naidoo, ein halbindisches Mädchen mit langem schwarzem Haar, um das jede Schülerin mit Krause oder schwer zu kämmendem Lockenkopf sie beneidet, zuckt die Achseln, wie um zu sagen: Bedaure. Du tust mir leid, aber ich behalte meinen Platz. Andere starren auf ihre Hände, ihre Füße, ihre Knie. Egal wohin, nur nicht zu mir. Sie schämen sich für mich. Gedemütigt durch meinen öffentlichen Rausschmiss und meinen Abstieg ins Bodenlose.
Ich erreiche die drittklassigen Plätze, wo sich mit spitzen Ellbogen und gespreizten Gliedmaßen die Schüler der untersten Kategorie lümmeln. Unter ihnen gibt es welche mit »Immer-da-Vätern«, welche mit »Manchmal-Vätern« und welche mit »vielen Vätern«, die Schulgeld bezahlen, wann und womit sie es gerade hinkriegen: eine Handvoll Münzgeld, eine Wagenladung gehacktes Holz für den Küchenherd der Schule, Gläser mit selbstgemachter Marmelade, in Maisblätter gewickelte gedämpfte Maiskuchen für den Morgentee der Lehrer.
Drittklassige Eltern haben kein Geld. Wenn sie Arbeit haben, wird sie nicht gut genug bezahlt, um das Schulgeld aufzubringen. Manche haben gar keine Arbeit. Mr. Vincent und seine Gattin beschaffen Spenden aus dem Ausland, um die Gebühren für die armen Schüler zusammenzukriegen. Ich zähle fünf in uralten Schuluniformen, andere haben Löcher im Hemd und mehrfach geflickte Shorts. Wenn wir zur Academy kommen, suchen die Missionare aus der Spendenkiste Sachen zusammen, die die armen Schüler am Wochenende anziehen können, wenn unsere Uniformen gewaschen werden.
In der dritten Klasse sind noch zwei Plätze frei, beide gleich schlimm. Einer neben Matthew mit dem Schielauge, der zu Mädchen schmutzige Sachen sagt. Ganz sicher nicht. Meine Oberschenkel wären danach voller blauer Flecke von seinen Dreckfingern und meine Ohren verseucht von versauten Anträgen auf körperliche Handlungen, von denen ich nie gehört habe und die ich nicht mal verstehe.
»Pssst … Adele.« Matthew mit dem Schielauge zwinkert mit seinem guten Auge. »Hierher, Mädchen. Du und ich können Freunde sein.«
Niemals! Niemals!
Der andere freie Sitz ist neben Lottie Diamond, die ist halb jüdisch, ein Viertel schottisch und der Rest rein Zulu. Lottie ist hellhäutig mit blauen Augen und welligen braunen Haaren, die raspelkurz abgesäbelt sind – zweifellos, um darin nistende Läuse leichter entfernen zu können. Und obwohl sie so gut wie weiß geraten ist, haust sie in einer Wellblechhütte am Rand eines Eingeborenenreservats bei Siteki und bringt ihre Ferien damit zu, Wäsche im Fluss zu waschen und mit den einheimischen Swasi herumzulungern.
Lottie ist genau die Sorte Mädchen, zu der ich höflich sein soll, wenn es nach Mutter geht, wegen ihrer eigenen ärmlichen Herkunft. Andererseits ist Delia das Oberliga-Mädchen, von dem Mutter mit ihrer ärmlichen Herkunft sich wünscht, dass ich fest mit ihr befreundet bin. Ich soll eine verbesserte Version von Mutter sein: immer nett zu den armen Schülerinnen, aber hoch angesehen bei den schnöseligen Mädchen, die ihr damals die kalte Schulter gezeigt haben.
»Hier rüber, Adele«, wispert Matthew mit dem Schielauge heiser. »Komm doch zu mir, Adele. Adele …«
Die Bartholomew-Zwillinge in ihren identischen blauen Latzröcken prusten vor Lachen über Matthews Kratzstimme. Lottie Diamond rückt einen Fingerbreit zur Seite, eine kleine Geste, die mich einlädt, mich zu setzen – oder im Gang stehen zu bleiben –, während Matthew mit dem Schielauge meinen Namen quakt wie ein Ochsenfrosch auf der Suche nach einer Gefährtin. Ich schlüpfe auf den Sitz neben Lottie. Ich bin gedemütigt und stinkwütend, weil ich vor vierzig Zeugen abserviert wurde. Ich hasse Delia, und doch möchte ich zurück an ihre Seite, wo ich hingehöre. Meine Unterlippe bebt, und Tränen brennen in meinen Augen.
Nein, ich darf nicht.
Wenn ich weine, nennen mich die anderen für den Rest des Schuljahrs Wasserfall oder Leitungsleck oder was ihnen sonst noch Geistreiches einfällt. Dann bin ich Zielscheibe für gehässige Witze, und das Gehänsel hört nie wieder auf. Lottie starrt durch das staubige Fenster nach draußen und ignoriert mein rotes Gesicht und die nassen Wimpern.
Ich ergreife die Gelegenheit, mich zu bücken und meine Impago-Schachtel zwischen meinen Füßen zu verstauen, bleibe vornübergebeugt und drücke die Augen gegen meinen Rock, bis der Stoff die Tränen aufsaugt. Mein Bauch tut weh. Alles in mir schmerzt. In Gedanken gehe ich die letzten Minuten noch einmal durch, hoffe, meine Herabstufung in die dritte Klasse beruht einfach bloß auf einem schrecklichen Missverständnis. Nein. Die Wahrheit ist ganz simpel. Delia hat mich abserviert.
Ich hätte es kommen sehen sollen. Delia will immer das Beste von allem: die hübschesten Kleider, den saftigsten Klatsch, die beliebtesten Freundinnen. Sandis reicher portugiesischer Vater liebte ihre Mutter so sehr, dass er mit ihr in die Kirche gegangen ist und vor Gott ein Versprechen abgelegt hat, mein Vater dagegen, na ja, er hat nur Mutter Versprechungen gemacht. Mutter sagt: Trag den Kopf hoch, Adele. Ich bin genauso gut wie eine kirchlich getraute Ehefrau, aber die verheirateten Frauen und ihre getauften Kinder wissen genau, dass sie was Besseres sind. Ihre Namen sind offiziell im Heiratsregister eingetragen und stehen im großen Buch des Lebens auf Gottes Nachttisch. Wenn ordentlich verheiratete Frauen Diamanten sind, dann sind die unverheirateten Nebenfrauen und ihre ungetauften Kinder Blech.
Delia hat mich gegen einen Diamanten ausgewechselt.
Jetzt sitze ich hier fest, neben einer aus dem Busch, die spuckt und flucht und sich mit Jungs und Mädchen prügelt. Lottie gewinnt alle ihre Kämpfe, aber trotzdem … es ist nicht achtbar.
»Hey.« Ein Finger tippt mir auf die Schulter, und ich werfe Lottie aus meiner gebückten Haltung einen finsteren Blick zu. Sie zeigt aus dem Fenster und ignoriert meine saure Miene, die ausdrückt: Wir sind keine Freundinnen. Wir werden nie Freundinnen sein. Dass wir nebeneinandersitzen, ist ein grässlicher Fehler. Ein Unglücksfall. Es hat auf lange Sicht keinerlei Bedeutung. Wieder tippt sie ans Fenster, nachdrücklich.
Ich richte mich auf, beuge mich über sie hinweg, blinzle in den wirbelnden Staub des Busbahnhofs Manzini. Mutter und Rian stehen auf dem ungepflasterten Weg, ihre Gestalten scharf umrissen im Gegenlicht der erstarkenden Sonne. Sie erscheinen mir unwirklich. Phantome aus einem Leben, das ich gleich für unermesslich viele Monate hinter mir lasse. Abzureisen macht mir plötzlich namenlose Angst. Ich will nicht zurück ins Internat, wo ich allein bin und mir erst noch neue Freundinnen suchen muss. Und es könnte sogar sein, dass mich niemand mehr will, nachdem mich die Oberliga-Mädchen abgeschossen haben. Am liebsten würde ich aussteigen und meinen Koffer über die Felder schleppen, bis ich wieder daheim und in Sicherheit bin.
»Warte …« Mutter zieht ein Buch aus ihrer Handtasche und läuft zum Busfenster. Auf Zehenspitzen streckt sie sich in die Höhe, um es mir zu geben. »Das hat Daddy im Auto vergessen. Es ist für dich. Extra aus Johannesburg.«
Ich greife durchs offene Fenster nach dem Buch und werfe einen Blick auf den Titel: Jane Eyre von Charlotte Brontë. Das Buch ist dick, was gut ist. Bei dicken Büchern dauert es länger, sie zu lesen. Dicke Bücher füllen die Zeit zwischen Unterricht und Abendessen aus, und die langen Stunden am Sonntagnachmittag vergehen wie im Flug. Bücher sind besser als Tratsch, auch wenn Delia das anders sieht.
Mutter sagt: »Sei brav, Adele.«
Ich zwinge mich zu lächeln und sage: »Natürlich.«
Ich bin immer brav – höflich zu Lehrern, besonnen im Umgang mit anderen Schülern und in der Kirche nichts als »Halleluja, lobet den Herrn«. Darum ist das, was mir gerade widerfahren ist, ja so ungerecht. Wenn es einen Gott gäbe, dann säße ich ganz vorn im Bus, wo ich hingehöre. Mutter hat schon recht. Gott hat zu viel zu tun, um die Nöte von einem Haufen Mischlinge in einem kleinen afrikanischen Binnenland zu bemerken. Die eigentlichen Götter, sagt sie, sind die weißen Männer in England, die Linien auf Landkarten ziehen und Gesetze verfassen, die vorschreiben: Geh hierhin, aber geh nicht dorthin.
Rian tritt näher. Er versteht genau, was mir gerade zugestoßen ist. Er sieht es in meinem Gesicht, hört es in Delias fernem Gekicher, merkt es daran, wie niemand im Bus mich anguckt.
»Mach dir nichts draus, Adele«, sagt er. »Sie ist es nicht wert.«
»Danke«, sage ich leise.
Mutter wirft mir einen Kuss zu, als der Ocean Current mit einem Ruck losrumpelt und zu einer Kolonne aus Bussen stößt, die sich Richtung Hauptstraße windet. Ich recke den Hals aus dem Fenster, um sie und Rian so lange wie möglich im Blick zu behalten. Sie werden immer kleiner. Der Ocean Current biegt auf die Straße nach Süden ein, und die Flut aussteigender Passagiere und Pickup-Trucks verschluckt Rian und Mutter.
»Wette, das fühlt sich toll an, was, Lottie?« Matthew mit dem Schielauge gackert. »Nimm einen Happs, solang es noch geht.«
Mir wird bewusst, dass ich mich weit über Lottie beuge und ihr meine Brüste fast ins Gesicht drücke. Wir berühren uns zwar nicht, aber es ist klar, wonach es aussieht. Lottie starrt aus dem Fenster auf die Eingeborenenfrauen, die auf den Feldern Gras schneiden, und ignoriert Matthew. Sie wird nicht mal rot bei seinen Worten. Fast als hätte sie um sich herum einen Schutzwall, den weder schlimme Wörter noch grobe Hände durchdringen können.
3 Die Straße nach Keziah
Die Fahrt verläuft langsam und öde. Langsam, weil die unbefestigte Straße eine von Schlaglöchern zerfressene Waschbrettpiste ist, auf der die Reifen des Ocean Current mit zwanzig Meilen pro Stunde dahinschlottern und -hüpfen. Außerdem haben Kühe Vorrang, also muss der Bus dauernd anhalten und wieder losfahren und hinter trägen Herden von langhörnigen einheimischen Rindern hertuckern, die von einem Grasflicken zum nächsten ziehen.