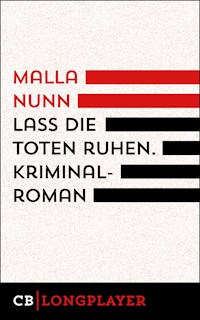
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Band 2 des Zyklus um Detective Sergeant Emmanuel Cooper. Durban 1953: In der großen Hafenstadt blüht das Verbrechen. Emmanuel Cooper schuftet tagsüber auf der Werft und arbeitet nachts undercover für seinen alten Boss. Dann stolpert er am Güterbahnhof über eine Leiche und weigert sich wegzusehen. Doch ihn trügt sein Gefühl, dass er nichts mehr zu verlieren hat … »Drogenbosse, Zuhälter, korrupte Polizisten, indische Kleinkriminelle, gestrandete Deutsche beherrschen die Szene. Ein Schmöker, ein packender Krimi!« Denis Scheck, Druckfrisch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Cooper 2 – Intrigen in Durban
Durban 1953: In der großen Hafenstadt blüht das Verbrechen. Emmanuel Cooper schuftet tagsüber auf der Werft und arbeitet nachts undercover für seinen alten Boss. Dann stolpert er am Güterbahnhof über eine Leiche und weigert sich wegzusehen. Doch ihn trügt sein Gefühl, dass er nichts mehr zu verlieren hat …
»Drogenbosse, Zuhälter, korrupte Polizisten, indische Kleinkriminelle, gestrandete Deutsche beherrschen die Szene. Ein Schmöker, ein packender Krimi!« Denis Scheck, Druckfrisch
Über die Autorin
Malla Nunn wurde in Swasiland geboren. In den 1970ern emigrierte ihre Familie nach Australien, um der Apartheid zu entgehen. Malla Nunn studierte Englisch, Geschichte, Theaterwissenschaften und schuf als Drehbuchautorin drei preisgekrönte Dokumentarfilme, darunter Servant of The Ancestors. Malla Nunn lebt und arbeitet in Sydney.
Malla Nunn
Lass die Toten ruhn
Kriminalroman
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2022
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
eBook-Herstellung: CulturBooks
Printausgabe: © Argument Verlag 2022
Titel der Originalausgabe: Let the Dead lie
© 2010 by Malla Nunn
Deutschsprachige Neufassung von Else Laudan
auf Grundlage der Übersetzung von Armin Gontermann
Die deutsche Erstausgabe erschien 2011 bei Rütten & Loening, Berlin.
Rütten & Loening ist eine Marke der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG.
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2011
(für die deutsche Übersetzung von A. Gontermann)
Erscheinungsdatum: August 2022
ISBN 978-3-95988-226-2
Für meine Eltern
Vorbemerkung von Else Laudan
Lass die Toten ruhen ist Band 2 in Malla Nunns Krimizyklus um Mordermittlungen in der Apartheid. Emmanuel Cooper verliert seinen Dienstrang, seinen Beruf und seinen »Europäer«-Status. Das schleudert ihn in eine andere Realität. »Weiß« zu sein ist ihm mit den Jahren ebenso in Fleisch und Blut übergegangen wie Polizist zu sein. Doch der erzwungene Perspektivwechsel hält ihn nicht davon ab, sich einzumischen – und von Mächtigeren benutzt zu werden.
Der Emmanuel-Cooper-Zyklus verbindet den Reiz historischer Romane mit exzellenter Kriminalliteratur und zeigt das Alltagsgesicht der Apartheid. Immer neue Segregationsgesetze verstärken die soziale und ökonomische Kluft zwischen Nachkommen europäischer Kolonialherren und eingeborenen sowie eingewanderten »Nichtweißen«. Erkennbar wird, wie das sich von Ungleichheit nährende System Alltag und Entscheidungen Einzelner beherrscht, von Lügen und kleinen Fehltritten bis zu großen Verbrechen.
Band 1 und 2 von Malla Nunns Edgar-nominierter Krimireihe über die südafrikanische Apartheid waren lange vergriffen und werden jetzt (in redigierter, erstmals werktreuer Neufassung) nachträglich ins Ariadne-Programm eingereiht, wo bereits Band 3 und 4 erschienen sind. Diese Bücher sind ›Fenster zur Welt‹, epische Spannungsromane mit intensiven Bildern: Literatur, die den Horizont weitet und der Vorstellungskraft auf die Sprünge hilft.
Else Laudan
Ein kurzes Glossar befindet sich am Ende des Buchs.
Prolog Paris, Frankreich, April 1945
Ein blinkendes Neonschild erhellte die schmale kopfsteingepflasterte Gasse. Die Regenschauer, die am Nachmittag über den Tuilerien und dem Boulevard Saint-Germain niedergegangen waren, hatten den Frühlingsabend abgekühlt, doch aus den Soldatenbars waberte die Hitze. Der Geruch von schwitzenden Leibern, verschüttetem Schnaps, Zigarettenqualm und Parfüm durchtränkte die Luft. Emmanuel war froh, dem Gedränge entronnen zu sein. Gerade betrat eine Gruppe schwarzer GIs einen Souterrain-Klub an der Ecke der Rue Véron, und eine Jazztrompete schmetterte in die Nacht hinaus. Entspannt schlenderte er durch die schlüpfrige Gasse, begleitet von drei kichernden Stenografinnen sowie Hugh Langton, Kriegsreporter der BBC mit erstklassigen Schwarzmarktbeziehungen.
»Da vorne ist es«, verkündete Langton. »Zwei Doppelzimmer im vierten Stock. Die paar Treppen machen euch doch nichts aus, Mädels?«
Fünf Tage Fronturlaub, danach zurück zu Drill und Dosenfleisch und der endlosen Parade zerstörter Städte. Ihm blieben fünf Tage, um zu vergessen. Fünf Tage, um die Bilder von zerschossenen Kirchen und Menschen mit neuen Erinnerungen zu überdecken. Die Dunkelhaarige des Trios schmiegte sich enger an ihn und drückte ihm einen heißen Kuss in den Nacken. Emmanuel ging schneller, gierte nach dem Gefühl von Haut auf Haut. Das blinkende Hotelschild warf Licht in einen Hauseingang ein paar Schritte weiter. Entblößte Beine, bleich und regenbesprenkelt, ragten auf die Straße hinaus. Im Halbdunkel der Nische war ein zerrissener Rock zu erkennen und eine offene Geldbörse.
»Mon Dieu …« Die Dunkelhaarige presste die schlanken Finger vor den Mund. »Regardez! Regardez!«
Emmanuel löste den Arm von ihrer Schulter und trat näher. Ein weiteres Neonblinken erhellte den gedrungenen, an einer Tür lehnenden Körper einer Frau. Im Aufschlag der schmuddeligen Jacke war ein blutiges Loch, typisch kleinkalibrige Eintrittswunde. Die offenen starren Augen und der schlaffe Unterkiefer ließen an eine Reisende denken, die den letzten Zug verpasst hat und die Nacht im Freien verbringen muss. Mehr der Form halber prüfte Emmanuel den Puls.
»Sie ist tot.«
»Dann können wir ja nichts mehr tun.« Langton drängte die Stenografinnen zum Hotel Oasis. Dieser kleine Zwischenfall könnte ernsthaft die Stimmung verderben. »Ich sorge dafür, dass die Concierge die Polizei ruft.«
»Geht schon vor«, sagte Emmanuel. »Ich treibe einen Gendarmen auf und komme nach.«
Langton nahm Emmanuel beiseite. »Ich muss auf das Offensichtliche hinweisen, falls du es nicht gemerkt hast, Cooper. Dort: tote Frau, hier: lebendige Frauen … Mehrzahl. Komm, nichts wie weg, Mann.«
Emmanuel hielt die Stellung. Ein Tornister voll Marschverpflegung und ein Hotelzimmer mit Seife und frischen Handtüchern, das hieß, die Stenografinnen würden warten. Der kalte Pragmatismus des Krieges.
»Okay, okay.« Der Engländer führte die Frauen auf das flackernde Neon zu. »Bleib nicht die ganze Nacht hier draußen. Im Feld kriegst du noch genug Tote.«
Das stimmte, aber es ging nicht an, eine Leiche einfach liegen zu lassen in einer Stadt, wo Recht und Ordnung wiederhergestellt waren. Emmanuel trieb einen stämmigen Polizisten auf, der sich unter einem Kirschbaum eine Zigarette gönnte, und eine Stunde später erschien am Tatort ein Kriminalermittler mit Halbglatze, stattlicher Adlernase und traurigen braunen Augen. Er spähte in den Hauseingang.
»Das ist Simone Betancourt.« Dem ausländischen Soldaten zuliebe sprach er Englisch mit starkem Akzent. Die meisten Fälle, bei denen Alliierte im Spiel waren, wurden der Handvoll zweisprachiger Polizisten übertragen. »Zweiundfünfzig Jahre alt. Gemeldeter Beruf: Waschfrau.«
»Sie kennen sie?«, fragte Emmanuel.
»Sie hat die Wäsche für die Polizeiwache gemacht und für viele kleine Pensionen hier. Ich kannte sie.« Er streckte Emmanuel die Hand entgegen. »Inspecteur Principal Luc Moreau. Sie haben die Leiche entdeckt?«
»Ja.«
»Ihr Name bitte.«
»Major Emmanuel Cooper.«
»Und Sie waren wohin unterwegs?«
»Zu dem Hotel da vorn.« Das war dem französischen Cop sicher auch schon klar.
»Zuletzt geregnet hat es …« Moreau sah auf eine goldene Armbanduhr. »Vor ungefähr zwei Stunden. Also liegt Simone schon länger hier. Zweifellos haben auch andere die Leiche gesehen. Und nichts unternommen. Warum haben Sie die Polizei alarmiert und so lange hier am Tatort gewartet, Major?«
Emmanuel zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht genau.« Zur Kulisse des Krieges gehörten auch die Toten. Soldaten und Zivilisten, Junge und Alte wurden stillschweigend auf dem Schlachtfeld und in den Trümmern liegen gelassen. Aber diese Wäscherin hatte Erinnerungen an eine andere wehrlose Frau wiederbelebt, die vor langer Zeit im Stich gelassen worden war. »Es kam mir falsch vor, sie da liegen zu lassen.«
Moreau lächelte und wickelte einen Streifen Kaugummi aus, eine von der amerikanischen Militärpolizei übernommene Angewohnheit. »Selbst im Krieg ist Mord obszön, nicht wahr, Major?«
»Mag sein.« Emmanuel warf einen Blick in Richtung Hotel. Dass er haltgemacht und den Tod von Simone Betancourt gemeldet hatte, würde weder Justizias Waage ins Gleichgewicht bringen noch die Erinnerung an gefallene Freunde dämpfen. Und doch war er geblieben. Die Nacht hatte sich abgekühlt. Himmel, er könnte längst mit einer Stenografin im Bett sein.
»Tun Sie mir einen Gefallen.« Moreau kritzelte etwas auf eine Seite seines Notizbuchs und riss sie heraus. »Gehen Sie jetzt zu Ihrer Dame. Trinken Sie. Essen Sie. Machen Sie Liebe. Schlafen Sie. Und wenn Sie morgen immer noch an Simone Betancourt denken, rufen Sie mich bitte an.«
»Wozu?« Emmanuel steckte das zerknitterte Stück Papier ein.
»Wenn Sie anrufen, erkläre ich es.«
***
Ferne Kirchenglocken schlugen elf Uhr. Mit trockenem Mund und entspannten Gliedern erwachte Emmanuel im zerwühlten Bett. Die dunkelhaarige Stenografin, Justine aus Cergy, stand nackt am Fenster und verschlang einen Riegel Schokolade aus der Marschverpflegung. In der Frühlingssonne, die grell durch die Scheibe schien, sah ihr Körper vollkommen aus. Auf dem Tisch standen eine Kanne Schwarzmarktkaffee und Croissants. Justine stieg wieder ins Bett, und Emmanuel vergaß Krieg und Unrecht und Angst.
Als er zum zweiten Mal erwachte, schlief Justine. Er betrachtete ihr friedliches Gesicht, wie das eines Kindes. Alles, was es zum Glücklichsein brauchte, war hier in diesem Zimmer. Und doch schlich sich Traurigkeit an. Er schlüpfte aus dem Bett und trat ans Fenster. Direkt unter dem maroden gusseisernen Balkon lag die Gasse, wo Simone Betancourt im Regen gestorben war.
Dass ein Leben so leicht ausgelöscht werden konnte, ohne Bedenken oder Rechenschaft, diese Lektion hatte Emmanuel als Kind gelernt. Eine Kompanie Soldaten durch den Krieg zu führen bestätigte nur, dass nichts heilig oder kostbar war. Schon seltsam, wie ihm trotz vier Jahren Ausbildung und Fronteinsatz immer noch die Erinnerung an den Tod seiner Mutter auflauerte und die Gegenwart unsicher machte.
Emmanuel holte die Telefonnummer des Ermittlers hervor und strich das Papier glatt. Er würde Inspecteur Luc Moreau anrufen, obwohl ihn das verstörende Gefühl beschlich, dass es andersherum war: Er war es, der gerufen wurde.
1 Durban, Südafrika, 28. Mai 1953
Die Auffahrt zum Güterbahnhof war ein dunkler Rachen voll verdreckter Güterwaggons und silbriger Gleisfäden. Ein paar weiße Prostituierte kreisten um eine matte Straßenlaterne. Indische und farbige Strichmädchen hielten sich im Schatten, abseits der Laufkundschaft und der Polizei.
Emmanuel Cooper überquerte die Point Road und betrat den Güterbahnhof. Die Prostituierten starrten ihn an, und die dreisteste von ihnen, eine dicke Rothaarige mit einem zerfressenen Fuchspelz um die Schultern, hob ihren Rock und entblößte einen Schenkel im schwarzen Netzstrumpf.
»Schätzchen«, grölte sie, »willst du kaufen oder nur gucken?«
Emmanuel verdrückte sich ins Labyrinth der Industrieanlagen. Sah er so verzweifelt aus? Aus dem Hafen von Durban wehten salzige Luft und Kohlenstaub heran, die Lichter eines Kreuzfahrtschiffs schimmerten über das Wasser. Feststehende Brückenkräne ragten über der Kolonne der Güterwaggons auf, und ein heller Halbmond beschien den steinigen Boden. Er ging weiter zur Mitte des Güterbahnhofs, folgte einem inzwischen vertrauten Pfad. Er war müde, nicht nur wegen der späten Stunde. Nach Mitternacht die Docks zu durchkämmen war schlimmer, als Streifenpolizist zu sein. Die hatten wenigstens einen greifbaren Auftrag: dem Gesetz Geltung verschaffen. Sein Job bestand darin, eine nervtötende Routine von Handgreiflichkeiten, Prostitution und Diebstahl zu beobachten und nichts zu unternehmen.
Er stieg über eine schwere Kupplung und ließ sich in der Lücke zwischen zwei Waggons nieder. Bald würde eine Ameisenstraße von Lastwagen vom Hof rollen, randvoll beladen mit Whiskey, Feinschnitttabak und Kisten mit Eau de Cologne. Engländer, Afrikaaner, Streifen-, Kriminal- und Bahnpolizei – der organisierte Schmuggel war ein perfektes Beispiel dafür, wie gut unterschiedliche Behörden zusammenarbeiten und sich koordinieren konnten, wenn sie denn ein gemeinsames Ziel verfolgten.
Er schlug das Observationsbuch auf. Die blass linierten Seiten waren in vier Spalten unterteilt: Namen, Zeiten, Nummernschilder und Beschreibungen des Diebesguts. Bis zu diesen kalten Nächten auf dem Güterbahnhof hatte er die öde Warterei auf die Landung in der Normandie für den Gipfel des Stumpfsinns gehalten. Die Unruhe und Angst der zusammengepferchten Truppen, das fade Essen und der Latrinengestank – all das hatte er ohne Murren ertragen. Die Unannehmlichkeiten unterschieden sich nicht wesentlich von dem, was er in den Elendsbaracken aus Wellblech und Beton erlebt hatte, als seine Familie in den Slums bei Jo’burg hauste.
Was dieser Observation korrupter Polizisten leider abging, war die moralische Gewissheit der D-Day-Invasion. Es war völlig unklar, was Major van Niekerk, sein früherer Chef bei der Kriminalpolizei am Marshall Square, mit den Informationen in dem Observationsbuch vorhatte.
»O Gott. O mein Gott …« Der Wind wehte ein Aufstöhnen über den Güterbahnhof. Manche von den billigeren Strichmädchen nutzten nach Einbruch der Dämmerung die leeren Güterwaggons.
»Oh nein …« Diesmal klang die Männerstimme laut und angsterfüllt.
Emmanuel stellten sich die Nackenhaare auf. Es drängte ihn, der Sache nachzugehen, doch er widerstand. Seine Aufgabe war es, die Aktivitäten des Schmugglerrings zu beobachten und zu dokumentieren, nicht einen betrunkenen Walfänger zu retten, der sich auf den Güterbahnhof verirrt hatte. Sie mischen sich auf keinen Fall ein. Was das betraf, war Major van Niekerk sehr deutlich gewesen.
Das leise Rauschen des Verkehrs auf der Point Road mischte sich jetzt mit unartikuliertem Schluchzen. Sein Instinkt zog Emmanuel dorthin. Er zögerte, schob dann das Observationsbuch in die Hosentasche. Zehn Minuten, um nachzusehen, dann wäre er zurück, um die Nummernschilder der Laster zu notieren. Allenfalls zwanzig Minuten. Er zückte eine silberne Taschenlampe, knipste sie an und lief auf die Lagerhallen am nordöstlichen Ende des Güterbahnhofs zu.
Das Schluchzen ließ plötzlich nach und klang gedämpft. Vielleicht von einer Hand vor einem Gesicht? Emmanuel blieb stehen und versuchte das Geräusch zu lokalisieren. Das Gelände war riesig, viele Kilometer Gleise liefen über die gesamte Länge des Industriehafens. Unter seinen Schuhen knirschte lockerer Schotter, das Weinen kam von vor ihm. Emmanuel stellte die Lampe auf Fernlicht und lief schneller. Zuckend erhellten sich Ausschnitte der Welt. Gespenstische Reihen abgestellter Güterwagen, Schleppketten, schmutzig verrußte Backsteinmauern und eine kleine Hintergasse, in der leere Jutesäcke herumlagen. Dann ein dunkles Rinnsal Blut wie ein Fragezeichen im Dreck.
»Nein …«
Emmanuel schwang die Lampe in Richtung der Stimme und erfasste im grellen Lichtstrahl zwei Inder. Beide waren jung mit dunklen, nach hinten gefetteten Haaren bis zu den Schultern. Sie trugen weiße Seidenhemden und fast gleiche Anzüge aus silbrigem Chintz. Der eine, ein schmächtiger Teenager mit tränenüberströmtem Gesicht, hockte gekrümmt an der Rückwand des Lagerhauses. Der andere, Anfang zwanzig mit Errol-Flynn-Schnurrbart, runzelte drohend die wulstige Stirn. Er beugte sich über den Jungen und hielt ihm den Mund zu, um ihn zum Schweigen zu bringen.
»Keine Bewegung.« Emmanuel sprach im Kriminalpolizei-Ton. Er langte nach seinem Webley-Revolver Kaliber .38 und griff ins Leere, wie ein Kriegsveteran ein Phantomglied zu fassen versucht. Die gefährlichste Waffe, die er bei sich hatte, war ein Stift. Egal. Die Waffe war eh nur zur Verstärkung.
»Lauf!«, schrie der Ältere. »Los!«
Die Männer rannten in verschiedene Richtungen davon, und Emmanuel nahm den kleineren aufs Korn, der stolperte und hinschlug. Emmanuel erwischte einen Ärmel und drückte den Jugendlichen gegen die Mauer.
»Wenn du noch mal wegläufst, breche ich dir den Arm«, sagte er. Eine Zugkupplung dröhnte. Der Ältere war noch in der Nähe. Emmanuel lehnte sich Schulter an Schulter neben den Jungen und wartete ab.
»Parthiv«, rief der Junge schniefend, »lass mich nicht allein.«
»Amal«, rief eine Stimme zurück. »Wo bist du?«
»Hier. Er hat mich erwischt.«
»Was?«
»Ich habe Amal«, rief Emmanuel. »Komm lieber her und leiste ihm Gesellschaft.«
Mit wiegendem Gangsterschritt tauchte der Mann aus der Dunkelheit auf. Ein Goldkettchen ergänzte seinen silbrigen Anzug, und an seinem Zeigefinger hing schwer ein ziselierter Ring mit einem dicken lila Topas.
»Und wer zum Teufel sind Sie?«, fragte der Kleinganove.
Emmanuel entspannte sich. Möchtegernschläger wie den hatte er früher in Jo’burg jeden Tag mattgesetzt. Damals, vor dem Drama in Jacob’s Rest.
»Ich bin Detective Sergeant Emmanuel Cooper«, sagte er.
Jetzt, wo die National Party das Sagen hatte, war die Polizei die mächtigste Gangsterbande Südafrikas. Die Harter-Bursche-Nummer des Inders löste sich prompt in Luft auf.
»Namen«, verlangte Emmanuel, als beide vor ihm an der Wand lehnten. Um das Problem, dass er hier weder zuständig noch ermächtigt war, würde er sich später kümmern.
»Dr. Jekyll und Mr. Hyde«, sagte der indische Errol Flynn. Er gab sich knallhart, aber irgendetwas an dem schicken Anzug und dem Schmuck wirkte … harmlos.
»Namen«, wiederholte Emmanuel.
»Amal«, sagte der Kleine schnell. »Ich heiße Amal Dutta, und das ist mein Bruder Parthiv Dutta.«
»Bleibt, wo ihr seid!«, befahl Emmanuel und richtete die Taschenlampe zu Boden. Neben der Blutlache lag eine Limonadenflasche. Dann erkannte er in der Dunkelheit die gekrümmten Finger einer Kinderhand. Es sah fast aus, als würden sie ihn herbeiwinken. Ein weißer Junge lag im Dreck, die Arme ausgestreckt, die dürren Beine verdreht. Seine Kehle war von Ohr zu Ohr aufgeschlitzt wie ein zweiter Mund.
Emmanuel erkannte das Opfer: ein englisches Slum-Kind, etwa elf Jahre alt, das sich zwischen Güterwaggons und Huren mit Besorgungen durchschlug. Jolly Marks. Wer wusste schon, ob das sein richtiger Name war?
Emmanuel untersuchte die Leiche von den zerfledderten Leinenschuhen aufwärts. Eine Tarnhose aus Armeebeständen, die Überlänge hochgekrempelt, an den Knien abgewetzt. Durch die Gürtelschlaufen war ein Stück Schnur gezogen, am Hosenbund ein Blutfleck. Das graue Hemd starrte vor Dreck, der sich auch in den Mundfalten des Jungen gesammelt hatte. Der forschende Blick stieß in jeder Hinsicht auf Mangel: Jollys zerlumpte Kleidung zeigte den Mangel an Geld, das verfilzte Haar und die krustigen Fingernägel den Mangel an Hygiene. Und mangels Eltern hatte niemand ein Kind davon abgehalten, sich nach Einbruch der Dunkelheit in den Docks von Durban herumzutreiben.
Emmanuel richtete das Licht erneut auf den fleckigen Hosenbund. Jolly Marks hatte doch immer ein kleines Notizbuch an einer Schlaufe seiner Khakihose hängen, in das er Bestellungen für Tabak und Lebensmittel notierte. Die Schnur für das Büchlein war noch da, aber das Notizbuch fehlte. Das konnte ein Hinweis sein.
»Hat einer von euch ein Notizbuch gefunden?«, fragte er.
»Nein«, antworteten die Brüder gleichzeitig.
Emmanuel hockte sich neben die Leiche. Neben Jollys rechter Hand lag ein verrostetes Taschenmesser, die kleine Klinge ausgeklappt. Emmanuel hatte fast im selben Alter auch so ein Messer besessen. Jolly war bewusst gewesen, dass hier draußen nachts üble Sachen passierten.
Emmanuel kannte diesen Jungen, kannte Einzelheiten seines Lebens, ohne nachfragen zu müssen. Er war aufgewachsen mit Jungs wie Jolly Marks. Nein, da machte er sich was vor: Er war selbst als einer dieser Jungs aufgewachsen. Ein dreckiger weißer Straßenjunge. So hätte auch er enden können: erst in den Slums von Jo’burg und dann auf den Schlachtfeldern Europas. Er war beidem entkommen und lebte noch. Diese Chance hatte Jolly nicht mehr. Emmanuel wandte sich wieder den Indern zu.
»Hat einer von euch den Jungen angerührt?«
»Nein!« Amal schüttelte heftig den Kopf. »Nie im Leben.«
»Und du?«, fragte Emmanuel Parthiv.
»Nein. Kein Stück. Wir haben hier bloß rumgelungert und nichts gemacht, und dann lag er da.«
Niemand lungerte nach Mitternacht in den Hafengassen von Durban herum, außer um etwas Verbotenes zu tun. Allerdings war zwischen Diebstahl und Mord ein großer Unterschied, und die Chintzanzüge der Brüder waren gebügelt und sauber. Emmanuel musterte ihre Hände, gleichfalls sauber. Jolly lag in einem Blutbad, die Kehle mit einem einzigen Schnitt aufgeschlitzt: das Werk eines erfahrenen Schlächters.
»Hat einer von euch den Jungen schon mal gesehen, vielleicht mit ihm gesprochen?«
»Nein«, sagte Parthiv zu schnell. »Den kennen wir nicht.«
»Ich wünschte, ich hätte ihn nie gesehen.« Amal rutschte die Stimme weg. »Ich wünschte, ich wär zu Hause geblieben.«
Emmanuel wandte den Lichtstrahl vom Gesicht des Jungen ab. Gewaltsamer Tod war verstörend, aber der gewaltsame Tod eines Kindes wirkte noch anders; der Schock prägte sich tiefer ein und währte länger. Amal war nur wenige Jahre älter als Jolly und wahrscheinlich noch ein Schuljunge.
»Setz dich hin und lehn dich an die Wand«, sagte Emmanuel.
Amal sank zu Boden und keuchte mit offenem Mund. Bei ihm war mit Angstzuständen zu rechnen. »Werden Sie uns … uns … verhaften, Detective?«
Emmanuel holte einen kleinen Flachmann aus der Jackentasche und drehte den Deckel ab. Er reichte ihn Amal, der fuhr zurück.
»Ich trinke nicht. Meine Mutter sagt, davon wird man dumm.«
»Heute Abend machst du mal eine Ausnahme«, sagte Emmanuel. »Ist sowieso hauptsächlich Kaffee.«
Der Jugendliche schlürfte einen Schluck und hustete, bis ihm Tränen aus den Augen rannen. Parthiv schnaubte verächtlich; dass sein jüngerer Bruder keinen Schnaps vertrug, war ihm peinlich. Emmanuel steckte den Flachmann ein und spähte in die schmale Gasse zwischen der Mauer des Lagerhauses und dem Güterzug.
Er hatte eine Leiche unter freiem Himmel, keine Mordwaffe und zwei Zeugen, die aller Wahrscheinlichkeit nach zufällig über den Tatort gestolpert waren. Der Albtraum eines Kriminalermittlers – aber auch wiederum ein Traum. Er hatte den Tatort ganz für sich. Keine Streifenpolizisten, die wertvolle Spuren zertrampelten, keine Vorgesetzten, die um die Leitung der Ermittlung rangelten. Unkrautbüschel zwischen dem Schotter zitterten in einem plötzlichen Windstoß. Hinter Jollys Leiche rollte der Stummel einer selbstgedrehten Zigarette über den Boden. Emmanuel hob ihn auf und roch daran. Vanille und Schokolade. Eine spezielle aromatisierte Tabakmischung.
»Rauchst du, Parthiv?«, fragte Emmanuel über die Schulter.
»Natürlich.«
»Welche Marke?«
»Old Gold. Das sind amerikanische.«
»Die kenne ich«, sagte Emmanuel. Die halbe Yankee-Armee hatte sich mit Old Gold und Camel durch Europa gequalmt. Für ein paar Jahre schien der Geruch der Freiheit identisch mit amerikanischem Tabak und Cornedbeef. Old Gold war Massenware, in Südafrika ein Importartikel. Der Vanille-Schokoladen-Tabak war vermutlich eine Spezialmischung.
»Was ist mit dir, Amal, rauchst du?«
»Nein.«
»Nicht mal nach der Schule eine paffen?«
»Nur einmal. Ich mochte es nicht. Es tut in der Lunge weh.«
Parthiv schnaubte wieder.
Emmanuel leuchtete auf Jollys Hände und Gesicht. Amal sah weg. Trotz des offenen Taschenmessers wiesen die Hände des Jungen keine Abwehrverletzungen auf. Der Mörder war schnell und höchst gründlich gewesen. Vielleicht lag es an der nächtlichen Kühle, dass ihm der Mord kalt und leidenschaftslos vorkam. Das Wort Profi schoss Emmanuel durch den Kopf.
Wohl kaum eine Bezeichnung, die auf einen der Dutta-Jungs passte. Er ließ den Lichtstrahl noch einmal über den unebenen Boden schweifen und hielt Ausschau nach Indizien. Jollys Auftragsbuch war nirgends zu finden.
In der Finsternis quietschte eine Zugkupplung. Parthiv und Amal starrten auf etwas im Dunkel des Güterbahnhofs hinter ihm. Emmanuel wirbelte herum, und ein schwarzes Loch tat sich auf und verschlang ihn.
2
Etwas Starkes zwang Emmanuel einen Sack über den Kopf und zerrte ihn ruppig bis über seine Schultern. Raues Sackleinen kratzte über sein Gesicht. Er roch faulige Kartoffeln. Keuchend wich die Luft aus seiner Lunge, als muskulöse Arme sich wie Pythons um seine Brust schlangen. Er wurde hochgehoben, sodass seine Füße unter ihm baumelten wie bei einem Kind auf der Schaukel.
Er spürte, wie sich ein Gesicht zwischen seine Schulterblätter presste. Der Mann, der ihn umklammerte, war klein und besaß die Kraft eines Trolls. Emmanuel wand sich und versuchte sich aus dem Griff zu lösen. Die Arme strafften sich noch eine Spur mehr, genug, um schon das langsame Nachgeben seiner Knochen zu spüren. Er gab den Widerstand auf und konzentrierte sich auf die Stimmen, die auf Hindi wütend durcheinanderredeten. Er hatte keine Ahnung, was gesprochen wurde, und konnte am Tonfall nicht erkennen, ob es Gutes oder Schlechtes für ihn verhieß.
»Halt den Mund, Amal«, schnauzte Parthiv auf Englisch. »Such unsere Taschenlampe und schau nach, ob wir auch nichts fallen gelassen haben. Ich hole den Wagen.«
»Er ist Polizist«, protestierte Amal. »Wir müssen ihn freilassen.«
»Auf keinen Fall. Nicht, nachdem du unsere richtigen Namen ausgeplaudert hast.«
»Was ist mit dem Jungen?«, fragte Amal.
»Den findet morgen früh schon jemand. Los jetzt.«
Parthiv feuerte auf Hindi eine Salve Befehle ab, beim letzten klang seine Stimme schon fern. Emmanuels Füße schrammten über lose Steine und die Stahlbänder der Gleise. Die Schwärze in dem Sack war erstickend. Er widerstand dem Drang, einen Befreiungsversuch zu unternehmen. Dabei würde er sich nur eine gebrochene Rippe einhandeln. Er hörte Amal hecheln, als steckte auch er in einem Jutesack. Ein Wagen hielt, Motor im Leerlauf.
»Geldi, geldi!«, befahl Parthiv. »Schnell.«
Eine Tür wurde geöffnet und Emmanuel auf die Rückbank geworfen. Sein Bewacher folgte nach und legte ihm einen Ellbogen ins Kreuz, eine leichte Berührung mit umso bedrohlicherer Wirkung. Emmanuel rührte sich nicht und atmete langsam. Hatten sie vor, ihn in den Mangrovensumpf am Rand des Hafens zu werfen oder seine Leiche im Buschland um die Umhlanga Rocks zu verbuddeln? Er hätte auf van Niekerk hören sollen. Einmischung war ein großer Fehler.
»Wenn Maataa das erfährt …«, stieß Amal hechelnd hervor.
»Wir nehmen den Nebeneingang«, erwiderte Parthiv so leichthin, als besprächen sie nichts Bedeutsameres als den Verstoß gegen Hausarrest.
»Und dann?«
Auf Amals Frage folgte Schweigen. Emmanuel stellte sich vor, wie Parthiv die wulstige Stirn runzelte. Kriminelle mit begrenztem Weitblick suchten ihr Heil immer in der nächstliegenden Lösung. Nur schnell das Problem loswerden und aufs Beste hoffen.
Der Wagen fuhr um eine Ecke, die Federung wippte. Der Ellbogen grub sich in Emmanuels Kreuz, um zu verhindern, dass er auf den Boden rollte. Bislang hatte der Mann fürs Grobe kein Wort gesagt.
»Madar-chod«, fluchte Parthiv auf Hindi, fuhr dann aber auf Englisch fort. »Bleib ruhig, Bruder. Die fahren nur vorbei. Sie haben keinen Grund, uns anzuhalten.«
»Zwei Wagen«, keuchte Amal. »Zwei Wagen.«
»Ganz ruhig. Ganz ruhig«, wiederholte Parthiv. »Die fahren woandershin.«
Blaulicht flackerte ins Wageninnere und drang durch das Gewebe des Jutesacks. Es waren zwei Polizeitransporter. Vielleicht hatte jemand anders den Mord an Jolly gemeldet. Das Blaulicht verebbte. Vielleicht besser so. Die Polizei würde die Angaben in van Niekerks Observationsbuch mit schwingenden Schlagstöcken und Nilpferdpeitschen quittieren. Da war er bei den Indern vermutlich sicherer.
»Siehst du?« Parthiv war aufgedreht vor Erleichterung. »Ein Kinderspiel. Alles in Butter, keine Probleme.« Der Wagen beschleunigte, bis der Motor im vierten Gang lief. Emmanuel versuchte nicht, bei jedem Abbiegen mitzuzählen oder auf den fernen Ruf eines Vogels zu lauschen, der nur in einem Park der Stadt zu finden war. Außer im Kino lief bei allen Entführungsfahrten dieselbe Tonspur: das rhythmische Geräusch der Reifen auf der Straße und der eigene Herzschlag.
Als der Wagen steil bergan fuhr, wurde er vom Gewicht seines eigenen Körpers in den Ledersitz gedrückt, dann fuhren sie eine Viertelstunde auf ebener Strecke weiter. Auf leicht abschüssiger Strecke kam der Wagen zum Stehen, der Motor ging aus.
»Du gehst vorne rein, schön leise«, sagte Parthiv. »Wenn Maataa oder die Tanten oder die Cousinen aufwachen, raspelst du ein bisschen Süßholz: ›Wie geht es euch heute? Wie schön das Haus ist.‹ Ich bringe inzwischen den hier außen rum in Girirajs Kyaha.«
»Okay.« Amal klang skeptisch. Selbst ein Teenager mit Angstzuständen merkte, wie undicht dieser Plan war.
»Sei ein Mann«, sagte Parthiv. »Wir kümmern uns allein um das Problem. Keine Frauen.«
Emmanuel wurde aus dem Fond gezerrt und einen Pfad entlanggestoßen. Blumenduft, süß mit einem Hauch von Verfall, drang durch den Kartoffelgestank. Sein Herzschlag beruhigte sich langsam. Er war in einem Garten und wurde zu einem Dienstbotenschuppen geführt, einer Kyaha. Eine Metalltür schrammte auf.
»Füße hoch.«
Emmanuel betrat den Raum. Die Hände des Eisenmanns packten ihn bei den Schultern und drückten ihn auf einen Stuhl. Ein Streichholz wurde angestrichen, dann erklang zweimal ein kurzes Zischen, als Baumwolldochte entzündet wurden. Der starke Geruch brennender Petroleumlampen füllte den Raum. Er wartete eine Minute, bis er einigermaßen sicher war, dass seine Stimme ruhig klang.
»Parthiv …«, sagte er. »Wie wär’s, wenn ihr mich gehen lasst, bevor eure Mutter kommt und merkt, was ihr euch eingebrockt habt?«
»Fessle ihn«, sagte Parthiv.
Emmanuels Hände wurden hinter den Stuhl gezerrt und mit etwas Rauem aneinandergebunden. Der Sack wurde heruntergerissen, und er sog begierig frische Luft ein. Er befand sich in einem kleinen Einraumhaus. Das Schlafzimmer bestand aus einer schmalen Pritsche in einer Ecke, die Küche aus einem kleinen Gasbrenner auf einer wackeligen Holzkiste, auf der in Schablonenschrift Saris and All stand. An in die Seite der Kiste eingeschlagenen Haken hingen zwei scharfe Metzgermesser. Ein dritter Haken war leer. Mitten im Raum standen zwei Stühle. An der Wand überm Bett klebte ein Zeitungsausschnitt, von dem eine indische Tänzerin mit betörenden Augen ins Zimmer starrte.
Parthiv zog sich einen Stuhl heran und seufzte theatralisch. Der Mann fürs Grobe blieb hinter Emmanuel und außer Sicht.
»Wir haben ein Problem«, begann Parthiv. »Wissen Sie, was das Problem ist?«
»Ich schätze, das bin ich«, sagte Emmanuel.
»Korrekt.«
»Bist du gut im Problemelösen, Parthiv?«
Das gelbliche Licht aus den Petroleumlampen warf dunkle Schatten über das Gesicht des indischen Ganoven, sodass es bedrohlich wirkte wie ein Totenschädel. Ein Trugbild. Emmanuel kannte üble Typen, bösartige Männer, die zum Vergnügen und ohne Skrupel töteten. In diese Liga gehörte Parthiv nicht.
»Ich bin der Beste.« Der Inder beugte sich vor und ließ seine Fingerknöchel knacken. »Du bist in deinem schlimmsten Albtraum gelandet, weißer Mann. Hier in diesem Raum ist die Gefahr zu Hause.«
»Was soll das heißen?«, fragte Emmanuel.
»Ich bin der öffentliche Feind, ein Killer durch und durch. Ich gehe meinen Weg, und mein Freund ist die nackte Gewalt.«
Emmanuel hätte fast geschmunzelt. Wo sollte ein indischer Jugendlicher im subtropischen Südafrika Gangster-Attitüden herhaben, wenn nicht aus dem Kintopp?
»Du kennst ja mächtig viele Filme«, sagte er. »James Cagney in The Public Enemy, Burt Lancaster in I Walk Alone, und ich weiß gar nicht mehr, wer in Brute Force mitgespielt hat. Die große Frage ist nur: Wer bist du im echten Leben, Parthiv? Robert Mitchum oder Veronica Lake?«
Parthiv beugte sich vor und versetzte Emmanuel einen Hieb gegen die Schläfe. »Sie sind geliefert«, sagte er. »Mein Mann kann Sie in Stücke brechen wie einen Hühnerknochen.«
»Wenn du mich sofort gehen lässt, Parthiv, kommst du vielleicht noch aus der Sache raus, ohne in den Knast zu wandern und für deinen Zellengenossen Bauchtanz zu machen.«
»Giriraj.«
Das Kraftpaket trat vor und baute sich vor Emmanuel auf. Er war höchstens eins fünfundsechzig, aber breitschultrig. Sein kahler Schädel war eingeölt und der gewichste Schnurrbart über den vollen Lippen zu spitzen Enden gezwirbelt.
Parthiv gab ein Handzeichen, und der Mann zog sein Baumwollhemd aus, hängte es ordentlich an einen Haken am Fußende des Bettes, trat wieder in die Mitte des Raums und stellte sich vor Emmanuel. Grüne Kobras fochten auf seiner Brust einen Kampf aus, die Tätowierung sah aus wie mit einem rostigen Nagel in die dunkle Haut geritzt: das Werk eines Gefängniskünstlers mit begrenzten Mitteln, unbegrenzter Zeit und einem Probanden, der viel Schmerz aushalten konnte. Emmanuel bemerkte frische Kratzspuren am rechten Unterarm. Von Fingernägeln vielleicht? Der Mann fürs Grobe trat näher und spannte seinen Bizeps an.
Parthiv war ein Schwätzer, aber Giriraj ein Kraftmeier. Höchste Zeit, alles zu gestehen.
»Okay«, sagte Emmanuel, »ich muss euch etwas sagen.«
»Gut, denn sonst …«
Ehe die nächste bombastische Drohung erfolgen konnte, schrammte die Tür auf. Parthiv sprang auf, als hätte sein Stuhl Feuer gefangen. Ein Sturzbach auf Hindi sprudelte aus seinem Mund. Er zeigte auf Emmanuel, dann auf Giriraj, dann auf sich selbst im Bemühen, die Situation zu erklären. Ein grellrosa Sari blitzte am Rand von Emmanuels Sichtfeld auf, ein Dutzend Glasperlenarmbänder klimperte. Eine Inderin um die fünfzig mit sehnigen Windhund-Gliedmaßen packte Parthiv am Ohr und drehte, bis seine Knie nachgaben. Sie stieß eine halblaute Schimpfkanonade aus und ließ auch dann nicht los, als Parthiv sich schon am Boden wand. Immer mehr Leiber zwängten sich in den Raum, bei zwölf verlor Emmanuel den Überblick. Die Duttas waren nicht einfach eine Familie, sie waren ein Klan mit einer Frauenüberzahl von drei zu eins gegenüber den Männern. Die Anzahl und Lautstärke weiblicher Stimmen ließen die Wellblechwände der Kyaha erzittern.
Amal stand eingezwängt zwischen einer Frau mit walnussfarbener Haut und einem alten Mann ohne Zähne. Er suchte kurz Parthivs Blick und schlug dann beschämt die Augen nieder, weil er es nicht geschafft hatte, ein Mann zu sein.
Giriraj wich an die Wand zurück, und eine junge Frau in bodenlangem Morgenmantel setzte ihm nach und schrie ihm ins Gesicht.
»Du hast einen Polizisten entführt? Hast du denn kein bisschen Hirn in deinem dicken Kopf?«
Die drahtige Frau in dem grellrosa Sari ließ Parthivs Ohr los und sank auf einen Stuhl. »Wir werden alles verlieren«, sagte sie. »Meine Söhne. Mein Geschäft. Wir werden in einer Bretterbude am Umgeni River enden.«
»Nein, Tante«, sagte die junge Frau in dem langen Morgenmantel. »Alles wird gut. Der Junge war schon tot, als Amal und Parthiv ihn gefunden haben. Sie sind unschuldig.«
»Sie sind Inder«, rief eine Stimme von der Tür her. »Die Polizei sorgt schon dafür, dass sie schuldig sind.«
»Das ist wahr«, sagte die Frau im rosa Sari. »Sie werden hängen.«
Jedes Geräusch im Zimmer erstarb. Auge um Auge, so lautete das Gesetz in Südafrika. Zwei Inder am Tatort des Mordes an einem weißen Jungen hatten kaum Chancen, eine weiße Jury von ihrer Unschuld zu überzeugen. Nach den neuen Rassentrennungsgesetzen der National Party waren Inder als Nichtweiße eingestuft. Damit standen sie zwar eine Stufe über der schwarzen Bevölkerung, aber trotzdem weit unter den »Europäern«.
Die walnusshäutige Frau hielt Amals Hand an ihre Wange und murmelte leise vor sich hin. Emmanuel sprach kein Hindi und verstand dennoch jedes Wort. Gebete klangen überall gleich: Er hatte sie in den Gefechten gehört und in den zerstörten Städten Europas. Die Anrufungen eines taubstummen Gottes. Die Frau im rosa Sari vergrub das Gesicht in den Händen. Ein kleines Mädchen, dunkelhaarig, zierlich und noch zu jung, um zu verstehen, was vorging, fing an zu weinen. Die Familie Dutta war in Auflösung.
»Ich bin kein Polizist«, sagte Emmanuel.
Die Frau im Morgenmantel drehte sich um. Sie war Anfang zwanzig, ein dicker schwarzer Zopf fiel ihr bis zur Taille. Die silbernen Blütenblätter ihres Nasenrings funkelten im Licht. »Bitte was?«, fragte sie.
»Ich bin kein Polizeiermittler«, sagte Emmanuel. »Früher schon, aber jetzt nicht mehr.«
»Nein«, sagte Parthiv. »Er ist ein Sheriff. Ein Detective. Ich erkenne das an seiner Art zu reden.«
»Ruhe.« Die Morgenmantelträgerin winkte vier ältere Frauen heran. Sie steckten die Köpfe zusammen und flüsterten. Dann öffnete sich der Kreis, doch der weibliche Familienrat blieb dicht beisammen. Sie wandten sich Emmanuel zu. Die junge Frau im Morgenmantel trat vor.
»Ich bin Lakshmi«, sagte sie höflich. »Und Sie sind?«
»Emmanuel Cooper.«
»Sie sind Polizist?«
»Nicht mehr.«
»Was tun Sie dann jetzt?«
»Ich arbeite am Maydon-Kai in der Victory-Werft.« Das war ein Teil der Wahrheit. Er konnte ihnen nicht erzählen, dass er zugleich auf Observierungsmission für Major van Niekerk unterwegs war und am Verladebahnhof The Point undercover zu Polizeikorruption ermittelte. Das war nichts für fremde Ohren. »Ich bin Schiffsverschrotter.«
Die Victory-Werft stellte ausschließlich Kriegsveteranen ein. In den Reihen der Werftarbeiter fanden sich sämtliche Hautfarben, zusammen bildeten sie das gesamte Spektrum der Streitkräfte des britischen Empires ab. Mischlingssoldaten vom Malay Corps und vom Cape Corps, Hindus und Moslems aus der British Indian Army, europäischstämmige Soldaten von den Royal Marines und der Welsh Infantry, allesamt in einer befriedeten Welt entbehrlich geworden und folglich abgeschnitten vom Geldhahn eines schrumpfenden Weltreichs.
»Ah …« Eine der Tanten rief Lakshmi zu sich, und die Frauen besprachen sich leise, begleitet von aufgeregten Handbewegungen und heftigem Kopfschütteln.
»Sie sind ein Ex-Soldat«, sagte Lakshmi, als die Beratung abgeschlossen war. »Meine Tante kennt diese Victory-Werft. Ihr Bruder war in der Fourth Indian Division.«
Ein Zwischenruf ertönte aus dem Publikum, und Lakshmi seufzte kurz, dann übersetzte sie. »Mein Onkel war in der Schlacht von Monte Cassino. Haben Sie davon gehört?«
»Natürlich«, sagte Emmanuel. »Die Inder haben gekämpft wie Löwen, um die Deutschen von diesem Berg zu vertreiben.«
Die Tanten nickten zustimmend über seine Antwort und bedeuteten Lakshmi fortzufahren.
»Was wollten Sie bei den Docks?«, fragte sie.
»Ich war einsam. Ich habe eine Frau gesucht, die mir ein bisschen Gesellschaft leistet.« Emmanuel gebrauchte seine Standardausrede. Es war die einzige glaubwürdige Erklärung dafür, sich nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Güterbahnhof herumzutreiben.
»Oh …« Lakshmi war sprachlos und blickte hilfesuchend zu den Ältesten.
Die Frau im rosa Sari hob den Kopf. »Raus, alle raus jetzt«, sagte sie. »Lakshmi, du bleibst da.«
Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen verließen im Gänsemarsch den Raum. Parthiv versuchte sich mit ihnen zu verdrücken, wurde aber von einem ausgestreckten Finger jäh zum Stehen gebracht. Er zog sich auf die Bettkante zurück. Giriraj ließ sich neben ihn sinken, beide ein Bild des Jammers.
»Sie haben gesagt, Sie sind ein Detective.« Lakshmi runzelte die Stirn. »Warum haben Sie Amal und Parthiv belogen?«
»Reine Gewohnheit«, sagte Emmanuel.
Und Sehnsucht danach, wieder Detective zu sein. Noch vor sechs Monaten war es sein Beruf gewesen, für die Toten zu sprechen. Alles andere fühlte sich bedeutungslos an. Im Innern war er nach wie vor Kriminalermittler.
»Hat die Polizei Sie gefeuert?«, fragte Lakshmi.
»Man hat mich gehen lassen.«
»Weswegen?«
»Ich konnte nicht anders«, sagte Emmanuel. Bei seinem letzten offiziellen Fall hatte er sich mit der mächtigen Security Branch angelegt, der Geheimpolizei, und er war noch am Leben. Das sollte ihm genügen. Er sollte dankbar sein, dass sein Leben weiterging, beinahe unversehrt.
Lakshmi nickte und wartete auf eine Erklärung. Emmanuel lehnte sich auf dem Holzstuhl an. Er dachte nicht gern daran zurück, wie leichtsinnig er gewesen war. Major van Niekerk hatte mit seiner Einschätzung recht gehabt: »Es ist eine Sache, der Security Branch irgendwo in der Pampa in die Quere zu kommen. Aber hier in Jo’burg, wo es alle mitkriegen … das ist wie ein Schlag ins Gesicht.«
Und genau das hatte Emmanuel getan. Er hatte die mächtigste Exekutivbehörde Südafrikas diffamiert, indem er einen Brief an die Mutter eines Schwarzen schrieb, den man fälschlich für den Mord an einem kapholländischen Police Captain anklagte. Der junge Mann, Mitglied der verbotenen Kommunistischen Partei, erhängte sich am Vorabend des Prozesses in seiner Zelle. So jedenfalls stand es dann in den Zeitungen.
»Und was genau stand in dem Brief?«, hatte Major van Niekerk gefragt, als er Emmanuel vor sechs Monaten in sein Büro am Marshall Square in Jo’burg zitierte. Einer von den Spitzeln des gewieften kapholländischen Majors hatte ihn informiert, dass bei der Security Branch eine Untersuchung lief, in der von einem gewissen Detective Emmanuel Cooper die Rede war.
Emmanuel sagte die Wahrheit. Den Major zu belügen wäre reine Zeitverschwendung. »Ich habe ihr mein Beileid ausgedrückt und geschrieben, dass er unschuldig war und die Security Branch ihn zum Geständnis gefoltert hat.«
Van Niekerk verdaute die Information und kalkulierte den Schaden. »Dieser Brief reicht aus, um Sie als untauglich für den Polizeidienst einzustufen, Cooper.«
»Verstehe, Major.«
»Verstehen Sie auch, dass die Security Branch, solange sie diesen Brief in Händen hat, alles mit Ihnen anstellen kann, wozu sie Lust hat? Und ich Ihnen nicht helfen kann?«
»Ja«, sagte Emmanuel.
Er war leichtsinnig und undankbar gewesen. Als er mit gebrochenen Rippen und ohne jemanden für den Mord an Captain Pretorius verhaftet zu haben aus Jacob’s Rest wiederkam, hatte der Major ihn gegen Kritik und Fragen abgeschirmt. Emmanuel hatte diesen Schutz in den Wind geschlagen und sich eingeredet, ein nicht unterschriebener Brief, selbst wenn darin die Wahrheit stand, könnte die brutalen Folgen der Ermittlung in Jacob’s Rest fortspülen.
»Noch etwas«, sagte der Major. »Es heißt, die Polizei in Sophiatown soll eine alte Mordakte übermittelt haben.«
Sophiatown, ein chaotisches Wirrwarr aus Häusern, Ziegelhütten und Wellblechbaracken knapp westlich von Johannesburg, war die Heimat einer Mischung aus Schwarzen, »Farbigen« unterschiedlicher Herkunft, Indern, Chinesen und mittellosen Weißen. Überbevölkert, bettelarm und gewalttätig, eng verbandelt und strotzend vor Leben und Musik, war Sophiatown ein Ballungsraum aus Hässlichkeit und Schönheit. Und Emmanuels Zuhause, bis er zwölf war.
Es dröhnte in seinen Ohren. So ein Brausen, vermutete er, hörten Ertrinkende, bevor sie zum letzten Mal untergingen. »Die Security Branch muss die Polizeiakte zum Mord an meiner Mutter angefordert haben«, sagte er. Kein Vertun. »Sie werden das Disziplinarverfahren nutzen, um den Fall öffentlich zu machen.«
Diese Polizeiakte warf delikate Fragen auf. War Emmanuels Vater wirklich der weiße Afrikaaner, den er als Kind »Vader« genannt hatte, oder war es der kapmalayische Besitzer des General Store, wo seine Mutter sechs Tage die Woche gearbeitet hatte?
Der Major musterte ein Landschaftsgemälde mit flachen grünen Hügeln, das an der beigefarbenen Wand hing, dann sagte er: »Die Security Branch wird für Ihre Entlassung sorgen und dann Ihre Rassenzugehörigkeit neu einstufen. Sie werden als Mischling klassifiziert. Und zwar öffentlich, um größtmöglichen Schaden anzurichten.«
Emmanuel wusste, der Schaden würde nicht nur ihn treffen. Der Skandal würde sein gesamtes Umfeld besudeln. Seine Schwester würde unweigerlich ihre Stelle als Lehrerin am Dewfield College verlieren, denn das war eine Schule für »europäische« Mädchen mit »europäischem« Lehrkörper. Major van Niekerks Name würde von den Beförderungslisten gestrichen werden, weil er zugelassen hatte, dass ein Mann von zweifelhafter rassischer Herkunft über den Rang eines Constable aufgestiegen war. Sogar die Kriminalpolizei am Marshall Square konnte unter Beschuss geraten. Sie alle würden durch den Dreck gezogen. Öffentliche Schmach und harte Bestrafung, genau das, was Lieutenant Piet Lapping von der Security Branch erreichen wollte.
Emmanuel wusste, dass er diese Lage niemand anderem als sich selbst zuzuschreiben hatte. Er hatte sehenden Auges eine Mission durchgezogen, die noch der naivste GI als unausweichlichen »Clusterfuck« erkannt hätte, da war die Krise vorprogrammiert.
»Ich nehme die Strafe auf mich, bevor sie mich drankriegen können«, sagte er. »Ich reiche meine Kündigung ein und beantrage eine Neueinstufung meiner Rassenzugehörigkeit, bevor sie es tun.«
Van Niekerk drehte und wendete den Vorschlag eine ganze Weile, dann sah er Emmanuel an. »Sie wollen sich in Ihr Schwert stürzen. Das könnte sogar funktionieren. Zudem wird in Ihrer Personalakte dann freiwilliges Ausscheiden vermerkt und keine Entlassung. So sichern Sie sich vielleicht die Chance, irgendwann zurückzukehren, wenn Gras über die Sache gewachsen ist.«
Van Niekerks Optimismus war atemberaubend. Keiner von ihnen würde es je erleben, dass die Security Branch vergeben und vergessen lernte. Der Major nahm ein Blatt Papier aus der Schublade und schob es über den lederbezogenen Schreibtisch. Dann zog er einen Füllfederhalter aus der Tasche und legte ihn daneben. Emmanuel schrieb ein Kündigungsgesuch, zurückdatiert auf vergangenen Freitag, zwei Tage vor der Zustellung seines Briefs am die Mutter des schwarzen jungen Mannes.
Van Niekerk setzte eine verschnörkelte Unterschrift unter das Gesuch und sagte: »Ich wollte Sie ohnehin zu mir rufen, Cooper, und Ihnen eine Neuigkeit mitteilen. Ich werde nächsten Monat nach Durban versetzt. Sie sollten sich auch überlegen, für eine Weile aus Jo’burg zu verschwinden.«
Und hier war er nun. In Durban … irgendwo am Stadtrand, in einer Dienstbotenhütte an einen Stuhl gefesselt. Major van Niekerk hatte ihm noch eine Chance gegeben, und er hatte es nicht geschafft, die simple Anordnung zu befolgen: »Sie mischen sich auf keinen Fall ein.«
»Ich bin nur ein Schiffsverschrotter«, sagte Emmanuel noch einmal zu Lakshmi. »Ich war am Güterbahnhof, um eine Prostituierte zu finden. Mehr nicht.«
»Er lügt, Maataa«, sagte Parthiv zu der älteren Frau. »Er ist Polizist. Ich schwöre es.«
»Durchsucht mich«, schlug Emmanuel vor. »Ich habe weder Waffe noch Dienstausweis.«
Lakshmi verknotete ihre Finger. Körperkontakt mit einem schwitzfleckigen Mann, der an den Docks Prostituierte abschleppte, war, als würde sie ihre Hand in eine Kloake stecken.
»Lasst mal sehen.« Die Frau im rosa Sari stand auf, und Lakshmi zog sich in die »Küchen«-Ecke zurück. Emmanuel war ziemlich sicher, dass Maataa auf Hindi »Mutter« hieß, diese Frau allerdings war etwa so weich wie Nashornhaut. Ihre dunklen, mit Kajal umrandeten Augen verrieten keinerlei Gefühlsregung. Ihm war unangenehm bewusst, dass er nach Schweiß stank und sein Anzug, der selbst in sauberem Zustand alt aussah, nach verfaulten Kartoffeln roch. Es war das anständigste Kleidungsstück, das er besaß; alle Knöpfe passten zusammen. Maataa öffnete sein Jackett und brachte ein hellblaues Hemd und dunkle Hosen zum Vorschein.
»Sieh her«, sagte sie zu ihrem Sohn. »Keine Waffe. Kein Dienstausweis. Nichts.«
»Aber …«, begann Parthiv, besann sich jedoch. Seine Mutter hatte jetzt das Sagen. Maataa durchsuchte die übrigen Taschen und fand den kleinen Flachmann mit Kaffee, einen Bleistift und sonst nichts. Van Niekerks Observationsbuch steckte sicher in seiner Gesäßtasche. Der Ausweis mit Geburtsdatum und Rassenzugehörigkeit sowie sein Führerschein lagen in einer Schublade in seiner Wohnung. Er nahm sie gar nicht mehr mit. Sollten doch die Straßenbahnschaffner entscheiden, wo er zu sitzen hatte. Er war die Erklärungen leid.
»Der tote Junge am Güterbahnhof«, sagte Maataa zu Emmanuel, »war der weiß?«
»Unter der Dreckschicht – ja, da war er weiß.«
»Kennen Sie den Jungen?«
»Er war kein Verwandter«, sagte Emmanuel. »Ich habe ihn öfter an den Docks gesehen. Das ist alles.«
»Schlimme Sache.« Die Inderin kniff die Augen zusammen. »Werden Sie zur Polizei gehen?«
»Ich werde nicht zur Polizei gehen«, sagte er. »Mich einzumischen war ein Fehler.«
Maataas kantiges Gesicht rückte näher. Sie roch nach Gewürznelken und einem Duftöl für die Schläfen, das Emmanuel nicht benennen konnte.
»Sie haben Angst«, stellte sie fest.
»Ja, habe ich.« Es war besser, gar nicht auf dem Radar der Security Branch aufzutauchen.
»Das ist sehr gut.«
Mit einem Finger winkte Maataa Giriraj herbei. Er löste die Fesseln von Emmanuels Händen, kehrte in die Schlafecke zurück und wartete auf weitere Anweisungen.
»Kann ich gehen?«, fragte Emmanuel. Er wollte jedes Missverständnis vermeiden.
»Sie werden Ihr Wort halten. Das sehe ich Ihnen an.« Sie studierte Emmanuels Gesicht und runzelte die Stirn. »Was sind Sie eigentlich … Europäer? Mischling? Oder sind Sie vielleicht in Indien geboren?«
»Suchen Sie sich was aus«, sagte er.
Maataa musste lachen bei der Vorstellung, solche Macht zu haben. »Ah, Sie sind ein frecher Kerl. Parthiv bringt Sie jetzt weg, aber gehen Sie nicht wieder zum Hafen. Es gibt viele, viele saubere Frauen in Durban.«
»Ich gehe direkt nach Hause«, versprach Emmanuel. Parthiv führte ihn nach draußen. Der nächtliche Garten war duftgeschwängert, cremefarbene Blüten so groß wie Babyhände schaukelten im Wind. Wenn er wollte, konnte er sich noch ein oder zwei Stunden van Niekerks Spezialauftrag widmen und verdrängen, dass er in die Rolle des Detective Sergeant zu schlüpfen versucht hatte. Die Erinnerung an Jollys gekrümmte Finger war heftig.
»Was wolltet ihr denn am Güterbahnhof?«, fragte er Parthiv, als sie auf die schmale Einfahrt vor dem Haus traten. Unter ihnen glitzerte Durban. Draußen auf der dunklen Fläche des Indischen Ozeans schimmerten die Positionslichter vor Anker liegender Frachter, die auf die Erlaubnis zur Einfahrt in den Hafen warteten. Emmanuel nahm an, dass er sich in Reservoir Hills befand, einem ausdrücklich für die indische Bevölkerung gebauten Randbezirk. Noch weiter draußen lag Cato Manor, ein aus Wellblech und Lehm zusammengehauenes Auffangbecken für die wachsende schwarze Bevölkerung.
»Ich hab auch eine Frau gesucht«, gestand Parthiv zu und schloss das Entführerauto auf, einen mitternachtsblauen Cadillac, tiefliegend und chromblitzend. »Meine Mutter will, dass Amal immer nur lernt, lernt und noch mal lernt. Das ist nicht gut. Er ist klug, aber er ist kein Mann.«
Emmanuel setzte sich auf den Beifahrersitz und wartete darauf, dass Parthiv den Motor anließ. Giriraj kam vom Seitenpfad herbei und stieg hinten ein. Für einen so breiten Mann bewegte er sich erstaunlich leise. Sie setzten rückwärts aus der abschüssigen Einfahrt und fuhren durch eine unbeleuchtete, von Jacaranda-Bäumen gesäumte Straße.
»Warum an den Docks?«, fragte Emmanuel. Die unterste Kategorie Prostituierter arbeitete rund um die Docks und in den leeren Güterwaggons. Parthiv aber saß am Steuer eines glänzenden neuen Cadillacs.
»Geht nicht anders«, sagte Parthiv. »Wenn ich Amal in ein Haus mit bezahlten indischen Frauen brächte, würde meine Mutter es rauskriegen. Sie will, dass er nur gute Noten hat und Anwalt wird.«
»Du hast also«, fasste Emmanuel zusammen, »deinen kleinen Bruder zu den Docks geschleppt, um ihm eine Frau zu suchen. Vielleicht sogar eine Weiße. Als Leckerbissen.«
»Genau.« Parthiv lächelte, froh, dass jemand seine selbstlosen Motive erkannte und zu schätzen wusste.
Emmanuel wäre am liebsten umgekehrt, hätte sich Amal geschnappt und ihm gesagt: Hör bloß nie auf Parthiv. Wenn du nicht Jahre in einer winzigen Zelle festsitzen und in einen Eimer scheißen willst, lern weiter. Jungfräulichkeit lässt sich leicht beheben. Knast dauert ewig.
»Er ist noch ein Kind«, sagte er. »In ein paar Jahren kommt er schon selbst drauf.«
»Das mit dem Jungen da in der Gasse«, sagte Parthiv, »das könnte auch Amal zustoßen. Tot, einfach so. Besser, man stirbt als Mann.«
»Besser, man stirbt überhaupt nicht«, sagte Emmanuel und versuchte nicht daran zu denken, wie Jolly Marks im Dreck gelegen hatte. Ermittlungen waren Aufgabe der Polizei, und Emmanuel gehörte nicht mehr dazu. Er war ein Zivilist, der für Major van Niekerk arbeitete. Trotzdem ließ der Tatort ihn nicht los.
»Wo war der Junge, als ihr ihn zum ersten Mal gesehen habt?«, fragte er.
Sobald ein paar Fakten über den Mord geklärt waren, würde er aufhören und die Polizei von Durban ihre Arbeit machen lassen. Ein totes weißes Kind bekam hohe Priorität. Die Kriminalpolizei würde Leute schicken und teure Überstunden in Kauf nehmen, um den Fall aufzuklären.
»Der Junge lag schon da«, sagte Parthiv. »Überall Blut.«
»War das, als du nach einer Prostituierten gesucht hast?«
»Ja, genau wie Sie. Wir hatten schon eine gefunden, eine Rothaarige mit glänzend lila Kleid und kleinen Titten, aber die wollte es nicht mit einem Charra machen, einem Inder.« Parthiv war immer noch gekränkt. »Ich hab ihr gesagt: ›Nur einer von uns. Gutes Geld. Die Polizei bekommt nichts mit.‹ Diese Hure hat nein gesagt. Also sind wir weiter, und da lag er in der Gasse, mausetot.«
»Ist jemand aus der Gasse herausgekommen?«
»Nein.«
»Habt ihr etwas gehört? Stimmen? Einen Streit?«
»Nichts. Wir waren ganz leise, weil die Polizei Inder schneller sieht als Weiße.«
»Habt ihr in der Gegend irgendwelche anderen Männer bemerkt?« Hatte der Mord an Jolly mit krummen Geschäften zu tun? Hatte er etwas gesehen, das er nicht hätte sehen sollen?
»Niemanden«, sagte Parthiv und drehte am Autoradio herum, obwohl bis zum Morgengrauen alle Sender abgeschaltet waren.
»Aber du kanntest den Jungen«, bohrte Emmanuel weiter. »Du hast ihn heute nicht zum ersten Mal gesehen. So ist es doch, oder?«
»Sie sind ein Cop«, sagte Parthiv. »Ganz sicher.«
»Bin ich nicht.« Emmanuel wusste, er war zu weit gegangen. »Ich war bloß neugierig.«
Parthivs Stimme wurde laut und panisch. »Sie machen verdeckte Ermittlungen, so ist es doch, oder?«
»Ich bin kein verdeckter Polizeiermittler«, sagte Emmanuel. Und gar nicht mehr bei der Polizei, ermahnte er sich. »Wenn du mich am Güterbahnhof abgesetzt hast, sehen wir uns nie wieder.«
»Im Ernst?«
»Im Ernst.«
Der Cadillac flitzte durch die leeren Straßen, vorbei an städtischen Parks mit leeren Schaukeln und heruntergekommenen Kricketfeldern. Bald erreichten sie den Güterbahnhof von The Point. Ein Betrunkener torkelte im Zickzack über den Gehweg, ein streunender Hund scharrte im Inhalt einer umgekippten Mülltonne. Keine Polizeitransporter, keine Absperrgitter oder Wachen am Eingang der Gasse, in der Jolly Marks immer noch unentdeckt lag.
»Danke fürs Fahren«, sagte Emmanuel. Parthiv reagierte mit einem humorlosen Schnauben, machte eine Kehrtwendung und fuhr zurück Richtung Stadt. Die roten Rücklichter wurden schwächer und verschwanden. Emmanuel kramte ein paar Münzen aus der Tasche. Das nächste öffentliche Telefon befand sich in Sichtweite des Polizeireviers von The Point. Ein riskanter Standort für das, was er vorhatte.
Er schlug den Jackettkragen hoch wie ein zweitklassiger Gauner aus einem von Parthivs Gangsterfilmen, dann schlüpfte er in die runde beige-rote Telefonzelle. An einer Metallkette baumelte ein zerfleddertes Telefonbuch. Er blätterte zu den Polizeiwachen und warf Münzen in den Schlitz.
»Sergeant Whitlam.« Die Stimme am anderen Ende war schroff. Bis zur Frühschicht und einem warmen Bett war es noch Stunden hin. »Polizeiwache The Point.«
»In der Gasse hinterm Büro von Trident Shipping liegt eine Leiche.«
»Bitte was?«
»Hören Sie gut zu, Sergeant Whitlam. Das hier ist kein Streich oder Witz. Schicken Sie jemanden in die Gasse hinter Trident Shipping. Ein Junge ist ermordet worden.«
»Wer ist da bitte?«
Emmanuel hängte ein. So weit war es gekommen: anonyme Anrufe in der Nacht, um die Mühlen des Gesetzes in Schwung zu bringen. Er zog sich in die Schatten zurück und kauerte gegenüber dem Eingang zur Gasse wie ein Dieb. Fünf Minuten vergingen, dann zehn. Jede Sekunde verstärkte das Groteske an der Situation. Ein erwachsener Mann hockte im Dunkeln und konnte nichts tun als warten. Das Vernünftigste wäre, aufzustehen und zu gehen.
Eine Viertelstunde später tauchte ein schlaksiger Streifenpolizist mit schlafwirrem Haar auf, um nachzusehen. Höchstens zwanzig, schätzte Emmanuel, noch nicht zynisch abgebrüht, aber überzeugt, dass der diensthabende Sergeant ihn losgeschickt hatte, um ein Hirngespinst zu jagen. Mit auf Fernlicht gestellter Taschenlampe betrat der Constable die schmale Gasse, kam sofort wieder heraus und rang nach Luft. Die subtropische Nacht war still und das Keuchen des Mannes weithin zu hören. Brechreiz, Schock und Fassungslosigkeit … Emmanuel wartete ab, während der junge Mann die Gemütsregungen durchlief, die mit der Entdeckung eines Mordopfers einhergingen. Der Constable wischte sich mit dem Ärmel über die Nase und zog die Polizeipfeife hervor. Ein langgezogener, kummervoller Ton hallte durch The Point.
3
Es war 6:45 Uhr, das Morgenlicht fiel weich auf die Markisen der Geschäfte und die gepflegten roten Backsteinhäuser hinter gepflegten roten Backsteinmauern und ordentlich gestutzten Hecken. Emmanuel knöpfte sein beschmutztes Jackett zu, strich ein paar verirrte Haarsträhnen zurück und ging zum Dover, der Mietskaserne im edwardianischen Stil, in der sich sein »möbliertes Apartment für Kurzzeitmieter« befand. Die Straßenbahn rumpelte davon Richtung West Street im Herzen der City. Der Löwenanteil der Sitzplätze war reserviert für weiße Büroangestellte, Beamte und parfümierte Verkäuferinnen. Nichtweiße quetschten sich in die letzten sechs Reihen, ein dichtes Gedränge aus Saris, Khakianzügen und Lunchpaketen.
Er näherte sich dem Eingang des Dover langsam, um seine Chancen besser abschätzen zu können, ungesehen durchs Seitentor hineinzuschlüpfen. Er hatte noch am Tatort gewartet, bis man dort eine Wache postierte, und erst dann den Heimweg angetreten. Das war ein Fehler. Mrs. Edith Patterson, die Hauswirtin, lauerte draußen auf dem Gehweg und zupfte Unkraut aus den Rissen im Asphalt. Ihr violettes Haar war straff auf Lockenwickler gerollt, und der Messingring mit den Schlüsseln zu ihrem Gebäude klimperte gegen den grünen Stoff ihres Kittels, während sie an der Unterwerfung der Natur arbeitete.
Die schwarze Hausdienerin, ein zierliches Zulu-Mädchen in einem Flickenkleid, sammelte die Abfälle ein und trug säuberliche Häufchen zum Auffegen zusammen. Am Zaun entlang reihten sich papierne Union-Jack-Flaggen, um die bevorstehende Krönung von Prinzessin Elizabeth Windsor zu feiern. Ein dreckstarrender Scottish Terrier kam hechelnd die Stufen herunter, trottete zu Mrs. Patterson und versuchte sich mit ihrem Arm zu paaren.
»Aus, Lancelot.« Die Hauswirtin schüttelte den Hund ab. »Böser Junge.«
Emmanuel wandte sich wieder der Straßenbahnhaltestelle zu. Er würde sein Glück später versuchen.
»Mr. Cooper.«
Mrs. Patterson stand jetzt aufrecht da, eine viel günstigere Ausgangsposition, um hochnäsig auf ihn herabschauen zu können. Er ging auf sie zu und lächelte. Das Jackett zuzuknöpfen war ein Missgriff, merkte er jetzt. So wirkte er noch jämmerlicher, als hoffte er, auf so simple Art seine Kleider vom Gestank befreien oder seinen schmuddeligen Anzug richten zu können. Aufmüpfig öffnete er die Knöpfe wieder. Seit fünf Monaten wohnte er im Dover und war noch nie mit der Miete im Rückstand gewesen. Er zahlte immer eine Woche im Voraus. Das sollte etwas gelten.
»Mr. Cooper.« Die braunen Augen der Hauswirtin wurden schmal. »Muss ich meine Entscheidung bedauern, Sie aufgenommen zu haben?«
Sie deutete auf das handgemalte Schild unter dem Gebäudenamen: Nur Europäer und gesittete Mauritier. Keine Ausnahmen. Wobei »gesittete Mauritier« eine Chiffre für hellhäutige Mischlinge war, sofern sie die überhöhte Miete zahlten und davon absahen, Barmädchen zum Bumsen mit aufs Zimmer zu nehmen.
»Mein Wagen hatte eine Panne, und ich habe die letzte Straßenbahn verpasst«, erklärte Emmanuel, während der räudige Scottie sich erfolglos bemühte, den Briefkastenpfosten zu begatten.
Mrs. Patterson spitzte die Lippen. Sie wartete darauf, dass Emmanuel sich entschuldigte oder reuig zeigte, weil er ihre schlimmsten Befürchtungen über gemischtrassige Männer bestätigte. Emmanuel entspannte die Schultern, hielt ihrem Blick stand und sagte nichts. Für heute hatte er sich genug gerechtfertigt. Die Hand des Hausmädchens verharrte über einem ungezupften Grasbüschel, als hielte die plötzliche Spannung in der Luft sie dort fest.
Mrs. Patterson wandte als Erste den Blick ab. »Ich führe ein anständiges Haus. Ein sauberes Haus.« Sie klopfte sich die schmutzigen Hände am Kittel ab, und die Schlüssel an ihrer Taille klimperten. »Ich dachte, das hätten Sie verstanden, Mr. Cooper.«
Emmanuel ging um die Hauswirtin herum zur Tür. Er wusste, sobald die Woche um war, würde Mrs. Patterson ihm einen Räumungsbefehl unter der Tür durchschieben. Er hatte die südafrikanische Todsünde begangen. Er war als Nichtweißer eingestuft. Er hatte es versäumt, Dankbarkeit dafür zu zeigen, dass eine Weiße ihn schikanierte.
»Lancelot. Aus! Böser Junge.« Der Ton der Hauswirtin stieß Emmanuel sauer auf. Sie sprach mit dem Hund genauso wie mit ihm.
Am Fenster bewegte sich ein Stück Stoff und verriet ihm, dass der pensionierte Postbeamte Mr. Woodsmith, Mieter der Erdgeschosswohnung, die Konfrontation mitbekommen hatte. Emmanuel nickte in Richtung Vorhang, und der Stoff fiel herab. Eine Woche und keine Sekunde länger.
Drinnen glänzte das frisch polierte Eichengeländer des Treppenhauses. Mrs. Patterson führte tatsächlich ein sauberes Haus. Warum allerdings der Scottish Terrier noch nie Bekanntschaft mit einem Bad oder einem Stück Seife gemacht hatte, blieb eins der kleinen Rätsel des Lebens.
Die Wände des Apartments waren hellgelb gestrichen, ein fröhlicher Farbton, der Emmanuel beim Eintreten jedes Mal deprimierte. Das Zimmer besaß ein Einzelbett, nicht breiter als eine Feldpritsche, einen zweiflammigen Gasbrenner und einen mit Mottenkugeln ausgelegten Kleiderschrank, in den seine zwei Anzüge, sechs Hemden und drei Arbeitshosen bequem hineinpassten. Das in eine Nische gequetschte und vom Rest des Raums durch einen Rundumvorhang abgetrennte Duschbad kostete ihn jeden Monat ein Pfund extra.
Ein Mietertelefon im Hausflur machte es ihm leicht, an jedem ersten Sonntag im Monat seine Schwester in Jo’burg anzurufen. Es waren kurze Gespräche. Er wiederholte die vertrauten Lügen, die er ihr schon erzählt hatte, wenn ihre Eltern sich in der Küche stritten. Das Leben war schön und alles in bester Ordnung. Lügen hielten sie zusammen.
Er griff in die Jackentasche und holte eine Postkarte hervor, ein getöntes Foto von nebelverhangenen Bergen und tiefen, stillen Tälern. Auf der Rückseite stand in krakeliger Handschrift eine Einladung zu einem Besuch in Zweigmans Krankenhaus im Tal der Tausend Hügel. Dr. Daniel Zweigman, der alte Jude, der Emmanuel das Leben gerettet hatte, nachdem er von der Security Branch übel zusammengeschlagen worden war, lebte nur zwei Autostunden entfernt. Emmanuel legte die Karte sanft auf die Bettdecke. Vielleicht ein andermal, wenn er in weniger desolater Verfassung war …
Er streifte den schmutzigen Anzug ab und warf ihn in einen kleinen Sisalkorb in der Ecke. Neben ihrer übrigen Arbeit übernahm das junge Dienstmädchen auch die Schmutzwäsche der Mieter. Emmanuel wusch sich. Er hatte ohnehin vorgehabt, sich nach seiner nächtlichen Überwachung den Tag freizunehmen, um auszuruhen und nachzudenken. Aber schlafen würde er heute Vormittag nicht. Er würde heute überhaupt nicht schlafen.





























