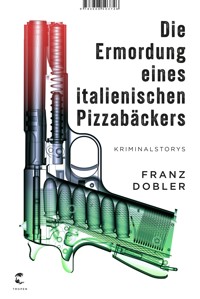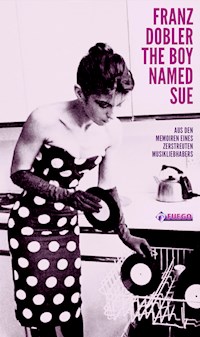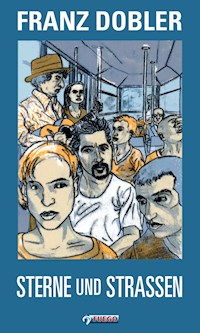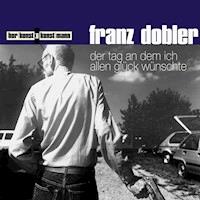17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein emotionaler wie kluger Roman über all das, was einen zu dem Menschen macht, der man ist.« Iris Berben Der Junge ist Adoptivkind. Doch seine Erziehung ist nicht nur Sache seiner Adoptiveltern, eines Eisenbahner und einer Hausfrau. Der New Yorker Jazz, das »Roaring Munich« der 80er prägen ihn mindestens genauso. Ein Sohn von zwei Müttern ist ein Roman, der vom Aufwachsen eines bayrischen Jungen mit persischen Wurzeln erzählt. Und von der Entwicklung eines Landes vom Provinzialismus der Nachkriegszeit zur modernen Bundesrepublik. Als seine Geschichte ihn einholt, ist der Junge schon ein erwachsener Mann und selbst Vater. Er sitzt im Flugzeug nach New York auf dem Weg zu seiner leiblichen Mutter, die er seit 30 Jahren nicht gesehen hat. Seine Adoptivmutter ist seit zwanzig Jahren tot, sie hat nie ein Flugzeug bestiegen. Während des scheinbar endlosen Fluges drängt seine Adoptionsgeschichte, die er immer mürrisch beiseite gewischt hat, weil er zu beschäftigt war, das Leben zu bewältigen, plötzlich an die Oberfläche. Er muss sich ihr stellen. Er ist ein Sohn von zwei Müttern. Oder waren es noch mehr? Ist nicht jeder auch ein Kind seiner Zeit, geprägt von einer Musik, von Lektüren und von den unzähligen Zufällen des Lebens? Franz Dobler geht der Sache auf den Grund. Er beginnt ganz am Anfang, als der kleine Junge in den späten 60ern im sogenannten bayrischen Pfaffenwinkel bei seinen Adoptiveltern abends in der Badewanne sitzt und ruft: »Ich bin ein Adoptivkind.« Der Beginn einer unglaublichen Geschichte, die genauso tief in das Leben des Münchner Unikats eintaucht wie in die Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik. »Ambivalent, unabhängig, kick-ass, und immer mit hochelegantem Strich gezeichnet – Franz Dobler ist der Mann mit den besten Frauenfiguren.« Simone Buchholz »Franz Dobler ist im besten Sinne ein Unterhaltungskünstler, seine Bücher besitzen auch immer eine besondere Leichtigkeit.« Friedrich Ani
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Franz Dobler
Ein Sohn von zwei Müttern
Roman
Tropen
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Favoritbuero, München unter Verwendung einer Abbildung von © mauritius images/Phil Degginger/Alamy/Alamy Stock Photos
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-50422-4
E-Book ISBN 978-3-608-12253-4
Das Flugzeug, das am anderen Ende der Welt in New York landen sollte, hatte ein Problem: Es würde nie dort ankommen. Womit er jedoch kein Problem hatte, weil er schon genug eigene Probleme hatte, unter anderem eines der größten, das die Menschheit kannte – die Mutter. Genauer gesagt, seine Mutter. Die er seit dreißig Jahren nicht mehr gesehen, erst kurz vor der Reise wieder gesprochen hatte und die er nun in New York treffen sollte. Wenn das Flugzeug denn dort ankäme. Die anderen Passagiere schienen das Problem des Flugzeugs nicht zu bemerken, aber das war nicht sein, sondern deren Problem. Dabei hingen sie seit mehr als einer halben Ewigkeit in der Luft. Das Flugzeug hatte sich eindeutig in einer unbekannten Zeitzone verirrt.
Man musste doch kein Wissenschaftler sein, um eine Problemzone zu erkennen, bevor man in sie hineingeriet.
Mit dem sicheren Gefühl (und dem Wissen, dass der Ausdruck sicheres Gefühl ein Unsinn war), dass es seine letzte wäre, zündete er sich eine Zigarette an. Und sofort hatte er wirklich ein Problem: Einer dieser Typen stand vor ihm, die sogar auf dem Flug zur Hölle ihre Stimme erheben würden, um die Einhaltung einer unwichtigen Verordnung einzufordern. Solche Typen waren ein echtes Problem, auf dem Boden wie in der Luft. Also sagte er zu diesem Typen, er solle einen Abflug machen, Motherfucker. Die Turbulenzen hatten jedoch zur Folge, dass der Motherfucker nicht gelassen reagierte. Der Motherfucker sah aus, als wollte er einen Faustkampf starten – ehe ihm offenbar dämmerte, dass bei Turbulenzen in fliegenden Flugkörpern andere Regeln galten und der im Sitz hängende Raucher ihm mit einem Tritt schneller das Knie zertrümmern würde, als er, der Motherfucker, seine Faust auf dessen Nase platzieren könnte, und so keifte er, das werde Folgen haben, und drehte dann mit einem Das-melde-ich-dem-Skymarshall-Gesicht endlich ab.
Der Wortwechsel hatte die Frau neben ihm am Fenster aus dem Schlaf geholt. Jede Frau wacht auf, wenn ein Mann in ihrer Nähe zu einem anderen Mann Motherfucker sagt, selbst wenn es kein Zeichen übelster Beschimpfung, sondern größter freundschaftlicher Anerkennung ist – was jedoch oft nicht sofort erkennbar ist, weswegen höfliche Männer in der Nähe einer Frau die Beschimpfung zu »Mother« abkürzen (bei direkter Rede heißt es dann natürlich, falls ein Mann beschimpft wird, »du mieser Mother« und nicht »miese Mother«, was ebenfalls ein Ausdruck liebevoller Verehrung sein kann). Wegen des Flugzeugproblems hatte er jedoch nicht darauf geachtet, seine Beschimpfung zu dem freundlicheren Mother zu verkürzen.
Seine Frau war gegen ihren Willen geweckt worden und wollte wissen, was denn jetzt schon wieder los sei. Sie zeigte mit dem Finger auf seine nicht brennende Zigarette. Warum war er so nervös, warum hatte er vor sich hin geredet, gibt’s ein Problem, irgendwas mit Mutter und New York, hatte er gerade Motherfucker gesagt?
Aber nein, sagte er, alles im Griff, schlaf weiter, der Weg ist noch endlos weit.
Viele behaupteten, alles im Griff zu haben – alle wussten, dass niemand die Sache mit der Mutter im Griff hatte. Diese Frau konnte sich niemand aussuchen. Man konnte auch nicht entscheiden, ob man eine Mutter hatte oder schon bald keine mehr, ebenso wenig wie man wählen konnte, ob man eine fröhliche Mutter, eine mörderische oder womöglich sogar zwei Mütter bekam. Er hatte größten Respekt vor der Wissenschaft, doch es war ihm egal, was die Biologie dazu sagte: Er hatte zwei Mütter. Die erste Mutter hatte ihn zur Welt gebracht und die zweite Mutter, seine Mama, hatte ihn adoptiert. Die Erste würde in New York darauf warten, ihn nach dreißig Jahren wiederzusehen, die Zweite war verstorben.
Keine einfache Geschichte, deswegen wollte er nie darüber schreiben. Jedenfalls nicht mehr als Notizen, jedenfalls kein Buch. Was für immer mehr Autor:innen das höchste der Gefühle war – das eigene Leben bis zum geradezu skandalösen Krümel Gras in Opas Nachtkasten zu erforschen und literarisch aufzubereiten –, langweilte ihn schon beim Gedanken daran. Dummerweise hatte er über die Jahre einen Berg Notizen angesammelt, der mit seiner Adoption zu tun hatte und von dem er eines Tages das dumme Gefühl hatte, ihn aus dem Weg räumen zu müssen. Als hätte ihn plötzlich in einer Geisterstunde ein Ghostwriter besetzt [schwaches Wortspiel]. Ein Berg Notizen, der zu einem Berg Arbeit wurde, die er auch gegen seinen Willen erledigen musste, weil diese Arbeit sonst jede andere – bessere – Arbeit verhinderte. Laut Plan sollte die Arbeit nun durch das Treffen mit der ersten seiner zwei Mütter in New York zu einem Ende kommen. Wenn das Flugzeug also nicht dort ankommen würde, wäre das deshalb für ihn kein Problem, weil ihm so eine Menge Arbeit erspart bliebe.
Vielleicht war es diese Art von Schreibarbeit, die gerne als ehrliche Arbeit gesehen wurde, in jedem Fall war eine Schreibarbeit, auf die man keine Lust hatte, eine Drecksarbeit, und die wurde nicht dadurch angenehmer, dass man sie als ehrliche Arbeit betrachtete.
Manchmal war er stolz darauf, dass es ihm gelungen war, in keiner Heilanstalt zu landen, obwohl er es mit zwei Müttern zu tun hatte. Wo doch seiner Erfahrung nach die meisten oder wenigstens ziemlich viele Menschen schon mit einer Mutter gut bedient waren, vor allem Erwachsene. Wenn Mutter ihren Besuch ankündigte, verdrehten sie genervt die Augen, wenn sie sich aber rarmachte, vermissten sie sie plötzlich. Oder behaupteten, diese miese Bitch hätte ihr Leben lang nur an sich selbst gedacht und sie immer vernachlässigt. Wenn die Mutter verstorben war, wurde sie für die Kinder dann sogar zur ewigen Last, weil sie ihr nicht alles hatten sagen können, was sie ihr noch und schon immer mal hatten sagen wollen. Und dann gab es ja auch noch diese Riesenbabys, die in fortgeschrittenem Alter noch bei ihr wohnten, weil sie sie nicht losließ.
Über der Welt lag ein Netz von Mutterproblemen: Da würde er doch wohl noch die Frage stellen dürfen (obwohl er nicht zu diesen miesen Mothers gehörte, die diese Formulierung in Verbindung mit politischen Ansichten benutzten), warum dann die Menschheit noch nicht längst ausgestorben war. Die für ihn persönlich viel interessantere Frage war natürlich, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er bei seiner Geburtsmutter aufgewachsen wäre und seine Mama nie kennengelernt hätte. Oder auch die Frage, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er zusammen mit seinen zwei Müttern aufgewachsen wäre, in einem Haushalt! Ein Adoptionsmodell, dem er im Verlauf seiner ausufernden Recherchen nie begegnete. War das verboten oder nur undenkbar?
Seine Mütter hatten sich nie kennengelernt, und während er seiner ersten Mutter viel von seiner zweiten erzählt hatte, hatte er seiner Adoptivmutter nie etwas von seiner Geburtsmutter erzählt. Sie war eine unverheiratete junge Frau gewesen – mehr wusste sie nicht über sie.
Seine beiden Mütter waren sehr verschieden, das zeigte sich in ihrem Flugverhalten noch deutlicher als in ihrem Alter: Die erste Mutter hätte die Tochter der zweiten sein können, und für seine jüngere, erste Mutter war Fliegen eine alltägliche Sache, wogegen seine ältere Mutter kein einziges Mal in ihrem Leben geflogen war. Falls es stimmte, was die beiden ihm erzählt hatten. Woher sollte er das wissen? Und woher sollte er wissen, was sie ihm nicht erzählt hatten? Oder, wie er es dann bei Ruth Klüger las und für sich passend umformulierte: Ich kenne meine Mama so schlecht, ich kenne meine Mutter so schlecht, ich kenne meine Mütter so schlecht, »wie alle Kinder ihre Eltern schlecht kennen«.
»Klingt etwas böse. Als gäbe es keine anderen Kinder.«
»Klüger konnte ihre Mutter nicht leiden. Und sie hing an ihr.«
»Aber kann man sich jemals sicher sein, dass man seine Eltern schlecht kennt? Und ist es nur Wunschdenken, wenn man glaubt, sie gut zu kennen?«
»Viele Schafe verlassen die Kirche, doch das vierte Gebot hält ewig.«
»Man kennt sie schlecht und ehrt sie doch.«
»Ich kenne meine beiden Mütter nicht besonders gut, das ist sicher.«
»Sicher ist nur, dass wir landen werden, du Mother.«
Er hatte viele Anfänge für dieses Buch geschrieben, und wenn es irgendwann zu spät wäre, würde er sich fragen, warum er diesen und keinen besseren genommen hatte, auch wenn dieser vielleicht nicht der schlechteste war … Gibt es eindeutige Merkmale, an denen man bereits auf der ersten Seite ein schlechtes Buch erkennt? Die gibt es, hatte ihm ein Lektor erklärt, als er noch jung und leicht zu beeinflussen gewesen war: Ein schlechtes Buch fängt damit an, dass jemand aufwacht … Wenigstens fing er also nicht damit an, wie er eines Morgens aufwachte und ihm trotz der unmenschlichen Kälte im Zimmer sofort klar wurde, dass er ein Buch über seine zwei Mütter schreiben musste, weil er, wenn er es nicht schrieb, zu einem Monster mutierte, dem nie wieder ein Wort einfiele, mit dem es andere Menschen glücklich machen konnte … Der Anfang, der der Wahrheit entsprach, war jedoch eigentlich genauso unbrauchbar: Er war seit zwanzig Jahren auf der Flucht vor diesem Buch, und letztendlich hatte er sich geschlagen gegeben, weil er erkannt hatte, dass er vor diesem Buch nicht fliehen, sondern es nur erledigen konnte. Ein obszöner Anfang: Menschen waren auf der Flucht vor durchgedrehten Männern mit Maschinenpistolen, aber nicht vor einem Buch. Selbst wenn sich der Text mit keinem anderen verdrängen ließ und immer wieder zurückkam, wie eine Gestalt aus einem Horrorfilm, die bei peitschendem Sturmregen mit dem Metallhaken ihrer Armprothese ans Fenster schlägt. Doch die Frage, ob das Projekt nicht besser abzuhaken wäre, begleitete ihn, solange er am Haken hing, oder wie man sagt, die Sache hatte eben einen Haken.
»Es war Mitternacht, es regnete«, als Lew Griffin das Krankenhaus betrat, um ein neu- und frühgeborenes »Crack-Baby« zu besuchen; die Mutter war abgehauen und er sollte sie auftreiben. Die Krankenschwester erklärte ihm, dass das im Brutkasten liegende Baby nicht überleben würde …
Auf die letzte freie Seite des Romans Nachtfalter von James Sallis hatte er in einer Nacht vor einigen Jahren einen weiteren Anfang für dieses Buch geschrieben, die Eintragung vergessen, zufällig wiederentdeckt, und hatte dann überlegt, ob er im Bett liegend noch in ein Dutzend weiterer Bücher Anfänge oder Notizen gekritzelt hatte und ob ein besserer als dieser dabei war: »Ich hatte zwei Mütter, eine seltsame Geschichte, der ich am liebsten aus dem Weg gehe, aber aus einigen Gründen habe ich mich dazu entschlossen, ein Buch darüber zu schreiben – man braucht eben was zu tun, man braucht Geld –, und es wird darauf hinauslaufen, dass ich etwa einhundertzwanzig Seiten um diese Sache herumschreiben werde. Wie man um ein Haus herumgeht, das man nicht betreten möchte. Also falls Sie das lesen, ohne das Buch schon gekauft zu haben, stellen Sie es besser zurück und suchen sich etwas anderes aus.«
Zu seiner Mama war er mit vier Monaten gekommen, und in den darauffolgenden vierzig Jahren hatte er immer nur Mama, nie Mutter zu ihr gesagt. Sie irgendwann später dann mit ihrem Vornamen anzusprechen, kam für ihn nicht infrage, weil sie das – da war er sich ganz sicher – verletzt und sie gedacht hätte, sie wäre jetzt nicht mehr seine Mama, vor allem seitdem er wusste, dass er noch eine Mutter hatte. Als er dann mit dreißig endlich seine Geburtsmutter traf, nannte er sie nicht Mutter. Sie waren sich einig, dass er sie mit ihrem Vornamen ansprechen sollte. Und so stand er nie vor dem Problem, dass eine unbekannte Frau von ihm verlangte, sie Mutter zu nennen, weil sie tatsächlich seine Mutter war. Mutter nannte er sie nur in der Schriftsprache, hier im Buch, in dem seine Adoptivmutter die Mama war, neben der er sich nie eine zweite Mama hätte vorstellen können. Er hatte zwei Mütter, aber nur eine Mama. Ausgeschlossen war übrigens, jemals zu einer seiner Mütter Mutti zu sagen. In seiner Muttersprache gab es keine Mutti, und nicht mal der Papa sagte Mutti zur Mama, die zu ihm Opa sagte, als ihre Tochter, die viel ältere Schwester des Adoptivsohns, ein Kind bekommen hatte, wie auch der Papa zur Mama jetzt Oma sagte, während er selbst weiterhin Mama und Papa zu ihnen sagte, obwohl seine Schwester sie inzwischen mit Oma und Opa ansprach.
Vor diesem Hintergrund war es wohl berechtigt, die Welt zuerst als Ansammlung von Sprachproblemen zu betrachten.
Sogar in der tiefen bayerischen Provinz fingen in den Siebzigerjahren manche Teenager damit an, ihre Eltern beim Vornamen anzusprechen. Da waren seine Eltern jedoch schon über fünfzig und hatten für derartige Neuerungen nichts übrig.
Seinen Adoptivvater nannte er immer Papa (der ihm eher eine gescheuert hätte, als sich vom Sohn wie ein Kumpel mit dem Vornamen ansprechen zu lassen).
Mit den Vätern war es deutlich einfacher, denn er war nicht der Ansicht, dass er zwei Väter hatte. Seinen Geburtsvater hatte er nie mit irgendwas angesprochen, weil er ihn nicht kannte, und im Buch würde er nur gelegentlich als Erzeuger vorkommen. Seine Mutter hatte ihm erzählt [oder besser »gestanden«?], sie könne sich nicht mehr genau an den Namen des Mannes erinnern, der ihn gezeugt hatte.
Ich glaube Ahmed, hatte sie gesagt, aber sie wisse es nicht mehr genau, oder Ali vielleicht, also ja, es war eben, also damals, ja, es war eben, na ja.
Während des scheinbar end- und garantiert erfolglosen Flugs in Richtung John-F.-Kennedy-Flughafen schleuderten so viele New Yorker Geschichten durch seinen Kopf, als hätte ihn nie etwas anderes beschäftigt. Er war kulturell so stark von diesen Vereinigten Staaten geprägt, man hätte meinen können, es hätte eine geheime Verbindung zwischen ihm und seiner ihm unbekannten Mutter gegeben, schon lange bevor er herausgefunden hatte, dass sie bald nach seiner Geburt mit einem Angehörigen der US-Armee ausgewandert war. In New Orleans, Cajun-Country, Texas, San Francisco, Nashville und Hunter S. Thompsons Geburtsstadt Knoxville war er gewesen, aber nie in New York, das er aus Filmen, Büchern und Musik so gut kannte, dass er den Ort in echt nie hatte aufsuchen wollen. Doch dann hatte sich seine Frau New York zum Geburtstag gewünscht. Und er hatte nach dreißig Jahren wieder mit seiner Mutter telefoniert, und dieses Telefonat hatte sich angefühlt, als hätten sie in dieser langen Zeit oft und freundlich miteinander gesprochen.
Es war jedoch nicht dieses Gespräch, eine ja durchaus schöne Sache, die ihn dazu gebracht hatte, seinen Berg Adoptionsnotizen endlich anzugehen. Es war eine miese Sache: Der New Yorker Serienkiller Joel Rifkin hatte ihn dazu genötigt, diese Arbeit anzugehen, der er so lange aus dem Weg gegangen war – Jesus, konnte es einen ekelhafteren Anlass geben?
Dieser Psycho Joel Rifkin schraubte sich in seinen Kopf hinein und kippte sozusagen in das Thema Adoption das Serienkiller-Thema rein.
Sollte er also dem New Yorker Serienkiller Rifkin, der bis heute im Knast saß, auch noch dankbar sein? Schließlich hatte er den Anstoß für ein neues Buch gegeben und die Entdeckung einiger verschütteter Erinnerungen ermöglicht. Scheinbar. Das heißt, der Schein trügt. Und Erinnerungen sind ein echtes Problem. Die treten dir eines Nachts die Tür ein und behaupten, sie gehörten zu dir. Das ist gelogen, du kennst sie nicht. Sie behaupten, sie würden seit vielen Jahren in deinem Haus wohnen, hinten im Keller, wo du schon lange nicht mehr warst. Aber die können ja viel behaupten, und du sagst, sie sollen verschwinden. Dann holen sie verkratzte und verknitterte Fotos aus ihren Taschen.
Und du sagst, sie sollen reinkommen.
Aber sie sollen bloß keinen Dreck machen.
Er war sich nicht mehr sicher, ob er seiner in Queens, New York, lebenden Mutter jemals erzählt hatte, wie er ihr damals, mit fünf oder sechs Jahren, erstmals auf die Spur gekommen war.
Samstag war Badetag, damals bei ihnen daheim. Die Dusche wurde kaum öfter benutzt als manchmal im Sommer, wenn es sehr heiß war, und gebadet wurde nur am Samstag. Eine halb volle Badewanne für vier Personen. Er war der Jüngste und musste am frühen Abend als Erster einsteigen, dann folgten seine viel ältere Schwester, die Mama und der Papa. Die Reihenfolge änderte sich nie, das Familienoberhaupt immer zuletzt, wahrscheinlich das Gegenstück zu der Regel, dass der Kapitän das sinkende Schiff als Letzter verlässt, eine Frage der Ehre. Erst viel später fiel ihm auf, dass diese Art Familienbad Mitte der Sechzigerjahre in kleinbürgerlichen Familien der oberen Unterschicht eigentlich nicht mehr üblich war. Aber Sparsamkeit wurde in ihrer Familie wahnsinnig großgeschrieben, alles musste man sich vom Munde absparen, und zwar meist deshalb, damit es die Kinder später einmal besser hatten. Nicht ausgeschlossen, dass ihn auch das traumatisiert hatte und er deswegen sein Leben lang der Typ war, der Plastiktüten oder Essensreste einfach nicht wegwerfen konnte. Das erste Auto kam 1967, ein olivgrüner VW Käfer, der zusätzlich zu den Blinkern noch ausklappbare Blinkanzeiger an den Seiten hatte [gibt’s einen Fachausdruck dafür?]. Lange vor den Wohlstandsgeräten Fernseher, Telefon und Kofferplattenspieler wurde das Auto zusammengespart. Seine Mama hatte keinen Führerschein und würde nie einen machen.
Er war fünf oder sechs Jahre alt, als er an einem dieser Samstage unter Aufsicht der Eltern in der Badewanne saß. Es schien einen Grund zu geben, dass sie sich zu zweit um seine Wochenreinigung kümmerten, und falls irgendwelche Gottheiten einen Plan gehabt hatten, dann war er gut. In seiner zweifellos unschuldigen Nacktheit verkündete er ohne Vorwarnung laut triumphierend: »Ich bin ein Adoptivkind!«
Papa und Mama waren schockiert. Als wäre eine Bombe vor dem Haus explodiert. Keine Übertreibung. Sie schreckten vor ihm zurück, fassungslos, verwirrt. Und er fand ihr seltsames Verhalten so lustig, dass er den Schockspruch Ich bin ein Adoptivkind sofort in einen Singsang verwandelte und wiederholte, bis ihm der Vater befahl, damit aufzuhören. Dabei hatte er überhaupt noch nicht gewusst, was ein Adoptivkind ist; obwohl ihm die Bande der Nachbarskinder ernsthaft und sorgfältig erklärt hatte, was Sache war: Deine Eltern sind nicht deine richtigen Eltern, du warst nicht im Bauch deiner Mutter, sondern im Bauch einer anderen Frau, und dann haben sie dich im Krankenhaus abgeholt und seitdem bist du ihr Adoptivkind. Er wusste noch nicht mal, was ein Bauch damit zu tun hatte, und wurde wie so oft verarscht, weil er der Kleinste in der Bande war. Seine Eltern waren nicht so modern, ihm die Angelegenheit jetzt sachlich zu erklären. Mama wiegelte ab, sie hätten ihm wieder nur Blödsinn erzählt, während Papa so schlau war, ihn zu fragen, was das denn heißen solle, Adoptivkind, wodurch sofort klar wurde, dass das Kind keine Ahnung hatte. Er konnte nur die Aussage nachbeten und fand es instinktiv besonders, dass seine Eltern nicht seine richtigen Eltern waren. Das musste man sich merken, dass sie erschreckten, wenn er Ich bin ein Adoptivkind krähte.
Die Antworten kamen erst Jahre später. Und viel später entdeckte er auf diesem lebenslänglich gestochen scharfen Bild in seinem Kopf, dass seine Eltern an diesem Badetag wohl gehofft hatten, das Adoptionsthema wäre damit erledigt und er hätte es am nächsten Tag vergessen.
Sie habe es nie vergessen können, erzählte ihm seine Mutter dann bei ihrer ersten und bisher einzigen Begegnung, und sie hätte an jedem einzelnen Tag an dieses Kind gedacht, das sie zur Adoption freigegeben hatte; oder hatte sie weggegeben gesagt? Das schlechte Gewissen sei sie nie wieder losgeworden, und es war so schlecht, dass sie den Kindern, die sie nach ihm noch bekommen hatte, nie etwas von ihrem ersten Kind erzählt hatte. Die wussten nichts von ihrem One-Night-Stand vor sechzig Jahren und auch nichts von seinem Flug nach New York, und es hatte also nichts gebracht, dass er seiner Mutter damals und jetzt wieder kurz vor seiner Reise erklärt hatte, dass sie kein schlechtes Gewissen haben müsse. Vielleicht hatten seine Halbgeschwister irgendwann etwas in einem mütterlichen Schrank gefunden, das ihnen komisch vorgekommen war, und sich vielleicht gefragt, ob sie ihre Mutter doch nicht so gut kannten, wie sie gedacht hatten. Und vielleicht würden sie verstehen, warum er sich vorgenommen hatte, jedes Vielleicht aus seinem Text zu streichen, obwohl er wusste, dass er das unmöglich durchhalten konnte. Alle wissen zu wenig oder wollen vielleicht nichts wissen oder bekommen nicht genug Wissen, selbst wenn sie vielleicht alles wissen wollen würden. Nicht nur vielleicht, sondern sicher ist es so, dass alle an einer Adoptionsangelegenheit Beteiligten die Sache nie vergessen. Vielleicht weil es mehr als ein natürlicher Vorgang ist, vielleicht weil zwei Mütter doppelt so kompliziert sind wie eine? Auch die Pädagogin und Kriminologin Prof. Dr. Christine Swientek konnte auf den Einsatz von »vielleicht« nicht verzichten: »Vielleicht haben diejenigen Mütter am besten die Freigabe ihres Kindes verwunden, die später heirateten und weitere Kinder bekamen.« Allerdings habe sie bei ihren Recherchen »keine Frau gesprochen, die die Freigabe des Kindes im Nachhinein mit Herz und Hirn bejaht hat und voll hinter der damaligen Entscheidung steht«, und »aus allen Briefen und Gesprächen« habe sie den Eindruck bekommen, »dass eine Verarbeitung im aktiven und positiven Sinne nicht stattgefunden hat«. [nicht mit Zitaten überfrachten!]
Ihr 1982 veröffentlichtes Buch mit dem Titel Ich habe mein Kind fortgegeben und dem Untertitel »Die dunkle Seite der Adoption« war eine Pionierarbeit, denn die Frage, wie diese Frauen »diesen Verzicht oder Verlust im Laufe ihres Lebens verarbeiten, ist bis heute nicht beantwortet. Die betroffenen Frauen berichten nicht unaufgefordert darüber – zumal viele in der Anonymität bleiben wollen –, und gefragt wurden sie bislang nicht danach«. Auch seine Mutter wollte anonym bleiben, während seine Tochter ihn später darauf hinwies, dass er doch das Recht hätte, aus seiner Anonymität aufzutauchen und seine amerikanischen Halbschwestern kennenzulernen. So wie sie als seine Tochter doch das Recht hätte, ihre Halbtanten kennenzulernen. Und so wie diese das Recht hätten, von ihm, dem unbekannten Halbbruder, zu erfahren. Er war jedoch der Meinung, dass er sich nicht über die Entscheidung seiner Mutter hinwegsetzen dürfte, die Adoption vor ihrer amerikanischen Familie geheim zu halten. Durch einen solchen Verrat wäre zu ihrem schlechten Gewissen ihm gegenüber dann auch noch sein schlechtes Gewissen ihr gegenüber gekommen. Um das vage Gefühl zu bekämpfen, dass er es irgendwann vielleicht doch bedauern könnte, seine Halbschwestern nicht kennengelernt zu haben, stellte er sich vor, wie sie sich schon beim ersten Kaffee als Trump-Fans entlarvten. Darauf konnte er verzichten. Seine Mutter aber hatte den gefährlich durchgeknallten rechtsradikalen Präsidenten am Telefon mit den harten Worten einer Frau beschimpft, die in den Bergen aufgewachsen war, und auch deswegen war er stolz auf sie, die sich seinetwegen zu Unrecht ein schlechtes Gewissen umgehängt hatte, das sie nicht mehr loswurde, während einer wie Trump und andere Psychopathen naturgemäß nie wegen irgendwas ein schlechtes Gewissen bekamen.
Es war mitten in der Nacht. Er lag auf dem Sofa und sah sich im Fernsehen eine Folge Seinfeld an, als er auf einmal mit Joel Rifkin konfrontiert wurde, dem Mann, der mindestens siebzehn Frauen ermordet hatte. Rifkins Verhaftung war zu diesem Zeitpunkt ein so großes Thema in New York, dass es auch in der am 18. November 1993 ausgestrahlten neunten Folge der fünften Staffel der Sitcom darum ging. Jerry Seinfeld und seine Freundin Elaine unterhalten sich über den enttarnten Serienkiller, der New York in Atem gehalten hat, als ihr wie üblich überdrehter Freund Cosmo dazukommt und wie üblich zu jedem Thema sofort neue Informationen und Meinungen beitragen kann.
»Wisst ihr, warum Rifkin zum Serienmörder wurde? Weil er ein Adoptivkind war!«, verkündet Cosmo. »Ich glaube, auch Jack the Ripper war ein Adoptivkind. Weil man durch eine Adoption zum Serienkiller wird!«
Er war auch ein Adoptivkind, er sprang vom Sofa auf, davon hatte er noch nie gehört. Er sah sich die Szene noch mal an. Instinktiv hatte er keinen Zweifel daran, dass dieser irre Cosmo bei allem Unsinn immer auch etwas erzählte, das tatsächlich diskutiert wurde, und er fing sofort an, nach Informationen zu suchen.
Dieser Rifkin war tatsächlich als Baby adoptiert worden, und vor allem die Boulevardmedien, die ihn »Joel the Ripper« nannten, hatten sich schnell darauf eingeschossen, dass seine Adoption wahrscheinlich für seine kaputte Psyche verantwortlich war.
Mit dem massiven Einsatz von wahrscheinlich und vermutlich oder möglicherweise und nicht ausgeschlossen konnten die Revolverblätter und Trashsender alles behaupten. Denn besonders in der Psycho-Zone Adoption herrschten die Vermutung und die Spekulation, nicht die Beweise. Alle nickten immer verständnisvoll, wenn sie hörten, dass aus einer Frau eine drogenabhängige Kriminelle geworden war, nachdem sie hatte erfahren müssen, dass ihre Eltern nicht ihre richtigen Eltern waren, das war doch klar.
Es war nicht nur die überraschende Information und die Neugier, die ihn antrieb, diese und seine Sache genauer zu betrachten, sondern auch eine diffuse Wut, dass der Inbegriff des Bösen mit dem Symbol des verletzlichen und schutzbedürftigen Kindes in Verbindung und mehr noch gegen jene Kinder in Stellung gebracht wurde, die immer mit mehr oder weniger unklaren Familienverhältnissen zurechtkommen mussten. Zwischen zwei Müttern: ein Niemandsland, das zu betreten nicht unbedingt gut ist …
Geradezu zwanghaft fragte er sich in dieser Nacht, noch während Seinfeld weiterlief, ob er an sich selbst jemals etwas gespürt hatte, was ihn zu einem Serienmörder hätte machen können. Er erinnerte sich an eine Reihe von Albträumen, in denen er von gesichtslosen Männern dazu gezwungen wurde, Mordaufträge auszuführen, wogegen er sich so verzweifelt wie erfolglos gewehrt hatte …
Das konnte die Reaktion auf einen Film wie Léon – Der Profi sein, in dem der Protagonist zwar Auftragsmorde ausführt, aber ein herzensguter vereinsamter Kerl ist und sich sogar um ein Waisenmädchen kümmert. Mit dem sexuellen Trieb des Serienkillers hat der Profi Léon nichts zu tun, und die Morde, die letztendlich auf sein Konto gehen, waren, wie es in Filmen mit sympathischen Killern gerne heißt, nie etwas Persönliches. Der Profikiller braucht mehr Geld, der Serienkiller Befriedigung. Dagegen hatte er selbst auch als Kind nie Lust gehabt, Tiere und sonstige Lebewesen zu quälen oder zu töten – was als deutliches Signal für psychopathische Persönlichkeiten und Serienmörder gilt.
Er hatte sich versteckt, als der Vater ihm, um einen richtigen Mann aus ihm zu machen, beibringen wollte, wie man Hasen schlachtet. Sich trotz angedrohter Strafen standhaft geweigert. Es nicht übers Herz gebracht. Andererseits hatte er fröhlich kreischend die stolpernden und flatternden Hühner verfolgt, denen gerade am Hackstock der Kopf abgeschlagen worden war. Und andererseits hatte er es später doch geschafft, Forellen mit einem kleinen Prügel den Kopf einzuschlagen. Er war seit der Pubertät immer kurz davor, sich allzu stark für Waffen zu interessieren, würde jedoch andererseits, selbst wenn er auf Nazis schießen müsste, keine Lust dabei empfinden. Glaubte er. Und er war sich bewusst, dass man auf Selbsteinschätzungen nicht viel geben sollte. War es eigentlich ausgeschlossen, dass in seinem Gehirn jetzt noch, kurz vor dem Rentenalter, ein Schalter umgelegt werden konnte und ihn doch noch zum Serienkiller machen würde? Äußerst extrem unwahrscheinlich, sagte die Wissenschaft. [hier sind Belege nötig!] Aber: Äußerst extrem unwahrscheinlich heißt auch: nicht ganz ausgeschlossen.
Mit den Stichworten Adoption und Serienkiller führte ihn die Suchmaschine, schneller als man »Gott steh mir bei« sagen kann, zum amerikanischen Psychologen Dr. David Kirschner und seinem 2006 veröffentlichten Buch Adoption: Uncharted Waters, das er auf seiner Website eindrucksvoll bewarb: »Adoptierte, die töten (…) – nichts, was jemals über Adoption geschrieben wurde, kann den Leser auf die Enthüllungen in diesem Buch vorbereiten.«
Sofort wird eine Namensliste von Serienkillern geliefert, die möglicherweise von Adoptionsproblemen angetrieben waren. Dieser Doktor Kirschner geht davon aus, dass »von den schätzungsweise fünfhundert Serienkillern in der US-Geschichte« 16 Prozent als Kinder adoptiert worden sind, während Adoptierte nur »zwei bis drei Prozent der Gesamtbevölkerung« ausmachten. Außerdem sei es »15-mal wahrscheinlicher«, dass Adoptierte einen oder beide Teile ihrer Adoptiveltern töteten. Schätzungsweise hatte Psychologe Dr. Kirschner einen Hang zu gewagten Schätzungen.
Immerhin rief das eine verschüttete Erinnerung hervor, einen Spruch der Mama, mit dem sie ihn manchmal zurechtgewiesen hatte: »Wer seine Eltern haut, dem wächst die Hand zum Grab hinaus!«
Er konnte sich nicht erinnern, jemals auch nur auf den Gedanken gekommen zu sein, seine Mama zu schlagen; er erinnerte auch nicht, weswegen sie ihm damals mit diesem unheimlichen Spruch gedroht hatte. Einmal hatte er sie darauf hingewiesen, dass er es deshalb nicht glaubte, weil man doch auf keinem Friedhof jemals eine Hand entdecken könne, die aus einem Grab herauswachse. Weil sich das niemand traut, sagte sie.
Ein andermal hatte er sie gefragt, warum sie ihn, er aber nicht sie schlagen dürfe. Sie schlug ihn selten und immer nur halbherzig, drohte ihm stattdessen eher und wirkungsvoller damit, dass ihm der Papa die Strafe verpassen würde. Das war normal: Die meisten seiner Kumpels bekamen gelegentlich eine verpasst, und in der Schule kriegten sie bis etwa 1970 öfter mal eine Ohrfeige oder Schläge mit dem Lineal auf die Hand – falls sie nicht gerade diesen einen Lehrer hatten, der lieber mit dem Schlüsselbund warf …
Gute Frage für Experten: Wurden Adoptivkinder schätzungsweise häufiger und heftiger geschlagen als andere Kinder? War es dann vielleicht deshalb schätzungsweise »15-mal so wahrscheinlich«, dass sie zu Elternkillern wurden, oder war es nur elfmal so wahrscheinlich?
Im sogenannten »Adopted Child Syndrome« (ACS) hatte Dr. Kirschner eine Art Rasterfahndung nach gewalttätigen Adoptivkindern ausgelöst. Dabei waren seine Forschungsergebnisse so umstritten, dass er sein Buch im Selbstverlag veröffentlichen musste. Und doch wird Kirschners Psychogramm bei passenden Mordfällen von jedem Revolverblatt zitiert: »Unsozial, Schulprobleme, Neigung zum Lügen, Stehlen und Weglaufen von zu Hause.«
Er selbst musste zugeben, dass alle Punkte auf ihn zutrafen. Wenn auch nicht immer gleichzeitig.
Sein Jugendfreund Hans war kein Adoptierter und hätte seinen Vater zu Recht ermorden können. Hans war ein Krimineller, der schon als frühreifer Teenager diese Laufbahn eingeschlagen hatte (und in einem Kriminalroman hätte ihm der Satz »Mein Freund Hans war ein geborener Krimineller« passieren können, ehe er den dummen Satz hoffentlich korrigiert hätte). Hans wurde in eine sehr kaputte Familie hineingeboren, die in der ganzen Siedlung berüchtigt und schlecht angesehen war; der Vater so ein schwerer Trinker, dass er sogar in einer Siedlung auffiel, in der nur trinkfeste Männer wohnten. Eine Familie aus dem White-Trash-Bilderbuch für übertriebene Klischees. Auffällig verkörpert von Hans’ Mutter: Nach diversen Operationen hatte sie einen völlig verzerrten Mund, aus dem nur noch unverständliche Laute kamen, und sie hinkte so extrem, dass ihr Oberkörper hin und her schwankte, als müsse sie im nächsten Moment hinfallen.
Wenn ihm die Mutter von seinem Freund Hans auf der Straße entgegenkam, ging er auf die andere Seite, um nicht Grüß Gott sagen und sie ansehen oder wegsehen zu müssen; wenn sie angetorkelt kam und er sich im Schutz seiner Kinderbande sicher fühlte, grölte er mit den anderen »Hilfe, die Hexe kommt!«. Die Frau war nicht so schwerbeschädigt zur Welt gekommen – Hans’ Vater, ihr Mann, hatte sie im Suff verprügelt. Als er noch klein gewesen sei, sagte Hans, und dass der Schläger mit einer geringfügigen Bewährungsstrafe davongekommen sei, und seinen Job habe der Schläger trotz hartem Suff nie verloren, er war Rangierer bei der Eisenbahn. Wo auch der Papa des Adoptivkinds als Zugführer arbeitete. Die ganze Siedlung wurde Eisenbahnersiedlung genannt.