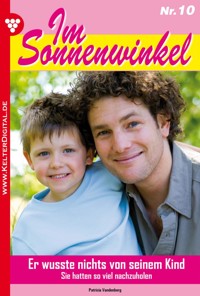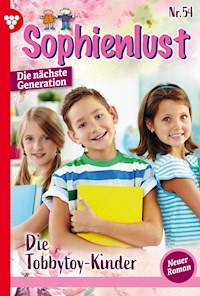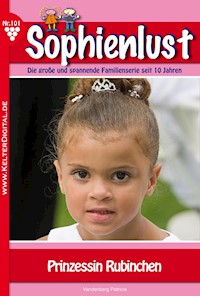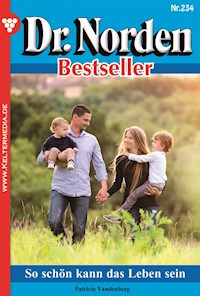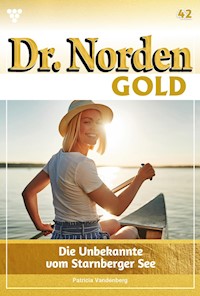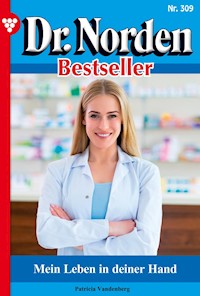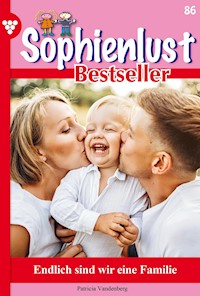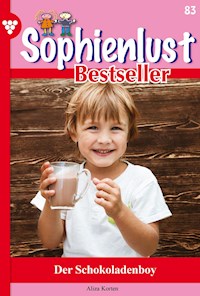Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dr. Norden
- Sprache: Deutsch
Für Dr. Norden ist kein Mensch nur ein 'Fall', er sieht immer den ganzen Menschen in seinem Patienten. Er gibt nicht auf, wenn er auf schwierige Fälle stößt, bei denen kein sichtbarer Erfolg der Heilung zu erkennen ist. Immer an seiner Seite ist seine Frau Fee, selbst eine großartige Ärztin, die ihn mit feinem, häufig detektivischem Spürsinn unterstützt. Auf sie kann er sich immer verlassen, wenn es darum geht zu helfen. Patricia Vandenberg ist die Begründerin von "Dr. Norden", der erfolgreichsten Arztromanserie deutscher Sprache, von "Dr. Laurin", "Sophienlust" und "Im Sonnenwinkel". Ohne ihre Pionierarbeit wäre der Roman nicht das geworden, was er heute ist. »Ich muss unbedingt mit dir sprechen, Papi.« Mit diesem aufgeregten Ausruf stürzte Anneka Norden ins Arbeitszimmer ihres Vaters. Mit jeder Minute, die sie darauf gewartet hatte, endlich mit Daniel allein zu sein, war ihre Nervosität gestiegen. War das, was ihr Freund Jeremy – er lag nach einer Blinddarmoperation in der Behnisch-Klinik – in der vergangenen Nacht beobachtet hatte, wirklich von besorgniserregender Bedeutung? Daniel, der eben erst im Begriff gewesen war, sich hinzusetzen, fuhr erschrocken zusammen. »Musst du dich so anschleichen?«, fragte er mit einer Mischung aus Ärger und Wohlwollen. »Vergiss nicht, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Ein Herzinfarkt in meinem Alter ist keine Seltenheit.« Lächelnd setzte er sich und klopfte auf seinen rechten Oberschenkel. »Komm her und sag mir, welcher Teufel hinter dir her ist, vor dem ich dich retten muss.« Obwohl Anneka inzwischen entschieden zu groß und zu erwachsen für ein Schoßkind war, kam sie dieser Aufforderung sofort nach. Für einen kurzen Augenblick war die Sorge aus ihrem Gesicht verschwunden. »Ich glaub dir ja viel«, erwiderte sie und plumpste auf Daniels Oberschenkel, dass er trotz ihres Federgewichts aufstöhnte. »Aber ganz bestimmt nicht, dass du herzinfarktgefährdet bist. Das hat doch Mario neulich sogar bestätigt, bei dem du zum Durchchecken warst. Er meinte, mit deiner Konstitution wirst du 120 Jahre alt.« »Richtig, jetzt erinnere ich mich«, lächelte Daniel vergnügt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Norden – 137 –Ein strahlender Schutzengel
Patricia Vandenberg
»Ich muss unbedingt mit dir sprechen, Papi.« Mit diesem aufgeregten Ausruf stürzte Anneka Norden ins Arbeitszimmer ihres Vaters.
Mit jeder Minute, die sie darauf gewartet hatte, endlich mit Daniel allein zu sein, war ihre Nervosität gestiegen. War das, was ihr Freund Jeremy – er lag nach einer Blinddarmoperation in der Behnisch-Klinik – in der vergangenen Nacht beobachtet hatte, wirklich von besorgniserregender Bedeutung?
Daniel, der eben erst im Begriff gewesen war, sich hinzusetzen, fuhr erschrocken zusammen.
»Musst du dich so anschleichen?«, fragte er mit einer Mischung aus Ärger und Wohlwollen. »Vergiss nicht, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Ein Herzinfarkt in meinem Alter ist keine Seltenheit.« Lächelnd setzte er sich und klopfte auf seinen rechten Oberschenkel. »Komm her und sag mir, welcher Teufel hinter dir her ist, vor dem ich dich retten muss.«
Obwohl Anneka inzwischen entschieden zu groß und zu erwachsen für ein Schoßkind war, kam sie dieser Aufforderung sofort nach. Für einen kurzen Augenblick war die Sorge aus ihrem Gesicht verschwunden.
»Ich glaub dir ja viel«, erwiderte sie und plumpste auf Daniels Oberschenkel, dass er trotz ihres Federgewichts aufstöhnte. »Aber ganz bestimmt nicht, dass du herzinfarktgefährdet bist. Das hat doch Mario neulich sogar bestätigt, bei dem du zum Durchchecken warst. Er meinte, mit deiner Konstitution wirst du 120 Jahre alt.«
»Richtig, jetzt erinnere ich mich«, lächelte Daniel vergnügt. Er strich Anneka eine hellblonde Strähne aus dem Gesicht und wurde ernst. »Aber du bist ganz blass. Sieht nicht danach aus, als ob du gute Nachrichten für mich hättest.«
Mit finsterer Miene schüttelte Anneka den Kopf.
»Vorhin in der Klinik … Jeremy hat heute Nacht was Mysteriöses beobachtet. Er hat es mir erzählt, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll«, öffnete sie ihrem geliebten Vater stockend ihr Herz.
»Und was genau hat er beobachtet?«
Anneka senkte den Kopf und spielte nervös mit dem schmalen Silberreif an ihrem Finger.
»Du weißt doch, dass er nachts immer spazieren geht, weil er nachdenken muss.«
»Das muss er doch jetzt nicht mehr«, wandte Daniel ein und dachte an den unglücklichen Gastjungen aus England, der an einem Austauschprogramm teilgenommen hatte, um seine Stiefmutter in Deutschland wiederzufinden und bei ihr zu bleiben. Ehe er überraschend mit einer Blinddarmentzündung in die Behnisch-Klinik gebracht worden war, hatte er ein paar Tage bei der Familie Norden gewohnt. Besonders Anneka hatte in dieser Zeit Freundschaft mit dem schwierigen Teenager geschlossen. »Wir haben Kyra gefunden, mit Jeremys leiblicher Mutter gesprochen und geklärt, dass er in Deutschland ein neues Leben anfangen darf«, erinnerte Dr. Norden seine Tochter.
Ungeduldig verdrehte Anneka die Augen. Manchmal verstanden die Erwachsenen wirklich nichts.
»Das wusste er aber in der vergangenen Nacht noch nicht«, erklärte sie gedehnt.
»Und da ist er wieder spazieren gegangen?«, fragte Daniel entgeistert. »Trotz frischer Operationswunde?«
»Ich hab ihn auch geschimpft. Aber zum Glück scheint es ja gut gegangen zu sein«, fuhr Anneka fort. Es drängte sie, zum Grund dieses Gesprächs zu kommen. »Als er also gestern Nacht unterwegs war, kam er an der Isolationsstation vorbei. Durch die Glasscheibe hat er einen Pfleger in Schutzkleidung beobachtet, der dem schwerkranken Mann Blut abgenommen hat.«
Nachdenklich wiegte Daniel den Kopf.
»Nachts? Das ist sicher ungewöhnlich, aber kommt durchaus hin und wieder vor«, gab er zu bedenken.
Doch Anneka war noch nicht fertig.
»Das dachte sich Jeremy auch und ist weitergegangen«, bestätigte sie und wippte nervös auf Daniel Oberschenkel herum, dass ihm der Muskel wehtat. Er bat sie, stillzusitzen. Sie tat ihm den Gefallen und fuhr fort. »Als er ein paar Minuten später am Aufenthaltsraum für das Pflegepersonal vorbeigekommen ist, hat er den Pfleger wiedergesehen. Durch einen Spalt in der Tür hat Jeremy beobachtet, wie er die Schutzkleidung ganz hektisch in ein Spint gestopft und irgendwas in die Tasche gesteckt hat. Er war sich nicht ganz sicher. Aber Jeremy meinte, es könnte die Blutampulle gewesen sein.«
Während Anneka erzählte, erschien eine steile Falte zwischen Daniels Augen.
»Das wäre furchtbar«, stieß er aufgebracht hervor und starrte seine älteste Tochter forschend an.
»Ich weiß. Der Patient leidet an Ebola«, verkündete Anneka düster.
Zu ihrer Überraschung schüttelte ihr Vater den Kopf.
»Es handelt sich um ein anderes Virus derselben Familie, das ein hämorrhagisches Fieber auslöst. Es nennt sich Marburg Virus und ist kaum weniger gefährlich als Ebola und löst ebenso starke Blutungen der inneren Organe aus. Wenn ein Mensch mit dem infizierten Blut in Kontakt kommt, erkrankt er mit Sicherheit«, erklärte Dr. Norden hektisch und schob Anneka von seinem Oberschenkel. Er sah seine Tochter einmal durchdringend an. Plötzlich war die Stille im Zimmer mit Händen greifbar. Das fröhliche Zwitschern der Vögel im Garten klang wie purer Hohn. »Bist du dir auch ganz sicher, dass Jeremy das alles nicht nur geträumt hat?«, fragte er vorsichtshalber noch einmal nach.
»Du kennst ihn doch. Er würde nie so was behaupten, wenn es nicht wahr wäre. Dazu sind wir ihm viel zu wichtig.«
Daniel Norden seufzte durchdringend.
»Ja, ich weiß.« Er fuhr sich mit den Händen übers Gesicht. »Tust du mir den Gefallen und lässt mich einen Moment allein?«, fragte er zutiefst deprimiert. »Bevor ich einen unbedachten Schritt tue, muss ich genau darüber nachdenken, wie wir jetzt am besten vorgehen. Ich will Jenny möglichst schonend auf die Möglichkeit vorbereiten, dass ihre Klinik in Gefahr ist.«
Verständig, wie Anneka war, nickte sie sofort.
»Klar, Papi.« Mit gesenktem Kopf schlich sie zur Tür.
Dort angekommen rief Daniel noch einmal ihren Namen.
»Und vorerst kein Wort zu den anderen.« Mahnend legte er den Zeigefinger auf die Lippen.
Diesmal lächelte Anneka und schüttelte tadelnd den Kopf.
»Ach, Dad!« Mehr sagte sie nicht. Fast lautlos fiel die Tür hinter ihr ins Schloss.
»Kommst du allein zurecht?« Benedikt Kühnel hatte die Seitenscheibe heruntergekurbelt und sah seine Tochter fragend an. Er hatte sie von der Schule abgeholt und in der Nähe seiner Wohnung abgesetzt, bevor er an seinen Arbeitsplatz in der Behnisch-Klinik zurückkehrte. »Im Tiefkühlfach ist eine Pizza, das weißt du ja.«
Lillis Augen waren groß und glänzten vor Trauer.
»Wann kommst du heim?«, fragte sie kläglich und bemühte sich, nicht allzu traurig auszusehen. Sie wusste ja, dass ihr Papa arbeiten musste, um Geld für sie beide zu verdienen.
Auf Benedikts Stirn erschien eine tiefe Falte.
»So schnell ich kann«, erklärte er unwillig. »Leider muss ich wie jeder andere normale Mensch auch mindestens acht Stunden täglich arbeiten.« Der Wagen stand am Straßenrand nicht weit von der Wohnung entfernt, die zu klein geworden war, seit seine Tochter vor ein paar Wochen zu ihm gezogen war.
Ihre Mutter, von der er schon lange getrennt lebte, war nach langer schwerer Krankheit gestorben. Und nun war Lilli hier in München und stellte sein Single-Leben auf den Kopf.
»Machst du heute wieder Überstunden?«, fragte sie mit ihrer dünnen Stimme.
»Ich denke nicht. Denkst du daran, deine Hausaufgaben zu machen? Ich kann mich doch auf dich verlassen?«, antwortete Benedikt ausweichend und sah nicht, wie Lilli artig nickte.
Im Rückspiegel betrachtete er das bunte Treiben des hektischen Stadtlebens. Ein ungeduldiger Kurierfahrer wartete darauf, dass er endlich den Weg freimachte. »Ich muss los, Schätzchen.« Er streckte die Hand aus, zwickte seine Tochter sanft ins traurige Kinn und setzte den Blinker.
Ein paar Augenblicke später war der Wagen im dichten Verkehr verschwunden.
»He da, aus dem Weg!« Ein Fahrradfahrer schoss auf dem Radweg heran und in letzter Sekunde machte Lilli einen großen Schritt, direkt hinaus auf die belebte Straße. Grelles Hupen ertönte, Reifen quietschten und jemand schrie entsetzt auf. Hände griffen nach Lilli, rissen sie zurück und hielten sie fest. Eine junge Frauenstimme rief erschrocken: »Mädchen, muss ich dein Schutzengel sein?«
Lilli stand stocksteif am Straßenrand und starrte den Mann in einem der Autos an, der wütend die Faust in ihre Richtung schüttelte, bevor er Gas gab und davonbrauste.
»Ich wäre fast überfahren worden«, stammelte Lilli, bleich vor Entsetzen. »Ich glaub, mir ist schlecht …« Sie presste beide Hände auf ihren aufgebrachten Magen.
Die rettenden Hände waren inzwischen von ihren Schultern verschwunden. Trotzdem stand sie wie zur Salzsäule erstarrt einfach nur da. Ihr Herz klopfte so heftig, als wäre sie kilometerweit gelaufen. Langsam drehte sie sich um. Ein Stück von ihr entfernt stand eine junge Frau in einer froschgrünen Jacke und lächelte ihr zu. Über den Verkehrslärm hinweg rief sie ihr zu: »Pass auf dich auf! Schließlich kann ich nicht immer deinen Schutzengel spielen!« Die Frau hob die Hand und winkte ihr zu. Dann drehte sie sich schwungvoll um und verschwand in der Menschenmenge. Ihre bunte Tasche hüpfte fröhlich auf ihrem Rücken.
Lilli starrte ihrem Schutzengel sehnsüchtig nach und fühlte sich plötzlich noch viel einsamer als vorher.
»Warum konnte sie nicht bei mir bleiben?«, fragte sie sich selbst. Statt wie versprochen direkt nach Hause zu gehen, starrte sie die Straße entlang. Der Name eines Kaufhauses prangte in großen Lettern an einem Haus und lockte Lilli mit dem Versprechen auf Gesellschaft. Sie vergaß die Hausaufgaben und machte sich auf den Weg.
Vor den Türen standen Ständer mit luftigen, fröhlichen Sommerkleidern und T-Shirts, durch die Lilli ihre Hände gleiten ließ, ehe sie eintauchte in das geschäftige Treiben.
»Ein Stück Pizza bitte«, verlangte sie an einem Stand, der Pizza-Ecken mit verschiedenen Belägen feilbot.
Der kräftige Verkäufer beugte sich lächelnd über die Theke.
»Welche Sorte soll’s denn sein? Napoli, Margherita? Oder vielleicht eine Prosciutto?«
Beim Anblick der italienischen Köstlichkeiten lief Lilli das Wasser im Mund zusammen. Am liebsten hätte sie sich von jeder Sorte ein Stück gekauft.
»Eine Margherita bitte«, verlangte sie schüchtern und zählte in der Handfläche das Geld ab. Es reichte noch für ein Getränk. »Und eine Cola.« Die war zwar normalerweise verboten. Doch Papa sah sie ja nicht, würde noch nicht einmal nachfragen, wenn er abends nach Hause kam. Das hatte Lilli inzwischen gelernt.
»Du hast eine gute Wahl getroffen.« Alfredo, der Verkäufer, legte ein Stück Pizza auf einen Pappteller und reichte Lilli das fettige, köstlich duftende Gebäck zusammen mit einer Serviette. »Bist du ganz allein hier?« Es standen keine weiteren Kunden an, und er hatte offenbar Zeit und Lust auf ein kleines Gespräch.
Lilli konnte sich nicht beherrschen und biss an Ort und Stelle von ihrem Mittagessen ab. Sie nickte kauend.
»Mein Papa ist in der Arbeit.«
»Den ganzen Tag?« Obwohl die Antwort eigentlich klar war, staunte der Pizza-Verkäufer.
»Ich bin jeden Nachmittag allein«, erklärte Lilli und biss noch einmal ab.
Tomatensauce lief ihr übers Kinn, und Alfredo reichte ihr mitfühlend lächelnd noch eine Serviette.
»Das ist aber nicht schön«, gab er unwillig zurück. »Kinder in deinem Alter brauchen Betreuung und Unterhaltung.«
Der Gedanke an die einsame Wohnung, die wie jeden Nachmittag mit gähnender Leere und beängstigender Stille auf sie wartete, tat Lilli weh.
»Wir ziehen bald in eine größere Wohnung um. Dann bekomme ich ein eigenes Zimmer, und Freunde können mich besuchen. Dann wird alles viel besser«, versicherte sie rasch.
»Und was ist mit der Nachmittagsbetreuung? Die gibt es doch inzwischen an vielen Schulen«, ließ Alfredo nicht locker.
»Die geht nur bis drei Uhr, und dann kann mich Papa nicht mehr abholen. Das passt nicht zu seiner Mittagspause«, hatte Lilli auch hierfür eine Erklärung. »Aber wie gesagt, mit der neuen Wohnung wird sicher alles besser.«
»Na hoffentlich«, brummte er skeptisch, als Lilli aus den Augenwinkeln eine froschgrüne Jacke die Rolltreppe hinunterfahren sah.
»Ich muss gehen!«, rief sie und lief winkend davon, der grünen Jacke hinterher. Ihr Rucksack tanzte erwartungsvoll auf ihrem Rücken.
Überrascht sah Alfredo dem Mädchen mit dem wippenden Pferdeschwanz nach, bis ein Kunde seine Aufmerksamkeit schließlich ablenkte.
Da drängelte sich Lilli schon an den Leuten auf der Rolltreppe vorbei, nahm zwei Stufen auf einmal und erntete böse Blicke, als sie einem Mann um ein Haar den Einkaufskorb aus der Hand schlug. In der Eile vergaß sie sogar, sich zu entschuldigen. All ihr Sehnen galt der froschgrünen Jacke, die im unteren Geschoss in dem Gedränge immer wieder wie ein tröstender Stern am Nachthimmel aufblitzte. Endlich erwischte Lilli ihren Schutzengel an einem Obststand.
»Hallo, Schutzengel!«, keuchte sie und zupfte die grüne Jacke am Ärmel.
Ein Kopf wendete sich zu ihr, sah sich suchend um, ehe er das Kind entdeckte.
»Was willst du denn von mir? Doch nicht etwa meinen Geldbeutel klauen?«, fragte der Mann, der in der froschgrünen Jacke steckte, empört.
Lilli schwitzte, ihre Wangen glühten von der Eile und der Scham, die ihr ins Gesicht gestiegen war.
»Tut mir leid«, murmelte sie, drehte sich um und lief schnell weg.
Draußen vor dem Kaufhaus bemerkte sie, dass sie immer noch den Rest der Pizza in der Hand hielt. Doch der Appetit war ihr gründlich vergangen. Mitsamt der Serviette warf sie ihn in eine Mülltonne und stapfte schlecht gelaunt in die winzige Wohnung ihres Vaters, die weit davon entfernt war, Zuhause genannt zu werden.
Der Zustand des an dem lebensgefährlichen Virus erkrankten Lukas Berwald verschlechterte sich rapide, sodass sich die behandelnden Ärzte gezwungen sahen, die Klinikchefin Jenny Behnisch zu informieren. Die ordnete sofort eine Ultraschalluntersuchung an, die ein erschreckendes Ergebnis hatte.
»Der Magen-Darm-Trakt ist mit Blut gefüllt«, erklärte Dr. Wiefahrn, kaum dass er den Kopf des Ultraschallgeräts auf dem Körper des Patienten aufgesetzt hatte. »Was sollen wir tun?«
»Kreislauf stabilisieren, schnell!« Sie versuchte, das Zittern in ihrer Stimme so gut es ging zu kontrollieren. Ihr entsetzter Blick war auf das Gesicht des Patienten geheftet. Aus seinem Mund rann Blut. Wie so häufig bei dieser Krankheit blutete seine Mundschleimhaut. »Tupfer!«, verlangte sie von einer Schwester.
»Der Blutdruck fällt«, verkündete ein weiterer Arzt, der die Monitore überwachte, die die Vitalfunktionen des Patienten überprüften.
»Legen Sie einen zweiten Zugang«, verlangte Jenny, obwohl sie genau wusste, wie sinnlos dieses Unterfangen war.