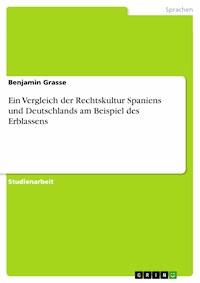
Ein Vergleich der Rechtskultur Spaniens und Deutschlands am Beispiel des Erblassens E-Book
Benjamin Grasse
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Romanistik - Vergleichende Romanistik, Note: 1,3, Humboldt-Universität zu Berlin (Philosophische Fakultät II), Veranstaltung: Sprach- und Kulturvergleich Spanisch- Deutsch, Sprache: Deutsch, Abstract: Versucht man Unterschiede in der Rechtsprache zweier Kulturkreise zu definieren, muss man sich zuerst klar machen, welche signifikanten Aspekte der jeweiligen Rechtskultur vergleichenswert sind. Allein die Zusammensetzung des Substantivs ´Rechtsprache´ eröffnet uns schon zwei Möglichkeiten einer Untersuchung. Dass das Recht an sich, insbesondere die Zivilgesetzbücher, für Spanien der Código Civíl(CC) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) für Deutschland, trotz der räumlichen Enge Europas und der Bestrebung die verschiedenen nationalen Rechtssysteme wenn nicht auf europäischen Niveau zu zentralisieren, wenigstens einander anzunähern, teilweise erhebliche Unterschiede aufweist , dürfte niemanden verwundern. Dies ist zum Teil unterschiedlichen Traditionen oder historischen Entwicklungen zur Staatenbildung geschuldet. Während man Spanien seit der Reconquista als mal mehr mal weniger einheitlichen Staatengebilde betrachten kann, wird auf dem deutschen Territorium der durchaus sehr divergierenden dezentralen Rechtssprechung in den Kleinstaaten erst mit der Reichsgründung von 1871 ein Ende gesetzt. Die heutige Definition der beiden Staaten, die parlamentarische Demokratie in Deutschland und die parlamentarische Monarchie Spaniens, spielen jedoch nur insofern eine Rolle, als dass ein Urteil in Spanien En nombre del rey und in der Bundesrepublik Deutschland Im Namen des Volkes gefällt wird. Auch dass die Sprache des Recht, die Rechtssprache oder besser wäre hier vom Sprachstil des Rechts zu sprechen, Unterschiede aufweist ist wohl für jeden nachvollziehbar. Natürlich ist auch die juristische Sprach eine Fachsprache, welche eben nicht der verbalen transregionalen und transsozialen Verständigung einer Sprachgemeinschaft dient sondern den Experten sich von den anderen, den Nicht-Eingeweihten abzusetzen. So machen es die Fachsprachen nicht nur Fremdsprachlern sondern auch Nativspeakern schwer, dem Anliegen fachbezogener Texte folgen zu können. Für die Linguistik stellt Günther Grewendorf treffend heraus, was auch auf alle Fachsprachen übertragen lässt: „ Die verbreitete Aversion gegenüber linguistischer Theorie liegt zum einem an Fehlern der Linguistik selbst, die es einerseits nicht immer verstanden hat, ihre abstrakten [...] Theorien für Anwendungsbereiche zu operationalisieren, die sich andererseits aber auch durch pseudotheoretischen und prinzipiell nicht vermittelbarem Wissenschaftsjargon bei angewandten Bereichen in Misskredit gebracht hat.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
I. Einleitung
I.I Der Erbfall im BGB und Código Civil
II. Dokumente
II.I Der Erbvertrag
II.II El pacto sucesorio
III. Vergleichende Analyse der Texte
III.I Beteiligte Personen
III.II Wortklassen
III.II.I Partizipien
III.II.II Substantive
III.II.III Adjektive
III.II.IV Rechtssprachlichkeit der Adverbien
III.II.V Tempi der Verben
II.III Phraseologismen
IV. Resümee
V. Bibliographie
Internetseiten
Literatur
Quellen
I. Einleitung
Versucht man Unterschiede in der Rechtsprache zweier Kulturkreise zu definieren, muss man sich zuerst klar machen, welche signifikanten Aspekte der jeweiligen Rechtskultur vergleichenswert sind. Allein die Zusammensetzung des Substantivs ´Rechtsprache´ eröffnet uns schon zwei Möglichkeiten einer Untersuchung. Dass das Recht an sich, insbesondere die Zivilgesetzbücher, für Spanien der Código Civíl(CC) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) für Deutschland, trotz der räumlichen Enge Europas und der Bestrebung die verschiedenen nationalen Rechtssysteme wenn nicht auf europäischen Niveau zu zentralisieren, wenigstens einander anzunähern, teilweise erhebliche Unterschiede aufweist , dürfte niemanden verwundern. Dies ist zum Teil unterschiedlichen Traditionen oder historischen Entwicklungen zur Staatenbildung geschuldet. Während man Spanien seit der Reconquista als mal mehr mal weniger einheitlichen Staatengebilde betrachten kann, wird auf dem deutschen Territorium der durchaus sehr divergierenden dezentralen Rechtssprechung in den Kleinstaaten erst mit der Reichsgründung von 1871 ein Ende gesetzt.[1]
Die heutige Definition der beiden Staaten, die parlamentarische Demokratie in Deutschland und die parlamentarische Monarchie Spaniens, spielen jedoch nur insofern eine Rolle, als dass ein Urteil in Spanien En nombre del rey und in der Bundesrepublik Deutschland Im Namen des Volkes gefällt wird.
Auch dass die Sprache des Recht, die Rechtssprache oder besser wäre hier vom Sprachstil des Rechts zu sprechen, Unterschiede aufweist ist wohl für jeden nachvollziehbar. Natürlich ist auch die juristische Sprach eine Fachsprache, welche eben nicht der verbalen transregionalen und transsozialen Verständigung einer Sprachgemeinschaft dient[2] sondern den Experten sich von den anderen, den Nicht-Eingeweihten abzusetzen.[3] So machen es die Fachsprachen nicht nur Fremdsprachlern sondern auch Nativspeakern schwer, dem Anliegen fachbezogener Texte folgen zu können. Für die Linguistik stellt Günther Grewendorf treffend heraus, was auch auf alle Fachsprachen übertragen lässt: „ Die verbreitete Aversion gegenüber linguistischer Theorie liegt zum einem an Fehlern der Linguistik selbst, die es einerseits nicht immer verstanden hat, ihre abstrakten [...] Theorien für Anwendungsbereiche zu operationalisieren, die sich andererseits aber auch durch pseudotheoretischen und prinzipiell nicht vermittelbarem Wissenschaftsjargon bei angewandten Bereichen in Misskredit gebracht hat.“[4] Gerade die deutsche Sprache hat fachbezogene Wortkonstrukte hervorgebracht, deren Bedeutung sich durchschnittlich gebildeten Muttersprachlern verschließt und ein wörtliches Übersetzen kaum ermöglichen. Stengel- Hauptvogel führt dies auf die Aufwertung des Deutschen gegenüber dem Französischen während der Romantik zurück und zitiert klassische Beispiele wie Ausstellungstag für Datum, Fernsprecher für Telefon, oder Liegenschaften für Immobilien um die Sperrigkeit der deutschen juristischen Fachsprache zu verdeutlichen.[5]
Aufgabe wird daher sein herauszustellen, inwiefern es, signifikante Abweichungen in der spanischen und deutschen Rechtssprechung gibt, um dann an einem Beispieldokument in spanischer und deutscher Ausführung die Anwendung der Rechtssprache hinsichtlich ihrer Verständlichkeit und Formalität zu untersuchen.
I.I Der Erbfall im BGB und Código Civil
Die wichtigste für alle verständliche Regel im Erbfall dürfte sich wohl kaum von der anderer Länder unterscheiden. Dass „Mit dem Tode einer Person(Erbfall) [...] deren Vermögen (Erbschaft) als ganzes auf eine, oder mehrere Personen [übergeht]“[6] , ist allgemein nachvollziehbar ohne den Gesetzestext zu kennen. Auch die disposiciones generales im Libro III des CC[7] gehen vom selben Umstand aus, welcher den Erbfall hervorruft, jedoch muss der Erbe, oder die Erbengemeinschaft, „ganz nach Tradition der romanischen Rechte“[8] die Erbschaftsannahme ausdrücklich erklären.[9]
Obwohl das internationale Erbrecht beider Staaten als annähernd gleich zu betrachten ist, gibt es jedoch hinsichtlich des nationalen Erbrechts erhebliche Unterschiede, welche insbesondere für Erblasser, welche Besitzungen im jeweils anderen Land, oder Erben mit der jeweils anderen Staatsangehörigkeit haben, von Bedeutung sind.
Gleichermaßen für Spanien wie auch für das deutsche Erbrecht gilt bei Nichtvorhandensein einer letztwilligen Verfügung oder Ähnlichem die gesetzliche Erbfolge. Während man jedoch im deutschen Erbrecht davon ausgeht, dass die gesetzliche Erbfolge der Regelfall sei, stellt das spanische Recht die gewillkürte Erbfolge über die gesetzliche und räumt damit dem letzten Willen des Erblassers eindeutig den Vorrang ein.[10]





























