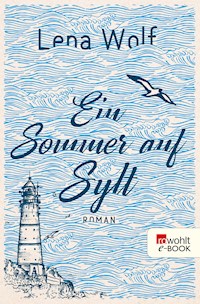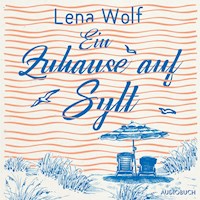
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Schwestern, ein Bauernhof am Meer und ein Tierarzt, der auch Herzen heilt. Wie hat sich Ella auf ein paar Tage mit ihrem Vater am Meer gefreut! Sie konnte ja nicht ahnen, dass sie auf Sylt ihrer Schwester begegnen würde. Seit Jahren haben die beiden keinen Kontakt, und nun sehen sie sich ausgerechnet auf einem kleinen Hof bei Morsum wieder. Ina hilft hier mit den Hühnern und Ziegen aus, sie konnte schon immer besser mit Tieren als mit Menschen. Doch die Versöhnungspläne des Vaters scheitern, alte Wunden brechen auf. Ella will schon die Koffer packen, wären da nicht die anderen Bewohner des Karsenhofs. Allen voran Tom, der Enkel der Hofbesitzerin. Er ist Tierarzt und kennt sich nicht nur mit störrischen Vierbeinern aus. Durch Tom lernt Ella die schönsten Seiten der Insel kennen. Und sie versteht, wieso ihre Schwester auf dem Hof ein neues Zuhause gefunden hat. Denn ist Familie nicht vor allem eine Sache des Herzens? Sommer, Sonne, Sylt: eine charmante Liebesgeschichte von der Spiegel-Bestseller-Autorin von «Ein Sommer auf Sylt».
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Lena Wolf
Ein Zuhause auf Sylt
Roman
Über dieses Buch
«Du befindest dich seit 24 Stunden auf Sylt und warst noch nicht am Meer?» Er stemmt die Hände in die Seiten. «Das müssen wir schleunigst ändern!»
Wie hat sich Ella auf ein paar Tage mit ihrem Vater am Meer gefreut! Sie konnte ja nicht ahnen, dass sie auf Sylt ihrer Schwester begegnen würde. Seit Jahren haben die beiden keinen Kontakt, und nun sehen sie sich ausgerechnet auf einem kleinen Hof bei Morsum wieder. Ina hilft hier mit den Hühnern und Ziegen aus, sie konnte schon immer besser mit Tieren als mit Menschen. Doch die Versöhnungspläne des Vaters scheitern, alte Wunden brechen auf. Ella will schon die Koffer packen, wären da nicht die anderen Bewohner des Karsenhofs. Allen voran Tom, der Enkel der Hofbesitzerin. Er ist Tierarzt und kennt sich nicht nur mit störrischen Vierbeinern aus. Durch Tom lernt Ella die schönsten Seiten der Insel kennen. Und sie versteht, wieso ihre Schwester auf dem Hof ein neues Zuhause gefunden hat. Denn ist Familie nicht vor allem eine Sache des Herzens?
Zwei Schwestern, ein Bauernhof am Meer und ein Tierarzt, der auch Herzen heilt.
Über «Ein Sommer auf Sylt»:
«Mit leichter Feder und guter Story … Eine echte Empfehlung für den Strandkorb!» (Ruhr Nachrichten)
«Eine beschwingte Liebeserklärung an die Insel Sylt!» (Sylter Rundschau)
Vita
Lena Wolf ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin aus Norddeutschland. Zuletzt landete sie mit «Ein Sommer auf Sylt» einen Spiegel-Bestseller. Ihre Urlaube verbringt sie am liebsten mit der Familie. Im Gegensatz zu ihrer Protagonistin träumt sie allerdings noch von einem Zuhause auf Sylt.
Mehr über die Autorin unter: www.lenaswolf.de
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-00970-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1.Kapitel
«Du fährst ein klitzekleines bisschen zu schnell, Papa.» Es ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Die Tachonadel des alten Mitsubishis zittert wie ein nervöses Insekt hinter der Plastikverkleidung, und zwar knapp oberhalb der Zahl 80. Erlaubt sind auf dieser Landstraße aber nur 50, was bedeutet: Mein Vater hat die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit auch mit viel Wohlwollen längst überschritten.
Ich verschlinge meine schwitzigen Hände ineinander und verschränke sie vor der Brust. Mein Blick schweift kurz nach rechts, zum Fenster hinaus, wo sich wattebauschartige Schönwetterwolken über endlos weiten Wiesen auftun. Es ist ein so sattes, frisches Grün, dass ich unweigerlich tief einatme. Den Stress wegatme. Denn leider ist mein Vater, was sein Auto und alle damit verbundenen Angelegenheiten anbelangt, inklusive seines Fahrstils, etwasdünnhäutig. Man muss genau abwägen, ob das, was man sagen möchte, auch wirklichwichtig ist. Falls ja, bestäubt man die Worte am besten dick mit Zucker, ehe man sie ihm, locker-fluffig und in einem Nebensatz verschachtelt, zuspielt. In allen anderen Fällen hilft nur, die Zähne zusammenzubeißen.
«Papa …», setze ich ein weiteres Mal an, denn 30 km/h Geschwindigkeitsübertritt empfinde ich als wirklich wichtigen Grund, eine Diskussion anzuzetteln. Kurz erwäge ich, ihn auch noch auf das Airbag-Symbol hinzuweisen, das seit Beginn unserer gemeinsamen Fahrt, also etwa seit 700 Kilometern, wie ein paarungswilliges Glühwürmchen flimmert. Doch ich habe eine Ahnung, was ich zur Antwort bekomme, nämlich denselben Vortrag, der sich bereits heute Morgen über mich ergossen hat, als ich den betagten Carisma wegen der kontrollbedürftigen Stoßdämpfer kritisiert habe.
«Schätzchen», dozierte Papa mit erhobener Stimme, «das sind zu vernachlässigende Verschleißerscheinungen. Dieser Fahrzeugtyp wurde von führenden Experten für seine herausragende Verarbeitung gelobt, die sich bis ins letzte Detail bemerkbar macht. Sogar für das Gepäcknetz gab es vom ADAC ein extra Sternchen. Weißt du», ein kurzer Blick streifte mich, «mir tun ja auch die Knie weh, weil ich früher Marathonläufer war. Darum gehöre ich aber noch lange nicht auf die Ersatzbank.»
Tja, so ist mein Vater nun mal, loyal und mitfühlend. Heute hat er für mein Empfinden allerdings ein wenig zu dick aufgetragen. Papa soll Marathon gelaufen sein? Wann das denn? In unserer Familie war eigentlich eher Mama die Aktive, wohingegen Papas Bewegungsdrang sich darauf beschränkte, mit einer Banane und vielen gut gemeinten Ratschlägen am Rande eines Sportereignisses zu stehen, um andere anzufeuern. Im Übrigen hat das morsche Gepäcknetz nicht mal einen Sommerurlaub überstanden. Aber das ist in diesem Moment nicht wirklich wichtig, also beiße ich mir auf die Lippen und verkneife mir jeden weiteren Kommentar. Trotzdem möchte ich gern mal wissen, warum er es plötzlich dermaßen eilig hat.
Zugegeben, wir waren die letzte halbe Stunde zum Stillstand verdonnert, während wir mit dem Autozug über den Hindenburgdamm ratterten und nichts tun konnten, außer die Landschaft zu betrachten. Doch die war phänomenal. Zartblauer Himmel, so weit das Auge reicht, und das idyllische Bild der Vogelschwärme, die friedlich im Watt herumstolzierten, hat mich berührt. Auch mein Vater wirkte in sich gekehrt. Bis zu dem Augenblick, als wir Westerland erreichten. Kaum dass der Zug hielt und er mit quietschenden Reifen losgedüst ist, als sei der Fahrkartenkontrolleur hinter uns her, schien nicht nur beim Airbag, sondern auch bei ihm eine Sicherung durchgebrannt zu sein.
Ich räuspere mich und beuge mich ein wenig vor, um meinem Vater ernst in die Augen sehen zu können. Wie immer trägt Papa eine Schiebermütze, die er sich exakt so tief ins Gesicht gezogen hat, dass er den Verkehr gerade noch zu erkennen vermag. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich ihn das letzte Mal ohne Mütze gesehen habe, er besitzt sie in allen Farben und Mustern. Im Winter wählt er wärmenden Tweed in klassischem Karomuster und erinnert mich dann an einen abgeklärten Grundbesitzer, der sonntags im Oldtimer seine Liegenschaften abklappert. Jetzt, im Sommer, bevorzugt Papa leichte unifarbene Modelle aus Leinen, auch um sein schütter werdendes Haar und die Kopfhaut vor der Sonne zu schützen.
«Papa, bitte drossele das Tempo», bringe ich endlich hervor. Sanft, aber eindringlich und ganz dick mit Zucker bestreut. Doch ich werde schlichtweg ignoriert. Mein Vater hebt das Kinn – und schaltet einen Gang höher. Ich kralle mich an meiner Jeans fest.
«Entspann dich, Schätzchen», sagt er ungerührt und tätschelt beschwichtigend meine schwitzige Hand. «Ich habe die Währungsunion überstanden, musste den Mauerbau erdulden und später mitansehen, wie die Besatzung der Apollo 11 auf dem Mond gelandet ist. Um mich brauchst du dich nicht zu sorgen.»
Und was ist mit mir?, jaule ich innerlich. Ich sitze doch auch in diesem Auto! Mal abgesehen davon, dass mir der Zusammenhang von Mondlandung und dieser Kamikazefahrt nicht einleuchten will, hinkt sein Vergleich an mindestens einer weiteren Stelle: «Papa, bei der Währungsreform warst du noch ein Baby», erinnere ich ihn.
«Weiß ich doch, Ella. Und trotzdem habe ich sie überstanden.» Er schaut kurz zur Seite und schenkt mir ein verschmitztes Lächeln, was die Sache aber nicht besser macht. Mein Vater ist 74 Jahre alt und befindet sich seiner Meinung nach im besten Alter. Auch weil er seit 15 Jahren keine Arztpraxis von innen gesehen hat, worauf er derart stolz ist, dass er es bei keiner Unterhaltung unerwähnt lässt. Dass er während dieser Fahrt noch nicht darauf zu sprechen gekommen ist, grenzt an ein Wunder.
Ebenso wie ich es kurios finde, dass er nicht ein einziges Mal von Ina angefangen hat. Zum Glück. Über sie möchte ich nun wirklich nicht sprechen. Ina ist meine große Schwester, besser gesagt war sie es, bevor sie vollkommen durchgedreht ist und unsere Familie zerstört hat. So sehe ich die Sache jedenfalls.
Ich presse mich nach hinten gegen die Lehne, um dem Druck entgegenzuwirken, der sich in meiner Magengegend zusammenbraut. Wie so ziemlich jedes Mal, wenn ich an Ina denke. Und daran, wie Papa sich über die Jahre damit abfinden konnte. Mit Inas Verschwinden, aber auch mit Mamas Tod. Er hat im Laufe der Zeit diese Das-Leben-ist-kurz-wir-müssen-das-Beste-draus-machen-Sicht auf die Dinge entwickelt, die, wie ich finde, vieles verklärt und die ich in Bezug auf Ina absolut nicht nachvollziehen kann. Dass er bei mir jedes Mal alte Wunden aufreißt, wenn er von ihr zu sprechen anfängt, will ihm partout nicht in den Kopf. Ebenso wie er nicht akzeptieren kann, dass ich sie nicht wiedersehen möchte.
«Weißt du noch damals?», kommt es prompt, und nur mit viel Mühe widerstehe ich dem Drang, mir wie ein störrisches Kind die Ohren zuzuhalten. Aber zum Glück will Papa auf etwas anderes hinaus. «Als du klein warst und ich dir gar nicht schnell genug fahren konnte? Ständig hast du mich angespornt, die Vögel am Himmel einzuholen.»
Bei der Erinnerung an diese unbekümmerte, lange zurückliegende Zeit mindert sich meine Anspannung für einen kurzen Moment, und ich werde fast ein wenig wehmütig. Damals, als wir noch zu viert waren. Eine glückliche Familie.
Schnell schiebe ich die Bilder von mir weg. «Das liegt Ewigkeiten zurück, Papa. Inzwischen bin ich 32, habe selbst einen Führerschein und kenne die Unfallstatistiken.» Ich mache eine strategische Pause, um meinem Vater Zeit zu geben, aus der Vergangenheit zurück ins Hier und Jetzt zu gelangen. Mein Tonfall wird eindringlich. «Und ich kann Verkehrsschilder lesen.» Einen Augenblick belasse ich es bei dieser Andeutung, in der Hoffnung, mein Vater würde nun den Fuß vom Gaspedal lösen. Doch ich täusche mich.
«Das kann ich ebenfalls», kontert er. «Aber der Kerl vor uns offenbar nicht. Warum bummelt der mit sechzig vor uns her, wenn man hier 80 fahren darf?»
Schlagartig ist auch der letzte Funken sentimentaler Rührseligkeit aus meinen Gedanken verschwunden. Meine Augen werden riesengroß. «Aber auf dem Schild eben stand 50!»
Endlich tritt mein Vater auf die Bremse. Und zwar dermaßen gewaltsam, dass unser Gepäck im Kofferraum nur so hin und her poltert. Ich werde gegen den Gurt gepresst, eine Woge Stresshormone brandet über mich hinweg, und mir bricht der Schweiß aus.
«Gefällt es dir so besser?», grummelt mein Vater, nachdem wir einen Moment angespannt geschwiegen haben. Soeben sind wir an das Ende eines kleinen Staus herangefahren und werden im Schritttempo einspurig an einer Baustelle vorbeigeleitet. Stop-and-go.
«Absolut!», sage ich und kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Dazu stoße ich einen theatralischen Seufzer aus, als Zeichen, dass mir die Ironie in seinem Tonfall nicht entgangen ist. «So gefällt es mir viel besser.»
Eine Weile hängen wir jeder unseren Gedanken nach, und ich schließe kurz ermattet die Augen. Hoffentlich geht das nicht in diesem Stil weiter, überlege ich. Papa wirkt dermaßen fahrig und unkonzentriert, dass ich mir langsam Sorgen mache. Zum Glück liegen zwei gemeinsame Wochen Urlaub vor uns, genug Zeit, ihm auf den Zahn zu fühlen. Möchte wirklich mal wissen, was mit ihm los ist.
Zwei Wochen – so viel Zeit haben Papa und ich uns nie zuvor genommen, wenn wir zusammen Ferien genossen haben. Seit beinahe acht Jahren gönnen wir uns dieses wunderbare Ritual – quality time, Vater und Tochter. Wir sind ein eingespieltes Team und folgen unserem eigenen Konzept: Abwechselnd sucht einer von uns das Reiseziel aus, der andere lässt sich überraschen. Und zwar ohne zu murren, was zugegebenermaßen manchmal nicht ganz leicht ist. Im letzten Sommer bin ich beispielsweise an meine Grenzen gestoßen. Papa war an der Reihe, und wie immer drängte es ihn zu einem eigenwilligen Ziel: den schottischen Inseln. Und so kam es, dass ich eine Woche auf Fair Isle verbrachte, alle Schafe mit Vor- und Nachnamen kennenlernte und mir Vorträge über Wolle und Färbetechniken anhören musste. Es war Mitte Juli, und während die Menschen zu Hause in Deutschland vor Hitze Gärten und Felder wässern mussten, strickte Papa mit wachsender Begeisterung Schals und Pullover in den schottischen Nationalfarben. Wir hatten 11 Grad, und ich fror wie ein Schneider, trotzdem würde ich sagen, die Reise war … nun ja … durchaus eine Bereicherung. Eine unvergessliche und intensive gemeinsame Zeit.
In diesem Jahr wäre eigentlich ich mit der Planung an der Reihe gewesen, und in der Tat hatte ich im Dezember bereits begonnen, meine Fühler auszustrecken. Mir schwebte ein beschaulicher Badeurlaub auf Kreta vor: Strand, Wellness und abends gemütlich Kartenspielen, während wir uns bei einem kühlen geharzten Weißwein die nötige Bettschwere antrinken. Ich hatte sogar schon ein süßes verschlafenes Nest gefunden, ein wenig ab vom Trubel, denn ich hegte einen speziellen Plan. Unter südlicher Sonne wollte ich Papa endlich mit Bastian, meinem Freund, bekannt machen. Die beiden hatten sich bislang nur ein paar Mal flüchtig getroffen, auf Kreta sollten sie sich genauer kennenlernen.
Doch ehe ich buchen konnte, geschahen zwei Dinge.
Erstens: Papa grätschte in die Planung. Wegen einer supertollen Überraschung, die seiner Meinung nach kein Jahr Aufschub duldete, wollte er mit unserer Tradition brechen und das zweite Jahr in Folge die Reise organisieren.
Zweitens (und das ließ mir Punkt 1 wie einen glücklichen Wink des Schicksals erscheinen): Bastian und ich haben uns getrennt. Es kam aus heiterem Himmel, genau genommen kam sie aus heiterem Himmel: Sarah. Unsere neue Arbeitskollegin. Hübsch, klug und überaus fleißig. Vor allem als es darum ging, Bastian in ihr Bett zu zerren.
Ich muss schlucken und öffne die Augen. Nachdenklich schaue ich aus dem Fenster. Über uns lächelt die Sonne, der Himmel ist noch immer strahlend blau. Eine Möwe umkreist unseren Wagen. Sie linst mal links, mal rechts durch die Scheiben und scheint darauf zu lauern, dass wir ihr etwas zu essen anbieten. Erst als irgendwo eine Hupe ertönt, flattert sie kreischend davon.
Etwa zum hundertsten Mal überlege ich, ob es ein Fehler war, Nein zu sagen. Der Moment, als Bastian mir seinen Fehltritt gestanden und mit Tränen in den Augen geschworen hat, dass ihm ein derartiger Fauxpas niemals wieder unterlaufen würde, war entsetzlich. Es fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Zumal sich im Zuge dieser Beichte herausstellte, dass es nicht bei einer heißen Liebesnacht geblieben war. Einen Ausrutscher hätte ich ja vielleicht noch akzeptiert, aber der Gedanke, über Wochen hintergangen worden zu sein, zog mir regelrecht den Boden unter meinen Füßen weg. Alles, was mir wichtig gewesen war, seine Liebe und Loyalität, aber auch der Zusammenhalt seiner Familie, war von einer Sekunde auf die andere zerstört. Dass er mir dann aus Reue im selben Augenblick einen Heiratsantrag machte, schmälerte meinen Kummer kaum. Weil es mir falsch vorkam. Denn mal ehrlich, welche Frau möchte unter solchen Umständen um ihre Hand gebeten werden? Ich bin wirklich ein aufgeschlossener und kreativer Mensch und würde vermutlich sogar einen Antrag beim Kühemelken oder Kärchern charmant finden. Aber als Wiedergutmachung für ein derart illoyales Verhalten? Ich schüttele kaum merklich den Kopf. Darauf konnte und wollte ich keinen gemeinsamen Lebensplan aufbauen.
Und ich will es noch immer nicht. Trotzdem geistert Bastian täglich durch meine Gedanken, und mein Herz fühlt sich jedes Mal ganz schwer an, wenn ich mal wieder ins Grübeln gerate. Darüber, was mit unserer Liebe geschehen ist und warum.
Inzwischen liegt dieses Ereignis mehr als ein halbes Jahr zurück, und ich … tja … bin keinen Schritt weiter. Es fällt mir schwer, einen konsequenten Schlussstrich zu ziehen, denn es hängt so vieles daran. Bastian und ich, seine zwei Brüder sowie deren Frauen, wir alle arbeiten in derselben Firma: der Brauerei Cornelsen. Cornbräu. Ein Familienunternehmen, das in dritter Generation von Bastians Vater geführt wird und in der Nähe von Reutlingen angesiedelt ist. Außerdem wohnen wir alle gemeinsam im großen Anwesen der Familie. Jedes Paar verfügt zwar über ein riesiges, eigenes Zimmer mit angeschlossenem Bad, doch die restlichen Räumlichkeiten teilen wir uns.
Ganz sicher wäre es nachvollziehbar gewesen, wenn ich Bastian gleich nach seinem Geständnis den Rücken zugekehrt hätte, doch ich konnte es nicht. Seine gesamte Verwandtschaft liegt mir am Herzen, vielleicht weil in meiner so viel schiefgelaufen ist.
Hinzu kommt, dass ich bei Cornbräu einen verantwortungsvollen Job bekleide. Ich bin das Sprachrohr zum Kunden, plane und organisiere Events, Brauereibesichtigungen und alles drum herum. Seit Kurzem bin ich sogar maßgeblich mit der Planung eines Bistros auf dem Firmengelände betraut – ich kann die Cornelsens nicht im Stich lassen.
Diese Reise ist meine erste Auszeit, und ich verspreche mir von den kommenden Wochen vor allem eins: Zeit mit Papa. Zeit zum Reden. Ich will ihm in Ruhe von der Trennung erzählen und meine Gedanken und Sorgen mit ihm teilen. Klar hat Papa haufenweise Eigenarten, und manchmal wünsche ich ihn samt seiner Apollo 11 auf den Mond, aber diese Augenblicke sind selten und nichts im Vergleich zu den vielen Stunden, in denen er mein bester Ratgeber war. Schon vor Mamas Tod, vor 15 Jahren, war er mein Fels in der Brandung, und ich werde ganz sicher nie aufhören, ihn um Rat zu fragen.
Ich spüre, wie ich von einer Woge sentimentaler Gefühle ergriffen werde, und mustere meinen Vater liebevoll von der Seite. Er trägt ein beigefarbenes Poloshirt aus Baumwolle, der oberste Knopf des Kragens steht offen. Erst jetzt fällt mir der gestrickte, dünne Schal darunter auf, mit dem er offenbar die schlaffer werdende Haut an seinem Hals kaschieren möchte. Ich weiß gar nicht, was mich mehr irritiert, dass Handarbeiten ein ernst zu nehmendes Hobby meines Vaters geworden sein könnten oder die Tatsache, dass man ihm sein Alter langsam ansieht. Der Anflug eines schlechten Gewissens pikt mich. Eine viel zu lange Zeitspanne ist vergangen, die wir mit Telefonieren überbrückt haben, doch auch Videotelefonie ersetzt keine Treffen unter vier Augen. Zumal mein Vater nicht gerade meisterhaft mit der modernen Technik umgeht. Entweder ist bei ihm besetzt, weil er vergisst, nach dem Telefonieren aufzulegen, oder aber er hält den Apparat falsch herum. Seit Monaten habe ich ihn unscharf oder pixelig zu Gesicht bekommen, und manchmal sehe ich auch nur sein Ohr, weil er versehentlich das Handy an die Wange presst.
Ich stoße einen tiefen Seufzer aus. Es tut unendlich gut, Papa wiederzusehen. Schon als ich gestern gegen Mittag in meiner ehemaligen Heimat Frankfurt ankam, wo Papa noch immer lebt, und er mit seiner Schiebermütze auf dem Kopf und einer Tafel dunkler Schokolade in der Hand auf dem Bahnsteig wartete, wurde ich von meinen Gefühlen übermannt.
Mein Vater räuspert sich. «Ella, ich muss dir etwas sagen.» Er linst scheu unter der Schiebermütze hervor. Der Stau will und will sich nicht auflösen, sodass Papas Blick längere Zeit auf mir ruht.
Ich fürchte, dass er nun doch von Ina anfangen will, darum überspiele ich die Situation mit einem Witz. «Falls du mir beichten möchtest, dass wir unseren Urlaub in diesem Jahr auf Sylt verbringen werden, obwohl ich doch ein Fan südlicher Sonne bin, kann ich dich beruhigen: Ich habe es bereits herausgefunden.» Entwaffnend grinse ich meinen Vater an.
«Nein, das ist es nicht.» Sein Gesichtsausdruck bleibt ernst, während seine Hände den Strickschal umklammern, als wolle er sich selbst damit strangulieren. «Es ist …» Er beugt sich vor und beginnt im Handschuhfach nach etwas zu kramen. Ein Stück hat sich die Schlange vor uns bewegt, etwa drei Meter. Hinter uns wird gehupt. Papa unterbricht die Suche, schließt auf und nestelt gleich darauf wieder nervös in dem Fach.
«Was fehlt?», erkundige ich mich. «Soll ich dir suchen helfen?»
Hektisch winkt mein Vater ab und stöbert weiter. «Nein, danke dir. Es ist … also … ich hab’s gleich.»
Natürlich will er keine Hilfe, war ja klar. Ich schaue ostentativ wieder aus dem Fenster und verkneife mir sogar einen Kommentar, als Papa für mehr Bewegungsfreiheit geräuschvoll seinen Anschnallgurt löst. Der Wagen vor uns hat erneut ein paar Meter wettgemacht, doch dieses Mal bleibt Papa auf die Suche fokussiert. Ächzend reckt er sich in seinem Sitz nach vorn, um mit den Händen bis in den hintersten Winkel des vollgestopften Fachs vorzudringen. Während ich mich noch frage, was zum Geier er dort drinnen alles deponiert hat, drückt er sich plötzlich mit dem Fuß ab, bäumt sich regelrecht auf und stößt ein siegessicheres «Ha!» aus. Exakt im selben Augenblick vollführt der Wagen einen Riesensatz – und kracht ins Heck des Vordermanns.
Ich werde mit Wucht in meinen Gurt gepresst, Glas splittert. Papa rutscht mit dem Oberkörper auf meinen Schoß und danach in den Fußraum. Seine Schiebermütze segelt an meinem Ohr vorbei. Dann herrscht für einen kurzen geisterhaften Moment Totenstille.
2.Kapitel
«Karsenhof. Wir müssen zum Karsenhof.» Mein Vater klingt erstaunlich gefasst, als er sich aus der Tiefe des Wagens emporkämpft. «Hier steht’s!» Triumphierend hält er einen Zettel wie eine gewonnene Trophäe in die Luft. Doch die Hand beginnt zu zittern, und auf seiner Stirn funkeln unzählige Schweißperlen.
«Du … liebe Zeit», stottere ich und muss mich selbst erst einmal sammeln. «Geht es dir gut? Tut dir was weh?» Ich helfe ihm auf den Fahrersitz und suche sein Gesicht nach Blessuren ab, kann aber nichts entdecken.
«Alles bestens. Und bei dir, mein Schatz?»
«Ich bin okay.» Während mein Vater sich nun endlich im Sitz zurücklehnt, um einen Moment durchzuatmen, wird im Wagen vor uns die Tür aufgerissen, und ein schlaksiger Kerl in Jeans, hautengem Stretchhemd und mit verspiegelter Pilotenbrille springt heraus. Wie ein aufgescheuchtes Huhn hüpft er um sein Auto herum, um den Schaden aus jeder Himmelsrichtung zu begutachten, wobei er mit hochrotem Gesicht in regelmäßigen Abständen die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.
«Verdammt und zugenäht», poltert mein Vater, der das Treiben ebenfalls verfolgt. «Hätte der Armleuchter nicht einen Tick weiter nach vorn fahren können?»
Ich weiß nicht recht, was ich darauf sagen soll. Papa ist entweder altersstarrsinniger, als ich dachte, oder aber er steht erheblich unter Schock. Den Fahrer vor uns trifft nun wirklich keine Schuld. Mit einem mehr als mulmigen Gefühl im Magen recke ich meinen Hals, um die Lage besser beurteilen zu können. Ich weiß, ich sollte aussteigen, um das Gespräch zu suchen und mich zu entschuldigen, doch die Szene vor meinen Augen wird immer skurriler. In dieser Sekunde zaubert der Kerl aus jeder Seite seiner Jeanstaschen ein Handy hervor und beginnt, synchron mit beiden zu telefonieren. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, und mir wird schrecklich heiß.
Papa donnert mit der flachen Hand auf das Lenkrad. «Na, der bekommt jetzt aber was zu hören!» Er angelt auf der Rückbank nach seiner Schiebermütze, stülpt sie sich mit Schwung über und macht sich daran, die Fahrertür zu öffnen. Ich umklammere seinen Arm.
«Warte!», rufe ich energisch und vergesse in der Aufregung, meine Worte mit Zuckerguss zu versehen. «Ich regele das. Du. Bleibst. Hier. Drinnen.»
Papa trägt eindeutig die Verantwortung an diesem Zusammenstoß, aber ich fürchte, dass ihm gerade ein bisschen der Sinn für die Realität abhandengekommen ist. Nicht dass die beiden Männer sich ernsthaft in die Wolle bekommen und am Ende noch prügeln. «Draußen ist es viel zu heiß», erkläre ich ein wenig versöhnlicher. Es war ins Blaue geschossen, denn natürlich hat der Mitsubishi keinen Bordcomputer. Und wenn, würde er vermutlich nicht funktionieren.
«Ich strotze vor Gesundheit! In diesem Jahr war ich noch kein einziges Mal beim …»
Ungeduldig nicke ich. «Und das soll auch so bleiben!», falle ich ihm ins Wort. Ehe er etwas erwidern kann, schnappe ich mir meine Handtasche und springe aus dem Wagen.
Es macht mir nichts aus, mich mit dem Typen auseinanderzusetzen. Ich kann Fehler eingestehen und halte mich für diplomatisch. Probleme zu lösen ist quasi mein tägliches Brot in der Brauerei. «Such du unterdessen schon mal deine Papiere zusammen», raune ich meinem Vater schnell noch zu, ehe ich mit Schwung die Wagentür von außen zuknalle. Dann wende ich mich an unseren Vordermann. Der Typ hat seine Telefonate inzwischen beendet und die Handys wieder in den Hosentaschen verstaut. Mit verschränkten Armen baut er sich vor mir auf.
«Es tut mir wahnsinnig leid», sage ich und lächele versöhnlich über seine erzürnte Miene hinweg. Nebenbei begutachte ich unauffällig den Schaden. Verdammt! Ich verstehe ja nicht viel von Autos, aber seins sieht leider ziemlich neu und gepflegt aus. Und zerdeppert. Es ist ein Mercedes, in dessen tiefschwarzem Lack sich die Sonne gleichermaßen spiegelt wie in der Pilotenbrille des Besitzers. Mir wird angst und bange. Hoffentlich ist Papa versichert, kommt es mir in den Sinn. Denn wenn ich es mir recht überlege, war Mama immer diejenige, die den Papierkram erledigt hat. Papa ist eher … nun ja, unorganisiert. Der mit der Banane und den guten Ratschlägen.
Gerade schiebt der Kerl sich die Sonnenbrille auf die Stirnmitte, wo sie wie festgeklebt haften bleibt. Aus eisblauen Augen fixiert er mich. «Das wird teuer!», motzt er. «Mein Mercedes ist keine zwei Wochen alt. Und dank dem alten Mann da hinterm Steuer hat er nun die Hälfte seines Werts eingebüßt.»
Die diplomatische Problemlöserin in mir will irgendwie nicht recht zutage treten, was unter anderem daran liegen könnte, dass ich fasziniert auf die Brille meines Gegenübers starre. Wie schafft er es nur, dass sie dort festbappt? Ich widerstehe dem Drang, danach zu greifen und mal kurz dran zu wackeln, und fasse mir ein Herz. «Selbstverständlich sind wir versichert und kommen für den Schaden auf», schaffe ich es mit belegter Stimme hervorzubringen. Wird schon so sein. «Mein Vater sucht in diesem Moment die Unterlagen heraus.» Ich strecke dem Kerl meine Hand entgegen und zaubere erneut ein Lächeln in mein Gesicht. «Ich bin übrigens Ella. Ella Lorenz. Und ich möchte mich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen.»
Er mustert mich mit erkennbarem Misstrauen. Als sei ich ein Scherzkeks, der seine Finger mit Rübensaft oder sonst einer klebrigen Substanz beschmiert hat, entscheidet er sich, meine Hand zu ignorieren. Stattdessen nickt er knapp, fischt wortlos eines der beiden Handys hervor und beginnt, Fotos der angedätschten Heckschürze zu knipsen.
Peinlich berührt beobachte ich ihn dabei. Von Nahem betrachtet, sieht das Hinterteil des Mercedes sogar noch gruseliger aus, wohingegen Papas alter Wagen kaum Blessuren aufweist. Herausragende Verarbeitung, kommt es mir in den Sinn, von führenden Experten bewertet. Wobei man fairerweise sagen sollte: Papas Auto weist kaum neue Blessuren auf. Die meisten Schrammen und Dellen waren mir bereits vor unserer Abfahrt aufgefallen.
Vielleicht sollte ich zur Sicherheit auch ein paar Aufnahmen machen?, überlege ich. Doch was würde das beweisen? Dass mein Vater im Main-Taunus-Kreis schon mehrmals irgendwo gegengerumpelt ist, höchstwahrscheinlich ohne sich bei irgendwem zu melden, geschweige denn sich zu entschuldigen? Nein, das möchte ich lieber nicht dokumentieren. Außerdem fällt mir in dieser Sekunde ein, dass mein Handyakku leer ist. Papa und ich hatten gestern Abend, als wir in Hamburg einen Übernachtungsstopp einlegten, beide unsere Ladekabel im Auto vergessen, und da in seinem Wagen keine Option zum Aufladen besteht, kann ich nun ohnehin nichts ausrichten.
«Wie zum Henker ist es möglich, dass man innerhalb einer Baustelle, wo Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist, einen Unfall verursacht?» Der Mercedesfahrer unterbricht kurz das Knipsen, um mich anzumeckern. «Hat der alte Mann sich mal einem Eignungstest unterzogen? Oder einem Sehtest?» Mit spitzem Finger deutet er irgendwo in den unteren Bereich seines Fahrzeugs. «Ich hoffe nicht, dass sich der Rahmen verzogen hat. Dann wird’s richtig blöd.» In stummer Verzweiflung schüttelt er den Kopf. «Mann, was für ein Mist!»
Ich fühle, wie eine weitere Hitzewelle in mir aufsteigt. Wir haben Anfang Juni und geschätzte dreißig Grad. Dazu der Stress – ich fächere mir mit der Hand Luft zu.
Was bitte schön meint er mit richtig blöd? Erstattet er Anzeige? Muss Papa womöglich seinen Führerschein abgeben? Oh mein Gott, das würde ihn umbringen!
«Was issn hier passiert?», ertönt plötzlich die schnodderige Stimme des Baustellenleiters, der sich uns schnaufend nähert. Seine orangefarbene Weste reflektiert das Sonnenlicht, sodass … Ich stocke. Trägt er etwa nichts drunter? Schützend halte ich mir die Hand über die Augen. In der Tat bedeckt die offen stehende Weste seinen blanken, sonnengebräunten Bauch nur wenig, und man kann nicht umhin, auf den dicken, ledernen Medizinball in seiner Körpermitte zu starren, den er stolz vor sich herschleppt. Dass er unseretwegen einen Extraweg durch die gleißende Sonne einlegen muss, scheint ihm wenig in den Kram zu passen.
Er betrachtet die zerbeulte Heckseite des Mercedes und stöhnt. «Also, Zeugen suchen, Adressen austauschen, weiterfahren. Und das gern ’n büschn dalli, ich kann die Ampel schließlich nicht ’n ganzen Tag auf Rot stellen!» Während er seinen kugeligen Bauch umklammert, als wolle er ihn am Runterfallen hindern, schlurft er wieder fort.
Mit einer Mischung aus Faszination und Unglauben starre ich ihm hinterher. Mein lieber Scholli … bauchfrei? Hut ab vor so viel Selbstbewusstsein.
Als ich meinen Blick von ihm löse, registriere ich den stattlichen Stau, der sich dank Gaffern nun auch auf der Gegenspur gebildet hat. Vereinzelte Fahrer hinter uns beginnen, ihren Unmut kundzutun, indem sie in kürzer werdenden Abständen hupen. Ich spüre, wie sich in meiner Kehle ein Schluckauf zusammenbraut. Eine lästige Laune der Natur, die immer dann auftritt, wenn mich etwas innerlich extrem aufregt, ich aber äußerlich gelassen wirken möchte. Und das hier ist … hicks … eine Herausforderung.
Hektisch krame ich in meiner Handtasche und fördere eine Visitenkarte zutage. «Hier», ich halte sie dem Mercedesfahrer unter die Nase. «Meine … hicks … Daten. Für Ihre Versicherung.»
Mittels einer minimalen Stirnbewegung lässt er seine Brille auf die Nase plumpsen, studiert die Karte einen Moment und verzieht dann den Mund. «Cornbräu? Interessant. Das erklärt einiges. Sind Sie und der alte Mann womöglich betrunken?»
Wie bitte?? Wie redet er denn mit mir? Während ich nach einer gepfefferten Erwiderung suche, betrachte ich fasziniert die furchenartige Druckstelle auf seiner Stirn. Der Typ ist wahrlich ein Fall von übersteigertem Selbstbewusstsein, denke ich. Zum Glück habe ich Erfahrung mit schwierigen und manchmal sogar bärbeißigen Kunden, für die ich Unmögliches möglich machen muss.
«Ich kann Ihren Unmut wirklich … hicks … sehr gut nachvollziehen», erkläre ich, so souverän es mir angesichts desSchluckaufs gelingen will. «Nichtsdestotrotz sollten wir … hicks …»
«Ich bestehe auf einen Alkoholtest!»
Einatmen, ausatmen. Er hat alles Recht der Welt, sauer zu sein, sage ich mir. Sein Wagen ist neu, und Papa hat ihn geschreddert. Es gibt keine zwei Meinungen. «Verständlich», pflichte ich ihm bei, «absolut … hicks … verständlich und …»
«Außerdem bestehe ich auf einen Zeugen!», unterbricht er mich erneut. «Hey, Sie da!» Mit seinen schlaksigen Armen fuchtelt er wild in der Luft herum und versucht, den Fahrer des nachfolgenden Wagens auf sich aufmerksam zu machen. In einem dreckverschmutzten Geländewagen sitzt ein Kerl, der telefoniert. Einen kurzen Moment spricht er noch, dann beendet er das Telefonat, sichtlich ungehalten, und steigt aus. Sind denn heute nur Männer unterwegs?, schießt es mir durch den Kopf, als er im Stechschritt auf uns zumarschiert. Ich hätte jetzt wirklich gern mal weibliche Unterstützung. Noch dazu scheinen es die Kerle allesamt eilig zu haben. Mit zusammengekniffenen Augen mustere ich den Neuankömmling. Kräftige Statur, kurze dunkle Locken und ein Bart. Nicht so ein Dreitage-Ding, aber auch kein Vollbart. Eher ein Ich-habe-Wichtigeres-zu-tun-als-mich-zu-rasieren-Bart. Er trägt ein verwaschenes graues T-Shirt, und seine Haut ist gebräunt, als sei er Sonne gewohnt. Ich schätze, er kommt irgendwo aus dem Süden, ganz sicher ist er kein Friesenjung. Auf den ersten Blick passt er so gut nach Sylt wie ein Mops auf den Mond.
«Wir benötigen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer für eine Zeugenaussage», bellt der Mercedesfahrer ihn an. Trotz der dunklen Farbe seines höchstwahrscheinlich teuren Hemdes kann ich jetzt nasse Flecken unter seinen Achseln erkennen. «Und ich rufe schon mal die Polizei, damit Sie ins Röhrchen …»
«Is bei Ihnen noch alles poliert im Oberstübchen?» Der Baustellenleiter, der sich nicht weit entfernt postiert hatte, kommt nun schnaufend zurückgewackelt. Mit wurstigem Zeigefinger tippt er sich gegen die Stirn. «Polizei? Wegen soner kleenen Delle?» Ihm steht der Widerwillen ins Gesicht geschrieben. «Wenn hier gleich einer die Bullen ruft, dann bin ich das. Und zwar weil Sie hier schon seit zwanzig Minuten mit Ihren Karren die Straße blockieren. Los jetzt.» Er klatscht in seine fleischigen Pranken, dass der Bauch wackelt. «Weiterfahren!»
«Nein!» Der Mercedesfahrer bleibt stur. Er stemmt die Ärmchen in die Hüften. «Erst muss jemand bei der jungen Dame Blut abnehmen oder sie wenigstens in ein Röhrchen pusten lassen.»
Meine Augen werden kugelrund. «Wie ich schon sagte …» Weiter komme ich nicht, denn nun meldet sich der Neuankömmling zu Wort.
«Ich würde vorschlagen, dass sich jetzt mal alle wieder beruhigen», sagt er. «Sonst stehen wir morgen noch hier.» Mit ernster Miene greift er in seine Gesäßtasche, befördert ein Portemonnaie zutage und zieht daraus eine Visitenkarte hervor. «Ich bezeuge gern, was ich gesehen habe, aber nicht hier und nicht jetzt.» Ohne mich eines Blickes zu würdigen, drückt er die Karte dem Mercedesfahrer in die Hand, der prompt mit einem Hochglanzkärtchen kontert. Auch ich bekomme eins vor die Nase gehalten. Thies Bentheim, lese ich. Vom Immobilienbüro Marquart & Steen.
«Und jetzt fahren Sie um alles in der Welt endlich weiter!», setzt der Neuankömmling noch einmal an. Sein genervter Blick streift nun auch mich.
Also ehrlich. Ich lasse mich doch hier nicht von zwei Männern, die sich für den Nabel der Welt halten, vorführen. Regel im Umgang mit schwierigen Kunden: authentisch bleiben, nicht die eigene Seele verkaufen. «Ich möchte… hicks … noch einmal entschieden anmerken, dass ich, nur weil ich … hicks … in einer Brauerei arbeite, nicht chronisch betrunken bin.» Mir ist klar, dass ich in den Augen der Typen rüberkomme wie ein hackestrammer Hooligan, der sich an eine leere Flasche Apfelkorn klammert und schwört, nüchtern zu sein. Erhobenen Hauptes fahre ich fort: «Und mein Vater … hicks … trinkt überhaupt keinen … hicks … Alkohol. Sie stecken ja bis unter die … Angeberbrille voll mit Vorurteilen.» Okay, das war jetzt nicht in höchstem Maße diplomatisch. Ich sollte dringend mal wieder eine Schulung besuchen. Und einen Logopäden oder wer auch immer sich mit nervösen Sprechstörungen auskennt.
«Ellimaus!», ruft Papa, der sich zu allem Überfluss nun zu uns gesellt. Unbemerkt hat er sich genähert. «Ich konnte keinen Hinweis auf meine Versicherung finden. Liegt alles zu Hause.» Papa wendet sich an den Mercedesfahrer: «Möchten Sie ersatzweise vielleicht meinen Führerschein sehen? Ich fahre seit über fünfzig Jahren unfallfrei!»
Als stünde das dadrinnen, denke ich. Darüber hinaus bezweifele ich diese Aussage, die Stoßstange von Papas Wagen spricht eine andere Sprache.
«Das wird kaum nötig sein», grätscht der Neuankömmling ins Gespräch. «Ich denke, die Schuldfrage ist hinreichend belegt. Und ob Alkohol im Spiel war …» Seine bernsteinfarbenen Augen bohren sich in meine, als wolle er herausfinden, ob ich noch in der Lage sei, meinen Blick zu fokussieren. Mir wird immer heißer. «… kann man in diesem Fall vernachlässigen. Es deutet nichts darauf hin, und eine Fahne kann ich auch nicht riechen.» Mit seiner angenehm sonoren Stimme klingt er wie ein Arzt mit erfreulicher Diagnose.
Na, besten Dank, denke ich.
«Primchen!», tönt der Baustellentyp, «dann wäre ja endlich alles geklärt. Also: Abmarsch!» Erneut klatscht er in seine riesigen Männerpranken.
«Stopp!», höre ich nun ausgerechnet meinen Vater einwenden. Er wedelt mit dem weißen Zettel, der Ursache allen Übels oder vielmehr das, was davon übrig ist. In seiner Nervosität scheint er ihn in kleine Krümel zerlegt zu haben. «Bevor jetzt alle aufbrechen, hätte ich mal eine Frage. Kennt jemand den Karsenhof und kann uns den Weg erklären?» Er lächelt unschuldig.
Ich starre ihn an. Muss das jetzt sein? Wozu gibt es Google?
Der Baustellenleiter hat nun ebenfalls die Nase voll. Er tippt demonstrativ auf seine Armbanduhr. «Noch zwei Sekunden, dann rufe ich die Polizei», lese ich in seinen Augen. Es könnte aber genauso gut bedeuten: «Noch zwei Sekunden, dann sprenge ich mit meinem Medizinball den Weg frei.»
Schnell trete ich vor. «Papa, wir haben doch … hicks … ein Handy. Das kann uns navigieren.»
Mein Vater sieht mich mitleidig an. «Aber unsere Akkus sind doch alle, Ella.»
Ach ja, verdammt. Auch wenn es seltsam klingt, er hat recht.
Der Mercedesfahrer sieht aus, als würde er Papa am liebsten in die nächste Geriatrie einweisen oder ihm zumindest lebenslanges Fahrverbot erteilen. Ausgesprochen miesepetrig spottet er: «Karsenhof? Was soll das sein, ’ne Brauerei hier auf der Insel?» Er stapft zu seinem Auto. «Ich sehe lieber zu, dass ich meinen Wagen in Sicherheit bringe. Sie hören von mir!» Die Autotür fällt krachend ins Schloss.
Sprachlos sehe ich ihm hinterher. Auch der Dunkelhaarige will los. Auf halber Strecke zu seinem Wagen dreht er sich noch mal um: «Falls Sie den Karsenhof in Archsum meinen, können Sie hinter mir herfahren. Falls nicht», er zuckt mit den Schultern, «kann ich Ihnen leider auch nicht helfen.» Er klingt wenig bedauernd.
«Archsum?» Mein Vater kramt in seinem Gedächtnis. «Ja! Ich glaube, das war es. Sie kennen die Ecke?»
Der Mann nickt. «Gleich nach dieser Baustelle fahren Sie kurz an die Seite, warten, bis ich vorbeigefahren bin, und dann folgen Sie mir. Aber ich warne Sie: Ich hab’s eilig und muss aufs Gas treten.» Er beißt sich auf die Unterlippe, trotzdem sehe ich, dass er grinst. «Eventuell ist es sicherer, wenn Ellimaus sich hinters Steuer klemmt.»
3.Kapitel
Während ich alle Mühe habe, unseren Pfadfinder nicht zu verlieren, denn er drückt in der Tat gewaltig auf die Tube, herrscht im Wagen angespannte Stille. Wir scheinen die Rollen getauscht zu haben: Papa reibt sich unentwegt mit den Handinnenflächen über die Hosenbeine, ich versuche, so gut es geht, mich auf das Fahren zu konzentrieren. Auf den Straßen rollt der Verkehr flüssig, vielmehr ist es die Landschaft, die mich mehr und mehr in ihren Bann zieht. Mal führt uns die Route entlang von Wiesen, Watt und begrünten Deichen, dann säumen geschmackvoll angelegte Privatgrundstücke unseren Weg. Immer wieder würde ich am liebsten anhalten, um einen ausgiebigen Blick über die steinigen Friesenwälle zu werfen, die so üppig bepflanzt sind, dass man meint, sie müssten unter der Last riesiger Kiefern oder Rosenbüsche zusammenbrechen. Und die Sonne scheint diese Idylle zusätzlich zu belächeln. Im Grunde könnte ich mich entspannen, die Aussicht und die Vorfreude auf den Urlaub genießen, doch ich bin nicht hundertprozentig bei der Sache. In meinem Innersten rumort es. Ich ärgere mich über mich selbst. Der Unfall wäre vermeidbar gewesen, wenn ich darauf bestanden hätte, die gesamte Distanz bis nach Sylt zu fahren. Warum habe ich meinen Vater hinters Steuer gelassen? Mir hätte auffallen müssen, dass ihn etwas beschäftigt und er nicht konzentriert beim Fahren ist. Andererseits mag ich mir die Diskussion nicht ausmalen, die ich mit dieser Bevormundung heraufbeschworen hätte. Dickköpfig, wie er ist, hätte er womöglich alles abgebrochen. Ich schalte einen Gang höher, weil unser Vordermann auf offener Strecke noch einen Zahn zulegt. Scheint, als sei er öfter mit Schallgeschwindigkeit unterwegs, vorzugsweise im Dreck. Die Marke seines Autos kann man jedenfalls vor Schmutz nicht lesen. Wer bitte schön braucht auf dem platten Land einen Geländewagen? Hätte er in der Baustellenwarteschlange vor uns gestanden, wäre er nach Papas Crash vermutlich nicht mal ausgestiegen.
Meine Grübeleien werden von einem Räuspern unterbrochen. «Hör mal, Ella … Unser Urlaub in diesem Jahr … Also, ich habe da eine kleine … Überraschung für dich.»
Ich werfe ihm einen knappen, verstörten Blick zu. Eine Überraschung? Im Sinne von: Wir sind auf dem Karsenhof zum Handarbeiten angemeldet und stricken einen Friesenpulli? Zuzutrauen wäre es ihm, denn Papa verbringt seit Mamas Tod viel freie Zeit in der Volkshochschule, wo er – für mein Dafürhalten – wahllos Kurse besucht. Und wenn ich wahllos sage, meine ich ein seeehr breit gestreutes Interessengebiet. Wie ein kompliziert verzweigter Amazonasarm hat sich seine Wissbegierde ausgestreckt, oder aber es ist lediglich ungezieltes Hobby-Hopping, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall betreibt Papa neben dem Stricken neuerdings Bogenschießen, nimmt an Kalligraphiewettbewerben teil und hat sich für den Herbst in einem DJ-Kurs eingeschrieben. Bislang habe ich mich nicht getraut, ihn nach seinen musikalischen Vorlieben zu fragen, denn der alte Mitsubishi verfügt über ein Kassettenfach. Nicht auszudenken, wenn wir den Rest der Strecke Blasmusik hören müssen!
«Es ist nämlich so», holt mein Vater mich mit stockender Stimme in die Realität zurück, «dass Ina …»
Ich stöhne innerlich und werfe ihm einen vernichtenden Blick zu. Bitte nicht dieses Thema. «Papa, du weißt, ich muss mich konzentrieren», falle ich ihm ins Wort. «Also fang bitte nicht von Ina an. Nicht jetzt.» Mein Tonfall ist harsch, wie so ziemlich jedes Mal, wenn der Name meiner Schwester fällt. «Für heute hatten wir wahrlich genug Aufregung.»
«Aber ich …»
Dieses Mal ist es meine Vollbremsung, die ihn zum Schweigen bringt. Der Pfadfinder ist auf einen Kiesweg abgebogen. Und zwar dermaßen abrupt, dass Papa und ich mal wieder mit den Anschnallgurten Bekanntschaft machen. Im Grunde hätten die einen Preis verdient und nicht das olle Gepäcknetz. Aber es scheint, als wäre unser Ziel erreicht. Karsenhof lese ich in geschwungenen Buchstaben auf einem schmalen Holzschild, das rechter Hand an einem Baum hängt. Etwa ein halbes Dutzend gestutzte Linden säumen den Kiesweg, der, von Unkraut durchbrochen, in einem Rondell mündet. Ein sichtlich ramponierter Strandkorb steht wie ein angespültes Fundstück achtlos herum und vermittelt nicht unbedingt einen einladenden Eindruck.
Freundlicherweise lotst uns unser Guide bis zum Ende des Wegs, dann bedeutet er mir mittels Handzeichen, wo wir parken können. Während ich das Lenkrad einschlage und annehme, er würde sich nun hupend vom Acker machen, lenkt er seinen Wagen rechts an uns vorbei bis zu einer Scheune, vor der er ohne ersichtlichen Grund zum Stehen kommt. Er reißt die Fahrertür auf, springt aus dem SUV und scheint im Heck des Wagens nach etwas zu suchen.
Ich wende meinen Blick ab und schaue mich um. Etwa zwanzig Meter entfernt steht ein altes Bauernhaus. Fast eher ein Hof, denn das Gebäude scheint mir auf den ersten Blick riesig zu sein. Und hübsch gepflegt, mit einem Fundament aus verwaschenem rotem Stein und einer Giebelwand, in der Fachwerkelemente eingefasst sind. Auf dem reetgedeckten Dach prangt ein Storchennest. Ungläubig blinzele ich. Ist das ein Hotel? Ich lasse meinen Blick schweifen, kann aber nicht den geringsten Hinweis darauf entdecken. Schade eigentlich, denn es sieht heimelig aus. Blühende Rhododendren umrahmen eine schmale Holztreppe, die zum Eingang des Hauses führt. Aber auch dort: kein Hotelschild. Weiter rechts, am Haus angrenzend, beginnt schon die Scheune. Um sie ist es allerdings weit weniger gut bestellt als um das Hauptgebäude. Nur eine Seite, die linke Stallhälfte, verfügt über ein gedecktes Ziegeldach, der restliche Teil ist allenfalls noch ein kahles Gerüst aus Balken, das sich wie ein dünnes Skelett vor dem stahlblauen Himmel abzeichnet.
Unser Lotse kreuzt mein Bild. Er hat sich eine orangefarbene Nylontasche, die aussieht wie ein moderner Schulranzen, quer um den Körper geschlungen und hetzt nun hinein in das marode Stallgebäude. Ein mittelgroßer Hund mit grauer Schnauze verfolgt ihn gemächlichen Schrittes. Verblüfft starre ich den beiden hinterher.
«Was zum Geier tut er hier?», frage ich, aber mein Vater zuckt nur mit den Schultern. Blass und in sich zusammengesunken kauert er auf seinem Sitz, und es wirkt, als sei er während der letzten Kilometer um Jahre gealtert.
«Du liebe Zeit, stimmt etwas nicht? Ist dir übel?» Es wäre nicht weiter verwunderlich, so schnell, wie wir gefahren sind. Dann wird mir plötzlich eiskalt. Düstere Gedanken breiten sich in meinem Bewusstsein aus, allen voran die Sorge, ob mein Vater nicht einfach nur unter Reiseübelkeit leidet, sondern womöglich ernsthaft erkrankt ist. Sofort startet in meinem Hirn ein Gedankenkarussell. Will er hier auf Sylt nach Heilung suchen? Weil er es mit den Bronchien oder der Lunge hat, soll die Nordseeluft seine Genesung vorantreiben? Oder aber ihm wurde geraten, eine Spezialklinik aufzusuchen, die es nur hier auf der Insel gibt? Betont er darum andauernd, wie hervorragend es ihm geht, damit ich mir keine Sorgen mache? Ich sehe ihm besorgt in die Augen. «Was wolltest du mir denn eigentlich sagen?»
«Ach», winkt Papa ab. Seine Stimme ist nur mehr ein Flüstern, während er regungslos dasitzt und mit deutlich sichtbarem Unbehagen durch die Frontscheibe ins Leere starrt. «Das hat sich erledigt.» Mir wird schlecht. Es hat sich erledigt? Erledigt?Was soll das nun wieder bedeuten? Doch ehe ich der Frage auf den Grund gehen kann, fokussiert sich plötzlich Papas Blick. Etwas hat seine Aufmerksamkeit erregt, also wende auch ich meinen Kopf und sehe, dass nun die Vordertür im Haupthaus offen steht. Ein kleines Mädchen, schätzungsweise sechs Jahre alt und bekleidet mit einem knielangen, beigefarbenen Trägerkleidchen, hockt am Fuße der Treppe. Mir scheint, als habe sie etwas verloren, und zwar einen Gummihandschuh, den sie nun hektisch aufhebt. Sie zwängt ihn sich unter den Arm, wo bereits ein Stapel Frotteehandtücher klemmt. Mit der anderen Hand greift sie neben sich nach einem Eimer, der randvoll mit Wasser gefüllt ist. Dann bewegt sie sich hochkonzentriert, um ja nichts zu verschütten, Richtung Scheune.
Als sie kurz anhält, um die Seiten zu wechseln, erblickt sie unser Auto. Sie blinzelt ein paar Mal angestrengt mit den Augen, dann scheint sie zu begreifen, dass hinter der Frontscheibe Menschen sitzen. Aufgeregt wedelt sie mit ihrer freien Hand, sodass die Handtücher ins Rutschen geraten. «Los, kommt schnell, sonst verpasst ihr es!»
Gleich darauf hat sie Sack und Pack wieder unter ihren Armen verstaut und tippelt, so schnell es der schwere Eimer zulässt, weiter.
Ich höre meinen Vater seinen Gurt lösen. «Na, dann wollen wir mal», sagt er, als sei er nicht eben einem Kollaps nahe gewesen. «Mal sehen, was da los ist.»
Ratlos sehe ich ihn an. «Du willst dort hinein? Aber … müssen wir uns nicht erst irgendwo anmelden, ehe wir das Grundstück betreten? Nicht dass uns der Hund beißt.» Dann erinnere ich mich an den Zettel aus dem Handschuhfach. «Oder werden wir …», ich durchbohre ihn mit meinem Blick, «…erwartet?»
Papas Miene bleibt regungslos. «Schauen wir mal», antwortet er kryptisch, klopft sich wie zur eigenen Ermunterung auf die Oberschenkel und steigt aus. Auf seinem Gesicht liegt plötzlich wilde Entschlossenheit. Und er scheint es eilig zu haben. «Mach schon, Ella! Du hast ja gehört, was die Kleine gesagt hat: Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir etwas.» Er beugt sich noch einmal ins Auto und zwinkert mir zu. «Und ehe du fragst: Nein, ich habe keine Ahnung, worum es geht.» Mit diesen Worten dreht er sich um und stapft in Richtung Scheune.
Ungläubig starre ich ihm hinterher. Was ist nur in ihn gefahren? Unangemeldet irgendwo Privatgrundstücke zu betreten ist eigentlich nicht seine Art. Ich kann mich nicht recht entschließen, was zu tun ist, darum bleibe ich einfach weiter sitzen und beobachte die Szene. Das kleine Mädchen ist längst drinnen verschwunden. Kurz bevor Papa die Scheunentür erreicht, dreht er sich um und winkt mich ungeduldig zu sich heran. Sichtlich verunsichert öffne ich die Fahrertür. Ein weiterer Grund, warum ich kein gutes Gefühl bei der Sache habe, ist, dass unser Pfadfinder sich ebenfalls dort drinnen befindet. Ganz sicher ist er nicht erpicht darauf, uns so bald wiederzusehen.
Aber es hilft nichts, Papa scheint es ernst zu meinen. Mit einem hörbaren Seufzer steige ich aus und nähere mich im Schneckentempo der Scheune. Als ich auf Papas Höhe angekommen bin, grabscht er nach meinem Arm. Von drinnen dringen Stimmen an mein Ohr. Die eines kleinen Mädchens und der dunkle Tonfall unseres Zeugen. Die beiden unterhalten sich, worüber, kann ich leider nicht verstehen. Vielleicht hätte es mir einen Hinweis darauf gegeben, ob wir hier erwünscht sind oder was um alles in der Welt uns überhaupt erwartet.
Papa zerrt an mir. Gemeinsam drücken wir die Tür auf und treten über die Schwelle. Dies ist der Teil der Scheune, der noch vom Dach bedeckt wird. Die Luft ist einen Tick kühler, und es ist um einiges dunkler als draußen. Als sich meine Augen an das schummrige Licht gewöhnt haben, erkenne ich, dass es sich um einen klassischen Stall handelt, nur ohne abgetrennte Boxen. Der Großteil des steinigen Bodens ist mit Stroh ausgelegt, ein paar Metallstangen zäunen kleine Areale voneinander ab. Ein Esel, der an einem Salzstein leckt und nebenbei versucht, die Fliegen von seinen riesigen Ohren zu verscheuchen, ist das erste Tier, das mir ins Auge sticht. Dann noch ein zweiter. Und ich sehe drei Ziegen. Sie sind nicht angebunden, stehen aber ordentlich in einer Reihe und beobachten höchst interessiert, was ein paar Meter neben ihnen im Stroh vor sich geht. Dort knien der Lotse und das kleine Mädchen auf dem Boden. Sie registrieren unsere Anwesenheit mit einer zustimmenden Kopfbewegung, schauen aber sogleich wieder nach vorn. Vor ihnen wandert eine weitere Ziege rastlos hin und her. Sie scharrt im Stroh, legt sich kurz hin, steht aber Sekunden später wieder auf. Plötzlich ruft das kleine Mädchen leise: «Sieh mal da! Es will raus!»
Unser Pfadfinder an ihrer Seite nickt stumm. Er trägt Handschuhe, die ihm bis zu den Ellenbogen reichen, neben ihm auf dem Boden steht der Wassereimer. Einen Moment brauche ich, um die Szene einordnen zu können. Dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Dies ist eine Geburt! Und er ist der Tierarzt?
Ungläubig treten Papa und ich näher, um bessere Sicht zu haben. Tatsächlich ist jetzt am Hinterteil der Ziege etwas zu sehen, eine kleine Blase, eigentlich mehr ein Schleimballon. Erst nach längerem Hinschauen kann ich in der Blase einen Flecken Fell erkennen – da sind Beine und ein winziger Kopf! Mir steht vor Überraschung der Mund offen, und ich schaue kurz zu Papa, um zu sehen, ob er das Spektakel ebenfalls bestaunt. In meinem ganzen Leben war ich noch niemals bei einer Geburt zugegen, weder bei einem menschlichen Baby noch bei einem Tier. Mir wird plötzlich ganz feierlich zumute. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, und ich krampfe meine Finger in Papas Arm, weil ich so aufgeregt bin.
Die Ziege hat sich wieder hingelegt, das kleine Mädchen robbt vorsichtig an sie heran. Ohne die werdende Mutter zu berühren, schaut sie sich alles in höchstem Maße interessiert an. «Das Erste liegt richtig herum», jubelt sie leise, hält sich dann aber schnell die Hand vor den Mund. Als der Kopf des Tieres ein Stückchen mehr herauslugt, reckt sie dem Tierarzt wortlos ihren kleinen erhobenen Daumen entgegen. Das Zicklein ist noch komplett von der Fruchtblase umgeben, als es, wie in einen schützenden Kokon gebettet, aus dem Mutterleib hinausgleitet. «Es ist da!», flüstert die Kleine, während der Doktor seelenruhig abwartet, wie die Ziege sich verhält. Erst als sie sich erhebt, reißt die Fruchtblase, und ihr Baby liegt schutzlos vor ihr im Stroh. Ich halte die Luft an. In meiner Unbedarftheit hatte ich angenommen, sie würde ihr Baby nun abschlecken, es säubern und sich mit ihm vertraut machen, doch sie ignoriert es und meckert nur leise vor sich hin.
Fasziniert starre ich auf das nasse Bündel, das vorsichtig zu strampeln beginnt. Willkommen auf der Erde, du niedliches Fellknäuel, denke ich. Ich hoffe, du wirst ein glückliches Leben haben.
Das kleine Mädchen beginnt jetzt sanft, das Neugeborene vom Schleim zu befreien. Vor allem im Gesicht, damit es leichter atmen kann. Kurz beugt sich nun doch die Mutter darüber. Sie beleckt das Baby, dreht sich aber recht schnell weg, um sich einen halben Meter nach links erneut ins Stroh fallen zu lassen.
«Es geht weiter», sagt der Doktor. «Behältst du das Kleine im Auge?»
Das Mädchen nickt. Was nun kommt, kann ich nicht so genau sehen, weil mir der Mann mit seinem Oberkörper die Sicht versperrt. Am liebsten würde ich mich weiter nach vorn drängeln, aber ich halte mich zurück. Ich fühle mich sowieso schon fehl am Platz hier, wie eine Gafferin, die nicht helfen, sondern nur rumstehen kann. Mein Gefühl sagt mir, dass die Ziege ein zweites Baby zur Welt bringen will. Doch diese Geburt scheint nicht so reibungslos vonstattenzugehen wie die erste.
«Ist es eine Steißlage?», fragt die Kleine angespannt. Sie hat das Neugeborene mithilfe eines der Handtücher gesäubert und es ein wenig in die Nähe der Mutter geschoben. Und siehe da, sie beginnt erneut, ihr Kind abzuschlecken. Es scheint sie zu beruhigen, denn momentan ist kein Gemecker mehr zu hören.
Reichlich verdattert und vermutlich mit offen stehendem Mund starre ich die Kleine an. Eine was? Steißlage? Ich habe den Begriff nie zuvor gehört, könnte mir aber zur Not einen Reim darauf machen. Aber ich bin 32. Mit sechs Jahren wäre mir ein derartiger Ausdruck ganz sicher nicht über die Lippen gekommen.
«Wir haben Glück, Mimi», höre ich die tiefe Stimme des Arztes. «Es ist nur ’ne normale Hinterendlage. Gleich kannst du deinen neuen Freund begrüßen.» In der Tat dauert es kaum mehr dreißig Sekunden, da hat er das Tier sanft an den Füßen herausgezogen. Augenblicklich entfernt Mimi, wie das kleine Mädchen offenbar heißt, wieder den Schleim. Dann wird auch dieses Baby zur Mutter geschoben.
«Das war’s», erklärt der Doc. Er hat die Ziege kurz untersucht. «Kein weiteres Baby im Bauch.»
Mimi gibt ein bedauerndes Seufzen von sich. «Ach, schade.»
«Komm schon, Mimi. Du hast zwei neue Kinder, um die du dich kümmern kannst. Außerdem laufen hier nun wirklich genügend Tiere zum Streicheln und zum Versorgen herum.» Er dreht sich um, und ich kann sein amüsiertes Gesicht sehen. Er deutet auf eines der Babys. «Aber du hast Glück, für deinen Ziegenkäse ist gesorgt. Dieses ist ein Mädchen.»
«Yippie», ruft die Kleine. Liebevoll streichelt sie abwechselnd beide Tierbabys und liebkost auch die Mutter. «Gut gemacht, Ziegelise.» Sie drückt dem Tier einen Kuss auf das nasse Fell.
Der Doktor scheint alle nötigen Handgriffe erledigt zu haben. Er wendet sich an die Kleine: «Willst du mal nachsehen, wo deine Mutter bleibt?»
Meine Hand wandert von Papas Arm, den ich bis eben fest umklammert habe, zu seiner Hand. Ich drücke sie, und wir lächeln uns an. Dann weise ich dezent in Richtung Tür, denn ich fühle mich nach wie vor wie ein Eindringling und finde, dass es der Anstand gebietet, sich jetzt stillschweigend zu verabschieden. Wenngleich ich die Flut Glückshormone, die mich gerade überschwemmt und meinen gesamten Körper innerlich prickeln lässt, gern noch ein Weilchen ausgekostet hätte. Ich spüre auf einmal Demut vor dem Wunder des Lebens und kann mich an dem Anblick der winzigen Tiere gar nicht sattsehen. Es ist zu niedlich, wie sie versuchen, sich auf ihren wackeligen Beinen aufzurichten und dabei voller Neugier mit ihren dunklen Augen ihre neue Welt erkunden.
Erneut schiele ich zu meinem Vater. Ihn offen anzusehen traue ich mich nicht, weil ich fürchte, dass meine überbordenden Gefühle beim Blick in seine warmen blauen Augen endgültig überschwappen und ich weinen muss. Also blinzele ich nur unauffällig zu ihm rüber. Genau wie ich hat er die Geburt mit Staunen betrachtet, ich erkenne es an seinen Gesichtszügen, die so weich und unverkrampft aussehen wie die ganze Fahrt über nicht. Als er jetzt lächelt, überkommt mich ein freudiger Schauer. Papa ist in unserer Familie von jeher derjenige mit dem sonnigen Gemüt und den Nerven aus Stahl. Und mit einem rosaroten Blick auf die Dinge. Für ihn sieht immer alles einen Tick besser aus, als es ist. Selbst die schlimmsten Ereignisse dreht und wendet er so lange, bis er ein winziges Körnchen Gutes daran findet. Ohne Papas optimistisches Wesen wäre unsere Familie sicher schon viel eher zerbrochen.
Dann, plötzlich, verkrampft sich die Miene meines Vaters. Er hat sich in Richtung Tür gewandt, wo etwas seine Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Ich folge seinem Blick, kann aber zunächst nichts Eigentümliches entdecken. Bis ich im geöffneten Scheunentor die Umrisse einer fremden Person erkenne. Wie ein Scherenschnitt hebt sie sich vom hellen Himmel ab. Von der Statur her würde ich auf eine Frau tippen. Wieder meldet sich mein schlechtes Gewissen. «Los, Papa», ich drücke auffordernd seine Hand. «Lass uns gehen.» Doch er ignoriert mich komplett. Ohne irgendeine Reaktion steht er da und schaut weiter gebannt zum Eingang.
«Mama!», ertönt der freudige Ruf der Kleinen.
Ich blicke mich um und sehe, wie sie sich aufrappelt und bestens gelaunt in Richtung Scheunentor hopst. «Komm schnell her! Ziegelise hat ihre Babys bekommen. Es war eine Hinterlaufgeburt, aber Tom und ich hatten alles im Griff.»
Okay, denke ich, die Kleine ist definitiv älter als sechs. Auf dem Gebiet bin ich eindeutig zu unerfahren. Andererseits … Während ich weiter über Kinder im Allgemeinen nachdenke, aber irgendwie zu keinem Ergebnis gelange, bleibt die Frau plötzlich stehen und wartet, bis das Kind herangelaufen ist. «Na, das ist ja schön zu hören!», sagt sie. «Ihr seid ein gutes Team.» Ihr Tonfall ist bei Weitem nicht so emotionsgeladen wie der des kleinen Mädchens, eher rau, fast ein wenig kantig. Tief in meinem Innersten meldet sich etwas, ein dumpfes Gefühl. Mehr eine Erinnerung an … tja, an was? Der Klang ihrer Stimme kommt mir bekannt vor, ich versuche, mich zu konzentrieren, doch etwas blockiert mich.
«So, das wäre geschafft», schnauft der Doktor und lenkt mich ab. «Ich düs’ dann mal weiter», sagt er zu niemand Bestimmtem. Er steht auf, zieht seine Handschuhe aus und wirft die riesigen Teile über den Rand des Eimers. Mit Bedacht klopft er sich das Stroh von der Hose. «Hab noch ein paar Sachen auf dem Zettel.»
Im Gegensatz zu vorhin an der Unfallstelle, als er uns hektisch und reichlich ungehobelt zur Eile angetrieben hat, wirkt er in diesem Moment wie die Ruhe selbst. Jeder Handgriff sitzt, alle Utensilien finden binnen kürzester Zeit ihren Platz in seiner Tasche, und man gewinnt den Eindruck, er könne sie mit verbundenen Augen einräumen. Hätte ich ihn zum jetzigen Zeitpunkt, unter diesen Umständen kennengelernt, wäre mein Urteil über ihn möglicherweise etwas milder ausgefallen. Aber vorhin war er einfach nur … nervig. Und wie er mich Ellimaus genannt hat, klingt mir jetzt noch in den Ohren.
«Nun komm endlich!» Das kleine Mädchen versucht ungeduldig, die Mutter ins Stallinnere zu ziehen.
«Langsam, langsam», wehrt die sich, und kaum höre ich den Tonfall ein weiteres Mal, versuche ich erneut, die Stimme einzuordnen. Doch es ist, als wolle ich eine winzige Fliege aus einem Wasserglas fischen. Meine Erinnerung entgleitet mir immer wieder.
Aber dann, in derselben Sekunde, als die Frau komplett über die Schwelle tritt und mich das Gegenlicht nicht mehr blendet, kehrt auch meine Erinnerung zurück. Und sie trifft mich wie ein Faustschlag in die Magengrube. Ina.
4.Kapitel
Halt suchend kralle ich meine Finger in Papas Hand. Ich spüre die Wärme seiner Haut, doch sie erreicht mich nicht. Mir ist kalt, und mein Körper fühlt sich auf einmal an, als habe das Blut darin aufgehört zu zirkulieren. Stattdessen scheint es mir in die Füße gesackt und dort zu einem Eisklumpen gefroren zu sein.
Einen Moment lang bin ich wie gelähmt, dann kehrt nach und nach das Leben in meinen Körper zurück. Ich wirbele zu meinem Vater herum und bringe ihn durch die Wucht der Bewegung fast zu Fall. «Ist das … hicks … Ina?», stammele ich alarmiert.
Was für eine selten blöde Frage, schimpfe ich mich selbst. Klar ist es Ina, die keine zehn Meter entfernt von uns im Scheuneneingang steht. Meine Schwester. Mehr als zehn Jahre sind wir uns aus dem Weg gegangen, nicht mal auf Mamas Beerdigung war Ina wirklich anwesend. Die zwei Sekunden, die sie sich Zeit genommen hat, um drei Rosen in das Grab zu werfen, zähle ich mal nicht dazu. Auch nicht ihre pflichtschuldige Teilnahme an der anschließenden Trauerfeier. Wie bei einem Geist konnte man Inas Gegenwart zwar die ganze Zeit spüren, aber mehr nicht. Sie hat sich in eine Ecke verkrümelt und mit niemandem gesprochen, nicht einmal mit mir. Und nun steht sie plötzlich da, das ist … das kann nicht sein. Weil es nicht sein darf! Mein Verstand weigert sich, den Umstand zu akzeptieren, doch sooft ich auch blinzele, das Ergebnis bleibt dasselbe.
Ich suche Papas Blick, doch er ignoriert mich. Seine Aufmerksamkeit gilt voll und ganz der Frau im Eingang, die offenbar stehen geblieben ist, denn es sind keine Schritte mehr zu hören. Nervös trete ich von einem Bein auf das andere. Papa rührt sich nach wie vor nicht vom Fleck.
Ganz langsam drehe auch ich mich zu meiner Schwester um und beginne, Details wahrzunehmen. Ina sieht, soweit ich es auf die Entfernung erkennen kann, annähernd so aus wie früher. Unter Hunderten hätte ich sie erkannt. Zum Beispiel an ihrer charakteristischen, leicht schiefen Nase, die davon rührt, dass wir vor vielen Jahren gemeinsam mein Zimmer umräumen wollten und uns dabei der Kleiderschrank fast umgekippt ist. Die Tür schwang auf und traf Ina mitten im Gesicht. Damals waren wir Kinder, ich keine sechs Jahre alt, und beste Freundinnen. Unser erster Impuls war es, die Aktion vor Mama geheim zu halten, denn uns war klar, dass sie nicht begeistert gewesen wäre. Doch die Nase hat geblutet wie verrückt, der Badvorleger, zwei blütenweiße Geschirrhandtücher und ein Badelaken waren im Nullkommanichts eingesudelt, und unter Inas Auge prangte ein schillerndes Veilchen.
«Ella …» Papas Stimme holt mich aus meinen Gedanken. Er hat sich zu mir gedreht. «Lass es mich bitte erklären …»
Ich fahre herum. Erklären?