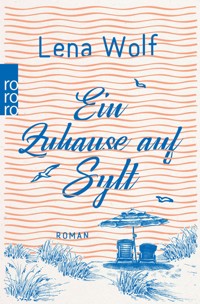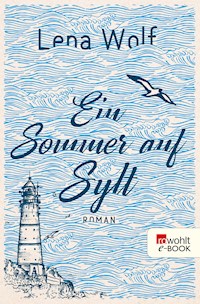9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem kürzesten Umweg ins Glück Endlich sitzt Luisa im Auto Richtung Frankreich. Nur dass sich Stefan hinters Steuer geklemmt hat, dämpft die Urlaubsfreude. Denn er ist Luisas Exmann. Auch dass ihre Mutter Elisabeth mit im Wagen sitzt, macht die Sache nicht einfacher. Diese ahnt nämlich nichts davon, dass Luisas Ehe gescheitert ist. Elisabeth will ihrer Tochter Luisa, die eigentlich ihre Adoptivtochter ist, bei dem ersten Treffen mit der leiblichen Mutter beistehen. Nicht dass die andere ihr den Rang abläuft – mit ihrer idyllischen Pension in der Provence! Entsprechend angespannt ist die Stimmung im Auto. Erst recht als der Wagen liegenbleibt. Zum Glück bietet sich bald eine Mitfahrgelegenheit: ein attraktiver Franzose, der ziemlich ungehemmt mit Luisa flirtet … Eine großartige Sommer-Beziehungskomödie mit Herz und Humor um eine Frau zwischen zwei Männern – und zwei Müttern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Lena Wolf
Sommer mit Aussicht
Roman
Über dieses Buch
Auf dem kürzesten Umweg ins Glück
Endlich sitzt Luisa im Auto Richtung Frankreich. Nur dass sich Stefan hinters Steuer geklemmt hat, dämpft die Urlaubsfreude. Denn er ist Luisas Exmann. Auch dass ihre Mutter Elisabeth mit im Wagen sitzt, macht die Sache nicht einfacher. Diese ahnt nämlich nichts davon, dass Luisas Ehe gescheitert ist.
Elisabeth will ihrer Tochter Luisa, die eigentlich ihre Adoptivtochter ist, bei dem ersten Treffen mit der leiblichen Mutter beistehen. Nicht dass die andere ihr den Rang abläuft – mit ihrer idyllischen Pension in der Provence!
Entsprechend angespannt ist die Stimmung im Auto. Erst recht als der Wagen liegen bleibt. Zum Glück bietet sich bald eine Mitfahrgelegenheit: ein attraktiver Franzose, der ziemlich ungehemmt mit Luisa flirtet …
Eine großartige Sommer-Beziehungskomödie mit Herz und Humor um eine Frau zwischen zwei Männern – und zwei Müttern!
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung FAVORITBUERO, München
Umschlagabbildung Yoko Nakamura/Getty Images; elyaka/fotolia.com
ISBN 978-3-644-40175-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1Alles andere als eine normale Urlaubsreise
«Können wir bitte kurz anhalten, ich müsste auf die 17.» Der Zeigefinger meiner Mutter schiebt sich von hinten über meine Schulter und deutet auf ein unscheinbares Autobahnschild mit der Aufschrift «Mühlbuck», das den nächsten Rastplatz ankündigt.
Jetzt schon?, denke ich und werfe einen verstohlenen Blick auf meine Armbanduhr. Gerade mal 14 Uhr. Vor etwa eineinhalb Stunden haben wir ihre Wohnung bei Bad Kissingen verlassen, und sie war doch kurz vor der Abfahrt noch mal auf dem Örtchen. Wie kann es sein, dass sie jetzt schon wieder muss?
«Auf die 17?» Stefan schnaubt, halb amüsiert, halb gequält, während seine Hände sich um das Lenkrad krampfen, als wäre es Mamas Luftröhre. Im Laufe der Jahre hat er sich an die manchmal etwas gestelzte Ausdrucksweise meiner Mutter gewöhnt. Nichtsdestotrotz durchkreuzt sie mit ihrem Wunsch mal wieder seine Pläne. «Okay …», ruft er nach hinten und sucht im Rückspiegel Mamas Augen. «Wenn es unbedingt sein muss.» Stefan mag seine Schwiegermutter, aber er hasst es, unterwegs spontan zu halten. Tatsächlich geht er jetzt ein wenig vom Gas, bleibt aber auf der mittleren Spur und schwupp … fliegt das Schild an uns vorbei.
Ich halte kurz die Luft an. Wenn das so weitergeht, wird dies ein Familienausflug mit tragischem Ausgang. Ich lese bereits die Schlagzeile: Todesfalle Rasthaus-Klo. Familiendrama an der Autobahn. Wie gut kennen Sie Ihre Angehörigen wirklich? Ich kneife die Augen zusammen und mustere Stefan, als sähe ich ihn zum ersten Mal. Dass er Anfang des Jahres vierzig geworden ist, würde man nicht vermuten. Seine Gesichtszüge sind noch immer jugendlich und seine Haut für einen Mann erstaunlich makellos. Und sie ist leicht gebräunt, wie nach ausgiebigen Strandspaziergängen bei milder Frühlingssonne. Dabei geht er in Wirklichkeit nie spazieren, als Unternehmensberater fehlt ihm dafür schlichtweg die Zeit. Gerade erst hat er sich gemeinsam mit einem Kollegen selbständig gemacht, leitet nun Managerseminare sowie Einzel- und Gruppencoachings. Außerdem berät er Start-up-Firmen in der Gründungsphase und arbeitet im Grunde rund um die Uhr. Ein paar Denkfalten haben sich neuerdings auf seiner Stirn eingegraben, und vereinzelte Strähnen seines kurzen, blonden Haares schimmern silbrig, wenn er wie jetzt den Kopf zur Seite neigt.
«Kannst du es noch ein wenig aushalten, Elisabeth?» Im Spiegel zwinkert er ihr entschuldigend zu. «Aber wenn wir später noch etwas vom Abend haben möchten, sollten wir so wenig Pausen wie möglich einlegen. Ich schlage deshalb vor …» Er tippt auf dem Display seines Navigationsgerätes herum, erreicht damit aber nur, dass der Wagen zur Seite ausbricht und gefährlich schlingert.
Mama und ich stoßen einen spitzen Schrei aus. Sofort reißt Stefan das Lenkrad zurück. «Verdammt!» Aus den Denkfalten auf seiner Stirn sind zwei tiefe Furchen geworden. Einen Moment konzentriert er sich auf den Verkehr, dann wandert sein Blick erneut zum Routenplaner. «Ich schlage also vor», greift er seinen Satz wieder auf, «noch etwas weiter zu fahren. Wenn alles nach Plan läuft, erreichen wir unser Zwischenziel in der Schweiz voraussichtlich gegen 18 Uhr.»
Meine Mutter tut, als habe sie die Worte nicht gehört, aber natürlich will sie Stefan durch ihr Schweigen klarmachen, was sie von seinem Vorschlag hält: nichts.
Ich rutsche ein wenig tiefer in den Beifahrersitz und beobachte sie verstohlen im Außenspiegel. Mama hat ihre Lippen gekräuselt und blinzelt mit zusammengekniffenen Augen angestrengt aus dem Seitenfenster. Sonnenlicht spielt in ihren kurzen, leicht lockigen Haaren, und ich überlege, seit wann sie diesen zarten Blaustich trägt. Er ist … nun ja … gewöhnungsbedürftig. Meine Mutter schaut nach unten, wickelt ihren Zeigefinger in ein Taschentuch und beginnt, sich damit Stirn und Schläfen abzutupfen. Ein wenig gestresst sieht sie aus, und ich ahne, was in ihr vorgeht. Sie gehört einer Generation an, in der man bestimmte Dinge nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, erst recht nicht mit einem Mann. Denn auch wenn es sich bei diesem Mann um ihren geliebten Schwiegersohn handelt, würde sie vermutlich eher den Rest der Strecke zu Fuß marschieren, als das Thema ihrer vollen Blase weiter zu vertiefen.
Ich grübele, ob ich etwas sagen kann, das die Situation entkrampft, doch ich fürchte, dadurch alles nur schlimmer zu machen. Diese Reise wird kompliziert genug, und wir sollten alles, das nicht zwingend diskutiert werden muss, besser umschiffen. Zum Glück scheint das auch meiner Mutter klar zu sein. Mit einem Ruck richte ich mich auf und schaue nach vorn aus dem Fenster. Immerhin spielt das Wetter mit. Schon heute Vormittag, als Stefan und ich in Frankfurt aufgebrochen sind, blitzte die Sonne strahlend und klar über den Dächern hervor. Inzwischen steht sie beinahe im Zenit und spiegelt sich auf unserer dunklen Motorhaube, als wolle sie sich vergewissern, dass keine Wolken ihren Auftritt trüben.
«Dass ich schon wieder auf die Toilette muss, liegt an den Entwässerungstabletten, die mir der Arzt verschrieben hat.» Auf der Rückbank hat meine Mutter nun offenbar doch beschlossen, das Thema noch einmal aufzugreifen. In ihrem Tonfall schwingt Trotz mit. «Außerdem bin ich beinahe neunzig. In diesem Alter muss man dankbar sein, wenn sich der Harndrang noch ankündigt.»
So viel zum Schamgefühl ihrer Generation. Stefan und ich tauschen einen verstörten Blick aus. Während er sich daraufhin kopfschüttelnd dem Verkehr widmet, drehe ich mich nach hinten und sage: «Mama, du bist siebenundsiebzig. Das ist von neunzig noch ziemlich weit entfernt.»
Meine Mutter zieht ihre Brauen in die Höhe. «Nichts macht so alt wie der ständige Versuch, jung zu bleiben», sagt sie pathetisch, und ihre wachen Augen funkeln mich vielsagend an.
Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Sprüche dieser Art begleiten mich schon mein Leben lang, allerdings habe ich das Gefühl, dass diese Marotte von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Falls das überhaupt möglich ist. Resigniert drehe ich mich nach vorn und atme einmal tief durch.
Plötzlich werde ich mit Wucht gegen den Gurt gedrückt. Stefan hat einen Kleintransporter überholt und gleich darauf einen rasanten Schlenker auf die rechte Fahrbahn gemacht. «Also gut», sagt er in gnädigem Tonfall. «Wir halten. Kurz. Ich würde allerdings vorschlagen, dass wir während der Pause auch eine Kleinigkeit zu Mittag essen. Plug and play.» Er setzt den Blinker. Ein leises Klick-Klack, Klick-Klack ertönt, schon sind wir auf die Ausfahrt abgebogen.
Plug and play? Redet er so in seinen Seminaren?
Meine Mutter stört sich nicht an Stefans Managerjargon, im Gegenteil. Als Zeichen ihrer Zustimmung schiebt sie stumm den nach oben gereckten Daumen vor und lässt ihn neben meinem Gesicht auf und ab wandern. Ich erhasche einen Blick auf ihren Handrücken und staune, wie viele hell- und dunkelbraune Flecken sich dort tummeln. Die Adern treten blassgrün hervor und zeichnen unter der Haut ein erhabenes Muster. Mama wird alt. Die plötzliche Erkenntnis versetzt mir einen Stich. Am Telefon hat ihre Stimme noch immer denselben festen Klang, den ich von früher kenne, sodass in meinem Kopf die Zeit stehengeblieben ist. Doch stattdessen scheint sie förmlich gerannt zu sein.
Meine Mutter und ich haben uns in letzter Zeit kaum gesehen. Es ergab sich einfach nicht. Bei meiner Arbeit war die Hölle los, dazu unsere geographische Entfernung und dann … tja … diese dumme Sache, wegen der es zu den vielen Notlügen kam. Eigentlich kein großes Ding, wirklich nicht. Wenn ich nur wüsste, wie ich es aus der Welt räumen soll.
Mama wird ausflippen.
Nicht dran denken. Nicht jetzt.
«Habt ihr Kleingeld?» Stefan lenkt den Wagen an der Tankstelle vorbei in Richtung Raststätte. Er schaltet den Routenplaner auf Stand-by und manövriert uns in eine Parklücke.
«Ja», antworten meine Mutter und ich synchron und greifen nach unseren Handtaschen. Die Pause kommt mir sehr gelegen, allerdings aus einem anderen Grund als dem, der meiner Familie vorschwebt. «Geht ihr ruhig schon mal essen», sage ich leise und so beiläufig wie möglich zu Stefan, «ich muss kurz beruflich telefonieren und komme anschließend nach.»
«Muss das sein, Liebes?» Mama hat meine Worte gehört und kommentiert, ehe Stefan auch nur den Mund aufmachen kann. «Du hast doch jetzt Ferien!»
Ich schlucke den Kommentar, der mir dazu auf der Zunge liegt, schnell hinunter. Egal was ich sage, meine Mutter würde meine Argumente nicht gelten lassen. Dabei ist es so simpel: Ich liebe meinen Job. Als Eventmanagerin für den Frankfurter Megastore LUX14 erforsche ich Trends, plane Veranstaltungen, halte den Kontakt zu Künstlern und deren Management. Klar, dass ich dafür rund um die Uhr erreichbar sein und auch mal außerhalb der Bürozeiten telefonieren muss. Beruf und Freizeit lassen sich ohnehin meist gar nicht klar voneinander trennen, aber das stört mich nicht. Im Gegenteil. Ich mag es, wenn sich meine Tage kunterbunt und abwechslungsreich gestalten. Wer mir das Smartphone verbietet, kann mich auch gleich erschießen.
Doch allein schon die Tatsache, dass ich meiner Arbeit nicht ausschließlich am Schreibtisch nachgehe, wirkt auf meine Mutter absolut unseriös. Sie selbst hat früher als Buchhalterin für einen kleinen Musik-Fachverlag gearbeitet. Ein klassischer Bürojob mit geregelten Arbeits- und Urlaubszeiten. So und nicht anders funktioniert das Leben in ihren Augen.
«Niemand, den ich sonst kenne, hängt derart viel am Telefon wie du», kommt es prompt von hinten. «Und jetzt auch noch während des Urlaubs …» Ich spüre ihren vorwurfsvollen Blick ein Loch in meinen Rücken brennen.
«Dies ist ja wohl alles andere als eine normale Urlaubsreise», lasse ich mich nun doch zu einem Kommentar hinreißen. Es klingt patziger, als es beabsichtigt war, und ich schaue meine Mutter nicht an, damit sie nicht an meinen Augen abliest, wie wütend mich ihre Kritik macht.
Stattdessen starre ich geradeaus durch die Frontscheibe und beobachte eine kleine Familie, Mutter, Vater und zwei Jungen, wie sie lachend zu ihrem Auto schlendern. Die Kinder essen Eis und haben ihre freie Hand jeweils in die eines Elternteils gelegt. Mein Magen zieht sich zusammen. Wie so ziemlich jedes Mal, wenn ich an den wahren Grund für diese Reise denke.
«Ich wollte damit nur sagen, dass du auf jeden Fall etwas essen solltest», protestiert meine Mutter. «Wie ich dich kenne, hast du noch nicht einmal gefrühstückt. Bald klappern deine Knochen gegeneinander.»
Das sagt die Richtige, denke ich, behalte es aber für mich. In ihrem zweiteiligen Kostüm, das entfernt an Coco Chanel erinnert, sieht Mama so schmal und dünn aus, als könne die nächste Windbö sie umpusten.
«Ich habe sehr wohl etwas gegessen», rechtfertige ich mich lahm. Ich weiß, das Gerede macht keinen Sinn. Mein Argument, dass ich zwar schlank, aber keinesfalls dünn bin und dass die Gefahr, vom Fleisch zu fallen, bei mir nicht besteht, würde an meiner Mutter abprallen wie Regen von einem Schirm.
«Sag doch auch mal was dazu, Stefan», fordert sie ihren Schwiegersohn auf, ihr beizustehen. «Du kannst unmöglich wollen, dass deine Frau zum Knochengerüst abmagert.» Beiläufig kramt sie ein silbernes Puderdöschen aus ihrer überdimensionalen Handtasche, lässt es aufschnappen und begutachtet sorgfältig ihr Spiegelbild.
Ich schiele zu Stefan und signalisiere ihm durch wildes Augenplinkern: Halt dich zurück, sonst wird alles noch schlimmer. Doch er sieht an mir vorbei, greift sich das Bedienteil des Radios und versucht, es im Handschuhfach zu verstauen. Geräuschvoll hantiert er mit dem sperrigen Inhalt des Fachs, um die Klappe zu schließen. Nebenbei bemerkt er: «Mach dir keine Sorgen, Elisabeth, ich passe auf, dass Luisa nicht ihre schönen Kurven einbüßt.» Mit Wucht startet er einen erneuten Versuch, das Schloss einschnappen zu lassen. Doch ein Kabel baumelt heraus und vereitelt sein Vorhaben.
Meine Kurven? Hat er mich mal angesehen? Von welchen Kurven redet er?
Während Stefan sich weiter mit dem Fach abmüht, klingelt auf der Rückbank das Handy meiner Mutter. Udo Jürgens singt Ich weiß, was ich will. Dumpf dudelt es aus den Tiefen ihrer Tasche, und ich kann hören, wie Mama bei ihrer Suche immer hektischer wird. Etliche Reißverschlüsse werden auf- und zugezogen, die Musik wird lauter, doch in der enormen Tasche mit ihren schätzungsweise achtzehn Fächern scheint Udo verlorengegangen zu sein. In eindrucksvoller Lautstärke trällert er weiter, was Stefan offenbar zu Höchstleistungen anspornt. Endlich knallt das Handschuhfach zu, er lässt sich erleichtert zurück in seinen Sitz fallen und lächelt mich an. Sein Blick wird weich. Ich weiß, was ich will, singt Udo, ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht …
In Stefans blauen Augen blitzt ein heller Schein auf. Ein Funkeln. Mir scheint, als warte er darauf, dass ich etwas sage.
«Ich … ähm …» Tatsächlich liegt mir gerade einiges auf der Zunge, nicht nur die Frage, was der Spruch mit den Kurven zu bedeuten hat. Doch als ich sehe, dass Stefans Lippen tonlos den Text mitsprechen, als sei er eine an mich gerichtete Botschaft, bleiben mir die Worte im Halse stecken.
… und glauben, nirgends ist ein Ende in Sicht, nein, für uns nicht …
Stefans Augen bohren sich in meine. Verlegen knispele ich an meinen Nägeln und fühle, wie ich eine Gänsehaut bekomme.
Mir ist die Situation unangenehm, und ich würde sie liebend gern überspielen, zum Beispiel indem ich ihn frage, warum er mich so ansieht. Jetzt, wo er doch Conni hat.
Aber das ist ein Thema, das ich unter keinen Umständen erwähnen sollte, wenn meine Mutter in Hörweite sitzt. Prüfend drehe ich mich zu ihr um. Sie hat jetzt das Handy am Ohr, nickt in regelmäßigen Abständen und studiert nebenbei einen zerknitterten Zettel, den sie aus den Tiefen der Tasche gezogen haben muss. Doch auch wenn es gerade den Anschein hat, dass sie in ihr Telefonat vertieft ist und hochkonzentriert den Einnahmeplan irgendwelcher Pillen vor sich hinmurmelt, weiß ich nur zu gut, dass ihr von meiner Unterhaltung mit Stefan kein Sterbenswort entgehen würde. Ihre Ohren können überall gleichzeitig Gesprächsfetzen aufschnappen. Jede noch so knappe oder verschlüsselte Äußerung wird von ihr aufgesaugt, unter den graublauen Locken zwischengespeichert und zur nächstbesten Gelegenheit hervorgeholt und analysiert.
Ich kapituliere, schlucke meine Frage schweren Herzens hinunter und schaue wieder zu Stefan.
«Ich weiß, was ich will», singt er ganz leise und jetzt ohne Udos Begleitung. Sein Blick ist so intensiv, dass ich spüre, wie mein Herz absurderweise ein wenig schneller zu klopfen beginnt. Einen Moment schaffe ich es, ihm in die Augen zu sehen, dann muss ich mich abwenden. Mit dem Kopf voran tauche ich in den Fußraum und beginne geschäftig in meiner Tasche zu kramen.
«Und was ist mit den länglichen Pillen, soll ich die teilen?», höre ich meine Mutter dumpf auf der Rückbank ins Telefon fragen. «Wie bitte – weglassen?» Sie klingt entsetzt.
Unbeirrt hänge ich weiter mit dem Oberkörper über meinen Beinen und versuche, etwas ganz anderes zu verstehen, nämlich was sich zwischen Stefan und mir gerade abspielt. Was ist auf einmal mit ihm los? Flirtet er mit mir? Das kann ja wohl kaum sein, schließlich …
«Luisa, ist alles in Ordnung?», fragt Stefan besorgt.
«Ja … Natürlich! Ich suche nur mein … Notizbuch.» Tatsächlich taste ich zwischen all meinen Sachen nach dem kleinen schwarzen Büchlein, das ich gleich zum Telefonieren benötige. Vollkommen unzeitgemäß, so ein Heftchen, und dass das Teil so zerfleddert aussieht, macht auf Kunden manchmal einen eigentümlichen Eindruck. Aber ich kann nicht anders. Ich hänge an dem Buch, es ist mein ständiger Begleiter, dem ich alles anvertraue – von neuen Kontaktdaten über spontane Ideen bis hin zu Aufzeichnungen, die ich mir beim Telefonieren mache. Ein Stück Nostalgie, das ich mir sorgsam bewahre. «Ich … hab’s gleich.»
Als ich in Zeitlupe endlich aus dem Fußraum auftauche, lächelt Stefan mich schon wieder an. Viele kleine Fältchen legen sich um seine Augen, wie ein perfekter, maßgefertigter Rahmen. Hoppla, denke ich. Wie viele es auf einmal sind. Können die alle im letzten halben Jahr entstanden sein?
«Manche Dinge ändern sich nie», sagt Stefan amüsiert und streicht mit seinen Fingern sanft über meine Hand, in der ich das Notizbüchlein halte. «Gut zu wissen.»
«Tja …», ich räuspere mich. Plötzlich habe ich einen fetten Kloß im Hals. Was total albern ist, Stefan ist schließlich mein Ehemann. Noch jedenfalls. Ich trage seinen Ring, und wir besitzen ein gemeinsames Haus. Es gibt somit keinen Grund, aufgeregt zu sein. Theoretisch. Schnell ziehe ich meine Hand unter seiner weg. «Wollen wir … jetzt mal aussteigen?»
Herrje, was ist nur mit mir los? Wieso bringen mich seine Aufmerksamkeiten so durcheinander?
Übersprungsartig schaue ich zu meiner Mutter nach hinten, die gerade ihr Gespräch beendet.
«Wiederhören, Frau Zink», verabschiedet sie sich. «Vielen Dank für Ihren Anruf. Und grüßen Sie bitte den Herrn Doktor von mir.» Sie hat kaum aufgelegt, da schaut sie ungeduldig von mir zu Stefan. «Können wir dann jetzt endlich? Die 17 wartet!»
Während meine Mutter und Stefan auf die gläserne Eingangstür der Raststätte zueilen, schlendere ich zu dem Rasenstück hinter den Parkplätzen. In die Mitte der Grünfläche wurde vor nicht allzu langer Zeit ein Vogelbeerbaum gepflanzt. So wie er da steht, einsam und schutzlos in der Sonne, tut mir der junge Baum fast leid. Versonnen streiche ich über die grüngraue Rinde des dünnen Stammes und atme ein paar Mal tief durch. Die Luft ist herrlich. Sommerlich warm und sie duftet blumig, trotz der nahe gelegenen Tankstelle und der Autobahn. Eine milde Brise streift meine nackten Oberarme. Ich recke das Gesicht gen Himmel und fühle, wie die wärmenden Sonnenstrahlen ein wohliges Kribbeln auf meiner Haut erzeugen. Doch innerlich will mir nicht recht warm werden.
Auf meinem Handy scrolle ich durch die zuletzt gewählten Nummern, tippe die von Janosch an und höre es kurz darauf in der Leitung rauschen. Irgendwann ertönt ein fremdes Tuten. Drei Mal, dann springt die Mailbox an. Auf Englisch erklärt mein ehemaliger Assistent zurzeit nicht erreichbar zu sein. Wie so oft. Ich bin enttäuscht. Seit Janosch vor einem halben Jahr bei LUX14 gekündigt hat, um sich in London als Trendscout selbständig zu machen, erreiche ich ihn kaum noch. Trotzdem sind wir heute fast enger befreundet als während unserer gemeinsamen Zeit in Frankfurt. Die Technik macht es möglich. Beinahe täglich schicken wir uns Kurznachrichten oder Fotos und bleiben über Instagram und Facebook im Leben des anderen auf dem Laufenden. Heute muss ich ihn aber dringend persönlich sprechen. «Hi, Jano, ich bin’s, Luisa», beginne ich und gerate ins Stocken, als ich merke, wie angespannt sich meine Stimme anhört. «Hast du die Nummer von Yves Rusco rausgekriegt? Bitte melde dich, es geht um …» Ich breche ab. Obwohl wir uns so nahestehen, habe ich ihm den Grund für mein Anliegen bislang verschwiegen. Warum, weiß ich gar nicht. Vielleicht, weil ich mir einbilde, dass, je weniger ich über das Thema rede, meine Chancen auf ein Wunder steigen. «Es ist extrem wichtig», beende ich zügig den Satz und lege auf, ehe ich ihm doch noch von dem Schlamassel erzähle, in dem ich gerade stecke.
2Salamipizza und Sanifair-Toilette
Bereits beim Betreten der Raststätte, noch im überhitzten Eingangsbereich, bereue ich es, nicht draußen auf meine Familie gewartet zu haben. Im Gegensatz zur frischen Sommerbrise schlägt mir hier drinnen eine Geruchsmischung aus Frittierfett, Kurzgebratenem und etwas undefinierbar Säuerlichem entgegen. Ich halte die Luft an, während ich im gut gefüllten Speiseraum nach meiner Mutter und Stefan Ausschau halte. Um mich herum werden fettig glänzende Essensberge, vor allem Pommes und Pizzaecken, zackigen Schrittes an mir vorbeibalanciert und oftmals noch im Gehen angeknabbert.
Ich entdecke die beiden an einem Tisch am Fenster. Sie sitzen über Eck, den Blick auf eine bunte Kinder-Hüpfburg gerichtet, und essen bereits. Als ich näher trete, schaut meine Mutter hoch. Mit einem Twist im Handgelenk, bei dem das Zifferblatt ihrer Armbanduhr im Sonnenlicht funkelt, deutet sie zum Buffet und sagt: «Hol dir etwas Leckeres, Liebes. Ich bezahle.»
Es ist nämlich so: Nicht nur hält sie meinen Job für neumodischen Quatsch, sie ignoriert auch komplett, dass ich mit fünfunddreißig Jahren längst mein eigenes Geld verdiene. Stattdessen behandelt sie mich wie einen Teenager, der orientierungslos durchs Leben treibt und finanziell von Mama abhängig ist.
«Danke, aber ich habe keinen Hunger.» Ich hänge meine Tasche über die Lehne eines freien Stuhls und setze mich. Die Augen meiner Mutter wandern in stummem Ersuchen zu Stefan. Er hebt nur hilflos die Hände.
Langsam spüre ich Wut in mir aufsteigen. Reicht es denn nicht, dass in meinem Leben gerade einiges schiefläuft – und das ist noch harmlos ausgedrückt –, müssen die beiden sich jetzt auch noch gegen mich verbünden? Da ist es doch kein Wunder, wenn einem der Appetit vergeht!
«Machst du dir Sorgen, Liebes?» Mama lässt nicht locker. Sie tupft sich den Mund mit einer Serviette ab. «Wegen Regina?» Ihr Tonfall ist jetzt nicht mehr so forsch, und ihr Blick wird weich, als sie mir in die Augen schaut und auf eine Antwort wartet.
Ich beiße mir auf die Lippen, dass es weh tut. Bitte nicht schon wieder dieses Thema. Nicht auch noch hier auf der Raststätte, zwischen Salamipizza und Sanifair-Toilette. «Nein», presse ich hervor und versuche, so unbekümmert wie nur möglich zu klingen. Allerdings schaffe ich es nicht, sie dabei weiter anzusehen. Missmutig wende ich meinen Blick ab und schiele nach links aus dem Fenster. An der Hüpfburg fängt gerade ein Junge an zu heulen, weil seine Eltern weiterfahren möchten und ihn mit sich ziehen.
Plötzlich spüre ich Stefans Hand. Sie wandert behutsam über meinen Handrücken, streift meinen Unterarm und bleibt dort bedeutungsschwer liegen. «Du tust das Richtige, Lu», sagt er zärtlich. «Es ist vollkommen legitim, dass du nach all den Jahren mehr erfahren willst.»
Ich schaue ihn überrascht an. Der sanftmütige Klang seiner Stimme und die Berührung seiner warmen, weichen Hand haben etwas Tröstliches. Gleichzeitig irritieren mich seine Worte. «Das stimmt ja so nicht», sage ich, obwohl ich mich eigentlich nicht auf das Thema einlassen wollte. «Es war nicht mein Wunsch, in der Vergangenheit zu stöbern. Es war der von Mama. Sie ist die treibende Kraft hinter dieser Reise.» Beinahe trotzig sehe ich zu meiner Mutter und denke im Stillen, dass ich, ginge es nach mir, jetzt garantiert nicht hier mit Hüpfburgpanorama säße, sondern an meinem Schreibtisch bei LUX14. Leider ist das in vielerlei Hinsicht gerade keine Option.
«Und das war richtig so», lobt Stefan meine Mutter. «Ich denke ganz genauso. Regina möchte dich kennenlernen, und du solltest ihr diesen Wunsch nicht ausschlagen. Da sind Elisabeth und ich uns absolut einig.» Er sucht kurz Mamas Zustimmung und fährt anschließend fort: «Dass du Angst vor dem Zusammentreffen hast, ist vollkommen verständlich. Es wäre wohl jedem mulmig zumute, wenn er seiner leiblichen Mutter nach fünfunddreißig Jahren zum ersten Mal begegnet.» Er lässt die Schwere des Satzes einen Moment wirken. «Aber genau deshalb begleiten wir dich ja. Wir stehen dir bei.»
Während er mir ein Lächeln schenkt, das wohl als Aufmunterung gedacht sein soll, auf mich aber ein klein wenig selbstgefällig wirkt, streichelt er ununterbrochen meinen Arm.
Stefan und Mama sind sich also einig. Na, das ist ja wunderbar. So langsam fühle ich mich nicht mehr wie ein Teenager, der finanziell abhängig ist und laufend gemaßregelt wird, sondern wie eine Zweijährige, die gar nichts allein entscheiden darf. Und wieso spielt er sich jetzt auch noch als Retter auf? Als hätte er im Vorfeld dieser Reise irgendetwas dazu beigetragen, dass dieses Treffen stattfindet. Meinetwegen hätte er nicht einmal mitzukommen brauchen. Auch Mama nicht.
Diese Fahrt ist eine einzige Farce.
«Ich habe keine Angst vor der Begegnung», protestiere ich und schiebe seine Hand von meinem Arm. «Kein bisschen.» Einen Augenblick schaffe ich es noch, mich zusammenzureißen, dann kann ich nicht mehr. Die Worte sprudeln nur so aus mir heraus, als hätte jemand eine geschüttelte Mineralwasserflasche geöffnet. «Regina ist mir vollkommen egal. Vor Jahren habe ich mir dieses Treffen sehnlich gewünscht, aber nun interessiert sie mich nicht mehr. Aus und vorbei!» Ich mache eine wegwerfende Handbewegung. «Ebenso wenig schert mich ihre Einladung. Ihr wisst genau, dass ich gute Gründe habe, dieser Frau ihren Wunsch auszuschlagen.» Ich lege meine ganze Verachtung in die Betonung der zwei Worte. «Sehr gute Gründe.»
Aus dem Augenwinkel kann ich sehen, dass Stefan und Mama ratlose Blicke austauschen.
«Sprichst du von Reginas Brief?», fragt Stefan vorsichtig.
«Von ihren Briefen», korrigiere ich. «Von diesem und auch von dem ersten.» Ich schaffe es nicht, ihn anzuschauen.
«Du darfst ihnen nicht so viel Bedeutung beimessen, Lu. Die richtigen Worte zu finden, fällt nun mal nicht jedem leicht», führt er zögernd an. «Schon gar nicht, wenn es darum geht, seine Gefühle aufzuschreiben.»
«Ach ja?» Meine Stimme klingt ein wenig schrill, doch ich kann nichts dagegen tun. Was mischt er sich ein? Er hat doch Reginas Zeilen gar nicht gelesen. Wenn überhaupt, hat meine Mutter ihm am Telefon ein paar Sätze aus ihrer Erinnerung zitiert. Und wer weiß schon, welche das waren. «Wenn sie ihr Anliegen nicht ausdrücken kann, hätte Regina besser gar nicht erst schreiben sollen.» Ermattet rutsche ich ein Stück auf meinem Sitz nach unten. Ich wünschte, die beiden würden mich endlich in Ruhe lassen.
«Ach Liebes.» Jetzt ist es Mama, die meinen Arm tätschelt. «Warte doch erst einmal ab, was Regina dir sagen wird. Ein Gespräch unter vier Augen ist so viel aufschlussreicher als ein Brief.»
Ich schließe die Augen und bete, dass der Moment vorbeigeht. In den letzten Wochen haben Mama und ich über kaum etwas anderes gesprochen als über Reginas Einladung. Schon lange haben wir nicht mehr so häufig telefoniert, und jedes Mal, wenn Mama mich anrief, kam es zum Streit. Jetzt mag ich nicht mehr. Diese Diskussion zermürbt mich. Was wollen die beiden überhaupt? Ich habe meiner Mutter das Versprechen gegeben, Regina zu besuchen, und jetzt sind wir auf dem Weg zu ihr. Reicht das nicht? Müssen wir jetzt auch noch pausenlos über sie reden?
Ich schweige weiter beharrlich. Stefan starrt vor sich auf die Tischplatte und meine Mutter auf ihren noch ziemlich vollen Teller, als stünde an einem dieser Orte zu lesen, wie sie mich zur Vernunft bringen könnten. Irgendwann hebt Mama den Kopf. Sie wartet, bis ich sie ansehe. Ihre Augen schimmern perlmuttfarben, als sie leise sagt: «Wer nach Rache strebt, hält seine eigenen Wunden offen. Denk mal darüber nach, Luisa.»
Ich wende den Blick ab. Ganz sicher werde ich das nicht tun. Ich werde weder länger über Regina noch über diesen blöden Spruch nachgrübeln. Wozu auch? Es gibt in meinem Leben Wichtigeres, das ich dringend überdenken muss. Mit Regina und ihrem französischen Berg-Kaff beschäftige ich mich erst, wenn es so weit ist.
«Ich hole mir jetzt eine Brezel», sage ich und stehe mit Schwung auf, um dem Gespräch ein Ende zu bereiten. Der Stuhl schabt quietschend über die rauen Fliesen. «Und danach können wir meinetwegen weiterfahren.»
«Ich habe übrigens im Romantikhotel Zum springenden Hirsch reserviert», erklärt Stefan, als wir wenig später am Auto stehen. Betont optimistisch fährt er fort: «Ein ruhiges Einzelzimmer für Elisabeth und ein lauschiges Zimmer zur Gartenseite für uns. Die Bilder auf der Website sahen äußerst vielversprechend aus.» Er zwinkert mir zu.
Eine Sekunde glaube ich, er will mich aufheitern, und quittiere seine Bemühungen mit einem dankbaren Lächeln. Ich muss mich wieder beruhigen. Die beiden sind vermutlich nur nervös und wissen nicht anders mit mir umzugehen. Mit meiner aufgestauten Wut mache ich alles nur schlimmer. Dann plötzlich erreichen mich Stefans Worte. Romantikhotel? Ein Zimmer? Ich starre ihn an. Stefan grinst breit, und sein Gesichtsausdruck sagt, dass ich mich nicht verhört habe.
Mit lässiger Geste öffnet er Mama die Tür, hilft ihr galant beim Einsteigen und hört nicht auf, mich über das Wagendach hinweg anzulächeln. Was bitte ist in ihn gefahren?
Sobald meine Mutter sitzt und ihre Tür geschlossen ist, flüstere ich so laut, dass er es gerade noch hören kann: «Was hat das zu bedeuten? Wieso buchst du uns ein lauschiges Hotelzimmer?»
Stefan lässt sich nicht in die Karten gucken. Mit geheimnisvoller Miene antwortet er: «Ich dachte, du freust dich. Wegen der Romantik.»
«Seit wann bist du denn romantisch?»
«Hast du etwa ein Problem damit?»
«Ich nicht. Aber du solltest eins damit haben.»
«Warum? Wir sind doch ein Ehepaar!»
«Theoretisch ja. Nur, dass der eine Teil dieses Paares …» Weiter komme ich nicht, denn in diesem Moment hämmert meine Mutter mit dem Ringfinger gegen die Scheibe. Gleich darauf öffnet sie in Königinnenmanier ein Stück die Tür und ruft: «Ich dachte, du hast es eilig, Stefan-Schätzchen?»
Wir steigen ein. Während ich den Anschnallgurt anlege und überlege, was mich noch so alles auf dieser Reise erwartet, lässt meine Mutter die Tür lautstark zuknallen. «Der größte Feind der Qualität ist Eile», zitiert sie gestelzt und vergisst nicht, uns im Anschluss ihre Übersetzung zuteilwerden zu lassen: «Also fahr bitte nicht wieder so hektisch, Stefan. Wir wollen doch sicher in unserem Hotel ankommen.»
«Aye aye, Madam!»
Sekunden später hat er den Motor gestartet, und wir nehmen erneut Kurs auf der A7 Richtung Süden. Die Sonne hat ihren höchsten Stand überwunden und belächelt mit goldenem Schein die sorgfältig bestellten Äcker entlang der Strecke. Nach wenigen Kilometern lädt rechter Hand ein klarer See zum Schwimmen ein. Vögel fliegen übermütig durch die Luft und hinter ihnen, weit weg am Horizont, erahne ich bereits die Berge.
Gerade fange ich ein wenig an zu entspannen, als meine Mutter unvermittelt fragt: «Was ist das für ein komisches Geräusch?»
Ihr Kopf taucht zwischen den Vordersitzen auf. «Irgendetwas schnarrt doch hier.»
Stefan, der gerade zwei Lastwagen passiert, die wiederum im Begriff sind, sich gegenseitig zu überholen, schweigt konzentriert.
«Also, ich höre nichts», erkläre ich.
«Aber ich.» Mama bleibt beharrlich. «Jetzt fiept es auch noch.»
Stefan schaut starr geradeaus. Er beendet sein Manöver und reiht sich auf der mittleren Spur ein. «Vielleicht ist es ja dein Hörgerät?», witzelt er und schlägt lachend auf das Lenkrad. Dabei trifft er aus Versehen die eingebaute Knopfleiste, sodass das Radio anspringt. Südwestrundfunk mit einer Reportage über Zugvögel und ihre Flugrouten. Wie passend.
Ein fremdes Geräusch ist jetzt jedenfalls nicht mehr zu hören. Nur noch meine Mutter, die pikiert erklärt: «Ich trage gar kein Hörgerät.»
Stefan tut eine Weile so, als würde er dem Bericht lauschen, dabei möchte er vermutlich nur das Gespräch mit meiner Mutter nicht vertiefen. Zugvögel interessieren ihn ganz sicher nicht. Das war zumindest so, bevor er in den Körper dieses Mannes geschlüpft ist, der plötzlich Liebeslieder summt, Übernachtungen in Romantikhotels bucht und einem den Arm streichelt.
«Also, der Gerd und ich, wir sind mal im Winter in den Harz gereist», fährt Mama unbeirrt fort, «da gab unser Wagen – ich glaube, es war ein Käfer – ähnlich unschöne Geräusche von sich.» Noch immer krallt sie ihre Nägel nach vorne gebeugt in die Lehne unserer Sitze. «Wir hielten an einem steilen Hang und mussten warten, bis jemand …»
Ich gähne innerlich. Die Geschichte mit der Panne im Harz hat meine Mutter schon mindestens zwanzig Mal erzählt. Und natürlich weiß sie das. Ich glaube, sie will uns foltern. Als Rache dafür, dass wir sie nicht ernst nehmen.
Während ich Stefan im Stillen bedauere, da er ihrem maschinengewehrgleichen Geschnatter ausgeliefert ist, blende ich Mamas Gerede aus und ziehe unauffällig mein Handy hervor. Ob Janosch sich bereits gemeldet hat? Es hängt so viel an dieser Telefonnummer, dass ich ganz wuschig werde. Was, wenn es ihm nicht gelingt, sie herauszufinden? Dann werde ich mir einen neuen Plan überlegen müssen, aber ich weiß jetzt schon, dass das leichter gesagt als getan ist. Gespannt linse ich auf das Display, doch es zeigt zu meinem Bedauern keine neue Nachricht. Um sicherzugehen, dass er sich nicht eventuell per Mail gemeldet hat, rufe ich meine beiden Accounts ab. Zunächst meinen privaten, dann den geschäftlichen. Das heißt, genau genommen versuche ich, meine Firmenmails abzurufen. Angeblich habe ich aber keine bekommen. Keine einzige. Null. Was vollkommen ausgeschlossen ist, an einem normalen Freitag wie heute. Typischerweise müssten haufenweise Mails mein Postfach verstopfen: Newsletter, die obligatorische Mail zum Wochenend-Meeting, Antworten auf Anfragen und Werbemails. Dazu die reguläre Geschäftspost. Und Spam. Aber da ist nichts. Ungläubig starre ich auf das Telefon in meinen Händen. Mein Blick fliegt zur Datumsanzeige meiner Uhr, dann checke ich, ob heute vielleicht ein weltweiter Feiertag ist, und nachdem ich das ausschließen kann, zwinge ich mich, scharf nachzudenken. Welcher mysteriöse Umstand könnte dafür verantwortlich sein, dass heute keine Mails kommen? Ein Satellitenausfall? Irgendetwas, das im All herumschwirrt und das Funknetz über Europa lahmlegt? Eine Cloud vor der Cloud?
Ich weiß überhaupt nicht, wo auf der Welt man heutzutage nicht erreichbar ist. Selbst auf dem Mond ist man vermutlich available. Ein ungutes Gefühl macht sich in meinem Inneren bemerkbar. Um mich davon abzulenken, rufe ich versuchsweise im Internet unterschiedliche Seiten auf und checke zudem mein Instagram-Profil. Alles funktioniert reibungslos.
Mit einem inzwischen mehr als flauen Empfinden im Magen wiederhole ich die Mailabfrage. Dieses Mal erhalte ich die Nachricht, dass mein Account nicht antwortet und ich mein Passwort eingeben soll. Ich atme erleichtert auf. Also doch nur wieder so ein Technik-Problem. Aber ein lösbares! Ich rufe die Seite mit den Einstellungen auf, gebe LUXLuisa14 ein und … es geschieht nichts.
Wrong password.
Zweimal wiederhole ich konzentriert die Eingabe der geforderten Buchstaben- und Zahlenkombination, dann erscheint ein neues Fenster mit einem neuen Text. Ich werde aufgefordert, die Sicherheitsfrage zu beantworten. Auch diese Antwort wird nicht akzeptiert.
Kraftlos lasse ich mich tiefer und tiefer ins Polster sinken. Einen sehr langen Moment lasse ich mir die abwegigsten Deutungen für dieses Phänomen durch den Kopf gehen, weil ich die einzige logische Erklärung nicht wahrhaben will. Mein Magen ist inzwischen ein dicker, in sich verkrampfter Knoten, der mir Übelkeit beschert. Ich schlucke ein paar Mal trocken und starre aus dem Fenster. Die vorbeifliegende Landschaft verschwimmt vor meinen Augen, sie wird vom Schwindel in meinem Kopf zu einem Zerrbild verfremdet. Alles um mich herum dreht sich.
Mühsam fixiere ich einen Punkt in der Ferne, damit sich meine Augen beruhigen. Es dauert lange, aber schließlich funktioniert es. Sobald ich wieder scharf sehen kann, versuche ich, mich ins Intranet von LUX14 einzuloggen. Auch das ist nicht möglich. Dreimal gebe ich meinen Namen und den zugehörigen Code ein. Dreimal erscheint dieselbe Fehlermeldung: Der Benutzername ist uns nicht bekannt.
Ganz langsam schaffe ich es, den Gedanken, der leise in meinem Hirn herumspukt und den ich bis gerade verdrängt habe, zuzulassen: Sie haben meinen Zugang gesperrt.
Auf einen Schlag wird mir eiskalt. Es ist die einzig logische Erklärung, und sie trifft mich wie ein Fausthieb mitten ins Gesicht: Mein Chef hat seine Drohung wahr gemacht.
Ich bin raus.
3Conni
Nein. Das kann nicht sein. Mein Chef Lutz Biedinghaus und ich hatten uns auf eine Beurlaubung geeinigt.
Okay, geeinigt ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Er hat mir eine längere Pause aufgezwungen. Von einem gesperrten Account war jedoch nie die Rede.
Draußen flimmert die Hitze über dem Asphalt, mehr nehme ich von der Umgebung nicht wahr. Ich weiß nicht einmal, ob es um mich herum wirklich so still ist oder ob ich mich nur fühle, als sei ich in einem Kokon dumpfer Tristesse gefangen. Wann hat Stefan eigentlich das Radio ausgeschaltet? Und seit wann hält meine Mutter auf der Rückbank ein Nickerchen? Ich habe keine Ahnung.
Mein Kopf schmerzt von der vielen Grübelei, und obwohl Stefan den Wagen auf angenehme neunzehn Grad temperiert hat, rinnt mir der Schweiß den Rücken herunter. Gleichzeitig fröstele ich und reibe mir die Arme, da es sich in meinem Inneren anfühlt, als habe ich zu viel eiskaltes Wasser in mich hineingeschüttet. Die Ungewissheit darüber, was genau sich zugetragen hat, nagt an mir. Nein, sie macht mich beinahe wahnsinnig. Blöderweise ist der Einzige, der Bescheid weiß und mir eine klare Auskunft geben könnte, mein Chef. Die Blöße, ihn anzurufen, werde ich mir aber ganz sicher nicht geben. Es ist zum Verrücktwerden! Wenn ich wenigstens mit jemandem über diese Sache reden könnte! Ein Blick auf mein Handy zeigt, dass Janosch sich noch immer nicht gemeldet hat. Ihm würde ich mich anvertrauen, aber offenbar hat er selbst genug um die Ohren.
Unauffällig linse ich zu Stefan. Bis zu unserer Trennung war er mein bester Berater, insbesondere, wenn es sich um berufliche Angelegenheiten drehte. Seine Begabung für analytisches Denken und die Nüchternheit, mit der er Sachverhalte ergründet und beurteilt, haben mir in der Vergangenheit häufig bei einem Problem den entscheidenden Denkanstoß geliefert. Er sieht Wege und Lösungen, die mir niemals in den Sinn kommen würden. Weil ich im Vergleich zu ihm nämlich leider vollkommen unstrukturiert bin. Und viel zu emotional.
Im Grunde sind Stefan und ich vom Naturell so unterschiedlich veranlagt, dass bei unserem Kennenlernen niemand auch nur einen Cent darauf verwettet hätte, dass aus uns mal ein Paar werden könnte. Und doch hat es gefunkt. Gut möglich, dass es eben diese Gegensätzlichkeit war, die uns zusammengeschweißt hat. Flexibilität und Spontanität waren meine Stärken, Planung und Organisation übernahm Stefan. Seine verbindliche Art bildete in meiner turbulenten Welt den Ruhepol. Er hatte die Dinge im Blick, er war mein Fels in der Brandung.
Ihn jetzt wieder in mein Leben zu lassen, sei es auch nur, indem ich ihm von meinen Problemen erzähle, hatte ich eigentlich nicht vorgehabt. Mit ihm am Abend ein Bett zu teilen, allerdings auch nicht.
Wie Stefan es prophezeit hat, erreichen wir um kurz nach 18 Uhr das Romantikhotel Zum springenden Hirsch. Damit haben sich seine planerischen Fähigkeiten aber auch erledigt. Ich weiß ja nicht, welche vielversprechenden Fotos er auf der Website des Hotels erspäht haben will, aber es muss sich um eine Fotomontage gehandelt haben. De facto ist an diesem Hotel nämlich gar nichts romantisch, und die Lage, zentrumsnah an der Hauptstraße, lässt auch nicht unbedingt darauf schließen, dass demnächst ein Hirsch um die Ecke gesprungen kommt. Das Haus ist ein betongrauer Klotz mit rissiger Fassade und flackernder Leuchtreklame. Vor der Eingangstür klafft eine Baugrube, sodass wir unseren Wagen in fünfzig Meter Entfernung halb schräg auf einem Gehweg parken und anschließend über eine provisorische Holzbrücke zum Gebäude balancieren müssen.
«Zum Glück liegen die Zimmer ja zur Gartenseite», macht Stefan sich selbst Mut, als wir den ebenfalls grau gefliesten Eingangsbereich betreten. «Sollen die sich hier vorn ruhig austoben.»
Eine junge Frau in einem kurzen, schwarzen Schlauchkleid und mit dunklem Kajal um die Augen schaut mürrisch von ihrem Monitor auf. Sie legt online eine Patience, und die Ankunft von Gästen scheint von ihrem Zeitlimit abzugehen. In Windeseile rattert sie alles Wissenswerte zum Hotel herunter, schiebt uns die Plastikkarten für unsere Zimmer über den Tresen und ist gleich darauf wieder in ihr Spiel vertieft.
«Ich gehe schlafen.» Mama sieht ziemlich erschöpft aus und hat auch keinen Hunger mehr. «Holt ihr mich zum Frühstück ab?»
Wir nicken, begleiten sie bis zu ihrer Tür in der ersten Etage und verabschieden uns. Nebenan, nur ein paar Schritte weiter, liegt unser Doppelzimmer.
Stefan zieht die Karte durch den Schlitz, die Tür springt auf und … mir bleibt die Luft weg. Der Raum ist winzig, wie eine Zwergenbehausung. Mit waldgrün bemalten Wänden, schlammfarbenen Vorhängen und einem Teppichboden, der seine besten Jahre lange hinter sich hat. Einen Schrank sucht man vergebens, Luxus ebenso. Das einzige Highlight ist ein DIN-A4- großer Flachbildfernseher. Na ja und der Ausblick in den Garten: ein betonierter Innenhof, in dem die Bauleute bereits das Gestänge für ein rückwärtiges Gerüst gelagert haben.
«Tja …», sage ich gedehnt und lasse meinen Blick durch das Zimmer schweifen, «so viel zum Thema Romantik.»
Das Herzstück des Zwergenzimmers bildet ein holzverkleidetes, mit handgeschnitzten Intarsien verziertes Doppelbett, über dessen Kopfende ein monströser, verstaubter Hirschkopf prangt. Zumindest thematisch wurde hier nichts ausgelassen. Wie ein Mahnmal hängt der Hirsch da, mit seinem mächtigen Geweih und einem Silberblick, von dem man sich geradezu verfolgt fühlt. Schnell schieße ich ein Foto für Janosch.
Auch Stefan kann nicht fassen, wo wir gelandet sind. Kopfschüttelnd beugt er sich über seine Reisetasche und wühlt darin herum. Als er wieder auftaucht, hält er eine Flasche Champagner in die Höhe. «Wie gut, dass ich die hier dabeihabe. Nüchtern wäre das alles ja gar nicht zu ertragen!» Er schaut mich ein wenig beschämt an.
Ich weiß nicht genau, ob er das Zimmer im Allgemeinen oder nur den Hirsch meint, aber das ist auch irgendwie egal. Was mich betrifft, passt der Spruch ohnehin auf die Reise insgesamt.
Alkohol ist keine Lösung, denke ich und deute mit dem Finger auf das schmale Bett. «Ähm … Wir schlafen da … gemeinsam?»
Stefans Blick bekommt etwas Spöttisches. «Wir haben acht Jahre in einem Bett geschlafen. Da kommt es auf diese eine Nacht wohl nicht an.»
«Aber zu der Zeit waren wir ein Ehepaar», erinnere ich ihn.
«Das sind wir noch immer.»
«Ja, aber nur auf dem Papier.» Ich begreife nicht, wie ihm das egal sein kann. «Als jemand, der mit Zahlen arbeitet, sollte dir bewusst sein, dass wir seit einem halben Jahr getrennt leben. Das sind sechs Monate.»
«Aber wir sind einvernehmlich auseinandergegangen. Alles ist gut zwischen uns. Und falls ich dich daran erinnern darf, teilen wir uns das Zimmer vor allem deshalb, weil deine Mutter noch nichts von unserer Trennung weiß. Außerdem …»
Ich will mir Stefans zweiten Grund gar nicht mehr anhören, weil mich sein erster schon so auf die Palme bringt, dass ich ihm ins Wort falle: «Du hast seit drei Monaten eine neue Freundin», erkläre ich. «Da schläft man nicht mit seiner Exfrau in einem Bett. Egal aus welchem Grund. Es ist Conni gegenüber nicht fair.»
Im Grunde kenne ich Conni gar nicht. Aber da sie nicht der Grund für unsere Trennung war und wir offenbar einen ähnlichen Männergeschmack haben, fühle ich mich ihr auf eine gewisse Art verbunden.
Stefan rollt nur mit den Augen.
«Oder weiß Conni etwa, dass du uns ein Doppelzimmer gebucht hast?», reite ich weiter auf dem Thema herum. «Weiß sie überhaupt, wo du steckst?» Kurz starren wir uns böse an, dann löse ich meinen Blick und lasse mich erschöpft aufs Bett sinken. Mit den Füßen streife ich mir die Schuhe ab.
Die Frage, was Conni weiß und was nicht, ist einfach so aus mir herausgesprudelt. Natürlich weiß sie es. Stefan ist kein Mann, der Geheimnisse hat. Er ist der Fels in der Brandung. Ein offenes Buch. Ein Sachbuch. Er ist quasi der fleischgewordene Konz-Steuerratgeber.
«Nein», sagt er nach langem Zögern. «Ich habe es ihr nicht erzählt.»
Ich falle aus allen Wolken. Dieser Mann ist nicht wiederzuerkennen.
Trotzig sieht er mich an. «Gegenfrage: Warum weiß deine Mutter noch immer nicht, dass wir uns getrennt haben?»
«Das ist ja wohl etwas vollkommen anderes.»
«Wenn du meinst.» Er lässt sich neben mir nieder. Dicht neben mir. Wir tragen beide nur T-Shirts, sodass sich unsere nackten Arme berühren. Ich spüre die Wärme seiner Haut und fühle, wie mich die mikroskopisch feinen Härchen seines Unterarms leicht kitzeln, sodass ich eine Gänsehaut bekomme. Die Nähe zu Stefan fühlt sich fremd an, aber gleichzeitig auch unendlich vertraut. Einen Moment rührt sich keiner von uns. Wir hängen jeder unseren Gedanken nach und starren stumm an die Wand. Sie ist gar nicht grün gestrichen, sondern tapeziert. Eine grüne Tapete mit winzigen Hirschen, die in verschiedene Richtungen springen. Automatisch beginne ich, die unterschiedlichen Posen der Tiere zu zählen. Es sind nur drei.
Als ich es nicht mehr aushalte, tue ich so, als müsste ich mich am Fuß kratzen, und rücke unauffällig ein Stück von Stefan ab.
«Ich habe Conni erzählt, dass ich zu einem Seminar nach Frankreich fahre», beginnt er stockend zu erzählen. Angesichts dieses Lügenmärchens scheint er ein schlechtes Gewissen zu haben, denn nun fügt er erklärend hinzu: «Ich brauchte einfach mal ein paar Tage für mich. Ihre Kinder sind äußerst lebhaft, das bin ich nicht gewohnt.» Als ich nichts dazu sage, weil ich immer noch ein wenig schockiert bin, wie verändert er plötzlich ist, ergänzt Stefan: «Du und Elisabeth, ihr seid nun mal meine Familie. Da ist es ja wohl logisch, dass ich euch in der Not beistehe.»
Ich muss husten. In der Not? Meint er das ernst? Ich bin doch keine Ausrede.
«Also», beginne ich, die Sache geradezurücken, «ich glaube, du verrennst dich da in etwas. Dies ist kein Notfall. Und selbst wenn, dürfte es Conni ganz und gar nicht recht sein, dass du dich mit deiner Exfrau auf dem Weg nach Südfrankreich befindest, mit ihr ein Zimmer teilst und Champagner trinkst.» Ich deute auf die Flasche, die er noch immer in der Hand hält.
«Ach ja?» Er setzt sich etwas schräg, um mich besser ansehen zu können. Er hat die Augen zusammengekniffen und fixiert mich mit strenger Miene. «Und deiner Mutter dürfte es nicht recht sein, dass du sie seit einem halben Jahr belügst. Aber das scheint dich wenig zu kümmern.»
«Das stimmt nicht. Außerdem lenkst du vom Thema ab.»
«Weil es dazu nichts mehr zu sagen gibt. Wie ich meine Beziehung zu Conni gestalte, geht nur mich etwas an.»
Und Conni, denke ich, halte aber den Mund.
Stefan ändert den Kurs. Sein Ton wird sanfter, und sein Blick verliert etwas an Strenge. «Bevor du jetzt dagegenhältst, dass deine Beziehung zu deiner Mutter nur dich etwas angeht, möchte ich anmerken, dass du mich dabei zum Komplizen machst. Das ist nicht fair.» Er knibbelt nervös an dem Flaschenetikett herum. «Als sie mich neulich auf dem Handy anrief und mir wie selbstverständlich von Reginas Einladung erzählte, bin ich ziemlich ins Schwimmen geraten. Ich wusste schließlich überhaupt nicht, worum es geht.»
Okay, da hat er recht. Ich schaue ertappt zu Boden. Daran, dass meine Mutter unsere Reisepläne, die ja genau genommen ihre Reisepläne sind, vor Stefan ausbreitet, hätte ich natürlich denken müssen. Vermutlich suchte sie einen Komplizen, um sicherzugehen, dass ich keinen Rückzieher mache. Trotzdem finde ich es unfair, mir jetzt die alleinige Schuld dafür zu geben. «Wir hatten doch abgesprochen, Mama noch ein wenig zu schonen», erinnere ich ihn. «Bis ein geeigneter Zeitpunkt gekommen ist.»
Stefan streicht sich versonnen über das Kinn. «Ich weiß, dass wir das gesagt haben. Und ich stehe nach wie vor zu meinem Wort. Trotzdem ist mir die Schwindelei unangenehm.»
«Mir doch auch», gestehe ich kleinlaut. «Allerdings begreife ich nicht, warum du überhaupt mitfahren wolltest. Das macht ja alles nur komplizierter.» Ich wünschte, er würde endlich aufhören, das Etikett zu zerfledern. Der Boden ist schon ganz krümelig, und seine Nervosität schwappt auf mich über. «Es wäre wirklich nicht nötig gewesen.»
«Schon möglich», sagt Stefan, «aber als dein Ehemann fand ich es nun mal selbstverständlich, dich zu begleiten.»
Himmel! Wir drehen uns im Kreis. «Aber du bist nicht mehr mein Ehemann», brause ich auf, «das Thema hatten wir doch gerade.»
Endlich stoppt Stefan das Geknibbel an der Flasche, stellt sie auf den Boden und zieht sich ebenfalls die Schuhe aus. Mit spitzen Fingern löst er die Knoten, fegt mit der Handfläche ein wenig Staub von den Budapester Kappen und schiebt das Paar anschließend halb unter das Bett. Stöhnend streckt er die Beine aus und wackelt mit den Zehen. «Ich wollte einfach nur helfen. Du mit deiner Flugangst und Elisabeth mit ihrer schwachen Blase – eine so weite Reise wollte ich euch allein nicht zumuten. Außerdem …» Er hebt den Kopf, und ich fühle seinen Blick auf mir lasten.
«Außerdem was?», hake ich vorsichtig nach, ohne ihn jedoch anzusehen.
«Weißt du, Lu, ich frage mich, ob es vielleicht noch einen anderen Grund gibt, weshalb du Elisabeth noch nichts von unserer Trennung erzählt hast.»
Jetzt schaue ich ihn doch an. «Was genau meinst du? Welcher Grund sollte das sein?»
Er zögert einen Moment und sagt dann vorsichtig: «Kann es nicht vielleicht sein, dass du inzwischen gar nicht mehr zu der Entscheidung stehst?»
Mir wird ein wenig mulmig zumute. Mein Herz klopft schwer in meiner Brust. «Wie kommst du darauf?», frage ich so unbekümmert wie möglich.
Stefan legt den Kopf schräg und schaut mich offensiv an. Seine Augen leuchten so blau wie das Meer an einem windstillen Tag. «Vielleicht …», sagt er und greift schon wieder nach meiner Hand. «Vielleicht hoffe ich es einfach. Damit es mir nicht allein so geht.»
Wie bitte? Oh Gott. Jetzt setzt mein Herz doch glatt ein paar Takte aus.
«Heißt das …» Ich weiß gar nicht, ob es gut ist, den Gedanken laut auszusprechen. Das würde ihn real machen. Noch kann ich mir einbilden, dies alles sei ein riesengroßes Missverständnis. Doch mein Mund ist schneller als mein Hirn. Ich muss es einfach wissen. «Willst du sagen … dass du den Schritt bereust?» Meine Stimme klingt rau, und ich spüre, wie meine Augenlider nervös zu flattern beginnen. Die Situation ist vollkommen unwirklich, und ich habe plötzlich die Befürchtung, ihn missverstanden zu haben. Oder habe ich Angst, richtig gehört zu haben? Verwirrt mustere ich das zerrissene Papier am Boden.
Als Stefan und ich beschlossen, uns zu trennen, geschah dies einvernehmlich und ohne viel Aufhebens. Wir waren im Urlaub, im Wallis, in der Schweiz. Nur ein paar Tage hatten wir uns frei geschaufelt, um den Kopf frei zu bekommen und uns von der Arbeit zu erholen. Doch statt gemütlich vor dem knisternden Kaminfeuer zu kuscheln, langweilten wir uns plötzlich miteinander. Der Alltag hatte sich wie eine dicke, filzige Wolldecke über unsere Liebe gelegt und sie mit seiner Routine erstickt. Also steckten wir die Köpfe zusammen und analysierten die Lage. Zwei Tage und Nächte redeten wir, ergründeten und suchten nach Lösungen. Bis am Ende feststand, dass nur eine Trennung uns helfen konnte. Es war traurig, aber irgendwie spürten wir auch eine gewisse Erleichterung dabei, das Problem so schnell gelöst zu haben. Zu Hause machten wir sogleich Nägel mit Köpfen: Stefan zog ins Gästezimmer, alles andere blieb, wie es war. Bis er in seinem Mittagspausenlokal Conni über den Weg lief und Hals über Kopf zu ihr zog.
«Ja», höre ich ihn leise neben mir sagen. Er drückt meine Hand. «Ja, ich bereue unsere Trennung.»
Mir wird auf einmal ganz schwindelig. Auf dieser Reise habe ich ja mit vielem gerechnet, aber bestimmt nicht damit. Und deshalb weiß ich auch so spontan gar nicht, wie ich auf diese Neuigkeit reagieren soll. Wir haben uns den Schritt doch gründlich überlegt, warum ihn jetzt in Frage stellen? Warum?
Weil ich vielleicht doch noch nicht so ganz über Stefan hinweg bin? Es liegt so viel Vertrautes zwischen uns, dass ich mich regelrecht zusammenreißen muss, nicht in alte Verhaltensweisen zu verfallen. Ich bin kurz davor, meinen Kopf auf seine Schulter sinken zu lassen, mich an ihn zu schmiegen und mein Gesicht in der kleinen Kuhle an seinem Hals zu vergraben. Aber wäre das schlau? Eine innere Stimme der Vernunft warnt mich davor, alles auf den Kopf zu stellen. Es gab gute Gründe für unsere Trennung, noch dazu ist Stefan inzwischen vergeben. Ich kann meinen Gefühlen unmöglich nachgeben. Schon gar nicht, ohne mir vorher über die Konsequenzen im Klaren zu sein. Und zwar gründlich. Nur fehlt mir dafür aktuell die Kraft. Das alles – Regina, diese Reise, meine Mutter, Stefan – wächst mir langsam über den Kopf. Es fühlt sich an, als würde ich vom Karussell meiner eigenen Emotionen herauskatapultiert werden und mich nun im freien Fall befinden.
Ich schaue in seine Augen und sehe die Erwartung, die darin liegt. Und ich spüre sein Verlangen. Er will, dass ich etwas sage, dass ich mich ihm öffne. Ich weiß, er möchte hören, dass ich genauso empfinde wie er, aber ich kann es nicht über die Lippen bringen. Nicht jetzt. Nicht ohne meine Gedanken ein wenig sortiert zu haben.
Klar gab es im Laufe der letzten sechs Monate Augenblicke, in denen ich an unserer Entscheidung gezweifelt habe. Oft sogar. Hätte er in einem dieser Momente dieselben Worte gesagt wie gerade eben, wäre ich vermutlich schwach geworden und mit wehenden Fahnen zu ihm zurückgekehrt. Weil ich ihn vermisst habe. Natürlich habe ich das. Doch irgendwann, etwa zu der Zeit, als Conni auftauchte, gelang es mir, unseren Schritt als das anzusehen, was er war: endgültig. Und es ging mir gut damit.
Bis heute.
«Aber …», stottere ich, «was ist mit … Conni? Ich meine, ihr seid doch so glücklich. Und überhaupt – ich mag Conni.»
Was rede ich denn da? Ich habe sie nur zweimal gesehen.
«Also, ich meine … Auf keinen Fall möchte ich schuld an ihrem Unglück sein.» Ich schaue an ihm vorbei auf die Wand, kann aber aus dem Augenwinkel sehen, wie Stefan beginnt, auf seiner Unterlippe herumzukauen. Irgendwann erklärt er: «Ich sage dir jetzt mal, wie ich die Sache sehe: Du und ich, wir sind ein gutes Team. Ein sehr gutes. Ich habe in der letzten Zeit viel über uns nachgedacht. Ich …» Er sucht nach den richtigen Worten. «Vielleicht haben wir damals einfach überreagiert. Dass wir im Urlaub plötzlich so viel Zeit hatten … damit konnten wir zwei Arbeitstiere nicht umgehen. Das waren wir nicht gewohnt.»
Ich starre ihn an, als habe er mir eröffnet, nach unserer Trennung schwul geworden zu sein. Meint er wirklich, das sei die Erklärung?
«Und was Conni betrifft …» Stefan lässt meine Hand los und steht auf. Er schnappt sich die Champagnerflasche und stellt sie auf einen der Nachtschränke. «Dazu kann ich dir sagen: Wir werden uns trennen.»
Mit vor Erstaunen aufgerissenen Augen beobachte ich, wie er seine Gürtelschnalle öffnet, den Riemen aus der Hose zieht und ihn sorgfältig zusammenrollt, um ihn akribisch neben der Flasche zu deponieren. Dann lässt er sich aufs Bett fallen, drückt das Kopfkissen in Form und streckt sich aus. «Ich habe ihr einen Brief auf dem Küchentisch hinterlassen, den sie schon gelesen haben müsste.»
Ich falle aus allen Wolken. «Du hast was? Aber … Warum?»
Er zuckt mit den Schultern.
Das ist alles?
«Also, ich glaube, ich gehe mal unter die Dusche», sage ich benommen, als auch nach längerem Warten keine weitere Erklärung von ihm folgt. Das wird ja immer doller. Ich muss jetzt dringend mal kurz für mich allein sein. Ehe Stefan etwas erwidern kann oder sich womöglich anbietet, mitzukommen, öffne ich meinen Koffer, schnappe mir meine Kulturtasche und verschwinde im Bad.
4Die ganze Geschichte
Der Wasserdruck im Hotel ist nicht gerade berauschend, aber die kurze Erfrischung reicht aus, damit ich mir zumindest über eins klarwerde: Auf keinen Fall werde ich mich auf Stefans Avancen einlassen! Nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich werde es ihm erklären, er wird es verstehen.
Alles wird gut.
Erschöpft rubbele ich mich trocken, kämme mein Haar und schlüpfe in das lange, ärmellose T-Shirt, das ich als Schlafshirt eingesteckt habe. Als ich kurze Zeit später das Zimmer betrete, muss ich erschreckt nach Luft schnappen. Stefan liegt wie drapiert auf dem Bett, und außer einem weißen Frotteehandtuch mit grünem Hirsch darauf, das er sich lässig um die Hüften geschlungen hat, ist er nackt. Als wäre er bei einem Film für die Rolle des griechischen Gotts zurechtgemacht und dann vergessen worden, blättert er gelangweilt in einem dünnen Flyer, vermutlich der Hausbroschüre.
Fehlen nur noch die Weintrauben, schießt es mir durch den Kopf, dann könnte dies auch die Vorlage für ein barockes Gemälde sein. Na ja, und der Hirsch müsste noch weg.
Mein Blick gleitet zu dem kleinen Kiefernholzschränkchen neben dem Bett, auf dem zwei Zahnputzgläser stehen, die bis zum Rand mit Champagner gefüllt sind. Er muss sie unbemerkt aus dem Bad stibitzt haben, während ich unter der Dusche stand.
«Was ist?», fragt Stefan so erstaunt, als sei ich diejenige mit dem nackten Oberkörper. Er richtet sich auf und hält mir ein Glas mit der goldenen Flüssigkeit hin, die nicht so recht sprudeln will. «Du hast lange gebraucht im Bad. Der Champagner ist jetzt noch wärmer geworden. Aber egal – da müssen wir nun durch.» Mit der freien Hand klopft er neben sich auf die Bettdecke. «Komm, mein Schatz, leg dich zu mir. Ich weiß, dieses Hotel ist nicht besonders einladend, aber davon werden wir uns nicht die Laune verderben lassen, oder?»
Ich zögere und denke, dass meine Laune eigentlich bereits seit geraumer Zeit verdorben ist und zwar genau genommen, seit Reginas Brief bei mir im Postkasten lag. Und je näher wir ihr und ihrer Pension kommen, umso schlimmer wird es. Dazu die Sache mit meiner Firma – inzwischen fühle ich mich regelrecht krank und wäre am liebsten allein. Dann würde ich mich ganz klein zusammenrollen, mir die Decke über den Kopf ziehen und versuchen zu schlafen. Oder weinen. Vermutlich beides.
Doch ich bin nicht allein, und Stefan trägt auch nicht die Schuld an meiner Misere. Meine Laune an ihm auszulassen und ihn dafür zu bestrafen, dass ich mich zu dieser Reise habe breitschlagen lassen, wäre nicht in Ordnung. Resigniert setze ich mich auf die Bettkante und nehme das Zahnputzglas entgegen.
Stefan schnippt mit dem Finger die Broschüre vom Bett und angelt nach dem zweiten Glas. «Ich dachte, ruhig und nostalgisch hieße, wir hätten ein romantisches Zimmer im Landhausstil, mit Kamin, einer Sitzecke und ’ner gut sortierten Minibar. Aber stattdessen», er vollführt eine allumfassende Geste und donnert zum Schluss mit der Faust gegen die Wand, «ist alles vom Billigsten. Die Wände – wie aus Pappe. Ich kann sogar deine Mutter schnarchen hören.» Er schlägt erneut gegen die Wand.
Einen Moment fürchte ich, bei seinem Gefuchtel könnte sich plötzlich das Handtuch lösen und sein … na ja … wertvollstes Körperteil zum Vorschein bringen, doch der Knoten hält. Dafür klopft es jetzt von nebenan zurück.
Verwundert hebe ich eine Augenbraue. «Scheint, als würde Mama doch noch nicht schlafen.»
Stefan macht eine unwirsche Kopfbewegung und erhebt sein Glas. «Egal.» Er lächelt mich an. «Also: Prost, mein Schatz!»
Wir stoßen an, und ich nehme einen großen Schluck. In Sekundenschnelle spüre ich, wie mir der Alkohol durch die Adern schießt und es in meinem Kopf und meinem Körper zu prickeln beginnt – gar nicht mal so schlecht.
«Weißt du, Lu …» Stefan hat das Glas abgestellt und die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Er mustert mich vom Kopf bis zur Taille. «Ich muss Elisabeth recht geben. Du arbeitest zu viel und ruhst dich zu wenig aus. Schau dich doch nur mal an.» Er deutet an mir herunter. «Du bist mehlweiß, obwohl wir bereits Juli haben. Als würdest du unter Tage schuften.»
«Also …» Das finde ich nun wirklich übertrieben.
«Nutz die kommenden Tage und erhol dich ein wenig. Auch du brauchst mal eine Pause.»
Entsetzt schaue ich ihn an. Ohne es zu wissen, hat er gerade exakt denselben Wortlaut benutzt wie mein Chef vor zwei Wochen, als er mich in sein Büro rief, um mir eine Standpauke zu halten. Ein schlimmer Tag, und mir wird heute noch ganz übel, wenn ich daran zurückdenke.
«Niemand kann auf Dauer ohne Erholung durchhalten», fährt Stefan fort. «Man muss den Kopf frei machen, um neue Kapazitäten zu schaffen …»
Auch diese Worte kommen mir bekannt vor. In meinen Gedanken verwandelt sich Stefans Stimme in die meines Chefs, Lutz Biedinghaus. Ich stehe vor dessen Schreibtisch und höre mir seinen Vortrag über mangelnde Verantwortung, Fehlplanung und zusätzliche Kosten an. Biedinghaus ist furchtbar wütend, aber beherrscht. Und noch etwas ist aus seinem Tonfall herauszuhören: Enttäuschung. Nie zuvor hat er mich mit solch harschen Worten bedacht, und allein die Erinnerung daran macht, dass sich mir die Kehle zuschnürt. Ich muss ein paar Mal trocken schlucken, um die Fassung zu bewahren.
«Hey, ist alles okay mit dir?» Stefan wedelt mit der Hand vor meinem Gesicht herum, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich zucke zusammen. «Himmel, Lu, warum bist du so schreckhaft?» Er klingt jetzt richtiggehend besorgt. «Was beschäftigt dich so? Denkst du an das Treffen mit Regina morgen?»