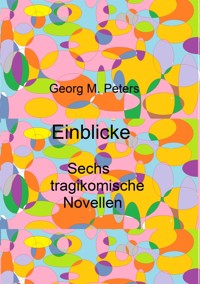
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch enthält sechs tragikomische Novellen.
Sie haben die Aufgabe den Leser gut zu unterhalten.
Sie zeigen Menschen in Situationen, die sie nicht erwartet haben. Situationen, in denen sie klug handeln wollen, aber nicht immer den klügsten Weg einschlagen.
Am unglaubwürdigsten, vermute ich, ist die Geschichte "Der Traum: Die Viererteilung". Doch gerade die hat sich genauso abgespielt, wie sie hier geschildert wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Einblicke
Sechs tragikomische Novellen
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenEinblicke
Copyright:
Dr. Klaus Moritz Richter
erreichbar über
Postfach 91 03 46
30 423 H a n n o v e r
Tel. 0511/4960995
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung in anderen als den gesetzlich vorgesehenen Fällen ist ohne vorherige, schriftliche Zustimmung des Verlages nicht zulässig.
Oblomow oder
die Hutschnur als oberste Grenze
Soll ich aufstehen oder nicht? Es ist jetzt zwölf Minuten nach elf. Darauf kann ich mich verlassen. Ich habe nämlich eine elektrische Uhr, die über Funk von der Göttinger Normaluhr gesteuert wird. Genauigkeit ist wichtig! Diese Feststellung erinnert mich an Polizeiberichte: Die weibliche Leiche wurde um 17 Uhr 34 gefunden, an dem und dem Tag und an dem und dem Ort. Äußerste Genauigkeit!
Aber weshalb soll ich aufstehen? Draußen ist grauer Himmel. Nicht doch! Dort ist ein Fleckchen Blau. Etwa zehn Prozent des Himmels sind blau. Oder sind es zwölf Prozent? Wahrscheinlich elf. Hofstätter schreibt in seinem Buch „Gruppendynamik“, dass eine Beobachtergruppe, wenn jeder einzelne seinen Schätzwert beisteuert, und dann der Mittelwert gebildet wird, besser schätzt als jeder einzelne.
Ich müsste andere nachher fragen, wie viel Blau sie um zwölf Minuten nach elf am Himmel gesehen haben. Schätzungsweise! Vielleicht ergibt sich dann ein genauerer Wert.
Wenn nur diese Kopfschmerzen nicht wären! Ich hatte gestern wieder mindestens 1,5 Promille. Es können aber auch mehr gewesen sein. Ich habe gelesen, wenn man sich an den Alkohol gewöhnt, dann steigt der Blutalkoholwert an, der nötig ist, um den gleichen Pegel, also subjektiv die gleiche Wirkung, zu erzielen.
Ich fühle mich wie der Schlaffmann im Film „Zur Sache Schätzchen“ mit Werner Enke. Der demonstriert seiner Freundin wie er sich fühlt. Er liegt auf dem Boden: „Schau her! Der Schlaffmann hebt den rechten Arm etwas an. So! Dann wird ihm der zu schwer, und er lässt ihn fallen. Jetzt hebt der Schlaffmann den linken Arm. Der wird zu schwer, und er lässt ihn fallen.“
Wenn ich wirklich aufstehen sollte, was könnte ich tun? Fernsehen? Ist noch ein Bier im Kühlschrank? Der Kühlschrank ist vereist! Wie hieß der Schauspieler noch mal, ein Millionär, der sich das Leben genommen hat? Seine Freundin erzählt von einem Sonntag, den sie gemeinsam mit ihm verbracht hat.
Es war sein sein vorletzter Lebenstag: Sein Kühlschrank war vereist. Nachdem sie gemeinsam mit dem Hammer das Eis entfernt hatten, lief der Kühlschrank nicht mehr. Das war ein Zeichen! Die Freundin fand es ganz natürlich, dass ihr Freund sich das Leben nahm, nachdem das Leben, die Umwelt, alle Dinge, sich so offenkundig gegen sie verschworen hatten.
So wie ich mich fühle, muss sich auch Oblomow gefühlt haben. Aber der hatte jedenfalls einen Diener. Das Leben, die Welt, haben heute noch nicht viel für mich getan. Ob ich ihnen das verzeihen werde, weiß ich nicht.
„Oblomow schüttelt den Kopf: Wärst du im Bett geblieben oder ins Bett zurückgegangen, wären das alles keine Probleme“ - schreibt Heinrich Böll.
Ich könnte, wenn ich aufstehe, mein großes Projekt in Angriff nehmen. Der Erfolg würde mich mit einem Schlag aus allen Problemen heraus reißen.
Meine Eltern sind Schuld an der ganzen Misere. Alfred Adler hat gesagt, man kann einem Kind nichts Schlimmeres antun, als es zu verwöhnen. Sie hätten mir nichts Schlimmeres antun können. Adler sagt weiter: Das Beste, was das Schicksal für ein Kind tun kann, ist, ihm Schwierigkeiten in den Weg zu legen.
Wie soll ich also mit Schwierigkeiten fertig werden, wenn ich es nicht gelernt habe? Ich würde meinen Eltern ja auch keinen Vorwurf aus ihrem Versagen mir gegenüber machen, wenn es dabei bliebe - wenn alles so bliebe wie es immer war.
Aber nun haben sie sich mit dem Bruder meiner Mutter in Verbindung gesetzt, der Psychologe ist. Ich führe immer nur mit meinem Porsche herum, führte meine Freundinnen aus, hieß es jetzt.
Ein junger Mann in meinem Alter müsse etwas lernen, etwas leisten. Als mein Vater so alt war wie ich, da habe er Teller gewaschen, um sich über Wasser zu halten.
Das Ende vom Lied ist: mein Vater zahlt mir jetzt, nach Beratung mit seinem Schwager, dem Psychologen, nur noch wenig mehr als den Sozialhilfesatz. Das ist die Höhe! Davon kann ich nicht einmal das Benzin von meinem Wagen bezahlen!
Mir Sozialhilfe! Wo mein Vater Geschäftsführer in einem Werk mit fünfhundert Angestellten ist - mit Prokura. Und mir dann Sozialhilfe zahlen! Wozu schenkt er mir einen Porsche, wenn er mir das Geld vorenthält, um damit herum zu fahren? Etwas mehr Konsequenz verlange ich!
Ich brauche unbedingt ein Bier. Die Welt ist nicht zum aushalten. Wo kommen all die Dosen her, die hier herumliegen? So viel habe ich gestern Abend doch auch nicht getrunken!
In der Ecke hinter den Zeitungen steht eine Flasche; vielleicht ist da noch etwas drin. Auch leer! Warum räumt denn keiner auf? So wie es hier im Zimmer aussieht, so sieht es auch in Afghanistan aus, oder in Simbabwe oder im Libanon oder in Kolumbien oder in Argentinien! Warum sorgt dort keiner für Ordnung?
Jetzt ist es elf Uhr einunddreißig. Auf die Sekunde genau! Genauigkeit einer Zeitangabe, die an kein äußeres Ereignis geknüpft ist! Das ist das, was der Franzose l’art pour l’art nennt.
Wenn ich gestern so viel getrunken habe, so ist das zu einem Teil auf die Tagesschau zurück zu führen und die Diskussionsrunden, die noch folgten. Ich weiß nicht, wie ich den Zustand der Welt ohne Alkohol ertragen soll.
Sehen meine Eltern eigentlich keine Tagesschau? Dann frage ich mich doch: Wie konnten sie in solche Welt ein Kind setzen? Das müssten sie sich doch auch vor zwanzig Jahren schon gefragt haben. Dafür werde ich sie zur Verantwortung ziehen - auf Heller und Pfennig.
Das hängt mit meinem Projekt zusammen. Es gibt für alles eine Grenze. Für mich ist das die Hutschnur. Bis hier her und nicht weiter! sage ich mir. Wenn mir etwas darüber geht, dann hört die Gemütlichkeit auf.
Erstens, wie kann man Kinder in diese Welt setzen, frage ich - in diese Welt? Zweitens, wenn man schon ein Kind in diese Welt setzt, wieso liest man dann vorher nicht die einschlägige Literatur, zu der unbedingt auch Alfred Adlers Bücher gehört hätten. Verwöhnung! Das Schlimmste, das man einem Kind antun kann! Und das mir! Auf Heller und Pfennig müssen meine Eltern dafür zahlen.
Diese Kopfschmerzen, die ich immer noch spüre! Die Tagesschau gestern! Dafür verlange ich Schmerzensgeld. Das wird meinen Eltern eine Lehre sein. Ein Kind, das nicht geboren ist, verlangt kein Schmerzensgeld. Aber ich! Ich werde mir einen Anwalt nehmen und sie verklagen. Auf fahrlässige Körperverletzung! Erstens dafür, dass sie mir das Schlimmste angetan haben, das man einem Kind antun kann. Und zweitens dafür, dass sie mich in diese Welt geboren haben, was eigentlich noch schlimmer ist.
Wenn sie dann gezwungen sind zu zahlen, dann kann ich endlich leben, wie es dem Sohn des Prokuristen gebührt.
5370 Zeichen.
Grenzen
oder Angst vor dem Fliegen
Ich sitze im Flugzeug. Schön, dass Herbert mir diesen Flug geschenkt hat. Zum ersten Mal ist mir das Fliegen ein Genuss. Auch das verdanke ich Herbert. Er hat mir erklärt, was "Übertragung" bedeutet, und ich habe es verstanden. Als Lehrer kann er gut erklären.
Ich glaube, er ist mir der liebste Schwiegersohn. Nach meinem Herzinfarkt war ich gar nicht in der Lage, mich innerlich gegen die Herzoperation aufzulehnen. Ich war froh, dass man sich um mich kümmerte. Und als ich aus der Narkose aufwachte, hatte ich das Gefühl, ich sei neugeboren. Dann kam die Rehabilitation mit ihren übermenschlichen Anstrengungen. Auf dem Gang wurde ich einfach ohnmächtig.
Ich habe es noch deutlich vor Augen, wie sich der Fußboden plötzlich schräg stellte und von links auf mich zu kam. Aber während der ganzen Zeit hatte ich keinen Zweifel daran, dass ich in der Klinik gut aufgehoben sei, und dass alles Menschenmögliche für mich getan werde.
Und alles war Technik; die ganze Klinik war ein großer technischer Apparat - in jedem Detail vom Technischen Überwachungsverein kontrolliert.
Außerdem erinnerte ich mich daran, wie sehr es mich jedesmal aufgeregt hatte, wenn bei der Inspektion meines Autos durch den TÜV Mängel moniert und protokolliert wurden, die mir belanglos erschienen.
In Bezug auf mein Auto, in Bezug auf das Krankenhaus habe ich offenbar ein ganz solides Vertrauen in die Technik. Warum sollte ich dieses Vertrauen nicht übertragen können auf das Fliegen? fragte Herbert.
Warum auf der einen Seite dieses wohltuende Vertrauen und auf der anderen Seite, sobald es um das Fliegen ging, dieses abgrundtiefe Misstrauen? Herbert hat es mir erklärt:
Dazwischen liegt eine Grenze, eine Denkbarriere, die unvernünftig ist, die aber lebenslang bestehen bleiben wird, wenn ich mich nicht mit ihr auseinander setze. Ich muss gestehen - das ist das Verdienst der pädagogischen Geduld von Herbert: diese Grenze verschwand tatsächlich in dem Moment, in dem ich über sie nachdachte.
Ich stelle mir jetzt einfach vor, das Flugzeug mit all den Einrichtungen zur Überprüfung der Sicherheit ist ein genau so sorgfältig, um nicht zu sagen pingelig überprüfter technischer Apparat wie das Krankenhaus oder wie mein Auto beim TÜV.
Ich schaue jetzt aus dem Fenster und sehe einen Teil der Tragfläche, ahne mehr als dass ich sie fühle die Kraft der Düsentriebwerke und blicke in die Tiefe: Schleier von Wolken und dazwischen von der untergehenden Sonne bestrahlte Ausschnitte der Landschaft.
Augenblicke wie diesen genieße ich, in denen mir meine Existenz bewusst wird. Sie sind selten, aber sie haften für alle Zeiten im Gedächtnis. Vielleicht wird dabei stets eine Grenze überschritten: die Grenze zwischen dem Alltag mit seinen täglichen, fast unbewussten Verrichtungen und einem heraus gehobenen Moment, in dem man das Leben selbst wahrnimmt.
Ich genieße diese Augenblicke, und ich genieße die Erinnerung an sie.
Einer war vor zwei Wochen, als ich meine Gartentür öffnete und auf mein Haus zuging. Ich kam gerade von Gertrud zurück. Gertrud, Herbert und ich hatten einen gemütlichen Abend verbracht.
Ich kam von der Bushaltestelle und es stürmte. Die Blätter, Zweige und Äste in den beiden Eichen vor meinem Haus wurden wild durcheinander gewirbelt, und der Wind peitschte den Regen wütend gegen die Ziegel und gegen die Scheiben.
In den Fenstern mischte sich das bleiche Licht der Gardinen und das gespiegelte, tobende Grauschwarz der Wolken. Die Schaufensterscheiben meines Ladens, eines Gemischtwarenladens, früher einmal Kolonialwarenladens, glänzten von dem Flüssigkeitsfilm, der daran herunter lief.
In dem Augenblick wurde mir wieder bewusst, wie sehr ich meinen kleinen Laden liebe. Vor dreißig Jahren habe ich ihn von meinem Vater übernommen. Am schönsten war es vor fünfzig Jahren, als ich meinem Vater gelegentlich im Laden helfen durfte.
Schon damals habe ich anscheinend für einen Moment die Grenze der Alltagswahrnehmung und der Gewohnheit überschritten. Immer, wenn ich an meine Kindheit, an meinen Vater, an die Anfangszeit im Laden zurückdenke, erscheint dieses Bild in meiner Erinnerung:
Es muss ein Vormittag im Frühling gewesen sein. Die Strahlen der Sonne kamen flach durch das Fenster und schienen bis in meinen Lieblingswinkel hinter der Tonbank am oberen Ende der Kellertreppe, in dem ich saß, wenn ich nichts zu tun hatte und ihm zusehen durfte.
Natürlich gab es damals keine Selbstbedienung. Die Kundin las von ihrem Zettel ab, was sie sich notiert hatte, und mein Vater eilte hin und her zwischen dem Butterfass und den Schubladen mit Mehl, Zucker und Graupen. Ich habe den Geruch noch in der Nase von dem Essig, Backobst und den verschiedenen Gewürzen und von dem Zedernholz, der aus der Ecke mit den Schulartikeln kam,.
Damals war die Arbeit im Geschäft interessanter als heute. Der Kunde hat heute, so scheint es mir manchmal, ein schlechtes Gewissen, wenn er den Händler in ein Gespräch verwickelt. Vielleicht hat der Wichtigeres zu tun.
Und der Händler hat das gleiche Bedenken, wenn er den Kunden nach seinem Befinden fragt. Aber damals wurde die Dauer des Kontaktes vorgeschrieben durch die Ware, die gekauft wurde. Die gewünschte Portion Butter musste im Fass abgestochen, auf die Waage gelegt, gemäß der Anzeige korrigiert werden.
Dann musste sie glatt geschlagen und verpackt werden. Die Schublade für das Mehl wurde herausgezogen, wobei sie sich wegen des Mehls in den Fugen wunderbar leicht bewegen ließ und ein sanftes, gedämpftes Geräusch von sich gab.
Die meisten Kundinnen kannten meinen Vater seit Jahren und nutzten diese Zwangspause gerne, um von ihren Problemen mit Ehemann oder Kindern zu erzählen, wobei wegen der Vertrautheit oft wenige Worte ausreichten, um verstanden zu werden. Wenn mein Vater dann mit seinem Holzspatel die Butter flach schlug, so war das oft Kommentar genug, und die Kundin hörte heraus, dass der Ehemann eine gehörige Abreibung verdiene.
Ich habe alles von meinem Vater übernommen: Das Geschäft, die Kunden, die Informationen. Über die meisten Kunden wussten wir mehr als der Arzt, der im Nebenhaus praktizierte. Zum Teil liegt das sicherlich daran, dass die Ärzte alle so schnell starben. In den dreißig Jahren, da ich das Geschäft allein oder mit meinem Mann zusammen geführt habe, haben sich in der Praxis drei Ärzte abgelöst.
Oft habe ich tatsächlich ein Glücksgefühl, wenn ich meinen Laden betrete. Ich genieße die Stille, bevor der erste Kunde kommt. Wenn er kommt, ist es jedesmal ein spannender Moment, da ich aus seinem Gesichtsausdruck, aus dem, was er mir von sich erzählt hat, und aus dem, was andere Kunden über ihn erzählt haben, zu kombinieren versuche, wie sich seine Lebensgeschichte inzwischen weiter entwickelt hat. Und dann genügt oft eine Frage von mir oder ein Wort von ihm, um zu prüfen, ob meine Vermutung richtig ist oder falsch.
Wenn ich allein im Laden bin, habe ich meistens allerhand zu tun. Aber es gibt auch Augenblicke der Ruhe, in denen ich den Anblick meiner Schätze genieße. Das sage ich natürlich keinem, auch Herbert nicht. Ich bin ja eine alte Frau, und da liegt der Gedanke immer nahe, „die Alte fängt langsam an zu spinnen.“
Aber wenn ich allein bin, und das Sonnenlicht fällt so schräg durch die Fenster wie in jenem heraus gehobenen Augenblick der Kindheit, dann glänzen die Glashäfen, die ich sorgfältig als Hinterlassenschaft meines Vaters aufbewahrt habe. Das Bonbonpapier glitzert, und ich sehe es wieder mit den Augen des Kindes.
Dann stelle ich mir vor, ich sei ein orientalischer Scheich, der in seiner Schatzkammer steht und sich im Scheine von Fackeln am Anblick seiner Juwelen erfreut.
Der jetzige Augenblick im Flugzeug wird wieder so ein heraus gehobenes Erlebnis werden. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mich im Flugzeug so wohl fühlen könne. Herbert hat mir erklärt, dass das Flugzeug, statistisch gesehen, das sicherste Verkehrsmittel ist.
Plötzlich sinken wir. Ob wir schon über die Grenze -
Den Befehl zum Sinken erhielt der Pilot von einem schweizerischen Kontrollturm. Der Fluglotse dort war allein in seiner Leitstelle. Einige Minuten lang hatte er nicht bemerkt, dass sich über ihm ein Unheil zusammen braute.
Deutsche Fluglotsen hatten die Situation aus der Ferne beobachtet und fragten sich, warum nichts geschehe. Schließlich gingen sie ans Telefon und riefen bei ihrem Kollegen in der Schweiz an. Doch da die Telefonzentrale gerade gewartet wurde, kam als Antwort nur das Besetztzeichen.
Beide Maschinen, die auf einander zu flogen, hatten Kollisionswarngeräte an Bord. Die beiden Geräte hatten sich bereits darauf verständigt, dass die eine Maschine in den Sinkflug und die andere in den Steigflug gehen solle.
Doch in diese Situation hinein forderte die Stimme des Fluglotsen den Sinkflug. Der Pilot, der eigentlich steigen sollte, wusste von seiner Ausbildung her, dass die Forderung des Warngerätes absoluten Vorrang habe. Ob die Stimme des Fluglotsen ihm so viel Vertrauen einflößte, dass er diese Schulweisheit missachtete?
Die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland verläuft hier durch den Bodensee. In der Nähe des Ufers saß eine Familie gerade beim Abendessen, als sie durch einen dumpfen Aufschlag aufgeschreckt wurde.
Das Geräusch kam aus dem Garten. Als sie nachschauten, sahen sie das große, abgerissene Triebwerk eines Düsenflugzeuges dort liegen. Die Sprecher in Tagesschau und Nachrichten berichteten über den Flugzeugzusammenstoß und teilten mit, dass es keine Überlebenden gegeben habe.
Briefgeheimnis
Ich genoss, nachdem meine Angestellten gegangen waren, die Ruhe in meinem Büro- und Sprechzimmer. Von einem solchen altertümlichen, distinguierten Büro mit hohen Wänden, in einem prächtigen Altbau im Zentrum Londons gelegen, hatte ich während meiner Ausbildungszeit geträumt.
Als ich dann die Möglichkeit hatte, es von meinem Vorgänger, Lord Higgins, einem Staranwalt, der hier in London als Spezialist für hoffnungslose Fälle galt, zu übernehmen, habe ich sofort zugegriffen.
Auch wenn ich dabei einige Schulden auf mich laden musste; doch die sind inzwischen abbezahlt. Ich habe nicht nur die Räume, sondern auch den riesigen, eichenen Schreibtisch, die schwarzen Ledermöbel für die Sitzecke, die dunkel-lackierten Bücherschränke und sogar die umfangreiche Büchersammlung übernommen.
Da wird mancher fragen, was soll ich als Psychoanalytiker mit den Büchern eines Juristen anfangen. Nun - der Lord war ein recht universeller Geist gewesen und hatte selbst Bücher geschrieben über weltanschauliche und historische Themen.
Und außerdem wurde ich gelegentlich als Gutachter zu Gerichtsverhandlungen hinzugezogen. Die kostbare Standuhr hat er mir quasi als Belohnung für eine „rettende Idee“, wie er es nannte, geschenkt.
Jetzt steht das Laufwerk schon seit geraumer Zeit still, weil es Klienten gibt, die durch das Ticken irritiert werden. Dafür fehlt mir allerdings das Verständnis, doch liegt das wohl daran, dass mein Hörvermögen im Bereich der höheren Frequenzen seit dem Krieg etwas eingeschränkt ist.
Ich betrachte die Stille im Haus als Vorboten eines geruhsamen Wochenendes im Kreise der Familie. Auch der Lärm vom Kreisverkehr unten auf der Straße ist durch die Höhe - ich bin im vierten Stock - und durch die Doppelverglasung so gedämpft, dass er kaum noch hörbar ist.
Ich stehe am Fenster und betrachte hinter den Dächern den Sonnenuntergang.
Plötzlich fällt mir ein, dass ich heute Abend bei der „Sonnenwendfeier“ turnusmäßig die Gastgeberrolle zu spielen habe. Diese Feier findet jeweils an einem Freitag im März wie heute oder im September statt, und eingeladen sind fünf ständige Gäste sowie ein Zufallsgast, den einer der Beteiligten gerne den andern vorstellen möchte.
Die ständigen Mitglieder kennen sich seit der Schulzeit in Eton. Inzwischen waren alle recht erfolgreich in ihrem jeweiligen Beruf.
Die Gastgeberrolle zu spielen bedeutet, dass man das Menü und die Getränke bezahlen und dass man die Einführungsrede halten muss. Diese Rede wird vor dem Essen gehalten und besteht meistens darin, dass der Gastgeber einen interessanten Fall aus seiner Praxis schildert.
Wir speisen jedesmal bei Rules, wo wir inzwischen gut bekannt und gelitten sind.
Während der Hinfahrt überlege ich mir, worüber ich reden soll. Vielleicht über meinen merkwürdigsten Fall und seinen tragischen Abschluss, der sich aus der Verletzung des Briefgeheimnisses ergab? Mit dem Fall war auch Lord William Brown, den wir Dick nennen, befasst. Dick ist Mitglied unseres Clubs und hat vor einem halben Jahr den Vortrag gehalten.
Könnte er etwas gegen die Ausbreitung dieses Stoffes einwenden? Ich entschließe mich, diese Frage zu verneinen. Die Sache ist abgeschlossen, und von den beteiligten Personen wird keine protestieren. Außerdem sind die meisten Fakten durch Fernsehen und Presse ohnehin bekannt.
Dick Brown hatte als Richter in diesem Fall entschieden. Ich kenne ihn nicht nur von unserer Schulzeit in Eton, sondern auch vom Studium in Cambridge her, hatte ihn danach aber für einige Zeit völlig aus den Augen verloren. Er ist groß und schmal mit einem kantigen Gesicht. Sein hervorstechendstes Merkmal ist, dass er viel und undeutlich redet, ohne irgend etwas zu sagen.
Ich betrete den Raum und sehe, dass alle Gäste bereits erschienen und in lebhafte Gespräche verwickelt sind. Nach dem Hallo der Begrüßung, dem Anzünden meiner Pfeife und dem Aufgeben der Bestellungen beginne ich wie folgt:
„Es handelt sich um einen Fall, den ihr alle - wenn ich von dem Ende einmal absehe - aus der Zeitung kennt, und mit dem Dick eigentlich mehr zu tun hatte als ich.
Dick rief mich eines Tages an in meinem Büro und sagte, er habe zufällig mein Gutachten gelesen, das ich im Zusammenhang mit dem Flugzeugattentat von Lockerbie abgegeben hatte.
Er müsse in einer neuen Sache, einer Selbstmordaffäre, urteilen und brauche dazu ein psychologisches Gutachten. Es handele sich um den Fall des Doppelselbstmordes im Zusammenhang mit der Planet`s-Beam-Sekte. Der Fall wurde damals polizeilich untersucht, und Anklage gegen die Sekte erhoben.
Ob ich bereit wäre, mich damit zu befassen. Er könne auch auf dem Dienstweg darum einkommen. Doch das sei verpflichtender als wenn ich ihm jetzt am Telefon sagte, ob ich Interesse daran hätte oder nicht. Er erläuterte ihn mir in groben Umrissen, und ich erklärte mich einverstanden, nachdem er mir zugesichert hatte, dass ich die Akten noch heute bekäme.
Ich sagte ihm zwar, ich müsse erst noch eine andere Sache abschließen; also drei Tage müsse er mir einräumen; aber in Wirklichkeit stand nach dem Gespräch das Gutachten für mich schon fest. Während er berichtete, hatte sich in mir das fertige Bild des Gutachtens geformt. Ich habe es gleich danach niedergeschrieben, um meine Gedanken nicht später mühsam rekonstruieren zu müssen, und es ihm drei Tage später im Gerichtsgebäude überreicht.
Dieser Augenblick der Übergabe sollte sich als verhängnisvoll erweisen.
Dick erzählte mir später davon: Als ich ihn in der Vorhalle entdeckte, war er im Gespräch mit einem recht unscheinbaren, schmächtigen Herrn, den ich nicht kannte. Dick schaute über ihn hinweg, und wir erblickten uns.
Ich sagte ihm, ich wolle ihm gerade das Gutachten vorbei bringen; dabei reichte ich es ihm über die Schulter des kleinen Mannes hinweg zu. Dick trug seine Robe über dem Arm, und ich hatte den Eindruck, dass er den Brief in die Westentasche seiner Anzugjacke steckte.
Tatsächlich hat er ihn vorbei gesteckt, und etwas später rutschte das schmale Couvert herunter und fiel auf den Boden. Nur Mr. Smith, der kleine Mann, bemerkte das - es war der Mr. Smith, mit dem ich mich in meinem Gutachten befasste.
Als Dick sich von ihm entfernte, hat Smith das Couvert aufgehoben und es, da er die richtige Vermutung hatte, dass der Inhalt ihn betreffe, mit in die Teeküche genommen. Die Teeküche muss er bei einem seiner früheren Gerichtsaufenthalte entdeckt haben.
Dort hat er den Brief, den ich vorsichtshalber zugeklebt hatte, mit dem heißen Dampf des Teekessels geöffnet. Dann hat er den Schriftsatz mit Hilfe des Kopiergerätes, das er auch bereits ausgekundschaftet hatte, kopiert, den Umschlag wieder verschlossen und mit Klebstoff, den er sich vom Pförtner ausgeliehen hatte, zugeklebt.
Anschließend ging er zu Dicks Büro und gab den Brief bei dessen Sekretärin ab, indem er irgendeine Entschuldigung murmelte, warum er den Brief nicht schon früher gebracht habe. Er habe geglaubt, Sir William verlasse gerade das Gerichtsgebäude durch den Haupteingang. Er sei hinter ihm hergegangen und bis zum Bahnhof gefolgt. Doch dann habe er gesehen, dass der Mann, dem er hinterherlief, gar nicht Sir William war. Dick weiß das so genau, weil Smith ihm später einen persönlichen Brief geschrieben hat - seinen letzten Brief.
Um was es sich bei der Sache handelte, wisst Ihr ja im Wesentlichen. Smith war in dem Fall des Doppelselbstmordes als Zeuge aufgerufen worden.
Die sich das Leben genommen hatten, waren seine Frau und seine Tochter. Die Frau war Mitglied der Planet`s-Beam-Sekte und lebte in dem Glauben, dass sie mit Hilfe „eines ganz harmlosen Medikamentes" die Reise zum Mars antreten könne.
Diese Überzeugung hatte sie während der spirituellen Sitzungen der Sekte gewonnen, die für sie seit sechs Monaten den ganzen Lebensinhalt ausmachten. Auf dem Mars würde sie in einem Land des Friedens und in einer intakten, paradiesischen Landschaft leben, die Unsterblichkeit haben und vor allem ihre geliebte Tochter Ilona wieder finden, die zwei Jahre vorher bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war.
Ihre andere Tochter, die elfjährige Wanda, habe sich, wie sie bei der Ankündigung ihrer Reise betonte, „freiwillig“ entschieden, mit ihr zu reisen.
Wanda hatte im Hotel noch einer Freundin erzählt, sie würde mit ihrer Mutter auf eine Reise gehen.
Wohin?
Auf den Mars.
Quatsch!
Doch! Wir werden eine Medizin einnehmen, die uns in einen ganz sanften Schlaf versetzt. Dann wachen wir auf und sind auf dem Mars. Dort treffen wir meine Schwester Ilona wieder.
Wer’s glaubt, wird selig! Solchen Quatsch hat dir deine Mutter bestimmt nicht erzählt.
Die Mutter war eine Frau von der gleichen Statur wie ihr Mann. Allerdings war ihr Gesicht von dem Fanatismus bereits gezeichnet gewesen. Es war eingefallen; spitz und schmal ragte die Nase daraus hervor. Die Haut war durchsichtig und dünn wie Pergament.
Bis zu ihrem Tode hatte sie ihren Mann als Mörder beschimpft. Er habe ihre Tochter Ilona ermordet.
In Wirklichkeit starb Ilona infolge eines Autounfalls bei Glatteis. Smith saß am Steuer, Ilona neben ihm - angeschnallt. Der Wagen kam in einer Kurve ins Rutschen und prallte gegen einen Baum. Die Polizei hat den Vorgang damals untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass man dem Fahrer kein Verschulden nachweisen könne.
Jedenfalls - am Abend des Tages, an dem Wanda ihrer Freundin von der anzutretenden Reise berichtete, in dem angemieteten Hotelzimmer, haben die Frau und ihre Tochter Wanda das angeblich so harmlose Mittel eingenommen und sind gestorben.
Mr. Smith, hatte in den letzten sechs Monaten, nachdem seine Frau mit der Sekte und seiner Tochter verreist war, keine Ahnung hatte, wo sich die beiden aufhielten. Nach ihrem Tode wurde er als Zeuge vernommen.
Doch eine weitere Tragödie ergab sich daraus, dass er durch sein trickreiches Verhalten Kenntnis vom Inhalt meines Gutachtens erlangte. Darin untersuchte ich nämlich die Rolle aller Beteiligten.
Die Staatsanwaltschaft war aus offensichtlichen Gründen zu dem Ergebnis gelangt, dass man Smith keine Mitschuld an dem Tod seiner Frau und seiner zweiten Tochter geben könne, und das hatte man ihm auch gesagt.
Smith war von allen Medien interviewt worden, nach dem Charakter und der merkwürdigen Motivation seiner Frau befragt worden und hatte sich dabei immer in die Brust geworfen, wie ungeheuerlich und irrwitzig ihre Tat sei, und dass er ihr durch sein Verhalten bestimmt keinen Anlass dazu gegeben habe.
Vor dem Tod ihrer älteren Tochter, der Ilona, sei die Frau umgänglich, heiter und anmutig gewesen. Nach Ilonas Tod wurde das Zusammenleben mit ihr immer unerträglicher - vor allem deshalb, weil sie ihm vorwarf, der Mörder ihrer Tochter zu sein. Als sie in ihre Sekte eintrat, sei sie ganz aus seinem Gesichtskreis verschwunden, und alle seine und der Polizei Versuche, sie und die Tochter aufzufinden, seien vergeblich gewesen.
Das Studium meines Gutachtens habe ihn dann, wie er Dick in seinem langen Brief mitteilte, wie ein Keulenschlag getroffen. Der Inhalt des Gutachtens war kurz zusammengefasst folgender:
Ich sei, schrieb ich, auf Vermutungen angewiesen, da mein Urteil nur auf Grund der Aktenlage zustande komme - schließlich sei keiner der Beteiligten mehr ansprechbar, und auf eine nochmalige Vernehmung des Smith - nach dem Tod seiner restlichen Familie - solle wenn möglich, verzichtet werden.
Doch trotz dieser Schwierigkeiten - so fuhr ich in meinem Gutachten fort - sei die Irrtumswahrscheinlichkeit gering. Über die Rolle, die die Sekte bei dem Selbstmord gespielt habe, gebe es keine Zweifel und über deren Bewertung ebenso wenige.
Die Verurteilungswürdigkeit dieser Rolle werde auch nicht gemindert, wenn man davon ausgeht, dass die Mutter den Selbstmord wahrscheinlich wollte und ihn in jedem Falle durchgeführt hätte - auch wenn ihr die Sekte beim Aufbau der Motivation, bei der Beschaffung des Giftes und bei der Verbrämung zu einem „harmlosen“ Reiseunterfangen nicht willkommene Hilfe geleistet hätte.
Den tieferen Grund für das tragische Geschehen sähe ich jedoch in der Familiendynamik und insbesondere auch in der psychischen Struktur des Ehemannes.
Er habe den Tod der älteren Tochter Ilona selbst nicht angemessen verarbeitet, sondern ein Schuldgefühl unterdrückt und verdrängt. Darin ist er unglücklicherweise bestärkt worden durch das polizeiliche Gutachten, das ihm eine Mitschuld an dem tödlichen Unfall absprach.
Dieses rein juristische Urteil habe er ins Moralische übertragen und sich in dem Glauben eingesponnen, ihm sei aus dem Tod seiner Tochter überhaupt kein Vorwurf zu machen. Das Unglück sei sozusagen schicksalhaft über sie gekommen; es sei ein durch höhere Gewalt, durch Wetterbedingungen und Eis auf der Fahrbahn bedingtes Verhängnis gewesen, das er und seine Frau nun ergeben auf sich zu nehmen hätten. Doch in diesem Spiel habe die Frau, seiner Meinung nach, die Rolle der Spielverderberin übernommen, indem sie ihn mit dem Vorwurf überfiel, er sei der Mörder ihrer Tochter.
Indessen sei es ganz offensichtlich, so schrieb ich, dass Smith den Tod seiner Tochter hätte verhindern können. Er hätte nur seinen Fuß um einen Millimeter vom Gaspedal zurückzunehmen brauchen. Schließlich ist nicht jeder, der diese vereiste Straße passierte, gegen einen Baum gefahren.
Aber diese Einsicht in seine moralische Schuld konnte er nicht ertragen. Er hat sie hinter einer starren Fassade aus Selbstgerechtigkeit und Unantastbarkeit verborgen - so weit, bis er selbst keinen Zugriff mehr darauf hatte. Und das wiederum hat die Frau nicht ertragen. Es wäre so einfach gewesen, wenn er sich zu diesem gerichtlich nicht relevanten Schuldanteil bekannt, seine Frau um Verzeihung gebeten und mit ihr gemeinsam um den Tod der Tochter getrauert hätte.





























