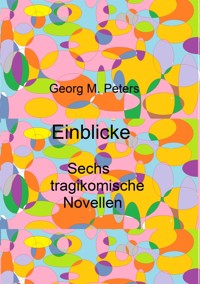Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie war es, unter dem Hitlerregime aufzuwachsen? Wie fühlte man sich als Kind bei den Luftangriffen? Wie spielten wir als Kinder auf der Straße? Welchen Einfluss hatten die Erwachsenen und die Freunde auf meine Entwicklung? Die schöne Beziehung zu meinem Großvater, die problematische Beziehung zu meiner Mutter! Die Mutter war weltgewandt aber depressiv, und diese Neigung zur Depression hatte sich auf mich übertragen. Ich hatte eine schöne Kindheit – trotz der Schwere der Zeit -, aber ich konnte sie nicht als schön empfinden. Das Buch beschreibt die Geschichte einer Selbstbefreiung – vieles gesehen aus der Perspektive eines Kindes oder Heranwachsenden. Da schleicht sich auch manchmal etwas Ironie ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg M Peters
Geboren im Jahr 1933
Selbstfindung eines Jugendlichen unter ungünstigen Umständen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Georg M. Peters
Geboren im Jahr 1933
Vorwort
Geboren im Jahr 1933
Kriegszeit
Ausbombung
Meine Einstellung zum Führerregime
Mein Großvater und ich
Die Beziehung zur Mutter
Onkel Georg in Chemnitz
Meine Lektüre
Einstellung zu Waffen
Die Einstellung zu den Juden
Politische Indoktrination
Kinderspiele
Modellbau
Sammeln
Im Park nach der Ausbombung
Schulunterricht
Als Flüchtling von Schule zu Schule
KLV-Lager
Das Kriegsende
Neurosen
Spiel mit Waffen
Schlüsselmomente
Verhältnis zu meiner Mutter
Träume
Nach dem Abitur
Meine Freundin Helga
Das Hauptproblem
Nachkriegszeit, 1947, 1948
Gymnasium
Sportunterricht bei Bader
Zeichenunterricht bei Millhagen
Harald Probsthain
Herta Schreiber
Beendigung des Studiums
Die erste Prüfung
Änderung meiner Einstellung
Zweite Prüfung bei Prof. Klüsener
Schuss ins eigene Knie
Das Problem des schlechten Schülers
Kleingruppenunterricht
Weitere Bücher vom gleichen Autor:
Impressum neobooks
Georg M. Peters
Dr. Georg M. Peters wurde am 24.4.1933 in Hamburg geboren und ist am 1.1.2023 ebenda gestorben.
Er war seit dem 3.2.1970 mit einer 14 Jahre jüngeren Psychologin und Malerin verheiratet. Aus dieser Ehe entstammen zwei Kinder.
Peters absolvierte sein Abitur in Hamburg und studierte in Hannover.
Seine Frau lernte er in Berlin kennen und er lebte in Hannover, mit zweitem Wohnsitz in Nürnberg, wo er in der Industrie arbeitete.
Bis ins hohe Alter war er aktiv in dem Versuch seine psychologischen Erkenntnisse bekannt zu machen.
Er kehrte kurz vor seinem Tod nach Hamburg zurück, wo er an einer Lungenentzündung verstarb.
Geboren im Jahr 1933
„Geboren im Jahr 1933“
Copyright Sophie Günther
Alle Rechte vorbehalten
2013
Vorwort
Eigentlich habe ich gar keine Lust, dieses Vorwort zu verfassen. Vermutlich haben auch die meisten Leser keine Lust, hier ein längeres Vorwort zu lesen. Deshalb fasse ich mich so kurz wie möglich.
Ich schreibe es nur, um dem Vorwurf entgegen zu treten, ich würde die beschriebene Zeit, Kriegs- und Nachkriegszeit, verharmlosen wollen. Das ist nicht meine Absicht. Meine Absicht ist lediglich, die Zeit aus der Sicht des beschriebenen Kindes oder Jugendlichen darzustellen. Natürlich blickt das Besserwissen dem Autor dabei ständig über die Schulter und führt gelegentlich zu einem ironischen Unterton. Deshalb möchte ich alle diejenigen, die keinen Sinn für Ironie haben, bitten, dieses Buch nicht zu lesen.
Meine Absicht ist auch nicht, die Schrecken des Krieges zu verharmlosen oder die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes. Keineswegs ist es meine Absicht, das Verbrechen, das durch den Holocaust an den Juden begangen worden ist, zu leugnen oder zu relativieren. Für mich ist nur wesentlich, welche Rolle die in der Wahrnehmung des betreffenden Jugendlichen gespielt haben. Soweit die in seinem Denken keine Rolle spielten, kommen sie hier eben nicht vor. Dies ist keine Zeitgeschichte. Diejenigen Leser, die etwas zu einem dieser drei Themenkreise lesen wollen, bitte ich, nach einem anderen Buch zu greifen.
Den übrig gebliebenen Lesern wünsche ich bei der Lektüre des Buches viel Vergnügen.
Georg M. Peters
Geboren im Jahr 1933
Geboren wurde ich im Jahre des Führers 1933. Die Bedeutung dieses Datums war mir zunächst nicht bewusst.
Bevor ich laufen lernte, lernte ich, die ästhetische Bedeutung der Symmetrie schätzen. Die Erwachsenen hatten sich ein Spiel mit mir ausgedacht, bei dem sie auf dem Fußboden eine Reihe von Flaschen aufstellten. Ich kroch an der Reihe entlang und prüfte, ob alle in einer Linie standen. Flaschen, die aus der Reihe tanzten, wurden von mir zurück gestellt. Doch wenn ich bis ans Ende der Reihe gekrabbelt war, um die Vollendung meines Werkes zu begutachten, hatten die Erwachsenen hinter meinem Rücken eine der Flaschen wieder aus der Reihe gerückt. Ich peilte an der Linie entlang, besah mir den Schaden, kroch zurück und richtete die Flaschen wieder aus. Doch sobald ich danach am Ende der Reihe angelangt war, um endlich die Schönheit einer geraden Linie genießen zu können, hatten die Großen wieder eine Flasche zur Seite gerückt - und ich hatte noch zu tun.
Das Leben ist ein ununterbrochener Lernprozess. Es gab eine Großmutter und einen Großvater, beides die Eltern meiner Mutter. Großmutter war mit neun Geschwistern in Hamburg-Finkenwerder aufgewachsen. Ihr kleiner Bruder wurde eines Tages, er war vier Jahre alt, traurig angetroffen mit einem toten Vogel in der Hand. Er starrte fassungslos das Tier an und sagte auf platt „eben hett hei noch piep seggt“.
Eine ähnliche Erfahrung zu machen ist mir verwehrt worden. Meine Eltern wohnten mit mir und meiner Schwester Ingeborg, die zwei Jahre jünger ist als ich, in einem der Elbvororte Hamburgs. Ein Sonntagsspaziergang stand bevor. Ich war schon fertig angezogen und ging voraus auf die Straße. Dem Haus gegenüber war ein Teich mit stolzen Schwänen darauf. Um das Warten auf die übrige Familie sinnvoll zu nutzen, befasste ich mich mit den großen Vögeln auf dem Wasser. Mein Verhältnis zu Tieren war geprägt durch die Liebe zu einem großen Plüschtier, meinem Teddy namens Philax. Die Eltern machten mit uns Kindern gelegentlich Ausflüge an die Elbe. Bei einem dieser Ausflüge, während wir in einem Gartencafé saßen, sah ich am Nebentisch ein Ehepaar, das einen großen Schäferhund bei sich hatte. Sofort vermutete ich in dem Tier eine Art Philax, stürmte auf es zu und umarmte es. Die Hundebesitzer trennten uns voneinander und riefen meine Eltern dazu auf, ihr Kind in Zukunft strenger zu beaufsichtigen. Das Tier sei außerordentlich gefährlich und bissig. Aber heute, an dem erwähnten Sonntag, waren keine Eltern in Sichtweite. Und diese Chance nutzte ich, um mich den Schwänen zu nähern. Die hatten einen so schönen langen Hals, um den man ihnen fallen konnte. Doch auf halber Strecke musste ich meinen Plan aufgeben, denn ich steckte bis zu den Hüften im schwarzen Schlamm. Die Schwäne aber lachten sich ins Fäustchen und segelten davon.
Kriegszeit
Bei zwei Gelegenheiten während des Krieges hatte ich Angst. Das erste Mal nach einem Luftalarm 1941. Wir wohnten im oberen Stockwerk eines schönen vierstöckigen Eckhauses aus der Gründerzeit. Die Wohnung hatte fünf Räume, Küche, einen kleinen Balkon zum Hof und einen großen Balkon zur Südseite. Im Keller befand sich ein großer Luftschutzraum für die Hausgemeinschaft mit Betonbarrieren vor den Kellerfenstern und einer luftdicht schließenden Stahltür nach innen zu den übrigen Kellerräumen.
Meine Eltern waren befreundet mit den Ehepaaren Thompson und Heise. Herr Thompson war prominent, ein führender Offizier im NSKK, dem nationalsozialistischen Kraftfahrkorps. An seinem Geburtstag füllte sich der Platz vor unserem Haus, der Alsenplatz, mit schwarz uniformierten Männern, die sich ihm zu Ehren versammelten, und die er von seinem Balkon im ersten Stock unsres Hauses herunter grüßte. Die genannten drei Ehepaare hatten sich einen eigenen Luftschutzraum eingerichtet, der ebenfalls eine Betonabdeckung des Kellerfensters besaß, aber nach innen überhaupt keinen Schutz. Die Tür war eine Gittertür aus Holz, bei der die Fugen zwischen den Brettern durch Säcke verhängt waren. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kellerganges befand sich eine ähnliche Tür und dahinter ein Kellerraum, der zum Hof mit einem Glasfenster ausgestattet war. Als Acht- oder Neunjähriger hatte ich genügend technisches Wissen, um zu erkennen, dass wir einer Bombe, die im Hof explodierte, schutzlos ausgeliefert wären. Ich glaube, ich wäre als Erwachsener mit Familie in dieser Situation lieber in den anderen Schutzraum gegangen. Aber in unserem Raum war es gemütlich. Die Erwachsenen saßen um einen flachen Holztisch herum und spielten Rommee. Wir Kinder lagen in den Etagenbetten, die an den Wänden herum aufgestellt waren. Während die Erwachsenen Bowle tranken, bekamen wir Kinder Apfelsaft. Statt zu schlafen, linsten wir zwischen den Decken, die zur Abschirmung aufgehängt waren, hindurch und schauten den Erwachsnen beim Kartenspielen zu. Es herrschte immer eine fröhliche Stimmung und wenn Entwarnung kam, dann stimmten die Erwachsenen Lieder an wie „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, keine Angst, keine Angst Rosmarie. Und wenn die ganze Erde bebt, und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie.“ Oder „ Hört Ihr die Motoren singen ‚Ran an den Feind’. Hört Ihr’s in den Ohren klingen ‚ran an den Feind’. Bomben! Bomben! Bomben auf Engelland! ... Denn wir fahren, denn wir fahren, denn wir fahren gegen Engelland, ahoi!“ Wie gesagt, es herrschte immer eine Bombenstimmung.
Angst hatte ich wie gesagt einmal nach Alarm im Jahr 1941. Im Anschluss an die Entwarnung gingen alle Erwachsenen auf den Dachboden, weil in der Ferne ein Dachstuhl in Brand geraten war. Offenbar war dort eine Brandbombe eingeschlagen. Nacheinander schaute jeder durch die Dachluke um einen Blick auf die Flammen zu erhaschen. Im Bett vor dem Einschlafen hatte ich Angst. Ich hatte von dem Hamburger Brand im 19. Jahrhundert gehört, der große Teile der Altstadt zerstörte. Jetzt hatte ich Angst, dass die Flammen, die ich gesehen hatte, sich wieder ausbreiten und unsere Wohnung erreichen könnten. Als unsre Wohnung 1943 tatsächlich abbrannte, hatte ich merkwürdigerweise keine Angst.
Angst hatte ich lediglich bei einer weiteren Gelegenheit. Das war 1945. Meine Familie wohnte in Wandsbek. Die Eltern wollten mich vor möglichen Luftangriffen in Sicherheit wissen und hatten deshalb Kontakt zu einer Familie in Bad Oldesloe, einer kleineren Stadt in der Nähe von Hamburg, aufgenommen. Die hatten einen Sohn, und da ich in der Schule immer gut gewesen war, sollte ich ihrem Sohn bei den Schularbeiten helfen und dafür in der Woche bei ihnen wohnen. In seiner Klasse war man etwas weiter fortgeschritten als ich in meiner zuletzt besuchten Schule. So wurde aus der Hilfe nicht viel. Stattdessen lernte ich von ihm – etwa Kaninchen auszunehmen. Ein Bein schnitt er ab, so dass aus der Schnittstelle eine Sehne heraushing. An der Sehne konnte man ziehen und dann bewegte sich die Pfote. Eindrucksvoll! Auch wie man Löschpapier in Unkrautexlösung tränkte und auf dem Ofen trocknete, lernte ich. Man musste aufpassen, dass es sich nicht entzündete! Dann wurde das brisante Material in Zeitungspapier eingerollt und mit einer Zündschnur versehen. So stellten wir Raketen her, die auch wunderbar durch die Luft flogen. Unter seinen Freunden war einer, der im Keller seines Elternhauses einen Superhet-Radioempfänger stehen hatte. Verstohlen schlichen wir uns in diesen Keller, um dort englische Sender zu hören, was streng verboten war. Nach dem Erkennungssignal aus Beethovens Fünfter erklang dann in deutscher Sprache die Nachrichtensendung vom BBC.
Am Wochenende fuhr ich regelmäßig mit dem Zug nach Hamburg-Wandsbek zu meinen Eltern. Der März war frühlingsmäßig mild und ruhig. Es war die gleiche Zeit, zu der beim Luftangriff auf Hildesheim fast die ganze Stadt ausgelöscht wurde. Doch davon wusste ich nichts. Angst hatte ich vor etwas anderem. Wenn ich am Sonntagabend nach Bad Oldesloe zurück fuhr, musste ich vom Bahnhof etwa zwanzig Minuten zu Fuß gehen, bis ich das allein stehende Haus meiner Gastfamilie erreichte. Es war dann regelmäßig dunkel, und um in das Haus zu gelangen, musste ich im Garten zwischen zwei hohen Wacholdersträuchern hindurch gehen. Davor hatte ich Angst. Schon in Wandsbek stand mir dieser Augenblick bevor.
Ausbombung
Wenn wirklich etwas passierte war keine Zeit, Angst zu haben. Eines Nachts im Jahr 1943 rief mein Vater aufgeregt „Anziehen, in den Keller gehen!“ und man hörte, dass es ihm Ernst war. Es war ein anderer Ton als sonst bei den Luftalarmen. Er hatte aus dem Fenster gesehen und am Himmel Leuchtzeichen, sogenannte „Tannenbäume“ erblickt. Die hatte es vorher nicht gegeben. Sie markierten für die Bombenflieger die Bereiche, in denen sie ihre Bombenlast abladen sollten. Wir waren kaum in unserem provisorischen Luftschutzkeller angekommen, als das Licht ausging und ein ungeheurer Lärm begann. Ich muss das Bewusstsein verloren haben. Denn später sagte meine Mutter, ich hätte geschrien. Aber daran erinnere ich mich nicht. Meine Erinnerung setzt wieder ein, als der Lärm vorbei war und wir aus dem Keller heraus wollten. Wir gingen in den Nachbarraum, der eine Ladeluke zur Straße hin besaß. Als wir hinausklettern wollten, riss die Mutter uns zurück, weil ein brennender Balken vom Dach auf die Straße fiel. Danach kletterten wir hinaus und begaben uns in den Park, der dem Alsenplatz gegenüber lag. Hier waren wir sicher.
Gefühle hatte ich überhaupt keine. Ich war quasi nur Auge, das die Umgebung in sich einsaugte. Zwischen uns im Park und unserem Wohnhaus befand sich im Eckhaus eine Apotheke. Die Apotheke brannte und unter ihr im Keller spielten sich Explosionen ab. Das heißt aus den Kellerfenstern zischten Flammenstrahlen heraus, die die ganze Breite der davor liegenden Straße überdeckten. Gelegentlich erfolgte ein Knall und der Feuerstrahl verlängerte und verbreitete sich. Die Häuserfront, die links den Alsenplatz begrenzte, stand in Flammen. Bei einem dieser vierstöckigen Häuser leuchtete Feuer aus allen Fenstern vom Erdgeschoss bis zum obersten Stockwerk. Dann sah ich, wie sich die Fensterfront ohne ihren inneren Zusammenhalt zu verlieren langsam nach vorne neigte und wie ein Kistendeckel umklappte.
Meine Einstellung zum Führerregime
Meine Kinder heute stellen wenig Fragen nach den Ereignissen jener Zeit. Ich vermute, das liegt an der Art wie sie darüber unterrichtet werden. Sie denken vermutlich, wenn ich über diese Zeit redete, müsste ich über schreckliches Leid, über Tote und Sterbende reden, darüber, wie wir die Juden aus der Stadt getrieben hätten – und über die Verbrechen, die ich selbst begangen habe. Ich will das hier tun und über meine Verbrechen berichten. Ich gestehe, dass es mir als Zehnjährigem an jedem globalen Weitblick und an Solidaritätsbewusstsein mit den unterdrückten Völkern gemangelt hat. Auch an jeder Kritik und jedem Widerstandswillen gegen das diktatorische Regime, unter dem ich aufwuchs.
Mein Widerstand beschränkte sich darauf, dass ich es nach Möglichkeit vermied, zum Dienst im Jungvolk zu gehen. Dieser Dienst begann damit, dass die Mutter mit mir zu einem Ausstattungsgeschäft in der Holstenstraße ging. Vier Eisenstufen ging es hoch zu dem kleinen Laden. Dort wurde für mich ein Braunhemd, ein Halstuch mit Lederknoten und ein Koppel mit Koppelschloss gekauft. Aber leider keine Cordhose, denn die wollte meine Mutter selbst nähen. Und der Koppel, den meine Mutter aussuchte, bestand nicht aus Leder, sondern aus einem brüchigen Kunststoff. Die fehlende Cordhose und der Ersatz durch eine selbstgenähte Hose aus dickem schwarzem Stoff hat mir beim Dienst stets ein Minderwertigkeitsgefühl eingeflößt. 1943, noch vor dem beschriebenen Luftangriff, musste ich an einer Versammlung unter Leitung des Hauptjungzugführers teilnehmen. Dreißig Jungen hörten eine Stunde lang seinen Ausführungen zu und versuchten, Fragen zu beantworten. Ich musste die Frage nach dem Geburtsdatum des Führers beantworten, was ich auch konnte. Schließlich hielt ich viel von unserem Führer. Ich war kein Verehrer von ihm, und ich dachte auch nicht viel über ihn nach. Aber dass er der größte aller Staatslenker war, das war ja unzweifelhaft. Dieses Wissen gehörte zu den selbstverständlichen Randbedingungen meines Daseins. Schließlich hatten wir ja auch die beste Wehrmacht, die beste Luftwaffe und die beste Kriegsmarine, vor allem die besten U-Boote der Welt. Aber dennoch war diese Jungvolk-Versammlung ein abschreckendes Beispiel für mich. Auch im Anbetracht aller Zusammenkünfte mit Gleichaltrigen später in der Schule oder in Jugendherbergen war diese Jungvolkversammlung bei weitem die langweiligste. Nach der Ausbombung habe ich mich stets erfolgreich um einen weiteren Dienst im Jungvolk herum gedrückt.
Ein Problem, das mich wirklich beschäftigte, war die Funktion des Viertaktmotors. Mein Großvater, der zur See gefahren war und eine Zeit lang die Fachhochschule in Wilhelmshaven besucht hatte, schenkte mir einen Taschenkalender. Darin war die Funktionsweise des Viertaktmotors an Hand von Schaubildern erklärt, und ich hatte das Prinzip begriffen. Das habe ich als einen großen Erfolg erlebt. Von meinem Großvater - es war, wie gesagt, der Großvater mütterlicherseits, die Großeltern väterlicherseits waren schon gestorben – hatte ich auch ein großformatiges Buch mit Darstellungen von Maschinenteilen bekommen. Nun wollte ich so, wie ich das Viertaktprinzip begriffen hatte, auch das Prinzip des Vergasers an Hand eines Schaubildes verstehen. Das ist mir nicht gelungen.
Mein Großvater und ich
Zu meinem Großvater hatte ich ein recht inniges Verhältnis. Ich glaube, meine Mutter hatte unter ihm in jüngeren Jahren gelitten, weil er Alkoholiker war und womöglich seine Frau schlug. Doch als ich ihn kennen lernte, waren diese Probleme bewältigt. Er war noch gut zu Fuß. So ging er von seiner Wohnung in der Stiftstraße zur Wohnung meiner Eltern, die damals noch in der Düppelstraße wohnten. Ausgebombt wurden wir in der Missundestraße. Wenn mein Großvater in die Düppelstraße kam, wurde ich in eine Karre gesetzt und er machte sich damit auf den stundenlangen Weg nach Hochkamp zu seiner anderen Tochter Hedwig. Tante Hedwig und ihr Mann, Onkel Willi, hatten ein Haus mit großem Garten. Ein Aufenthalt dort war immer etwas besonderes. Am Abend schob mein Großvater mich wieder nach Hause. Im Winter, wenn es kalt war, zog er seine dicke Joppe an und machte sich mit mir auf den Weg. In der Silvesternacht sahen wir unterwegs Jugendliche, die am Kantstein Feuerwerkskörper entzündeten. Ich fragte meinen Opa, was die dort machten. Das Gute an diesen Unterhaltungen war, dass er immer auf alle meine Fragen eine Antwort parat hatte. „Die schießen das alte Jahr um die Ecke,“ belehrte er mich. Ich war stolz darauf, dass ich gesehen hatte, wie das alte Jahr um die Ecke geschossen wurde, und erklärte zu Hause meinen Eltern voller Stolz, dass ich gesehen hätte, wie das alte Jahr um die Ecke geschossen worden sei.