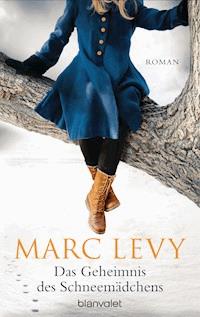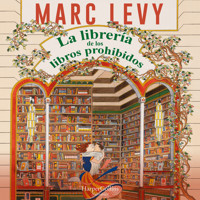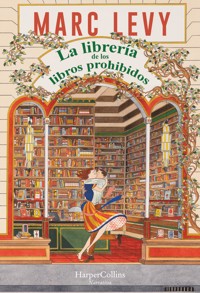5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen, fünf Tage und Träume, die wahr werden ...
Philadelphia, Frühjahr 2010: Nach dreißig Jahren Haft flieht Agatha aus dem Gefängnis, obwohl sie nur noch wenige Jahre zu verbüßen hätte. An einer Tankstelle springt sie zu einer jungen Frau ins Auto und zwingt sie mit vorgehaltener Waffe, mit ihr zusammen nach San Francisco zu fahren. Milly, zunächst zu Tode erschrocken, findet nach und nach Gefallen an ihrer unverhofften Begleitung und wird von der Geisel zur Komplizin. Fünf Tage lang reisen die beiden quer durch die USA, und für Milly, die noch das ganze Leben vor sich hat, stellt sich unweigerlich die Frage: Wie weit darf man auf der Suche nach dem eigenen Glück gehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Philadelphia, Frühjahr 2010: Nachdem sie dreißig Jahre in Haft gesessen hat, flieht Agatha, obwohl sie nur noch fünf Jahre zu verbüßen hätte. An einer Tankstelle steigt sie zu einer jungen Frau ins Auto und zwingt sie, mit ihr zusammen nach San Francisco zu fahren. Milly, zunächst zu Tode erschrocken, findet nach und nach Gefallen an der geheimnisvollen Passagierin. Aus der Geisel wird eine Komplizin. Fünf Tage lang reisen die beiden quer durch die USA, und bei jeder Rast begegnen sie jemandem aus Agathas Vergangenheit. Für Milly, die noch das ganze Leben vor sich hat, stellt sich die Frage: Wie weit darf man auf der Suche nach dem eigenen Glück gehen?
Autor
Marc Levy wurde 1961 in Frankreich geboren. Nach seinem Studium in Paris lebte er in San Francisco. Mit siebenunddreißig Jahren schrieb er für seinen Sohn seinen ersten Roman, Solange du da bist, der von Steven Spielberg verfilmt und auf Anhieb ein Welterfolg wurde. Seitdem wird Marc Levy in fünfundvierzig Sprachen übersetzt, und jeder Roman ist ein internationaler Bestseller. Marc Levy lebt zurzeit mit seiner Familie in New York.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.marclevy.info
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
MARC LEVY
EINE ANDERE VORSTELLUNG VOM GLÜCK
Roman
Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Bettina Runge
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Une autre idée de bonheur« bei Editions Robert Laffont, Paris.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2014 by Marc Levy/ Susanna Lea Associates, Paris
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de, nach einer Originalvorlage von Editions Pocket
Umschlagdesign: ©Emmanuel Romeuf
KW · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19615-8V005
www.blanvalet.de
Für Pauline, Louis und Georges
Es gibt keine Zufälle, es gibt nur Begegnungen.
Paul Éluard
Er hielt ihr Tagebuch in Händen, begierig auf die Worte, die sie zu Papier gebracht hatte, und versuchte, in der einen oder anderen Person seine eigenen Züge wiederzuerkennen, den Widerhall ihrer Gespräche in den Cafés von Greenwich Village, eine der Zeit gestohlene Episode. Und mit jeder Seite, die er umblätterte, hörte er sein Herz schlagen, außer Atem von einer Liebe, deren Erinnerung verblasst war wie die Fußabdrücke eines Läufers, der sich im Schnee entfernt.
Während die Dunkelheit hereinbrach, setzte er seine Lektüre fort. Er saß allein am Tisch des einzigen Raums in seinem Haus und kümmerte sich weder um sein Abendessen noch um die Stunden, die sich weit in die Nacht zogen. Hier gab es nichts Überflüssiges, doch alles Lebensnotwendige war vorhanden. Als die ersten Sonnenstrahlen durch die Jalousie drangen, schlug er das Buch zu und hielt, die Hände auf den Knien, mit einem tiefen Seufzer die Tränen zurück.
Sie hatte ihr Leben erzählt, ohne ihn je beim Namen zu nennen und auf die Rolle einzugehen, die ihm darin zukam, oder auf die Wahl, die sie getroffen hatte. Und er fragte sich, ob das auf Gleichgültigkeit ihrerseits zurückzuführen war oder auf einen Groll, den die Zeit nicht besänftigt hatte.
Schließlich trat er zum Waschbecken, betrachtete sein Gesicht in dem gesprungenen Spiegel, der an einem Nagel hing, und erkannte nicht die Züge desjenigen, der ihn während der gesamten Lektüre verfolgt hatte. Vielleicht war das der Grund, weshalb Hanna ihn aus ihrer Vergangenheit ausgelöscht hatte. Merkwürdig, diese Erinnerungen, dachte er, während er sich eiskaltes Wasser ins Gesicht spritzte. Manche Menschen nähren sich davon, als würde ihre Existenz dadurch von einem Faden zurückgehalten, der sie vom Tod entfernte; andere löschen sie aus, um die ihnen verbliebene Zeit zu erhellen.
Er machte sich sein Frühstück: Kaffee und Eier auf Speck, die in einer gusseisernen Pfanne brutzelten. Sie musste in diesen Seiten ein Indiz zurückgelassen haben, eine Antwort auf die Frage, die ihr Verschwinden erklärte, eine Spur. Sonst hätte sie sie verbrannt oder mitgenommen.
Danach stellte er seinen Teller ins Spülbecken und kehrte an den Tisch zurück.
»Herrgott, Hanna, du konntest die Wahrheit doch nicht derart ignorieren«, fluchte er und rieb sich die Wangen, um gegen die Müdigkeit anzukämpfen.
Er starrte auf die Wanduhr, erhob sich und öffnete den Schrank, um seine Reisetasche zu packen. Er legte drei Hemden hinein, Unterwäsche, eine Wolljacke und einen Pullover. Er holte den Umschlag, der all seine Ersparnisse enthielt, steckte ihn in seine Manteltasche, nahm seinen Hut und den Holster vom Garderobenhaken, überprüfte die Sicherung des Revolvers und ließ ihn weit unten in der Tasche verschwinden. Dann erstickte er die Glut im Kamin, verriegelte die Fensterläden, löschte das Licht und trat aus der Haustür.
An diesem Spätwintermorgen stand die Sonne noch tief am Himmel. Der Weg vor ihm führte zur großen Straße. Sobald er an der Kreuzung angelangt wäre, müsste er die sechs Meilen bis zum Bildstock laufen, wo der Bus hielt. Er hatte keine Zeit zu verlieren; der Wind, der ihm entgegenblies, verlangsamte seinen Schritt. Das hatte jedoch den Vorteil, dass die Wölfe ihn nicht wittern würden. Fast hätte er sich gewünscht, die Meute würde ihn verfolgen und er könnte sein ganzes Magazin leer schießen, doch er nahm es sich sogleich übel, seinen Zorn gegen sie gerichtet zu haben. Die Wölfe und er kamen inzwischen gut miteinander aus. Wenn er zur Jagd aufbrach, folgten sie ihm in gebührendem Abstand. Und wenn er seine Beute getötet hatte, warteten sie, bis er sie zerlegt hatte, um sich dann an den Fleischresten zu weiden, die er ihnen an dem Gerippe zurückließ. Wenn er Holz hackte, beobachteten sie ihn von der Kuppe des Hügels aus, bis er ihnen mit einer Kopfbewegung zu verstehen gab, dass er sich auf den Heimweg machte und seine Waffe geladen war. Die Wölfe schienen die Regel verstanden zu haben, keiner von ihnen hatte sich jemals genähert, und Thomas Bradley hatte niemals auf einen von ihnen schießen müssen.
Es war Mittag, als er den Bildstock erreichte. Sein Haus war seit Langem am Horizont verschwunden. Das Land erstreckte sich vor ihm – flach, so weit das Auge reichte.
Der Überlandbus näherte sich. Er war noch zu weit entfernt, als dass man sein Motorengeräusch hätte hören können, doch man erkannte schon die Staubwolke, die er aufwirbelte. Diese Expedition war vielleicht seine größte Dummheit seit dreißig Jahren. Schließlich ging er das Risiko ein, eine Erinnerung, die sein Leben begleitet hatte, mit einer Realität zu konfrontieren, die sie zunichtezumachen drohte.
Tom hob den Arm, um dem Fahrer ein Zeichen zu machen, und als sich die Bustüren öffneten, lächelte er selbstironisch und musste schließlich erkennen, dass sich hinter seiner Maske der Furchtlosigkeit ein Mann verbarg, der gegenüber einer Frau verletzlich war.
»Aber was für eine Frau!«, rief er dem Fahrer zu, als dieser ihm das Wechselgeld aushändigte.
Zwanzig Dollar für die erste Etappe der schönsten aller Reisen, die er sich je erträumt hatte. Sie würde bis zum Ende führen, das Einzige, das ihn daran hindern könnte, wäre, unterwegs zu sterben, aber solange er noch einen Funken Leben in sich hätte, würde er sie suchen.
Tom Bradley hatte diesen Moment lange herbeigesehnt. Wenn er ehrlich mit sich selbst gewesen wäre, hätte er zugegeben, dass er darauf gelauert hatte. Und als am Vortag ein junger Polizist – einer von den vielen, die er ausgebildet hatte – an seine Tür geklopft hatte, um ihm einen Umschlag zu überreichen, der ein Tagebuch enthielt sowie eine Nachricht von seinem Freund, dem Richter Clayton, hatte er gewusst, dass dieses Leben, auf das er nach und nach verzichtet hatte, noch nicht mit ihm fertig war.
Als er im hinteren Teil des Busses Platz nahm, kniff er die Augen zusammen und lachte laut auf. Das war nicht das Ende, sondern der Anfang eines großen Abenteuers.
Kapitel 1
Wer Milly begegnet, könnte sie für ein Rock’n’Roll-Girl halten. Das liegt an ihrem Aussehen, das an die junge Patti Smith erinnert, aber es ist nur ein Anschein, den sie sich gibt. Millys Leben hat überhaupt nichts von Rock’n’Roll an sich. Wenn sie allein ist, was häufig vorkommt, hört sie in voller Lautstärke klassische Musik, weil es nur Bach, Grieg und Glenn Gould gelingt, den Widerhall der Einsamkeit zum Schweigen zu bringen.
Milly Greenberg hatte Santa Fe verlassen, nachdem sie ein Stipendium für die Universität von Philadelphia erhalten hatte. Zweitausendzweihundert Meilen und sechs Bundesstaaten trennten ihren Geburtsort von der Stadt, in der sie nun lebte. Diesen Abstand hatte sie absichtlich zwischen ihr Leben als junges Mädchen und als Frau gelegt. Und dennoch hatte Milly sich in den Jura-Vorlesungen in Pennsylvania beinahe ebenso gelangweilt wie während ihrer Kindheit in New Mexico. Die drei Dinge, die sie dazu bewogen hatten, ihr Studium fortzusetzen, waren das Leben, das sich ihr auf dem Campus bot, die Tatsache, dass sie einen echten Freund gefunden hatte, und dass die Professoren sie trotz ihres nicht immer einfachen Charakters geschätzt hatten. Milly hatte sich nie in diese Gruppen junger Mädchen integriert, die von morgens bis abends kokettierten, sich in jeder Pause nachschminkten, die, um immer auf dem Laufenden zu sein, die Geschichten der jeweils wichtigsten Promis verfolgten und deren Eskapaden und Enttäuschungen spannender fanden als das Schicksal der Welt. Sie hatte auch kaum Kontakt zu den jungen Männern mit den breiten Schultern gehabt, die ihren Testosteron-Überschuss ausschwitzten und die Sportkappen und Farben des amerikanischen Footballteams trugen. Milly war eine unauffällige und fleißige Studentin gewesen und hatte, obwohl sie Jura sterbenslangweilig fand, eine Entschiedenheit an den Tag gelegt, wirklich etwas aus ihrem Leben zu machen. Was das sein würde, wusste sie noch immer nicht, aber es erwartete sie ein Schicksal, ein Schicksal, das eines Tages an ihre Tür klopfen würde.
Nach Abschluss ihres zweiten Studienabschnitts hatte die Universität das Stipendium nicht verlängert, ihr jedoch einen Deal vorgeschlagen, den Mrs. Berlington als »Austausch auf Gegenseitigkeit« bezeichnet hatte. Dabei sollte sie als Praktikantin im juristischen Dienst mitarbeiten – wobei diesem ausschließlich Mrs. Berlington angehörte – und im Gegenzug fünf Dollar Entlohnung pro Stunde, eine Krankenversicherung und eine Dienstwohnung dafür erhalten. Milly hatte das Angebot sofort angenommen. Nicht aus Interesse und natürlich auch nicht wegen der Bezahlung, sondern um weiterhin den Campus aufsuchen zu können. Sie hatte dort bereits ihre Orientierungspunkte und ihre Gewohnheiten.
Noch immer frühstückte Milly gerne im Tuttleman Café,lief um 8 Uhr 53 über die große Wiese, um 8 Uhr 55 an der Buchhandlung Gutman vorbei, bevor sie das Verwaltungsgebäude betrat, wo ihr Arbeitstag um 8 Uhr 57 begann. Um 11 Uhr 50 bestellte sie von ihrem Computer aus ein Pastrami-Sandwich für Mrs. Berlington. Um 12 Uhr 10 ging sie in umgekehrter Richtung über die Wiese zum Café des Kambar Campus Center, holte das Sandwich für Mrs. Berlington und einen Frühlingssalat für sich selbst ab und kehrte über die Ringallee zurück, sodass sie wieder an der Buchhandlung vorbeikam. Während sie ihrer Chefin gegenübersaß, nahm sie ihre Mahlzeit ein und kehrte um 12 Uhr 30 an ihren Arbeitsplatz zurück. Um 15 Uhr 55 legte sie den Block mit den Diktaten von Mrs. Berlington wieder in die Schublade ihres Schreibtischs und darauf den versilberten Fotorahmen, aus dem ihre Großmutter sie anlächelte, schloss die Schublade ab und verließ das Büro um 16 Uhr.
Es folgte für diesen Tag die letzte Überquerung des Campus Richtung Parkplatz, wo Milly wieder von etwas Besitz ergriff, das bewies, dass sie eine eher unkonventionelle Angestellte war: ein Oldsmobile-Cabriolet von 1950. Es hatte ihrer Großmutter gehört, die es ihr einige Jahre, bevor sie Santa Fe verlassen hatte, geschenkt hatte. Dieses Fahrzeug, das sie mit der Hingabe eines Sammlers pflegte, musste heute rund achtzigtausend Dollar wert sein. Das Cabriolet, das die Automobilfabrik Oldsmobile drei Jahrzehnte vor ihrer Geburt verlassen hatte, stellte im Notfall eine echte Lebensversicherung dar. Ein Leben, das ihr kurz vor ihrem einunddreißigsten Geburtstag perfekt zusagte.
Um 16 Uhr 06 nahm Milly am Steuer Platz, schaltete das Autoradio ein und löste ihr Haar, bevor sie den Motor anließ, und hörte, wie das Dröhnen des 6,6-Liter-V8 einer Fuge von Bach, einer Symphonie von Mendelssohn oder einem anderen klassischen Musikstück einige Basstöne hinzufügte.
Von diesem Augenblick an glich Milly dann doch eher einem Rock’n’Roll-Girl. Bei jeder Temperatur – Regen ausgenommen – fuhr sie mit flatternden Haaren zur Tankstelle 7-Eleven, wo sie ihren Durst mit einer Cola für zwei Dollar siebzig stillte und ihr Auto mit 7,5 Liter Benzin für sieben Dollar dreißig auffüllte. Jeden Abend, während sie die Ziffern im Sichtfenster der Tanksäule durchlaufen sah, zählte sie die Minuten, die sie damit verbracht hatte, Mrs. Berlingtons Berichte zu tippen. Zehn Dollar ausgegeben in fünf Minuten, das entsprach dreitausend Zeichen, die sie vormittags auf ihrer Tastatur getippt hatte. Mit dem Rest ihres Lohns bezahlte sie ihr Abendessen – da das Sandwich von Mrs. Berlington auf Kosten des juristischen Dienstes ging, hatte Milly sich mit dem Angestellten des Kambar Café sehr schnell darauf geeinigt, dass der Preis für ein Pastrami-Sandwich um den Betrag für einen Frühlingssalat erhöht wurde –, kaufte sich einige Kleidungsstücke, erweiterte ihre CD-Sammlung, gönnte sich samstags einen Kinobesuch und unterhielt vor allem ihren Oldsmobile.
Der Angestellte des Kambar Cafés hieß Jo Malone. Einen solchen Namen kann man nicht erfinden. Sein echter Vorname lautete Jonathan, aber »Jonathan Malone« klang nicht so gut, das hatte Milly mit ihrem unfehlbaren musikalischen Ohr befunden. Jo, der ihr seinen eines Gangsterfilms würdigen Namen verdankte, war ein junger Mann von hochgewachsener Statur, den die Natur mit einem poetischen Talent bedacht hatte. Gelang ihm nicht das Kunststück, zu jeder Jahreszeit einen wunderbaren Frühlingssalat zusammenzustellen?
Jonathan Malone war leidenschaftlich in eine gewisse Betty Cornell verliebt, die ihren Blick niemals auf dem Angestellten einer Cafeteria hätte ruhen lassen, selbst wenn dieser das Gesamtwerk von Corso, Ferlinghetti, Ginsberg, Burroughs und Kerouac verschlungen hätte, deren Prosa Jo beinahe auswendig kannte. Jo Malone bemühte sich, in die Sandwichs und Salate zu fünf Dollar fünfzig etwas Poesie zu legen, immer in der Hoffnung, eines Tages sein Studium fortsetzen zu können und die wunderbare Welt der Wörter jungen Mädchen nahezubringen, deren Vorbilder Britney Spears, Paris Hilton und magersüchtige Models waren. Milly hatte oft zu ihm gesagt, er habe die Seele eines Missionars, der die Literatur zur Religion erhoben habe.
Nachdem sie die Tankstelle verlassen hatte, raste Milly über den Highway 76 bis zur folgenden Ausfahrt, die in Richtung ihres Zuhauses führte.
Milly wohnte in einem kleinen Holzhaus in der Flamingo Road, direkt hinter dem Wasserreservoir des Vororts. Es war ein einfaches Viertel, dem man jedoch einen gewissen Charme nicht absprechen konnte. In dieser Straße endete die Stadt, und der Wald forderte wieder sein Recht ein.
Abends las Milly, abgesehen von freitags, wenn Jo zum Essen kam. Sie schauten die neue Folge einer Fernsehserie an, die sie beide liebten: das Leben einer Anwältin, Ehefrau eines künftigen Senators, das ins Wanken geriet, als die Affäre ihres Mannes mit einem Callgirl von der Presse aufgedeckt wurde.
Nach dem Ende der Episode las Jo laut die Gedichte vor, die er während der Woche geschrieben hatte. Milly hörte ihm aufmerksam zu und bat ihn anschließend um eine zweite Lesung, dieses Mal untermalt von einem Musikstück, das sie anhand von Jos Texten ausgewählt hatte.
Die Musik war das Bindeglied zwischen ihnen, und das seit ihrer ersten Begegnung, für die sie letztlich auch die Ursache gewesen war.
Jo spielte in der Kirche Orgel, um am Monatsende über die Runden zu kommen. Da die musikalischen Aufgaben pauschal mit fünfunddreißig Dollar abgegolten wurden, liebte er Beerdigungen.
Hochzeiten dauern wahnsinnig lange, die Gäste zaudern, bevor sie Platz nehmen, die Braut lässt auf sich warten, die Glückwünsche ziehen sich in die Länge, und es muss immer weitergespielt werden, bis die Eheleute und ihre Gäste den Vorplatz verlassen haben. Trauerfeiern haben den Vorteil, dass die Toten unfehlbar pünktlich sind. Da der Pfarrer zudem ein fürchterliches Grauen vor Särgen hatte, übersprang er munter ganze Passagen seines Breviers, um die Messe in genau fünfunddreißig Minuten zu beenden.
Ein Job für einen Dollar pro Minute war Gold wert, und Jo, der nicht der einzige Musiker war, auf den der Pfarrer zurückgreifen konnte, versäumte es nie, die in der Sonntagszeitung erscheinenden Todesanzeigen zu studieren, um sich als Erster in den Wochenplan eintragen zu können.
Bei einer Trauerfeier an einem Mittwochmorgen, als er soeben mit einer Fuge von Bach begann, bemerkte Jo, wie eine junge Frau die Kirche betrat. Die Zeremonie ging zu Ende, die Gemeindemitglieder erhoben sich, um Mrs. Ginguelbar die letzte Ehre zu erweisen. Zu Lebzeiten war sie Lebensmittelhändlerin gewesen und dummerweise durch Kisten mit Wassermelonen zu Tode gekommen, die auf die doppelte Höhe ihrer Körpergröße aufgestapelt gewesen, umgekippt und auf ihren Oberkörper gestürzt waren. Die arme Mrs. Ginguelbar war nicht sofort tot gewesen, ihre Agonie musste entsetzlich lange gedauert haben, denn sie lag eine ganze Nacht unter einem Berg von Kürbisgewächsen, unter denen sie schließlich erstickte.
Milly, die mit ihrem offenen Haar, den Jeans und dem ausgeschnittenen T-Shirt so gar nicht zu der Trauergemeinde passte, hatte sofort seine Aufmerksamkeit erregt. Der Organist hat von seinem Platz aus das Privileg, alles im Detail zu sehen, was in der Kirche vorgeht.
Noch heute heiterte er Milly, wenn sie niedergeschlagen war, mit einigen pikanten Anekdoten auf, deren Zeuge er gewesen war. Da hatte es Hände gegeben, die unter einen Rock fassten oder eine Hose streichelten, geschwätzige Banknachbarn, die flüsterten, ohne der Zeremonie die geringste Aufmerksamkeit zu schenken, Köpfe, die hin und her schwankten, bevor die dazugehörige Person einnickte, andere, die sich umdrehten, um eine Frau anzustarren – wobei auch das Gegenteil vorkam und häufiger, als man vermutet hätte –, Lachanfälle, wenn der Herr Pfarrer, der einen leichten Sprachfehler hatte, sagte: Bisch dasch der Tod eusch scheidet. Selbst Bibeln, unter denen sich ein Mobiltelefon oder ein anderes Buch verbargen, entgingen Jo nicht.
An diesem Mittwoch hatte Jo, sofort nachdem sich die Türen geschlossen hatten, seine Orgel verlassen, um die Wendeltreppe hinunterzueilen, die neben dem Beichtstuhl endete. Die junge Frau war allein auf einer Bank sitzen geblieben, während der Trauerzug Mrs. Ginguelbar bereits auf den Friedhof geleitete, der neben der Sakristei lag.
Er hatte sich neben sie gesetzt, das Schweigen schließlich gebrochen und sie gefragt, ob sie der Verstorbenen nahegestanden habe. Milly hatte erklärt, diese gar nicht gekannt zu haben, und, bevor Jo sich nach dem Grund ihrer Anwesenheit erkundigen konnte, hinzugefügt, seine empfindsame Spielweise und seine Bach-Interpretation hätten ihr sehr gut gefallen. In diesem Moment hatten zwei Seelen ihre Einsamkeit überwunden. Jo, weil ihm noch nie jemand etwas so Schönes über seine Musik gesagt hatte, und Milly, weil sie zum ersten Mal, seit sie in Philadelphia war, den Wunsch hatte, sich mit jemandem anzufreunden.
Jo hatte sie an der Hand genommen, um sie Richtung Wendeltreppe zu ziehen. Milly hatte entzückt von der Empore ins Kirchenschiff hinabgeschaut. Jo hatte sie aufgefordert, sich an die Orgelpfeifen zu lehnen, die sich an der Wand entlang erhoben, hatte sich an seinen Spieltisch gesetzt und eine Toccata in d-Moll gespielt.
Milly hatte das Gefühl gehabt, die Musik durchströme ihren Körper, dringe direkt in ihr Herz und der Rhythmus schlage in ihren Adern. Diese Empfindung, die Töne würden ihren Körper durchlaufen, hatte etwas Göttliches. Leider wurde dieses Privatkonzert durch die Ankunft des Pfarrers unterbrochen. Erstaunt, seine Kirche nicht still vorzufinden, war er auf die Empore gekommen. Als er Milly entdeckte, mit dem Rücken an den Orgelpfeifen, offenem Mund und verzücktem Lächeln, hatte er die Miene eines Exorzisten im Angesicht des Teufels angenommen. Jo hatte aufgehört zu spielen, und als der Pfarrer ihn gefragt hatte, wer diese junge Frau neben ihm sei, hatte er derart gestammelt, dass seine Erklärungen nicht zu verstehen waren.
Milly hatte dem Pfarrer die Hand gereicht und mit einer Dreistigkeit, die Jo verblüffte, behauptet, sie sei seine Schwester. Mit hochgezogenen Augenbrauen hatte der Pfarrer die fünfunddreißig Dollar für Jo auf eine Bank gelegt und sie gebeten, die Kirche zu verlassen.
Auf dem Vorplatz hatte Jo, der damals noch Jonathan hieß, Milly zum Mittagessen eingeladen.
Zehn Jahre später legten sie noch immer am Jahrestag ihrer ersten Begegnung einen Tulpenstrauß auf das Grab von Mrs. Ginguelbar.
Milly hatte ein großes Abenteuer erlebt, das sie Jo nähergebracht hatte. Es war mit ihrer Arbeit verbunden.
Der Server des Campus war gehackt worden. Den Rektor hatte der Verdacht beschlichen, dass etwas nicht normal sei, als die Studenten ungewohnt entspannt zu ihren Semesterprüfungen erschienen waren. Noch ungewöhnlicher war, dass die Professoren keine Prüfungsarbeit mit weniger als achtzig von hundert Punkten benoten konnten. Sehr schnell stellte sich heraus, dass jemand vorab Zugang zu den Prüfungsaufgaben gehabt haben musste.
Der juristische Dienst der Universität hatte bislang nur triviale Angelegenheiten zu bearbeiten gehabt, Überprüfungen von Versicherungspolicen, Anträge über verschiedene Bescheinigungen, Abfassung administrativer Rundschreiben jeglicher Art. Der Direktor hatte eine Vorliebe für Rundschreiben, die das Verhalten der Studenten auf dem Campus regelten, insbesondere für solche, die Verbote aussprachen. Daher hatte sein aufsehenerregender Auftritt im Justiziariat und die Ankündigung, die Universität werde das erste Mal in ihrer Geschichte Anzeige erstatten, noch dazu eine strafrechtliche, den Blutdruck von Mrs. Berlington zu einem Höchstwert getrieben, der den Durchschnittsnoten der Studenten bei Weitem überlegen war.
Für die Erstellung der Anzeige hatte Mrs. Berlington nur einen halben Tag benötigt und Milly noch einmal genauso lange, um sie abzutippen. Beide – vor allem Mrs. Berlington – hätten es vorgezogen, dass diese Arbeit sie noch etwas länger beschäftigen würde, für eine Zeitspanne, die in den Augen des Direktors der Schwere der Tat entspräche.
In stillschweigendem Einvernehmen hatten sie daher noch einige Tage gewartet, bis sie ihn darüber informierten, sie hätten ihre Aufgabe erfüllt und der juristische Dienst sei bereit, alle Register zu ziehen und mit allen Mitteln gegen die gewissenlosen Hacker vorzugehen, die das System angegriffen hatten.
Im Lauf dieser so außergewöhnlichen Woche hatte Milly jedes Mal, wenn sie dem Direktor auf dem Flur begegnete, die Miene einer gramvollen Angestellten aufgesetzt, die voll und ganz Anteil nahm an der dramatischen Situation, in der sich die Universität befand, was ihr schließlich ein kleines Lächeln eingebracht hatte, ein zerknirschtes zwar, aber doch immerhin ein Lächeln. Halleluja!
Und während Mrs. Berlington sich insgeheim wieder ihrer normalen Arbeit zuwandte, hatte Milly, die sich zunehmend langweilte, beschlossen, ihre eigenen Ermittlungen anzustellen.
Jo Malone war ein Poet und würde künftig die Art Professor sein, die sich jeder Student wenigstens einmal während seines Studiums erträumte. Er verstand es aber auch, geschickt mit verschiedenen Tastaturen umzugehen: der einer Orgel, eines Klaviers oder Cembalos und der eines Computers. Wenn irgendjemand in Millys Umfeld – das, um ehrlich zu sein, nur Mrs. Berlington, den Direktor der Universität, Mrs. Hackermann, ihre Nachbarin in der Flamingo Road, und Jo umfasste – ihr helfen konnte, die Identität der Person herauszufinden, welche die Prüfungsaufgaben gestohlen hatte, war es Jo, ihr einziger und wahrer Freund.
An dem Dienstag, der auf die Entdeckung der Untat folgte, hatten Milly und Jo sich auf eine nächtliche Expedition gewagt, die zwar nicht ganz legal war, jedoch im Rahmen einer Ermittlung erfolgte, die im Erfolgsfall der Universität nutzen würde.
Als Jo um 22 Uhr 30 seinen Dienst beendete, erwartete Milly ihn in ihrem Oldsmobile auf dem Parkplatz des Campus. Er war zu ihr gekommen, und sie hatte ihm erlaubt, eine Zigarette im Auto zu rauchen, bei geschlossenem Dach, aber offenem Fenster. Sie hatten eine halbe Stunde in tiefstem Schweigen ausgeharrt, bevor sie die Straße betraten, die an der Bibliothek entlangführte und von allen am schlechtesten beleuchtet war. Dank ihres Ausweises konnten sie problemlos das Verwaltungsgebäude betreten, in dem sich der Computerraum befand. Jo hatte beschlossen, vor Ort tätig zu werden. Falls die Polizei die Anzeige ernst nahm und ihre eigenen Ermittlungen veranlasste, würde jeder Zugriff auf den Server von außen leicht zu verfolgen sein. Es kam also nicht infrage, von seinem eigenen Computer aus zu operieren, auch nicht von einem der Internetcafés in der Stadt, die aus Gründen der nationalen Sicherheit inzwischen alle mit Überwachungskameras ausgestattet waren.
Jo, dessen Scharfsinn Milly immer wieder imponierte, hatte den Verdacht, der Hacker könnte die gleichen Überlegungen angestellt haben wie er. Bei solchen Cyberangriffen war der beste Weg, sich nicht schnappen zu lassen, sich direkt auf das Tier zu konzentrieren, dessen Blut man abzapfen wollte, etwa nach Art der Zecken, die bekanntlich auch einen Hund einer Computerfestplatte vorziehen.
Bei Nacht über den Gang im Erdgeschoss zu laufen, machte ihnen große Angst. Sie mussten leise sein und sich zwischen 21 Uhr und 21 Uhr 30 ans Werk machen, denn in dieser halben Stunde war die Putzkolonne in den oberen Stockwerken.
Eine Taschenlampe zwischen die Zähne geklemmt, hatte Jo die Tür des Server-Racks geöffnet, sich eingeloggt und begonnen, auf der Tastatur zu klackern. Er hatte sich den Speicher des Servers angesehen, Tag und Stunde des Einbruchs festgestellt und den unwiderlegbaren Beweis gefunden, dass jemand hier eingedrungen war. Der Hacker musste gestört worden sein und sich seither in großer Sorge befinden, denn er hatte seinen Bluetooth-Stick zum Senden zurückgelassen. Die Prüfungsaufgaben waren mit Bluetooth-Sender vom Server auf einen USB-Stick übertragen worden. Jo hatte sich über die Inkompetenz der Fakultätsinformatiker lustig gemacht, die dies nicht vor ihm entdeckt hatten.
»Sie waren mindestens zu zweit. Einer hier und der andere draußen, wahrscheinlich direkt unter dem Fenster, denn dieses Ding hat keine große Reichweite«, hatte er geflüstert, während er das Corpus Delicti herausnahm.
Milly hatte daraus geschlossen, dass der Hacker zwangsläufig Fingerabdrücke hinterlassen haben musste; Jo müsste nur auf den Server der Polizei zugreifen, um seine Identität herauszufinden. Er hatte sie nicht ohne Verwunderung angeschaut und dabei angelächelt, gerührt, weil sie ihm eine solche Heldentat zutraute. Mit einem einfacheren Plan im Kopf hatte er den Stick in seine Tasche geschoben, auf die Uhr geblickt und seiner Freundin bedeutet, dass es Zeit war, zu verschwinden.
Auf dem Rückweg mussten sie sich plötzlich in das Zimmer retten, in dem Milly arbeitete, und sich unter dem Schreibtisch von Mrs. Berlington verstecken. Eine Reinigungskraft der Putzfirma hatte ihre Routinerunde geändert und bearbeitete das Linoleum im Flur mit einer Poliermaschine, sodass sie die Örtlichkeit nicht verlassen konnten. Zusammengekauert hielten die beiden Freunde den Atem an. Doch das war nicht mehr möglich, als Milly hinter ihrem Rücken einen Gegenstand hervorzog, der in ihr Kreuz gedrückt hatte, und dabei entdeckte, dass es sich um einen Filzpantoffel handelte. Das Bild von Mrs. Berlington mit ihrer schulmeisterlichen ernsten Miene und Filzpantoffeln an den Füßen löste bei Milly einen Lachanfall aus, den Jo nur mit größter Mühe mit der Hand ersticken konnte. Es war das einzige Mal, dass die Stimmung zwischen ihnen getrübt wurde. Das war in der Vergangenheit nicht passiert und sollte sich auch nie wieder ereignen. Aber Jo spürte, wie die Zunge seiner besten Freundin entlang der Lebenslinie seiner Handfläche glitt. So tauschten sie im Halbdunkel unter Mrs. Berlingtons Schreibtisch einen überraschten Blick, bis Milly plötzlich sagte, sie höre kein Geräusch mehr im Flur und sie könnten sich nun davonmachen.
Als sie wieder bei Milly waren, hatte Jo besagten Stick in seinen Computer geschoben und ihn mit Algorithmen traktiert, bis ihm schließlich das Passwort seines Eigentümers preisgegeben wurde. Daraufhin hatte er Milly voller Stolz verkündet, er werde die Identität der Schuldigen bald aufdecken.
Als Joe am nächsten Tag mit dem Corpus Delicti hinter seiner Theke stand, löste er jedes Mal, wenn ein Student das Café des Kambar Campus Center betrat, von seinem Handy eine Verbindungsanfrage aus. Da die meisten mindestens einmal am Tag kamen, dauerte es nicht lange, bis er zu der Erkenntnis kam, dass Frank Rockley einer der Hacker war. Jo unterdrückte ein Lächeln und genoss seine Entdeckung. Frank Rockley war Kapitän der Baseballmannschaft der Universität, und Jo war neugierig, was der Rektor wohl tun würde, wenn er den Namen des Schuldigen erfuhr – und das drei Monate vor der Meisterschaft der Universitätsmannschaften, die so wichtig für das Ansehen und die finanzielle Situation der Einrichtung war.
Er hatte sich gewundert, dass diese Enthüllung bei Milly keinerlei Freude hervorrief. Er hatte eher mit einem Lachanfall gerechnet, aber sie sah traurig aus, als sie ihm zuhörte, und er konnte es sich nicht verkneifen, sie nach dem Grund zu fragen.
Da vertraute Milly ihm ein Geheimnis an, das ihr zu schaffen machte. Obwohl sie diesen auf Sport fixierten Typen, die sie, womöglich zu Unrecht, als Ignoranten betrachtete, nur Geringschätzung entgegenbrachte, hatte sie für Frank Rockley Gefühle entwickelt.
»Es sind seine Augen«, gestand sie auf einer Bank, auf der sie Platz genommen hatten. »Da ist etwas in seinem Blick, der Abglanz einer traurigen Kindheit. Ich habe gehört«, fügte sie hinzu, »dass sein Vater ihn drängte, Karriere zu machen, während er sich lieber einer Nichtregierungsorganisation angeschlossen und sich aufgemacht hätte, die Welt zu entdecken.«
»Und woher weißt du das?«, fragte Jo sie und beglückwünschte sich, kein Wort über die Erregung verloren zu haben, die er am Vorabend unter Mrs. Berlingtons Schreibtisch empfunden hatte.
»Als ich eines Abends in mein Auto stieg, ist er gekommen und hat mir gesagt, dass er es elegant findet. Es war dieses Wort aus seinem Mund, das mich hellhörig gemacht hat. ›Elegant‹ ist ein hübsches Wort, nicht wahr? Wir haben uns unterhalten, ich glaube, er war an diesem Abend bedrückt. In der folgenden Woche bin ich ihm im Sekretariat begegnet, wir haben uns angelächelt. Wir haben einen Kaffee getrunken …«
»Aber nicht bei mir«, unterbrach Jo.
»Nein«, antwortete Milly, »es war vormittags, wir sind ins Tuttleman gegangen, kurz und gut, er hat mir seine Geschichte erzählt, und ich habe gemerkt …«
»Dass er dir gefällt?«
»So in etwa, ja.«
»Hast du mit ihm darüber gesprochen?«
Milly versetzte Jo einen kleinen Stoß. »Das war nur vorübergehend, kein Grund, Aufhebens darum zu machen.«
Jo fragte sie, ob sie vorhabe, Frank zu verraten, und Milly erinnerte ihn daran, dass weder er noch sie Polizist waren. Außerdem würden sie große Schwierigkeiten haben, dem Direktor zu erklären, wie sie seinen Hacker aufgestöbert hätten.
»Möchtest du wissen, wer sein Komplize war?«
»Kennst du ihn?«
»Ich kenne sie«, stellte Jo klar.
»Ach!«, flüsterte Milly und stand auf.
»Wenn es dich so wenig interessiert, warum haben wir dann überhaupt den ganzen Aufwand getrieben?«
Als Antwort dankte sie Jo mit einem Kuss auf die Wange, versicherte ihm, sie habe einen super Abend verbracht, ihre nächtliche Eskapade bliebe eine ihrer schönsten Erinnerungen. Dann verabredete sie sich, als wäre nichts geschehen, für einen Kinobesuch am nächsten Abend, was im Grunde völlig unnötig war, da sie ohnehin jeden Samstag gemeinsam ins Multiplex am West Ridget Pike gingen.
Als er Milly nachschaute, dachte Jo wieder an den Tag, an dem er sie in der Kirche zum ersten Mal gesehen hatte.
Die Freundschaft, die Jo und Milly seit zehn Jahren verband, lebte von vertraulichen Mitteilungen, Kinobesuchen am Samstagnachmittag, langen Gesprächen auf dem Mäuerchen am Wasserreservoir, aber auch von einvernehmlichem Schweigen. Im Winter, wenn die ersten Flocken fielen, stiegen sie auf das Dach von Millys Haus, um zuzusehen, wie der Schnee die Fichten und Silbertannen weiß werden ließ. Sie rauchten ein paar Zigaretten und plauderten, bis die Kälte sie zwang, wieder ins Haus zu gehen.
Milly verriet Frank Rockley nicht, ebenso wenig wie seine Komplizin, auch wenn sie dies überlegt hatte, als sie deren Romanze entdeckte: Sie hatte die beiden im Kino gesehen, als sie sich so leidenschaftlich küssten, dass man hätte glauben können, sie leckten sich das Gesicht ab. Milly hatte daraus geschlossen, dass Stephanie Hopkins in einem früheren Leben ein Frosch gewesen sein musste, um den Mund so weit aufreißen zu können. Da Milly von optimistischem Naturell war, hatte sie es tröstlich gefunden, dass Frank verlegen schien, dabei überrascht zu werden. Ein Mann zeigt sich unter solchen Umständen nur verlegen, wenn er sich seiner Gefühle nicht sicher ist. Wenn Frank erst einmal das Gesamtpaket von Busen und Po seines Froschs genossen hatte, würde ihre Geschichte nur noch eine Erinnerung sein.
Frank brauchte dafür zwei Monate. Immerhin hatte Hopkins Körbchengröße 90 C.
Eines Morgens sah Milly ihn, wie er im Tuttleman an einem Tisch saß, vertieft in die Lektüre eines Jura-Lehrbuchs. Sie näherte sich mit schelmischer Miene, legte den Stick auf den Tisch, den Jo ihr anvertraut hatte, und entfernte sich, ohne sich noch einmal umzusehen. Dabei rechnete sie im Geist, wie lange Frank brauchen würde, um hinter ihr herzulaufen und sie einzuholen. Doch er tat nichts dergleichen, es war wirklich kein Zufall, dass er Mannschaftskapitän war, und dies hatte die Gefühle, die Milly für ihn hegte, nur noch verstärkt. Sie rächte sich, als sie sich erneut begegneten und er sie zum Abendessen einladen wollte.
Sie antwortete ihm, sie werde darüber nachdenken.
Dieser Zirkus hätte noch länger so weitergehen können, aber Jo mischte sich ein und las ihr die Leviten. Hätte er das Glück, dass Betty Cornell sich für ihn interessierte, ginge er nicht das Risiko ein, sich kindischen Spielchen hinzugeben. Milly gab ihm recht und verbrachte am folgenden Samstag den Abend und die Nacht mit Frank.
Die Jahreszeiten fliegen nur so dahin, selbst im Stadtrandgebiet von Philadelphia. Frank ist nicht mehr Mannschaftskapitän; nach Abschluss seines Studiums trat er in die Anwaltskanzlei seines Vaters ein, deren Büros sich in der Stadtmitte befinden. Milly und er sind noch immer ein Paar. Noch sind sie nicht so weit, zusammenzuziehen, aber es ist ein Thema, mit dem sie sich befassen, ebenso wie mit dem Gedanken, eines Tages zu heiraten. Frank arbeitet viel und spielt zum Ausgleich jeden Samstag Baseball. Milly nützt die Gelegenheit, um mit Jo ins Kino zu gehen. Nach der Vorstellung bummeln sie durch das Einkaufszentrum und unterhalten sich lange. Wenn sie sich etwas zum Anziehen kauft, schenkt sie ihm gelegentlich ein T-Shirt oder ein Hemd und lädt ihn zum Essen ein.
Wenn dann der Winter kommt, steigen sie auf das Dach von Millys Haus und beobachten Seite an Seite, wie der Schnee fällt.
Meistens ist Milly mit ihrem Leben glücklich und zufrieden. Auch wenn es einen Touch von Routine hat mit der Arbeit auf dem Campus, wo Mrs. Berlington ihr inzwischen die freie Formulierung der Berichte anvertraut, die sie ihr früher diktiert hat, den fünf Nächten pro Woche, in denen Frank bei ihr übernachtet, und den Samstagen mit Jo, sagt es ihr doch voll und ganz zu.
An manchen Abenden findet Frank Milly mit abwesendem Blick vor, dann erzählt er ihr von seinen Träumen, von seiner Lust, sich von seinem Vater zu befreien, sich in einer Nichtregierungsorganisation zu engagieren und mit ihr zusammen auf Reisen zu gehen. An solchen Abenden denkt Milly wieder an ihr Schicksal, an das sie immer geglaubt hat, wobei sie sich gelegentlich fragt, ob es tatsächlich irgendwann an ihre Tür klopfen wird.
Am ersten Frühlingstag, als sich Milly um 16 Uhr 06 in ihr Oldsmobile setzt, das auf dem Parkplatz steht, kann sie nicht ahnen, dass ihr Schicksal bald an ihre Tür klopfen wird.
Kapitel 2
Diese Nacht sollte die letzte sein, die sie hier verbringen würde, das hatte sie sich geschworen. Und während sie ihren Plan gedanklich noch einmal durchging, fragte sie sich, wie das Leben wohl draußen sein mochte. So vieles war ihr entgangen. Fernsehen und Presse boten zwar eine Art Verbindung zur modernen Welt, doch seit Langem interessierte sie das nicht mehr sonderlich, und so flüchtete sie sich lieber in die Lektüre der Bücher aus der Bibliothek. Sie wusste nichts oder so gut wie nichts von der Welt, in die sie zurückkehren wollte.
Sie schloss ihr Tagebuch und versuchte, sich zu erinnern, wann sie die ersten Zeilen geschrieben hatte. Es war an einem Morgen nach Heiligabend gewesen, vor neun oder zehn Jahren vielleicht, wie sollte sie das noch wissen? Durch diesen öden Alltag, diese stupide Routine beginnt sich am Ende alles zu verwischen. Ihr Leben hatte sich nach ihrer Verlegung verbessert, und dieses Weihnachtsessen war fast ein wenig wie ein Fest. Es wurde ein leicht mit Rum durchtränkter Kuchen gereicht, ein Gebäck, das einen komischen Namen hatte – ähnlich wie Bobo oder Baba –, aber sie hatte ihn vergessen. Sie hätte die Seiten datieren sollen, ihr Gedächtnis ließ nach, obwohl sie es jeden Abend vor dem Einschlafen zu trainieren versuchte.
Durch das vergitterte Fenster sah sie den orangefarbenen Lichtschein der Laternen, die den Hof erleuchteten, und stellte sich vor, eine jener Romanfiguren zu sein, die aus der Vergangenheit auftauchen, um in einer Gegenwart aufzuwachen, die ihnen unbegreiflich ist. Die Vorstellung amüsierte sie, und sie lachte still in sich hinein.
Sie schob das Heft unter ihre Matratze, wusch sich und legte sich mit einem Roman ins Bett, mit dessen Lektüre sie erst am Vortag begonnen hatte. Sie wartete auf den allgemeinen Befehl Licht aus. Sie, die in ihrer frühen Jugend so stolz auf ihren umfangreichen Wortschatz gewesen war, wurde jetzt mit so vielen Begriffen konfrontiert, deren Sinn sich ihr nicht erschloss. Was konnte »twittern« anderes bedeuten als das Zwitschern eines Spatzen? Und warum sollte die Heldin eines Romans, als sie das Restaurant verließ, das Vogelzwitschern nachahmen, um von einem Dinner mit einem Politiker zu erzählen, der sich wie ein Rüpel benommen hatte. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Und dann noch ein Foto von dem Typen in Facebook zu veröffentlichen – wahrscheinlich ein neues Magazin –, kaum dass sie zu Hause war, hatte ebenfalls weder Hand noch Fuß.
Als der Schlafsaal im Dunkeln lag, hielt sie die Augen geöffnet, zählte die Sekunden – verzählte sich nie – und hörte bei Zehntausendachthundert auf. Das Licht wurde um 21 Uhr gelöscht, es war jetzt also Mitternacht, die Stunde des Schichtwechsels. Sie zog den Sack mit schmutziger Wäsche, in dem sie ihre Sachen versteckt hatte, unter dem Bett hervor, zögerte, ob sie den Roman mitnehmen sollte, und erhob sich geräuschlos. Auf Zehenspitzen lief sie bis zur Tür, drehte den Griff gerade so weit, dass sie sich öffnen ließ, und trat vorsichtig auf den Gang. Jetzt nur noch fünfzig Meter bis zu der Nische mit dem Springbrunnen.
Sie drückte sich hinein, hielt den Atem an, bis die Aufseherin ihre Runde beendet hatte, und setzte dann ihren Weg fort.
Die diensthabende Krankenschwester ging zu Bett, als das Licht gelöscht wurde. Eines Nachts hatte sie nicht mehr zurück in ihr Zimmer können, nachdem sie eine Gefangene versorgt hatte, die sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte, und so schloss sie die Tür nicht mehr ab. Den Schlüssel hatte Agatha damals entwendet, sie war in solchen Dingen besonders geschickt. Wenn eine Patientin vor Schmerzen so laut schreit, dass einem fast das Trommelfell platzt, gibt eine gewissenhafte Krankenschwester nicht mehr auf ihren Schlüsselbund acht. Agatha vermochte alle möglichen Krankheiten zu simulieren, um etwas mehr Zeit auf der Station zu verbringen, sie konnte auch vortäuschen, dass sie die Tabletten schluckte, die man ihr gab.
Sie betrat den Raum, schloss die Tür hinter sich und legte sich auf den Fußboden. Das Licht des Lämpchens, das den verglasten Medikamentenschrank erleuchtete, reichte weit. Sie robbte bis zum Gitter vor dem Lüftungsschacht, das nicht mehr richtig befestigt war, seitdem Agatha im Lauf ihrer sechs Besuche die Schrauben eine nach der anderen entfernt hatte. Die Schwester ließ sie immer noch ein Weilchen allein auf der Pritsche liegen, nachdem sie ihr ein Beruhigungsmittel verabreicht hatte.
Sie ließ sich in den Lüftungskanal gleiten, der auf der anderen Seite der Mauer in den Technikraum führte, in dem die Hausmeister ihre Geräte aufbewahrten. Wie oft hatte sie sich mit der Krankenschwester den Spaß erlaubt, ihre Gespräche zu belauschen. Sie selbst hatte ihr erklärt, woher die Stimmen kamen.
Im Technikraum angekommen zog sie den Pyjama aus und schlüpfte in ihre Kleider, kletterte in den Container, in den Papier, Kartons, Plastikflaschen und anderer trockener Müll geworfen wurde, und bedeckte sich damit. Dann zählte sie die Sekunden weiter bis halb eins.
Als sich die Tür des Raums öffnete, begann ihr Herz wie wild zu schlagen. Die Räder des Containers, in dem sie sich versteckte, quietschten auf dem Linoleum des Gangs. Der Reinigungsmann, der ihn schob, blieb kurz stehen, um sich die Nase zu putzen, und setzte seinen Weg fort. Agatha hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss der Tür drehte, die auf den Hof führte. Der Mann schnäuzte sich erneut, hob den Deckel, um das Papiertaschentuch wegzuwerfen, und schob den Container bis zur Laderampe. Danach Stille.
Eintausendachthundert Sekunden später vernahm sie das Motorgeräusch eines Lkw, das Schrillen des Rückfahralarms und den Lärm der Spindelgriffe, die Richtung Tonne aufgefahren werden, um den Müllcontainer hochzuheben.
Agatha hatte sich diesen sicher gefährlichsten Augenblick wohl schon hundert Mal vorgestellt. Sie rollte sich zusammen, hob die Arme über den Kopf und entspannte die Muskeln. Sie hatte schon schwierigere Akrobatikakte absolviert, doch hatte ihr Körper weniger Spannkraft, ihre Gelenke waren nicht mehr so beweglich. Die Scharniere des Deckels begannen zu klappern, sie fühlte, wie sie rutschte, und bemühte sich, nicht dagegen anzukämpfen und ihre Kräfte lieber für das Folgende aufzubewahren. Die Neigung wurde zunehmend stärker, und plötzlich wurde sie in einem Wust von Papier, Kartons und Flaschen in das gähnende Maul des Müllwagens geschleudert.
Die Kiefer des Kompressors gingen nieder, um den Abfall in den Bauch des Müllbehälters zu schieben. Agatha streckte die Arme aus, stützte sich mit den Beinen ab und hielt sich am Rand des Fülltrichters fest, während der Container selbst auf die Straße zurückgesetzt wurde. Die Bestie schien gesättigt, die Kinnbacken wichen zurück und boten Agatha die Gelegenheit, sich unter den Kartons zu verkriechen, die das Gemetzel überstanden hatten.
Der Lkw setzte sich endlich in Bewegung, die Gangschaltung knirschte, er verlangsamte das Tempo, während das Hofgitter in seinen Schienen zur Seite rollte, und fuhr dann hinaus auf die Straße.
Ein Fahrzeug folgte ihnen nicht, es fiel kein Scheinwerferlicht in ihr Versteck. Agatha hob den Kopf und sah den Asphalt hinter sich vorüberziehen. Auf beiden Seiten der Straße ragten große silbern glänzende Nadelbäume in den Himmel. Die Luft war warm, und sie wusste, dass sie diese mit dem Duft der Freiheit gewürzte Nacht niemals vergessen würde.
Der Lkw durchquerte den Wald, ein Dorf, dann ein weiteres und erreichte schließlich die Vorstadt. Sie zögerte herauszuklettern, als er bei der ersten roten Ampel an der Stadtgrenze anhielt. Die Kreuzung war leer, aber für ihren Geschmack zu hell erleuchtet. Der dritte Stopp sagte ihr zu, es war düster und weit und breit kein Mensch zu sehen. Sie sprang aus dem Abfallcontainer, blieb aber dahinter sofort stehen, damit der Fahrer sie nicht im Rückspiegel ausmachen konnte. Als der Lkw wieder anfuhr, begann sie ruhig zu gehen wie jemand, der gerade die Straße überquert. Falls der Fahrer sie gesehen hatte, fiel ihm sicher nur ein Fußgänger in der Nacht auf.
Als sie den Bürgersteig erreichte, lief sie mit gesenktem Kopf weiter. Der Lkw verschwand, und sie musste sich zusammenreißen, um nicht einen lauten Freudenschrei auszustoßen. Es war aber noch zu früh, in Jubel auszubrechen. Sie marschierte gute zwei Stunden, ohne ein einziges Mal stehen zu bleiben. Ihre Beine schmerzten, ihre Ohren dröhnten, die Lunge brannte, Kopf und Schultern fühlten sich sehr schwer an. Je länger sie voranschritt, desto mehr griff der Schmerz nach ihrem ganzen Körper, und sie befürchtete fast, es nicht zu schaffen.
Völlig außer Atem hob sie den Kopf. Sie, die längst nicht mehr an Gott glaubte, begann, ihn anzuflehen. Dreißig Jahre Buße hatten ihm nicht genügt. Was wollte er noch? Was hatte sie getan, was so schrecklich war, dass sie diese Strafe verdient hätte?
»Du konntest mir alles nehmen, und du hast es getan, meine Würde aber nicht, darauf werde ich nie verzichten!«, schwor sie mit erhobener Faust.
Eine Reklametafel hoch oben an einer Stange verwies auf ein Einkaufszentrum einige Straßen weiter. Bis dorthin wollte sie es schaffen, und sei es mit letzter Kraft.
Als sie den riesigen verlassenen Parkplatz überquerte, erfasste sie ein Schwindelanfall, und sie musste sich an der Kühlerhaube eines Autos abstützen, um nicht zu straucheln.
Endlich entdeckte sie eine Telefonzelle. Seit sie auf den Beinen war, hatte sie sich ständig gefragt, ob es auf der ganzen Welt keine Kabinen mehr gab. Sie suchte in den Tiefen ihrer Tasche, fand Geld, das sie der Krankenschwester entwendet hatte – einige Dollars und ein Dutzend Münzen, die in Papier eingewickelt waren, damit sie nicht klimperten –, schob zwei davon in den Schlitz des Apparats und wählte eine Nummer.
»Ich bin’s«, hauchte sie. »Du musst mich abholen.«
»Hast du’s geschafft?«
»Glaubst du, ich würde dich sonst um diese Tageszeit anrufen?«
»Wo bist du?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung, in einem Einkaufszentrum, dem Newton Square Shopping Center. Ich stehe vor einem chinesischen Restaurant auf dem Alpha Drive. Ich flehe dich an, beeile dich.«
Der Mann, mit dem sie sprach, tippte die Adresse in seinen Rechner ein.
»Ich bin in zehn, höchstens fünfzehn Minuten dort, ein Chevy Volt, bleib da und warte auf mich.«
Er legte auf, und Agatha hängte seufzend den Hörer ein. Was zum Teufel ist ein Chevy Volt?, fragte sie sich.
Sie hatte kein Wort gesprochen, seit sie ins Auto gestiegen war. Sie hatte nur das Fenster geöffnet und auf die Landschaft hinausgeblickt.
»Es wäre besser, du machst das nicht. Es gibt überall Videokameras, die dich erkennen könnten«, sagte der Fahrer besorgt.
»Welche Kameras? Sind wir in Amerika oder in Orwells Welt?«
»Beides, mein Liebling«, erwiderte er.
»Nenn mich nicht so, das mag ich nicht.«
»Möchtest du jetzt, da du frei bist, lieber Hanna genannt werden?«
»Lass mich bloß in Ruhe, Max, ich bin frei und müde.«
»Dann lass das Fenster rauf, wenn du es bleiben möchtest.«
»Sie werden vor sechs Uhr morgens überhaupt nichts merken. Ich glaube auch nicht, dass sie gleich sämtliche Polizisten auf mich hetzen werden, ich bin für niemanden mehr besonders interessant.«
»Wenn das der Fall wäre, würde ich nicht mitten in der Nacht durch die ganze Stadt fahren«, meinte Max.
Agatha wandte sich ihm zu und schaute ihn an.
»Du bist alt geworden«, sagte sie.
»Seit meinem letzten Besuch?«
»Nein, seitdem wir uns das letzte Mal auf der Flucht in einem Auto befunden haben. Aber beim letzten Mal hörte man den Motor, und du bist deutlich schneller gefahren.«
»Damals gab es kein Radar, und das Auto fuhr mit Benzin, dieses hat einen Elektromotor.«
»Autos fahren heute elektrisch? Zum Kuckuck, es wird schwer, sich anzupassen. Wo bringst du mich eigentlich hin?«
»Nicht zu mir, zu gefährlich. Wegen der Besuche bei dir werden sie mich wahrscheinlich zuerst vernehmen.«
»Ich dachte, du bist unter falschem Namen gekommen?«
»Ja, aber es gab auch im Besuchszimmer Videoaufzeichnung. Da werden sie die Verbindung schnell hergestellt haben.«
Agatha seufzte.
»Die Zeiten haben sich geändert, Hanna, dafür kann ich nichts.«
»Doch, wir können alle etwas dafür, denn wir sind gescheitert. Mir wäre es lieber, du nennst mich Agatha. Hanna gibt es nicht mehr, nicht auf dieser Welt zumindest.«
»Wir sind alle älter geworden, wie du schon sagtest. Ich habe ein kleines Chalet in der Nähe des Valley Forge. Wir sind bald da.«