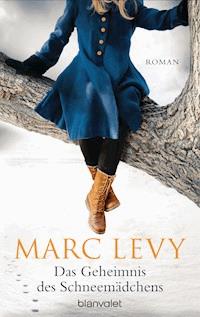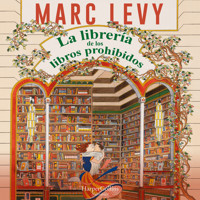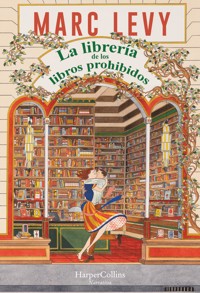2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Macht der Liebe und ein Funken Magie ...
Eigentlich steckt die Mittdreißigerin Julia mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit, als sie plötzlich einen Anruf erhält: Ihr Vater, zu dem sie schon lange keinen Kontakt mehr hat, ist unerwartet verstorben. Unter Julias Trauer mischt sich Ärger: Hatte Anthony nicht schon immer ein Talent dafür, im wichtigsten Moment zu verschwinden? Einen Tag vor seiner Beerdigung entdeckt sie, dass er post mortem eine Überraschung für sie in petto hat – eine Überraschung, die sie auf die ungewöhnlichste Reise ihres Lebens mitnimmt und sie nach Berlin führt, wo sie einst ihre große Liebe zurücklassen musste ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Eigentlich steckt die Mittdreißigerin Julia mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit, als sie plötzlich einen Anruf erhält: Ihr Vater, zu dem sie schon lange keinen Kontakt mehr hat, ist unerwartet verstorben. Unter Julias Trauer mischt sich Ärger: Hatte Anthony nicht schon immer ein Talent dafür, in den wichtigsten Momenten ihres Lebens zu verschwinden? Einen Tag vor seiner Beerdigung entdeckt sie, dass er post mortem eine Überraschung für sie in petto hat – eine Überraschung, die sie auf die ungewöhnlichste Reise ihres Lebens mitnimmt und sie nach Berlin führt, wo sie einst ihre große Liebe zurücklassen musste …
Autor
Marc Levy wurde 1961 in Frankreich geboren. Nach seinem Studium in Paris lebte er in San Francisco. Mit siebenunddreißig Jahren schrieb er für seinen Sohn seinen ersten Roman, Solange du da bist, der von Steven Spielberg verfilmt und auf Anhieb ein Welterfolg wurde. Seitdem wird Marc Levy in zweiundvierzig Sprachen übersetzt, und jeder Roman ist ein internationaler Bestseller. Marc Levy lebt zurzeit mit seiner Familie in New York.
Von Marc Levy bei Blanvalet bereits erschienen
Solange du da bist
Am ersten Tag
Die erste Nacht
Sieben Tage für die Ewigkeit
Wo bist du?
Wer Schatten küsst
Bis ich dich wiedersehe
Die zwei Leben der Alice Pendelbury
Zurück zu dir
Mit jedem neuen Tag
Das Geheimnis des Schneemädchens
Er & Sie
Eine andere Vorstellung vom Glück
Kinder der Hoffnung
Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Bettina Runge
Die französische Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites« bei Editions Robert Laffont, S. A., ParisDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Taschenbuchneuausgabe September 2019 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright der Originalausgabe © 2008 by Editions Robert Laffont, S. A. Paris | Susanna Lea Associates, Paris.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage
Umschlagmotiv: © Émilie CapmanSociety/Archive
KW · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-23038-8V001www.blanvalet.de
»Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben:entweder so, als wäre nichts ein Wunder,oder so, als wäre alles eines.Ich glaube an Letzteres.«
ALBERT EINSTEIN
Für Pauline,für Louis
1
»Also, wie findest du mich?«
»Dreh dich, damit ich dich ansehen kann.«
»Stanley, seit einer halben Stunde musterst du mich jetzt von Kopf bis Fuß! Ich halte es nicht länger auf diesem Podest aus.«
»Also, ich würde es etwas kürzer machen, es wäre eine Schande, so schöne Beine zu verstecken!«
»Stanley!«
»Willst du meine Meinung hören oder nicht? Dreh dich noch mal, damit ich dich von vorn begutachten kann. Wusste ich’s doch! Kein Unterschied zwischen Vorder- und Rückenteil. Wenn du vorn einen Fleck machst, kannst du es einfach andersrum anziehen … Vorn, hinten, ein und dasselbe!«
»Stanley!«
»Allein die Vorstellung, ein Brautkleid im Ausverkauf zu erwerben, macht mich ganz krank. Warum nicht gleich übers Internet? Du wolltest meine Meinung hören.«
»Mit meinem Infografikergehalt kann ich mir leider nichts Besseres leisten.«
»Zeichnerin, meine Prinzessin! Großer Gott, wie ich dieses Vokabular des einundzwanzigsten Jahrhunderts verabscheue!«
»Ich arbeite am Computer, Stanley, nicht mehr mit Buntstiften.«
»Meine beste Freundin entwirft und animiert wunderbare Figuren. Ob mit Computer oder nicht – sie ist Zeichnerin und nicht Infografikerin. Du musst wirklich alles infrage stellen!«
»Also was nun, kürzer machen oder nicht?«
»Fünf Zentimeter! Dann müssen die Schultern gehoben und die Taille etwas enger genäht werden.«
»Gut, ich habe verstanden, du magst dieses Kleid nicht.«
»Das habe ich nicht gesagt!«
»Aber gedacht.«
»Vorschlag: Ich beteilige mich an den Kosten, und wir schauen bei Anna Maier vorbei. Hör ein Mal auf mich, ich flehe dich an!«
»Zehntausend Dollar für ein Kleid? Du bist völlig übergeschnappt! Das ist auch für dich viel zu teuer. Und außerdem ist es nur eine Hochzeit, Stanley.«
»Deine Hochzeit!«
»Ich weiß.« Julia seufzte.
»Mit dem Vermögen, das dein Vater besitzt, hätte er …«
»Ich habe meinen Vater zum letzten Mal gesehen, als ich an einer roten Ampel stand und er in seinem Wagen die Fifth Avenue entlanggefahren kam … vor einem halben Jahr. Ende der Diskussion!«
Schulterzuckend stieg Julia von dem Podest herab. Stanley ergriff ihre Hand und nahm sie dann in die Arme.
»Alle Kleider dieser Welt würden dir wunderbar stehen, Darling. Ich möchte nur, dass dein Outfit perfekt ist. Warum bittest du nicht deinen Zukünftigen, es dir zu schenken?«
»Weil Adams Eltern schon das Fest ausrichten und ich vermeiden möchte, dass es in seiner Familie heißt, er würde ein Aschenputtel heiraten.«
Mit leichtem Schritt durchquerte Stanley die Boutique und steuerte auf einen Ständer vor dem Schaufenster zu. An die Theke neben der Kasse gelehnt, waren Verkäufer und Verkäuferinnen in ein Gespräch vertieft und schenkten ihm keinerlei Beachtung. Er griff nach einem weißen Etuikleid und kam damit zurück.
»Probier dieses an – und keine Widerrede.«
»Das ist Größe sechsunddreißig, Stanley, da passe ich niemals rein!«
»Was hab ich gerade gesagt?«
Sie verdrehte die Augen und ging zu der Umkleidekabine, auf die Stanley deutete.
»Es ist Größe sechsunddreißig«, knurrte sie.
Wenige Minuten später riss sie den Vorhang so energisch auf, wie sie ihn zugezogen hatte.
»Endlich ein Hochzeitskleid, das Julia würdig ist«, rief Stanley. »Sofort wieder auf das Podest mit dir!«
»Hättest du vielleicht eine Seilwinde, um mich hinaufzubefördern? Denn sobald ich das Bein anwinkele …«
»Es steht dir großartig!«
»Und wenn ich nur ein Petit Four esse, platzen die Nähte.«
»Am Tag seiner Hochzeit isst man nicht! Ein paar Millimeter mehr Spielraum im Brustbereich, und du siehst aus wie eine Königin! Glaubst du, in diesem Laden würde sich mal eine Verkäuferin blicken lassen? Das ist doch einfach unglaublich!«
»Ich bin diejenige, die nervös sein müsste, und nicht du!«
»Ich bin nicht nervös, sondern fassungslos, dass ich derjenige bin, der dich vier Tage vor dem großen Tag hierher schleppt, um dir dein Kleid auszusuchen!«
»Ich habe eben in letzter Zeit von früh bis spät nur gearbeitet. Versprich mir, Adam niemals von diesem Tag zu erzählen. Seit einem Monat schwöre ich ihm, dass alles längst fertig ist.«
Stanley griff nach einem Nadelkissen, das auf einer Sessellehne vergessen worden war, und kniete vor Julia nieder. »Dein Mann weiß gar nicht, was für ein Glück er hat. Du bist bezaubernd.«
»Hör auf, gegen Adam zu sticheln. Was wirfst du ihm eigentlich vor?«
»Er ähnelt deinem Vater …«
»So ein Blödsinn. Adam ist ganz anders. Übrigens kann er ihn nicht ausstehen.«
»Adam kann deinen Vater nicht ausstehen? Ein Pluspunkt für ihn.«
»Nein, mein Vater kann Adam nicht ausstehen.«
»Dein Vater hat immer schon alles gehasst, was sich dir nähert. Wenn du einen Hund gehabt hättest, hätte er ihn gebissen.«
»Stimmt, hätte ich einen Hund gehabt, so hätte der meinen Vater mit Sicherheit gebissen«, meinte Julia und lachte.
»Nein, dein Vater hätte den Hund gebissen!«
Stanley erhob sich und trat ein paar Schritte zurück, um sein Werk zu begutachten. Er nickte und holte tief Luft.
»Was ist jetzt noch?«, fragte Julia.
»Es ist perfekt, oder besser gesagt, du bist perfekt. Lass mich schnell noch den Gürtel anpassen, dann kannst du mich zum Mittagessen einladen.«
»In ein Restaurant deiner Wahl, Stanley!«
»Bei dieser Sonne ist mir die nächstbeste Terrasse recht, vorausgesetzt, sie liegt im Schatten und du hörst auf herumzuzappeln, damit ich endlich mit diesem Kleid fertig werde … fast perfekt.«
»Wieso fast?«
»Weil es heruntergesetzt ist, Darling!«
Eine Verkäuferin kam vorbei und fragte, ob sie Hilfe brauchten. Stanley schickte sie mit einer Handbewegung fort.
»Glaubst du, er kommt?«
»Wer?«, fragte Julia.
»Na, dein Vater natürlich.«
»Hör auf, dauernd von ihm zu reden. Ich habe dir gesagt, dass ich seit Monaten nichts von ihm gehört habe.«
»Das heißt noch lange nicht …«
»Er kommt nicht!«
»Hast du dich denn bei ihm gemeldet?«
»Ich habe es mir schon lange abgewöhnt, dem Privatsekretär meines Vaters mein Leben zu erzählen, weil Papa auf Reisen oder in einer Besprechung ist und keine Zeit für seine Tochter hat.«
»Hast du ihm denn eine Heiratsanzeige geschickt?«
»Hörst du jetzt endlich auf?«
»Gleich! Er ist eifersüchtig, alle Väter sind eifersüchtig! Das ist nun mal so.«
»Es ist das erste Mal, dass du ihn verteidigst.«
Die Melodie von »I Will Survive« war aus Julias Handtasche zu hören. Stanley sah sie fragend an.
»Willst du dein Handy?«
»Das ist sicher Adam oder das Studio.«
»Rühr dich nicht vom Fleck, sonst ruinierst du meine Arbeit. Ich hole es dir.«
Stanley griff in die Handtasche seiner Freundin, zog das Handy heraus und reichte es ihr. Gloria Gaynor verstummte sogleich.
»Zu spät!« Julia seufzte und las die Nummer auf dem Display.
»Also, Adam oder die Arbeit?«
»Weder noch«, erwiderte sie mürrisch.
Stanley sah sie eindringlich an.
»Spielen wir Rätselraten?«
»Es war das Büro meines Vaters.«
»Ruf zurück!«
»Ganz gewiss nicht! Er kann ja anrufen.«
»Das hat er doch gerade, oder?«
»Nein, es war die Nummer seines Sekretärs.«
»Sei nicht kindisch, du wartest auf diesen Anruf, seitdem du die Heiratsanzeige verschickt hast. Vier Tage vor deiner Hochzeit solltest du den Stress etwas runterschrauben. Oder willst du eine dicke Fieberblase auf der Lippe oder einen grässlichen Ausschlag am Hals bekommen? Also ruf ihn jetzt sofort zurück.«
»Damit Wallace mir erklärt, es tue meinem Vater schrecklich leid, aber er könne eine seit Monaten geplante Reise nun mal nicht absagen? Oder dass er genau an diesem Tag einen extrem wichtigen Termin habe oder was sonst für eine Ausrede?«
»Oder aber, dass er liebend gerne zur Hochzeitsfeier seiner Tochter kommt und darauf besteht, dass sie ihm trotz ihrer gelegentlichen Differenzen einen Ehrenplatz reserviert.«
»Mein Vater pfeift auf solche Ehren. Denn würde er tatsächlich kommen, würde er einen Platz in der Nähe der Garderobe vorziehen, vorausgesetzt, die Garderobiere ist gut gebaut!«
»Hör auf, ihn so schlechtzumachen, und ruf ihn an, Julia. Ach, mach doch, was du willst, aber ich kann dir jetzt schon garantieren, dass du während der Feierlichkeiten verzweifelt nach ihm Ausschau halten wirst, statt den Augenblick zu genießen.«
»Und das lässt mich vergessen, dass mir die Petits Fours verboten sind, damit das Kleid, das du für mich ausgewählt hast, nicht aus allen Nähten platzt.«
»Volltreffer, Darling!«, zischte Stanley, drehte sich um und steuerte auf die Ladentür zu. »Wir gehen ein anderes Mal essen, wenn du hoffentlich bessere Laune hast.«
Als Julia vom Podest stieg, um ihm nachzulaufen, wäre sie um Haaresbreite gestolpert. Sie packte ihn bei der Schulter, und diesmal war sie es, die ihn in die Arme nahm.
»Entschuldige, Stanley, ich wollte das nicht sagen, tut mir leid.«
»Was deinen Vater betrifft oder das Kleid, das ich so schlecht ausgewählt und angepasst habe? Ich mache dich darauf aufmerksam, dass die Nähte sowohl dem Sprung vom Podest als auch deinem Wettlauf hinter mir her standgehalten haben!«
»Das Kleid ist perfekt, du bist mein bester Freund. Ohne dich würde ich nicht einmal bis zum Altar kommen.«
Stanley sah Julia an, zog ein seidenes Taschentuch aus seiner Jackentasche und tupfte die feuchten Augen seiner Freundin ab.
»Willst du wirklich die Kirche am Arm einer Tunte durchqueren, oder ist es deine letzte Gemeinheit, mich als deinen Schuft von Vater auszugeben?«
»Bilde dir ja nichts ein. Du hast nicht genügend Falten, um in dieser Rolle glaubwürdig zu wirken.«
»Das sollte ein Kompliment für dich sein, Dummkopf, ich wollte dich etwas jünger machen.«
»Stanley, ich möchte nur an deinem Arm zum Altar geführt werden! An wessen Arm sonst?«
Lächelnd deutete er auf Julias Handy und sagte zärtlich: »Ruf deinen Vater an! Ich knöpfe mir inzwischen die ignorante Verkäuferin vor, die nicht zu wissen scheint, was ein Kunde ist, damit dein Kleid in zwei Tagen fertig ist und wir endlich essen gehen können. Los, mach schon, Julia, ich sterbe vor Hunger!«
Stanley wandte sich ab und ging zur Kasse. Diskret drehte er sich noch einmal um, sah, wie sie zögerte und schließlich eine Nummer wählte. Er nutzte die Gelegenheit, um sein Scheckheft zu zücken, bezahlte das Kleid und die Schneiderarbeiten und rundete die Summe etwas auf, um sicherzugehen, dass alles in achtundvierzig Stunden fertig wäre. Er steckte den Abholschein in die Tasche und kehrte zu Julia zurück, als sie das Gespräch beendete.
»Nun?«, fragte er ungeduldig. »Kommt er?«
Julia schüttelte den Kopf.
»Welche Ausrede hat er diesmal parat?«
Julia holte tief Luft und sah Stanley an.
»Er ist tot!«
Die beiden Freunde blickten sich eine Weile schweigend an.
»Diese Entschuldigung kannst du wirklich nicht infrage stellen«, flüsterte Stanley schließlich.
»Du bist ein richtiger Idiot, weißt du das?«
»Ich bin nur verwirrt, das wollte ich nicht sagen, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Es tut mir leid für dich, Darling.«
»Ich spüre gar nichts, Stanley, nicht den geringsten kleinen Stich in der Brust, keine einzige Träne.«
»Das kommt noch, keine Sorge, du hast es nur noch nicht begriffen.«
»Eben doch.«
»Willst du Adam anrufen?«
»Nein, jetzt nicht, später.«
Stanley musterte seine Freundin besorgt. »Du willst deinem zukünftigen Ehemann nicht sagen, dass dein Vater soeben gestorben ist?«
»Er ist gestern Abend gestorben, in Paris. Sein Leichnam wird per Flugzeug überführt, die Beerdigung findet in vier Tagen statt«, fügte sie mit kaum vernehmbarer Stimme hinzu.
Stanley begann, an den Fingern zu zählen.
»An diesem Samstag?«, fragte er mit weit aufgerissenen Augen.
»Am Nachmittag meiner Hochzeit«, murmelte Julia.
Stanley trat erneut an die Kasse, ließ sich seinen Scheck zurückgeben und zog Julia auf die Straße.
»Jetzt lade ich dich zum Mittagessen ein!«
New York war in das goldene Licht der Junisonne getaucht. Die beiden Freunde überquerten die Ninth Avenue und steuerten auf das Pastis, ein französisches Bistro, zu – eine echte Institution in diesem Viertel, das sich mitten im Umbruch befand. Im Lauf der letzten Jahre waren die alten Lagerhallen des Meat Packing District den Luxusateliers der bekanntesten Modeschöpfer der Stadt gewichen. Schicke Hotels und Boutiquen waren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Eisenbahnstrecke war in einen Grüngürtel verwandelt worden, der sich bis zur Tenth Street erstreckte. Hier beherbergte eine ehemalige Fabrik im Erdgeschoss einen Bio-Supermarkt, darüber hatten sich Produktionsfirmen und Werbeagenturen angesiedelt, und im fünften Stock befand sich das Studio mit Julias Büro. Die neu angelegten Ufer des Hudson River waren Anziehungspunkt für Radfahrer, Jogger und Verliebte, die sich über die Bänke im Manhattan-Stil freuten. Ab Donnerstagabend bevölkerten zusätzlich Besucher aus dem benachbarten New Jersey das Viertel, die den Fluss überquerten, um hier zu flanieren und sich in den zahlreichen Szenebars und Restaurants zu vergnügen.
Auf der Terrasse des Pastis bestellte Stanley zwei Cappuccinos.
»Ich hätte Adam längst anrufen müssen«, sagte Julia schuldbewusst.
»Wenn es darum geht, ihm zu sagen, dass dein Vater gestorben ist, ja, da hättest du ihn zweifellos sofort informieren müssen. Wenn es aber darum geht, den Priester, den Partyservice und die Gäste abzubestellen, weil eure Hochzeit verschoben werden muss, dann kann das auch noch ein wenig warten. Lass ihn noch ein Stündchen träumen, ehe du seinen Tag ruinierst. Außerdem bist du in Trauer, das gibt dir alle Rechte, also nutze sie!«
»Wie soll ich es ihm sagen?«
»Darling, er wird ja wohl verstehen, dass es ziemlich schwierig ist, am selben Nachmittag seinen Vater zu beerdigen und zu heiraten. Und solltest du tatsächlich mit diesem Gedanken liebäugeln, so wäre das äußerst geschmacklos. Aber wie konnte so etwas passieren, Herrgott noch mal!«
»Glaube mir, Stanley, Gott hat nichts mit dieser Geschichte zu tun. Es war einzig und allein mein Vater, der dieses Datum gewählt hat.«
»Ich glaube nicht, dass er gestern Abend in Paris gestorben ist, nur um dir deine Hochzeit zu verderben, auch wenn ich ihm eine gewisse Raffinesse, was den Ort betrifft, nicht absprechen kann!«
»Du kennst ihn nicht. Um mich zu nerven, ist er zu allem fähig!«
»Trink deinen Cappuccino und lass uns die Sonne genießen. Später rufen wir dann deinen Exbräutigam an!«
2
Die Reifen der Air France Cargo 747 knirschten auf der Landebahn des JFK Airport. Von der Fensterfront der Ankunftshalle aus konnte Julia beobachten, wie der Mahagonisarg auf dem Förderband aus dem Laderaum zu dem neben der Maschine geparkten Leichenwagen glitt. Ein Beamter der Flughafenpolizei holte sie ab. Eskortiert vom Privatsekretär ihres Vaters, von ihrem Verlobten und ihrem besten Freund, stieg sie in den Minivan, der sie zu der Maschine fuhr. Dort erwartete sie ein Beamter der amerikanischen Zollbehörde, um ihr einen Umschlag zu überreichen. Er enthielt verschiedene offizielle Dokumente, eine Uhr und einen Pass.
Julia blätterte ihn durch. Diverse Stempel zeugten von den letzten Monaten im Leben des Anthony Walsh. Sankt Petersburg, Berlin, Hongkong, Bombay, Saigon, Sydney und andere Städte, die sie gern mit ihm besucht hätte.
Während sich vier Männer um den Sarg kümmerten, dachte Julia an die langen Reisen, die ihr Vater unternommen hatte, als sie noch jenes kleine Mädchen war, das sich wegen jeder Lappalie auf dem Schulhof geprügelt hatte.
So viele Nächte, in denen sie auf seine Rückkehr gewartet hatte, all die Morgen, an denen sie auf dem Schulweg von Steinplatte zu Steinplatte gehüpft war und ein Himmel-und-Hölle-Spiel ersonnen hatte, das – wenn sie es perfekt beherrschte – die Rückkehr ihres Vaters garantieren würde. Und in diesen Nächten des Hoffens ging bisweilen der Wunsch in Erfüllung: Die Tür ihres Schlafzimmers öffnete sich, und in einem magischen Lichtstreifen zeichnete sich der Schatten von Anthony Walsh ab. Er setzte sich ans Fußende des Betts und legte einen kleinen Gegenstand auf die Decke, den sie am nächsten Morgen finden würde. Das waren die Lichtblicke in Julias Kindheit – ein Vater brachte seiner Tochter aus jedem Land einen einzigartigen Gegenstand mit, der ihr etwas von seiner Reise erzählte. Eine Puppe aus Mexiko, einen Pinsel aus China, eine Holzfigur aus Ungarn, ein Armband aus Guatemala – das waren wirkliche Schätze.
Und dann hatten bei ihrer Mutter die ersten Anzeichen von Verwirrung eingesetzt. Julia erinnerte sich an ihr Unbehagen, als ihre Mutter beim sonntäglichen Kinobesuch mitten im Film plötzlich fragte, warum das Licht ausgegangen sei. Ein Gedächtnis, in das sich unaufhörlich weitere Löcher fraßen, erst kleine, dann immer größere, bis sie schließlich Küche und Musikzimmer verwechselte und einen markerschütternden Schrei ausstieß, weil der Konzertflügel verschwunden war. Gedächtnislücken, die dazu führten, dass sie sich nicht mehr an die Vornamen ihrer Familienangehörigen erinnerte. Und schließlich der Abgrund an dem Tag, als sie Julia ansah und ausrief: »Was macht denn dieses hübsche Kind in meinem Haus?« Und die unendliche Leere an jenem Tag im Dezember, als die Ambulanz sie abholen kam, nachdem sie ihren Morgenmantel angezündet hatte und reglos dastand, noch immer verblüfft über die neu entdeckte Freiheit, nachdem sie, eine notorische Nichtraucherin, sich eine Zigarette angezündet hatte.
Eine Mutter, die wenige Jahre später in einer Klinik in New Jersey starb, ohne ihre Tochter wiedererkannt zu haben. Auf die Zeit der Trauer folgte eine Jugend mit allzu vielen Abenden, an denen sie mit dem Privatsekretär des Vaters ihre Hausaufgaben machte, während Letzterer immer häufiger immer längere Reisen antrat. Gymnasium, Universität, Prüfungen, Abbruch des Studiums, um endlich ihrer einzigen Leidenschaft zu frönen – Figuren erfinden, ihnen mit bunter Tinte Form geben und auf dem Computerbildschirm Leben einhauchen. Tiere, die menschliche Züge bekamen, treue Begleiter, bereit, ihr durch einen einzigen Bleistiftstrich ein Lächeln zu schenken.
»Ist das der Ausweis Ihres Vaters, Miss?«
Die Stimme des Zollbeamten holte Julia in die Realität zurück. Sie antwortete mit einem einfachen Nicken. Der Mann setzte seine Unterschrift auf ein Formular und drückte einen Stempel auf das Foto von Anthony Walsh. Der letzte Eintrag in einen Pass, in dem die Namen der Länder von nichts anderem zeugten als von Abwesenheit.
Der Sarg wurde in einen schwarzen Leichenwagen verladen. Stanley nahm neben dem Fahrer Platz, Adam öffnete Julia die Tür, besorgt um die junge Frau, die er an diesem Nachmittag hätte heiraten sollen. Der Privatsekretär von Anthony Walsh schließlich ließ sich hinten auf einem Klappsitz nieder, ganz nah bei dem Sarg.
Der Wagen setzte sich in Bewegung, verließ das Flughafengelände und nahm den Van Wyck Expressway in nördliche Richtung.
Niemand im Wagen sagte ein Wort. Wallace ließ die Kiste mit der sterblichen Hülle seines ehemaligen Chefs nicht aus den Augen. Stanley starrte auf seine Hände, Adam sah Julia an, und Julia betrachtete die Stadtviertel auf dem Weg nach Manhattan.
»Welchen Weg nehmen Sie?«, fragte Julia den Chauffeur, als sich die Abzweigung nach Long Island ankündigte.
»Über die Williamsburg Bridge, Ma’am«, antwortete dieser.
»Könnten wir nicht über die Brooklyn Bridge fahren?«
Der Fahrer setzte den Blinker und wechselte sogleich die Spur.
»Das ist aber ein Umweg«, flüsterte Adam. »Sein Weg war kürzer.«
»Der Tag ist sowieso im Eimer, da können wir ihm auch eine Freude machen.«
»Wem?«, fragte Adam.
»Meinem Vater. Bieten wir ihm eine letzte Fahrt über die Wall Street, durch TriBeCa, SoHo und warum nicht auch durch den Central Park?«
»Der Tag ist im Eimer, das kann man wohl sagen. Also, wenn du ihm eine Freude machen willst …«, erwiderte Adam. »Aber wir sollten dem Priester mitteilen, dass wir später kommen.«
»Mögen Sie Hunde, Adam?«, fragte Stanley.
»Ja, aber sie scheinen mich nicht besonders zu mögen. Warum?«
»War nur so eine Idee …«, erwiderte Stanley und kurbelte sein Fenster runter.
Der Wagen durchquerte Manhattan von Süden nach Norden und traf eine Stunde später in der 233rd Street ein.
Am Haupttor des Woodlawn Cemetery hob sich die Schranke. Der Wagen bog in eine schmale geteerte Straße, ließ einen Sternplatz hinter sich, fuhr an mehreren Mausoleen vorbei und gelangte schließlich in eine Allee, an der ein frisch ausgehobenes Grab auf seinen zukünftigen Bewohner wartete.
Der Vertreter der Kirche stand schon bereit. Der Sarg wurde auf zwei Böcke über der Grube gestellt. Adam ging dem Priester entgegen, um die letzten Einzelheiten der Zeremonie zu besprechen. Stanley hakte Julia unter.
»Woran denkst du?«, fragte er sie.
»Woran ich in dem Augenblick denke, in dem ich meinen Vater beerdige, mit dem ich seit Jahren nicht gesprochen habe? Du stellst wirklich verwirrende Fragen, Stanley.«
»Dieses eine Mal ist es mir ernst: Woran denkst du in diesem Moment? Es ist wichtig, dass du dich erinnerst. Denn der Augenblick wird immer Teil deines Lebens sein, glaube mir!«
»Ich habe an meine Mutter gedacht und mich gefragt, ob sie ihm da oben begegnen wird oder ob sie weiterhin in ihrem Vergessen inmitten der Wolken umherirrt.«
»Glaubst du jetzt plötzlich an Gott?«
»Nein, doch vor einer guten Nachricht ist man nie gefeit.«
»Ich muss dir etwas gestehen, Julia. Aber schwör mir, dich nicht über mich lustig zu machen. Denn stell dir bitte vor: Je älter ich werde, desto mehr glaube ich an Gott.«
Julia deutete ein trauriges Lächeln an.
»Nun, was meinen Vater betrifft, so bin ich nicht sicher, ob die Existenz Gottes eine gute Nachricht ist.«
»Der Priester ist bereit und fragt, ob wir vollzählig sind und er anfangen kann«, meldete sich Adam zu Wort.
»Wir sind nur vier Personen«, erwiderte Julia und machte dem Sekretär ihres Vaters ein Zeichen, näher zu treten. »Das ist das Los der großen Reisenden, der einsamen Freibeuter. Familie und Freunde sind lediglich Bekannte, verstreut über alle Teile der Welt … Und Bekannte legen nur selten weite Wege zurück, um an Beerdigungen teilzunehmen. Es ist ein Augenblick des Lebens, in dem man niemandem mehr einen Dienst oder einen Gefallen erweisen kann. Man wird einsam geboren und stirbt einsam.«
»Das hat Buddha gesagt, und dein Vater war ein echt katholischer Ire, mein Liebling«, erwiderte Adam.
»Ein Dobermann, Sie bräuchten einen riesigen Dobermann, Adam!« Stanley seufzte.
»Wieso wollen Sie mir unbedingt einen Hund anhängen?«, fragte Adam ungehalten.
»Schon gut, schon gut!«
Der Priester trat auf Julia zu, um ihr zu sagen, wie leid es ihm tue, diese Art von Zeremonie halten zu müssen, da er heute viel lieber ihre Hochzeit zelebriert hätte.
»Könnten Sie nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen?«, fragte Julia. »Weil wir uns eigentlich nichts aus vielen Gästen machen. Für Ihren Chef zählt doch die Absicht, oder?«
Stanley konnte sich nicht verkneifen, laut loszulachen, was den Priester natürlich empörte.
»Ich bitte Sie, Miss!«
»Mein Vorschlag ist gar nicht abwegig, denn so könnte mein Vater wenigstens an meiner Hochzeit teilnehmen!«
»Julia!«, ließ sich Adam vorwurfsvoll vernehmen.
»Gut, laut allgemeiner Meinung ist es eine schlechte Idee«, räumte Julia ein.
»Möchten Sie ein paar Worte sagen?«, fragte der Priester.
»Ich würde so gern, aber …«, erwiderte sie und fixierte den Sarg. »Sie vielleicht, Wallace?«, schlug sie dem Privatsekretär ihres Vaters vor. »Schließlich waren Sie der treueste Freund meines Vaters.«
»Ich glaube, ich bin genauso wenig dazu in der Lage wie Sie, Miss. Außerdem haben Ihr Vater und ich uns eher wortlos verstanden. Vielleicht ein einziges Wort, wenn Sie gestatten, aber nicht an ihn gerichtet, sondern an Sie. Allen Fehlern zum Trotz, die Sie ihm möglicherweise vorwerfen, sollen Sie wissen, dass er ein manchmal harter, oft ein witziger, aber zweifellos ein guter Mensch war. Und er hat Sie geliebt.«
»Wenn meine Rechnung stimmt, war das mehr als ein Wort«, meinte Stanley hüstelnd, als er Julias Augen sich verschleiern sah.
Der Priester sprach ein Gebet. Langsam glitt der Sarg von Anthony Walsh in die Grube. Julia reichte dem Sekretär ihres Vaters eine Rose. Lächelnd gab ihr der Mann die Blume zurück.
»Sie zuerst, Miss.«
Die Blütenblätter verteilten sich auf dem Sarg. Drei weitere Rosen fielen darauf, und die vier Trauergäste traten den Rückweg an.
Weiter hinten auf der Allee standen anstelle des Leichenwagens zwei Limousinen. Adam nahm seine Verlobte bei der Hand und steuerte darauf zu. Julia warf einen prüfenden Blick zum Himmel.
»Keine einzige Wolke, nur Blau, Blau, Blau. Überall Blau, nicht zu warm, nicht zu kalt, kein Windhauch. Was für ein herrlicher Tag zum Heiraten.«
»Es wird andere Tage geben, keine Sorge«, versicherte Adam ihr.
»Einen Tag wie diesen?«, rief Julia und breitete die Arme aus. »Mit einem solchen Himmel? Und solchen Temperaturen? Mit Bäumen, deren Blätter förmlich explodieren? Mit Enten auf dem See? Vielleicht, wenn wir bis zum nächsten Frühjahr warten!«
»Auch der Herbst ist schön, glaube mir. Und seit wann liebst du Enten?«
»Sie lieben mich! Hast du nicht gesehen, wie viele vorhin auf dem Teich neben dem Grab meines Vaters waren?«
»Darauf habe ich nicht geachtet«, erwiderte Adam, leicht besorgt über die plötzliche Erregung seiner Verlobten.
»Es waren Dutzende da, Dutzende Wildenten mit ihrer Fliege um den Hals, die auf dem Teich gelandet und wieder aufgebrochen sind, sobald die Zeremonie beendet war. Es sind Enten, die beschlossen hatten, zu meiner Hochzeit zu kommen, und die mich zur Beerdigung meines Vaters begleitet haben.«
»Julia, ich möchte dir heute nicht widersprechen, aber ich glaube nicht, dass Enten Fliegen tragen.«
»Was weißt du schon davon? Zeichnest du vielleicht Enten? Ich schon! Wenn ich dir also sage, dass diese da ihr Festtagsgewand angelegt haben, bitte ich dich, mir das zu glauben!«, rief sie.
»Okay, mein Liebling, deine Enten trugen einen Smoking, aber jetzt lass uns gehen.«
Stanley und der Privatsekretär erwarteten sie in der Nähe der Wagen. Adam zog Julia am Arm hinter sich her, doch sie blieb vor einem Grabstein mitten auf dem Rasen stehen. Sie las den Vornamen derjenigen, die zu ihren Füßen ruhte, und das Geburtsdatum, das ins neunzehnte Jahrhundert zurückreichte.
»Kanntest du sie?«, fragte Adam.
»Das ist das Grab meiner Großmutter. Meine ganze Familie ruht auf diesem Friedhof. Ich bin die Letzte der Linie Walsh. Das heißt, außer den vielen Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, die zwischen Irland, Brooklyn und Chicago verstreut leben. Tut mir leid, das von eben, ich glaube, ich war etwas aufbrausend.«
»Nicht so schlimm, wir wollten heute heiraten, und stattdessen beerdigst du deinen Vater. Kein Wunder, dass du durcheinander bist.«
Sie betraten die Allee. Die beiden Limousinen waren nur noch wenige Meter entfernt.
»Du hast recht«, fuhr Adam fort, während er den Himmel betrachtete. »Was für ein herrliches Wetter. Dein Vater hat uns wirklich bis zum letzten Tag genervt.«
Julia blieb stehen und zog ihre Hand ruckartig aus der seinen.
»Jetzt sieh mich nicht so an«, flehte Adam. »Das hast du seit der Nachricht von seinem Tod selbst mindestens zwanzig Mal gesagt.«
»Ja, ich darf das sagen, so oft ich will, aber nicht du! Steig in den ersten Wagen mit Stanley, ich nehme den zweiten.«
»Julia! Das tut mir wirklich leid …«
»Braucht es nicht, doch ich möchte heute Abend allein sein und die Sachen dieses Vaters ordnen, der uns bis zu seinem letzten Tag genervt hat, wie du es ausdrückst.«
»Aber das waren doch deine Worte, nicht meine, verdammt!«, rief Adam, während Julia in den Wagen stieg.
»Noch etwas, Adam. An dem Tag, an dem wir heiraten, will ich Enten, Dutzende von Wildenten!« Damit zog sie die Tür zu.
Die Limousine verschwand hinter dem Friedhofstor. Missmutig ging Adam zu dem zweiten Wagen und nahm auf der Rückbank neben dem Privatsekretär Platz.
»Oder vielleicht ein Foxterrier! Der ist klein, beißt aber ordentlich zu …«, meinte Stanley, der vorn saß und dem Chauffeur das Zeichen zur Abfahrt gab.
3
Der Wagen, der Julia zurückfuhr, glitt im plötzlich einsetzenden Platzregen langsam die Fifth Avenue entlang. Während er vor einer roten Ampel stand, starrte Julia in das Schaufenster des großen Spielwarenladens an der Ecke 58th Street und entdeckte darin einen riesigen Fischotter aus graublauem Plüsch.
An einem Samstagnachmittag, ähnlich diesem, hatte Tilly das Licht der Welt erblickt. Der Regen hatte so heftig an die Fenster von Julias Büro getrommelt, dass sich kleine Bäche auf den Scheiben bildeten. Gedankenverloren sah Julia bald Flüsse entstehen, die hölzernen Rahmen wurden zu den Ufern des Amazonasdeltas, und der Blätterhaufen, den der Wind durch die Luft wirbelte, wurde zum Bau eines kleinen Säugetiers, den die Fluten mit sich reißen sollten, was die Gemeinschaft der Fischotter in tiefe Verzweiflung stürzte.
In der folgenden Nacht ließ der Regen nicht nach. Allein in dem großen Computerraum des Animationsstudios, in dem sie arbeitete, entwarf Julia daraufhin die ersten Skizzen ihrer neu erfundenen Figur. Sie war außerstande, die vor dem Computer verbrachten Stunden zu zählen, in denen sie gezeichnet, animiert, koloriert und jeden Ausdruck, jede Mimik ersonnen hatte, die den blauen Fischotter zum Leben erweckten. Außerstande, sich an die vielen späten Besprechungen zu erinnern, an die Zahl der Wochenenden, die sie der Geschichte von Tilly und seiner Familie gewidmet hatte. Der Erfolg, den die Comicfigur haben sollte, war die Entschädigung für die zwei Jahre, die Julia und fünfzig Kollegen, die unter ihrer Leitung standen, hart gearbeitet hatten.
»Ich steige hier aus und gehe den Rest des Weges zu Fuß«, sagte Julia, an den Chauffeur gewandt.
Der Fahrer wies sie auf die Heftigkeit des Gewitters hin.
»Das ist das Erste, was mir an diesem Tag Freude macht«, erwiderte sie und schlug die Tür zu.
Der Chauffeur sah sie über die Straße zu dem Spielzeuggeschäft huschen. Was machte ihr der Regen aus, wenn ihr Tilly hinter der Fensterfront zuzulächeln schien? Julia konnte es sich nicht verkneifen, ihm verstohlen zuzuwinken. Zu ihrer großen Überraschung erwiderte ein kleines Mädchen, das neben dem riesigen Plüschtier stand, ihren Gruß. Seine Mutter nahm es energisch bei der Hand und versuchte, es zum Ausgang zu zerren, doch das Mädchen befreite sich und schlang die Arme um den Fischotter. Julia beobachtete die Szene. Das Mädchen klammerte sich regelrecht an Tilly, und die Mutter schlug der Kleinen auf die Finger, damit sie das Stofftier losließ. Julia betrat das Geschäft und steuerte auf die beiden zu.
»Wussten Sie, dass Tilly über magische Kräfte verfügt?«, fragte Julia.
»Wenn ich eine Verkäuferin brauche, gebe ich Ihnen Bescheid, Miss«, entgegnete die Frau und sah ihre Tochter vorwurfsvoll an.
»Ich bin keine Verkäuferin, ich bin seine Mutter.«
»Wie bitte?«, erwiderte die Mutter der Kleinen mit erhobener Stimme. »Soweit ich weiß, bin das immer noch ich!«
»Ich sprach von Tilly, dem Plüschtier, das Ihre Tochter allem Anschein nach ins Herz geschlossen hat. Ich habe es zur Welt gebracht. Erlauben Sie mir, es ihr zu schenken. Ich kann gar nicht mit ansehen, wie es so allein in diesem grell erleuchteten Schaufenster sitzt. Das aggressive Licht der Scheinwerfer wird sein Fell ausbleichen, dabei ist Tilly so stolz auf sein graublaues Haarkleid. Sie machen sich keine Vorstellung davon, wie viele Stunden wir damit zugebracht haben, die richtigen Farben für Nacken, Hals, Bauch und seine Schnauze zu finden, um ihn wieder zum Lächeln zu bringen, nachdem sein Haus von den Fluten davongetragen wurde.«
»Ihr Tilly bleibt in diesem Geschäft, und meine Tochter wird lernen, an meiner Seite zu bleiben, wenn wir in der Stadt sind!«, erwiderte die Mutter und zog so kräftig am Arm ihres Kindes, dass es die Pfote des großen Stofftiers loslassen musste.
»Tilly würde sich freuen, eine Freundin zu haben«, beharrte Julia.
»Sie wollen einem Plüschtier Freude machen?«, fragte die Mutter kopfschüttelnd.
»Heute ist ein etwas außergewöhnlicher Tag. Tilly und ich würden uns glücklich schätzen und Ihr Töchterchen, glaube ich, auch. Ein einziges Ja, um drei Wesen glücklich zu machen, das ist doch eine Überlegung wert, finden Sie nicht?«
»Oh nein! Alice bekommt kein Geschenk, und schon gar nicht von einer Wildfremden. Guten Abend, Miss!« Damit steuerte sie auf den Ausgang zu.
»Alice hätte es aber verdient. Beschweren Sie sich bitte in zehn Jahren nicht!«, rief Julia ihr nach und schluckte ihren Zorn hinunter.
Die Mutter wandte sich um und bedachte sie mit einem hochmütigen Blick. »Sie haben ein Plüschtier zur Welt gebracht und ich ein Kind. Also behalten Sie bitte Ihre Lebensweisheiten für sich.«
»Stimmt, kleine Mädchen sind nicht wie Plüschtiere. Vor allem lassen sich die Schrammen, die man ihnen zufügt, nicht so leicht ausbessern!«
Empört verließ die Frau den Laden. Mutter und Tochter entfernten sich auf dem Bürgersteig der Fifth Avenue, ohne sich noch einmal umzudrehen.
»Entschuldige, Tilly«, sagte Julia zu dem Plüschtier. »Ich glaube, ich war nicht besonders geschickt. Du weißt ja, Diplomatie ist nicht meine Stärke. Aber keine Sorge, wir finden noch eine nette Familie für dich.«
Der Geschäftsführer, dem nichts von der Szene entgangen war, trat auf sie zu.
»Schön, Sie zu sehen, Miss Walsh. Sie waren sicher schon seit über einem Monat nicht mehr hier.«
»Ich hatte viel Arbeit in den letzten Wochen.«
»Ihr Fischotter ist ein Riesenerfolg. Dies ist schon das zehnte Exemplar, das wir bestellt haben. Vier Tage im Schaufenster, und, hopp, sind sie verkauft«, versicherte der Mann und rückte das Plüschtier wieder an seinen Platz. »Obwohl dieses, wenn ich mich nicht irre, schon fast zwei Wochen hier ist. Aber kein Wunder, bei diesem Wetter …«
»Das hat nichts mit dem Wetter zu tun«, erwiderte Julia. »Dieser Tilly hier ist der echte, deshalb ist er komplizierter und muss sich seine Familie selbst aussuchen.«
»Miss Walsh, das sagen Sie jedes Mal, wenn Sie uns besuchen«, meinte der Geschäftsführer belustigt.
»Alle sind Originale«, bestätigte Julia und verabschiedete sich.
Es hatte aufgehört zu regnen. Julia trat auf die Straße, machte sich auf den Heimweg und tauchte in der Menge unter.
Die Bäume der Horatio Street beugten sich unter der Last der nassen Blätter. Am Frühabend kam die Sonne schließlich wieder zum Vorschein, um dann über dem Hudson River unterzugehen. Ein sanftes purpurfarbenes Licht erleuchtete die schmalen Straßen des West Village. Julia grüßte den Wirt des kleinen griechischen Restaurants gegenüber von ihrem Haus. Der Mann, der gerade die Tische auf seiner Terrasse eindeckte, erwiderte ihren Gruß und fragte, ob er ihr einen Tisch für den Abend reservieren sollte. Julia lehnte höflich ab und versprach, am morgigen Sonntag zum Brunchen zu kommen.
Sie schloss die Eingangstür des kleinen Hauses auf, in dem sie wohnte, und stieg die Treppe in den ersten Stock hinauf. Oben auf der letzten Stufe saß Stanley und wartete.
»Wie bist du raufgekommen?«
»Mister Zimoure, der Geschäftsführer des Ladens unten im Haus, war gerade dabei, Kartons ins Untergeschoss zu tragen. Ich bin ihm zur Hand gegangen, und wir haben über die letzte Schuhkollektion gesprochen, ein wahres Wunderwerk. Aber wer kann sich heutzutage noch so was leisten?«
»Nicht wenige, wenn man die vielen Menschen sieht, die am Wochenende, mit Kartons bepackt, das Geschäft verlassen«, erwiderte Julia. »Brauchst du etwas?«, wollte sie wissen und öffnete die Wohnungstür.
»Nein, aber du brauchst zweifelsohne Gesellschaft.«
»Bei deinem falschen Hundeblick frage ich mich, wer von uns beiden einen Einsamkeitskoller hat.«
»Zur Rettung deines Selbstwertgefühls nehme ich die ganze Verantwortung auf mich, ohne Einladung hier erschienen zu sein!«
Julia zog ihren Regenmantel aus und warf ihn auf den Sessel neben dem Kamin. Der Raum war erfüllt vom Duft der Glyzinie, die an der roten Ziegelfassade hochkletterte.
»Es ist wirklich sehr gemütlich hier bei dir«, rief Stanley aus und ließ sich auf das Sofa sinken.
»Na, wenigstens das ist mir in diesem Jahr gelungen«, sagte Julia und öffnete den Kühlschrank.
»Was ist dir gelungen?«
»Das Stockwerk dieses alten Hauses einzurichten. Willst du ein Bier?«
»Katastrophal für die Linie! Ein Glas Rotwein vielleicht?«
Im Handumdrehen zauberte Julia ein kleines Abendessen, stellte eine Käseplatte auf den Holztisch, entkorkte eine Weinflasche, legte eine CD von Count Basie ein und bat Stanley, ihr gegenüber Platz zu nehmen. Er begutachtete das Etikett des Cabernet und pfiff anerkennend.
»Ein richtiges Festmahl«, erwiderte Julia und setzte sich hin. »Sieht man einmal von den fehlenden zweihundert Gästen und den nicht vorhandenen Petits Fours ab, könnte man sich, wenn man die Augen schließt, bei meinem Hochzeitsessen wähnen.«
»Willst du tanzen, Darling?«, fragte Stanley.
Und noch bevor Julia antworten konnte, zog er sie auf die imaginäre Tanzfläche.
»Siehst du, es ist trotzdem ein Festabend«, meinte er und lachte.
Julia ließ den Kopf an seine Schulter sinken.
»Was sollte ich ohne dich anfangen, mein alter Stanley?«
»Nichts, doch das weiß ich schon seit Langem.«
Das Stück war zu Ende, und Stanley setzte sich wieder hin.
»Hast du Adam wenigstens angerufen?«
Julia nickte. Sie hatte ihren langen Spaziergang genutzt, um sich bei ihrem zukünftigen Ehemann zu entschuldigen. Adam hatte Verständnis für ihr Bedürfnis, allein zu sein. Er selbst machte sich Vorwürfe wegen seines ungeschickten Verhaltens während der Beerdigung. Seine Mutter, mit der er nach seiner Rückkehr vom Friedhof gesprochen hatte, war empört gewesen über seine Taktlosigkeit. Er brach an diesem Abend zum elterlichen Landhaus auf, um den Rest des Wochenendes im Kreise der Familie zu verbringen.
»Es gibt Augenblicke, da frage ich mich, ob dein Vater nicht gut daran getan hat, sich gerade heute beerdigen zu lassen«, flüsterte Stanley und schenkte sich nach.
»Du kannst ihn wirklich nicht ausstehen, was?«
»Das habe ich nie gesagt!«
»In einer Stadt mit zwei Millionen Singles bin ich über drei Jahre allein geblieben. Adam ist galant, großzügig, aufmerksam und zuvorkommend. Er toleriert meine unmöglichen Arbeitszeiten und tut sein Bestes, um mich glücklich zu machen. Und vor allem liebt er mich, Stanley. Also sei bitte etwas nachsichtiger ihm gegenüber.«
»Ich habe nichts gegen deinen Verlobten, er ist perfekt! Ich fände es einfach nur schöner, einen Mann in deinem Leben zu sehen, der dich so richtig mitreißt, auch wenn er tausend Macken hätte, und nicht einen, bei dem du nur bleibst, weil er über gewisse Qualitäten verfügt.«
»Es ist leicht, mir Vorhaltungen zu machen. Aber was ist mit dir, warum bist du allein?«
»Ich bin nicht allein, Julia, ich bin Witwer, das ist nicht dasselbe. Und weil der Mann, den ich geliebt habe, gestorben ist, hat er mich deshalb noch lange nicht verlassen. Du hättest sehen müssen, wie schön Edward sogar noch in der Klinik war. Seine Krankheit hat ihm nichts von seiner Ausstrahlung genommen. Und noch sein letzter Satz war voll schwarzen Humors.«
»Und was war sein letzter Satz?«, fragte Julia und nahm Stanleys Hand in die ihre.
»Ich liebe dich!«
Die beiden Freunde sahen sich eine Weile schweigend an. Schließlich erhob sich Stanley, zog sein Jackett an und küsste Julia auf die Stirn.
»Ich gehe schlafen. Heute Abend hast du gewonnen. Ich bin es, der einen Einsamkeitskoller hat.«
»Warte noch. Mit diesen letzten Worten wollte er dir wirklich sagen, dass er dich liebt?«
»Klar doch, denn schließlich ist er daran gestorben, dass er mich betrogen hat«, erwiderte Stanley lächelnd.
Am Morgen schlug Julia, die auf dem Sofa eingeschlafen war, die Augen auf und bemerkte die Decke, die Stanley über ihr ausgebreitet hatte. Kurz danach entdeckte sie den Zettel, den er unter ihren Frühstücksteller geschoben hatte. Sie las: »Egal welche Gemeinheiten wir uns an den Kopf werfen – du bist meine beste Freundin, und ich liebe dich auch, Stanley.«
4
Fest entschlossen, den Tag in den Studios zu verbringen, verließ Julia gegen zehn Uhr ihre Wohnung. Sie war mit der Arbeit in Verzug und wusste, es wäre völlig sinnlos, zu Hause auf und ab zu laufen oder, weit schlimmer noch, das zu ordnen, was in wenigen Tagen zwangsläufig wieder in Unordnung geraten würde. Genauso sinnlos wäre es, Stanley anzurufen, der sicherlich noch schlief. Am Sonntag pflegte er erst am Nachmittag aufzutauchen, es sei denn, man lockte ihn mit einem Brunch oder versprach ihm Pfannkuchen mit Zimt.
Die Horatio Street war noch wie ausgestorben. Julia grüßte einige Nachbarn, die bereits auf der Terrasse des Pastis saßen, und beschleunigte den Schritt. Während sie die Ninth Avenue entlanglief, schickte sie Adam eine versöhnliche SMS, und zwei Kreuzungen weiter betrat sie den Chelsea Farmer’s Market. Der Liftboy fuhr sie in die letzte Etage. Sie schob ihre Chipkarte in den Scanner, der den Zugang zu den Studios sicherte, und öffnete die schwere Metalltür. Drei Infografiker saßen an ihren Arbeitstischen. Ihre Mienen und die Zahl der im Papierkorb sich türmenden Kaffeepappbecher verrieten Julia, dass sie die Nacht hier zugebracht hatten. Das Problem, das ihr Team seit Tagen beschäftigte, war also noch nicht gelöst. Niemandem war es bisher gelungen, einer Division von Libellen, die ein bestimmtes Schloss vor der drohenden Invasion eines Heeres von Gottesanbeterinnen schützen sollten, Leben einzuhauchen. Laut Fertigungsplan, der an der Wand hing, war der Angriff für den nächsten Tag vorgesehen. Falls die Staffel bis dahin nicht gestartet wäre, würde die Zitadelle widerstandslos in die Hände des Gegners fallen, oder der neue Animationsfilm käme mit erheblicher Verspätung heraus – beides undenkbar.
Julia nahm bei ihren Kollegen Platz, ließ sich den Stand der Dinge erklären und beschloss, augenblicklich das Notprogramm zu starten. Sie griff zum Telefon und rief nacheinander alle Mitglieder ihres Teams an. Sie entschuldigte sich jedes Mal, dass sie ihnen leider den Sonntagnachmittag verderben müsse, da sie sich innerhalb der nächsten Stunde im Besprechungszimmer einzufinden hätten. Am Montagmorgen würden die Libellen am Himmel von Enowkry ausschwärmen, auch auf die Gefahr hin, dass das Team dafür die ganze Nacht sämtliche Daten noch einmal überprüfen müsste.
Und während die erste Mannschaft die verdiente Ruhepause antrat, eilte Julia durch die Gänge des Bio-Supermarkts, um zwei Kartons mit Gebäck und Sandwichs zu füllen, die ihre Truppe bei Laune und auf den Beinen halten sollten.
Gegen Mittag hatten sich siebenunddreißig Mitarbeiter eingefunden. Statt der morgendlichen Ruhe ging es jetzt zu wie in einem Bienenstock: Zeichner, Infografiker, Koloristen und Animationsexperten tauschten Berichte, Analysen und die verrücktesten Ideen aus.
Um 17 Uhr löste eine Spur, auf die ein ganz neuer Mitarbeiter gestoßen war, Aufregung und eine Besprechung im großen Versammlungsraum aus. Charles, ein blutjunger Informatiker, gehörte erst knapp eine Woche zu ihrem Team. Als Julia ihn bat, das Wort zu ergreifen, um den anderen seine Theorie zu erläutern, begann seine Stimme zu zittern, und sein Vortrag wurde ein einziges Gestammel. Der Teamleiter machte alles noch schlimmer, indem er sich über ihn mokierte. Schließlich setzte sich der junge Mann an einen der Computer und tippte etwas ein, während hinter seinem Rücken zunächst weiter getuschelt und gelästert wurde. Die Sticheleien verstummten abrupt, als auf dem Bildschirm plötzlich eine Libelle mit den Flügeln schlug und am Himmel über Enowkry einen perfekten Kreis beschrieb.
Julia war die Erste, die ihn beglückwünschte, und seine sechsunddreißig Kollegen klatschten Beifall. Jetzt musste man nur noch siebenhundertvierzig weitere kriegerische Libellen mobilisieren. Inzwischen hatte der junge Informatiker an Selbstsicherheit gewonnen und erläuterte eine Methode, mit der er hoffte, seine Formel vervielfältigen zu können. Während er sein Projekt im Detail erklärte, klingelte das Telefon. Der Mitarbeiter, der den Hörer abnahm, bedeutete Julia durch ein Zeichen, dass der Anruf für sie sei, allem Anschein nach etwas Dringendes. Sie flüsterte ihrem Nachbarn zu, genau zu notieren, was Charles gerade erklärte, und verließ den Raum, um das Gespräch in ihrem Büro entgegenzunehmen.
Julia erkannte sofort die Stimme von Mr. Zimoure, dem Inhaber des Schuhgeschäfts unten in ihrem Haus. Mit Sicherheit hatten die Armaturen in ihrer Wohnung erneut den Geist aufgegeben, und wahrscheinlich tropfte das Wasser bereits durch die Decke auf Mr. Zimoures Schuhe, von denen ein einzelnes Paar im Ausverkauf so viel kostete, wie Julia im halben Monat verdiente. Das wusste sie umso genauer, als ihr Versicherungsagent es ihr vorgerechnet hatte, nachdem er Mr. Zimoure einen größeren Scheck überreicht hatte, um den von ihr verursachten Schaden zu begleichen. Julia hatte beim Verlassen der Wohnung vergessen, den Wasserhahn an ihrer altgedienten Waschmaschine abzudrehen, aber wer vergisst nicht irgendwann solche Kleinigkeiten?
An jenem Tag hatte besagter Versicherungsagent ihr garantiert, dies sei das letzte Mal, dass er derartige Schadensfälle regulieren würde. Allein der Tatsache, dass Tilly der Held seiner Kinder war und der Zeichentrickfilm ihm ruhige Sonntagvormittage garantierte, war es zu verdanken, dass er die Versicherung überredet hatte, ihren Vertrag nicht schlichtweg zu kündigen.
Was ihr Verhältnis zu Mr. Zimoure betraf, hatte die Angelegenheit großer Anstrengungen ihrerseits bedurft: Eine Einladung zum Thanksgiving-Festessen, organisiert bei Stanley, ein Aufruf zu weihnachtlichem Burgfrieden und viele andere Aufmerksamkeiten waren nötig gewesen, damit sich das Verhältnis zwischen den beiden Nachbarn wieder normalisierte. Leider war dieser Herr von Natur aus wenig zuvorkommend, hatte zu allem seine Theorie und lachte im Allgemeinen nur über seine eigenen Witze. Julia hielt den Atem an und wartete, dass ihr Gesprächspartner ihr das Ausmaß der Katastrophe im Detail ausmalen würde.
»Miss Walsh …«
»Mister Zimoure, was immer auch passiert ist – seien Sie versichert, dass ich es unendlich bedauere.«
»Nicht so wie ich, Miss Walsh, denn meine Kunden stehen Schlange, und ich habe Besseres zu tun, als mich in Ihrer Abwesenheit um Ihre Lieferung zu kümmern.«
Julia versuchte, sich zu beruhigen und zu begreifen, worum es eigentlich ging.
»Welche Lieferung?«
»Diese Frage müssten Sie mir beantworten, Miss!«
»Tut mir leid, aber ich habe nichts bestellt, und außerdem lasse ich grundsätzlich alles in mein Büro liefern.«
»Was diesmal ganz offensichtlich nicht der Fall war, denn vor meinem Schaufenster parkt ein riesiger Lastwagen. Der Sonntag ist mein wichtigster Verkaufstag, und das bedeutet gewaltige Verluste für mein Geschäft. Die beiden Hünen, die diese für Sie bestimmte Kiste abgeladen haben, weigern sich abzufahren, solange nicht jemand die Kiste in Empfang genommen hat.
»Eine Kiste?«
»So ist es. Muss ich Ihnen alles zweimal sagen, während meine Kundschaft immer ungeduldiger wird?«
»Ich verstehe das nicht, Mister Zimoure, und weiß gar nicht, was ich Ihnen antworten soll.«
»Sagen Sie mir zum Beispiel, wann Sie hier sein können, damit ich den Herren mitteilen kann, wie viel Zeit wir durch Ihr Verschulden verlieren.«
»Aber ich kann im Moment unmöglich kommen. Ich stecke mitten in der Arbeit.«
»Glauben Sie denn etwa, dass ich hier Däumchen drehe, Miss Walsh?«
»Mister Zimoure, ich erwarte keine Lieferung, weder Paket noch Päckchen – und schon gar keine Kiste! Noch einmal, es muss sich um einen Irrtum handeln.«
»Durch mein Schaufenster, vor dem Ihre Kiste steht, kann ich ohne Brille auf dem Aufkleber Ihren Namen, darunter unsere gemeinsame Adresse und den Zusatz ›zerbrechlich‹ lesen! Anscheinend haben Sie etwas vergessen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Ihr Gedächtnis Sie im Stich lässt, nicht wahr?«
Wer mochte der Absender dieser Lieferung sein? Ein Geschenk von Adam vielleicht oder eine Bestellung, die sie vergessen hatte, etwas fürs Büro, das sie versehentlich an ihre persönliche Adresse geordert hatte? Auf alle Fälle konnte Julia die Leute, die sie an einem Sonntag ins Studio zitiert hatte, nicht einfach allein lassen. Der Tonfall von Mr. Zimoure gebot indes, innerhalb kürzester Frist, das heißt augenblicklich, einen Ausweg zu finden.
»Ich glaube, ich habe eine Lösung für unser Problem, Mister Zimoure. Mit Ihrer Hilfe können wir uns aus dieser Notlage befreien.«
»Ich bewundere erneut Ihre Logik. Sie wollen mir erklären, dass Sie eine Lösung für etwas gefunden haben, das einzig Ihr Problem und nicht im Geringsten meines ist, und ich muss gestehen, dass Sie mich erneut in Erstaunen versetzen, Miss Walsh. Ich lausche also mit größter Aufmerksamkeit.«
Julia vertraute ihm an, dass sie unter dem Teppich der Treppe auf Höhe der sechsten Stufe einen Zweitschlüssel zu ihrer Wohnung versteckt hatte. Man müsse nur zählen. Und wenn es nicht die sechste Stufe sei, dann eben die siebte oder vielleicht die achte Stufe. Mr. Zimoure könne den Lieferanten somit die Tür öffnen, die daraufhin umgehend – da sei sie ganz sicher – mit diesem großen Lastwagen, der die Sicht auf das Schaufenster versperrte, verschwinden würden.
»Und ich nehme an, im Idealfall soll ich so lange warten, bis diese Hünen gegangen sind, um die Tür zu Ihrer Wohnung hinter ihnen abzuschließen und den Schlüssel wieder in sein Versteck zu legen, nicht wahr?«
»Im Idealfall … Treffendere Worte hätte ich nicht finden können, Mister Zimoure …«
»Sollte es sich um ein Elektrogerät handeln, Miss Walsh, so wäre ich Ihnen unendlich dankbar, wenn Sie es von einem erfahrenen Handwerker anschließen ließen. Sie verstehen, worauf ich damit hinauswill!«
Julia wollte ihn beruhigen, dass sie kein Gerät dieser Art bestellt habe, doch ihr Nachbar hatte bereits aufgelegt. Sie zuckte mit den Schultern, dachte kurz nach und wandte sich dann wieder der Aufgabe zu, die ihre ganze Aufmerksamkeit erforderte.
Bei Einbruch der Dunkelheit versammelten sich alle vor dem Bildschirm im großen Besprechungszimmer. Charles saß am Computer, und die erzielten Resultate schienen ermutigend. Noch einige Stunden intensiver Arbeit, und der »Krieg der Libellen« könnte programmgemäß stattfinden. Die Informatiker überprüften noch einmal ihre Berechnungen, die Infografiker kümmerten sich um die letzten Details der Ausstattung, und Julia kam sich allmählich überflüssig vor. Sie ging in den Teesalon, wo sie auf Dray, einen Zeichner und Freund, traf, mit dem sie den größten Teil des Studiums absolviert hatte.
An der Art, wie sie sich reckte und streckte, erahnte er die Rückenschmerzen und riet ihr, nach Hause zu gehen. Sie hätte das Glück, nur wenige Straßen von hier entfernt zu wohnen, das solle sie nun auch nutzen. Er würde sie anrufen, sobald die Versuche abgeschlossen seien. Julia war äußerst empfänglich für diese Aufmerksamkeit, glaubte aber, bei ihrer Truppe bleiben zu müssen. Dray gab zu bedenken, dass nur zusätzlicher Stress entstehen würde, wenn sie dauernd ihre Nase in alle Büros steckte.
»Und seit wann wird meine Anwesenheit hier als Belastung empfunden?«, wollte sie wissen.
»Jetzt übertreib mal nicht, unsere Nerven liegen einfach blank. Wir hatten in sechs Wochen nicht einen einzigen freien Tag.«
Julia hätte eigentlich bis zum nächsten Sonntag Urlaub gehabt, und Dray gestand, dass ihre Mitarbeiter gehofft hatten, bei der Gelegenheit einmal ein wenig durchatmen zu können.
»Wir dachten, du wärst auf Hochzeitsreise … Fass das bitte nicht falsch auf, Julia. Ich bin nicht ihr Wortführer«, fügte Dray leicht verlegen hinzu. »Das ist der Preis der Verantwortung, die du auf dich genommen hast. Seitdem du zur Chefin des Creative Departement aufgestiegen bist, bist du nicht mehr eine einfache Arbeitskollegin, sondern stellst eine gewisse Autorität dar … Der Beweis ist das Team, das du mit ein paar Anrufen, noch dazu an einem Sonntag, hast mobilisieren können!«
»Ich finde, es hat sich gelohnt, oder nicht?«, erwiderte Julia. »Aber ich glaube, die Anspielung verstanden zu haben. Da sich meine Autorität negativ auf die Kreativität der anderen auszuwirken scheint, lasse ich euch allein. Ruf mich auf jeden Fall an, sobald ihr fertig seid – nicht weil ich die Chefin bin, sondern weil ich zum Team gehöre!«
Sie griff nach ihrem Regenmantel, der über einer Stuhllehne lag, vergewisserte sich, dass ihr Schlüssel noch in ihrer Jeanstasche steckte, und steuerte energisch auf den Lift zu.