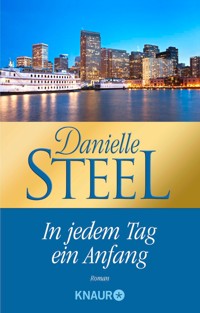10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Menschen, die alles verloren haben, finden zueinander und zu neuem Glück
Vor fast einem Jahr sind Ophélie Mackenzies Mann und Sohn bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, einzig ihre elfjährige Tochter gibt ihr noch die Kraft zum Leben. Eines Tages lernt Ophélie bei einem ihrer einsamen Strandspaziergänge den charmanten Zeichenlehrer Matt Bowles kennen, einen verständnisvollen und sensiblen Mann, der selbst mit persönlichen Schicksalsschlägen zu kämpfen hat. Die beiden freunden sich an, aus Freundschaft wird Liebe, und ein neues Familienglück scheint zum Greifen nahe. Doch die Schatten der Vergangenheit fordern ihren Tribut …
Ein Roman der internationalen Bestsellerautorin voller Hoffnung und zweiter Chancen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch:
»Pip drehte sich abrupt zu Ophélie um. Einen Augenblick lang sah es so aus, als wolle sie ihrer Mutter vor Erleichterung um den Hals fallen, doch dann schrie sie vorwurfsvoll: ›Du hast gesagt, du wärst in einer Stunde wieder hier!‹
Ophélie senkte schuldbewusst den Blick. ›Es tut mir sehr leid … Weißt du … unterwegs ist etwas passiert.‹
›Ist das Boot untergegangen?‹ Pip blickte mit großen Augen von ihrer Mutter zu Matt. Amy zog sich unterdessen diskret zurück.
›Nein, das nicht‹, entgegnete Ophélie sanft und nahm Pip in den Arm. ›Außerdem habe ich eine Schwimmweste getragen, wie ich es dir versprochen hatte.‹
›Was ist dann passiert?‹, wollte Pip wissen.
›Wir sind draußen auf dem Meer auf einen Jungen gestoßen, der auf seinem Surfbrett abgetrieben war. Matt hat ihn gerettet.‹
Pips Augen weiteten sich.
›Wir beide haben ihn gerettet‹, berichtigte Matt. ›Deine Mutter war unglaublich.‹«
Zur Autorin:
Danielle Steel ist mit einer Milliarde verkaufter Exemplare ihrer Romane eine der beliebtesten Autorinnen der Welt. Zu ihren jüngsten internationalen Bestsellern gehören »The Ball at Versailles«, »Das nächste Kapitel« und »Happiness«. Ebenso schrieb sie »His Bright Light«, die Geschichte über das Leben und den Tod ihres Sohnes Nick Traina, und »A Gift of Hope«, eine Erinnerung an ihre Arbeit mit Obdachlosen. Danielle Steel teilt ihre Zeit zwischen Paris und ihrem Haus in Nordkalifornien auf.
Danielle Steel
Eine Begegnung voller Hoffnung
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Emmy Rave
HarperCollins
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel Safe Harbour bei Random House Publishing Group, New York.
© 2025 Danielle Steel
Neuausgabe
© 2025 HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
Covergestaltung von zero-media.net, München
Coverabbildung von FinePic®, München
E-Book Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN9783749907755
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten.Die Rechte der Urheberinnen und des Verlags bleiben davon unberührt.
Für meine außergewöhnlichen, wunderbaren Kinder; Beatrix, Trevor, Todd, Sam, Victoria, Vanessa, Maxx, Zara und Nick, die ich sehr liebe und die dafür sorgen, dass ich glücklich bin und mich geborgen fühle. Mögt ihr immer ein sicherer Hafen füreinander sein.
Und für die Engel der »Yo! Angel!«: Randy, Bob, Jill, Cody, Paul, Tony, Younes, Jane und John.
In tief empfundener Liebe,
d.s.
Die Hand Gottes
Stets mit einem Gefühl
tiefer Bestürzung,
Betroffenheit,
Angst
kommt der Tag,
an dem wir zu den verlorenen Seelen Gottes gehen.
Vergessen, frierend,
gebrochen, schmutzig
und gelegentlich, doch selten,
gebadet und sauber,
mit neuer Kleidung auf den Straßen,
mit noch immer ordentlichen Frisuren,
die Gesichter glatt rasiert.
Doch nur einen Monat später sehen wir,
wie die Tage ihnen zugesetzt haben.
Dieselben Gesichter wirken verändert,
die Kleider zerlumpt,
die Seelen zerfetzt wie ihre Hemden
und Schuhe, ihre Augen leer …
Ich gehe zur Messe,
und meine stillen Gebete
sind tief empfunden.
Dann brechen wir auf.
Wie Matadore,
die die Arena betreten,
nicht ahnend,
was die Nacht bereithält:
Wärme oder Verzweiflung,
Gefahr oder Tod –
für sie oder für uns.
Wir halten Ausschau nach den Augen,
die nach uns suchen.
Sie erwarten uns bereits.
Sobald wir aus dem Wagen springen,
rennen sie auf uns zu,
strecken ihre Arme nach uns aus.
Wir schleppen Kisten und Kartons heran,
um sie durch einen weiteren Tag zu bringen,
eine weitere Nacht im Regen,
eine weitere Stunde in der Kälte.
Ich habe für euch gebetet …
Wo wart ihr?
Ich wusste, ihr würdet kommen!
Durch den Regen kleben ihre Hemden
an ihren Körpern,
ihr Schmerz und ihre Freude
mischen sich mit unserer.
Wir sind ihre ganze Hoffnung,
jeden Tag aufs Neue,
das Ausmaß ihrer Verzweiflung
können wir nur erahnen.
Ihre Hände berühren unsere,
ihre Augen heften sich auf uns.
Gott schütze euch,
sagen die Stimmen sanft,
als sie sich dankbar entfernen.
Für einen kurzen Moment
teilen sie ihr Leben mit uns,
geben uns Einblick
in ihre Qualen und ihre Freude,
ihr Leben auf der Straße.
Während wir weiterfahren,
bleiben sie zurück,
für immer eingebrannt
in unsere Erinnerung.
Das Mädchen, dessen Gesicht
von Schorf bedeckt war;
der einbeinige Junge
im strömenden Regen,
dessen Mutter geweint hätte,
wüsste sie von seinem Leid,
der Mann, der zusammenbrach und weinte –
zu schwach,
um unsere Gaben entgegenzunehmen –
und dann die anderen,
die uns ängstigen,
uns auflauern,
uns beobachten
und offenbar überlegen,
ob sie sich auf uns stürzen
oder unsere Hilfe annehmen sollen,
ob sie auf uns einschlagen
oder uns danken sollen.
Ihre Hände berühren die meinen,
ihre Leben berühren die unseren,
unwiderruflich.
Unser einziger Schutzschild
dort draußen
ist unser Gottvertrauen,
das uns immer aufs Neue
hinausfahren lässt
und uns beschützt,
wenn wir ihnen wieder und wieder
gegenübertreten.
Die Nacht dauert an,
Gesichter ziehen vorbei.
Die Trostlosigkeit
wird für einen kurzen Augenblick unterbrochen,
in dem Hoffnung aufkeimt,
und eine Tasche, voller warmer Kleider
und Lebensmittel,
eine Taschenlampe, ein Schlafsack,
ein Kartenspiel und ein paar Pflaster
geben ihnen ein wenig ihrer Würde zurück.
Du erkennst: Sie sind Menschen wie wir.
Dann lässt ein Gesicht
mit verwüsteten und verwüstenden Augen
dein Herz stillstehen
und zerbricht die Zeit in kleine Splitter,
bis wir genauso
niedergeschmettert
sind wie sie
und es keinen Unterschied mehr
zwischen uns gibt.
Als seine Augen die meinen suchen,
sind wir eins.
Wird er mir erlauben,
ihm zu helfen,
oder wird er auf mich losstürmen
und mich angreifen,
weil er meine Zuversicht
nicht nachvollziehen kann?
Warum tust du das für uns?
Weil ich euch liebe,
möchte ich sagen,
doch selten finde ich die richtigen Worte.
Ich reiche ihm eine warme Jacke,
zusammen mit meinem Herzen.
Meine Hoffnung und mein Vertrauen
gelten allen dort.
Manche sind dem Tode so nahe,
dass sie nicht mehr sprechen können.
Das ergreifendste Antlitz von allen
wartet ganz am Ende,
nach einigen wenigen fröhlichen Gesichtern.
Dieses letzte Gesicht –
dasjenige, das ich in Gedanken mit nach Hause nehme –
ist seins.
Eine Dornenkrone auf dem Kopf,
das Gesicht umschattet.
Er ist der Schmutzigste
und Erschütterndste von allen.
Er steht da und starrt mich an,
lässt mich nicht vorbei.
Er durchbohrt mich mit
seinem Blick,
leer; unheilvoll,
gezeichnet von Verzweiflung.
Ich sehe ihn kommen,
er eilt direkt auf mich zu.
Ich will davonlaufen,
aber ich kann nicht,
wage es nicht.
Ich spüre Furcht in mir aufsteigen,
dann stehen wir uns Auge in Auge gegenüber;
wir schmecken die Angst des anderen
wie Tränen,
die sich auf den Lippen vereinen.
Ich frage mich:
Wenn dies meine letzte Chance wäre,
Gott nahe zu sein,
die Hände nach ihm auszustrecken
und auch von ihm berührt zu werden,
wenn dies meine einzige Chance wäre,
zu beweisen, was ich wert bin
und wie sehr ich ihn liebe,
würde ich wirklich davonlaufen?
Ich muss mich zusammennehmen
und mich erinnern,
dass sich Gott in vielerlei Formen zeigt,
in verschiedenen Gesichtern,
in wütenden Augen
und nicht nur in herrlichen Düften.
Ich reiche dem Mann die Gaben,
mein Mut verlässt mich,
ich vermag kaum zu atmen.
Dann erinnere ich mich,
warum ich in dieser dunklen Nacht
zu ihm – zu ihnen allen –
gekommen bin …
Wir stehen uns gleichberechtigt gegenüber;
der Tod schwebt zwischen uns.
Endlich nimmt er meine Geschenke entgegen,
segnet mich
und geht weiter.
Als wir heimfahren,
erkenne ich
still und des Sieges gewiss:
Wir wurden zum wiederholten Male
von der Hand Gottes berührt.
Zuflucht
Einst zerrissen,
nun geheilt.
In meinen Gedanken
an dich
nehme ich Zuflucht.
Deine Wunden,
meine Narben …
das Vermächtnis derer,
die uns liebten.
Unsere Siege
und Niederlagen
werden langsam eins,
unsere Geschichten
vermischen sich,
liegen vor uns
in der Wintersonne.
Die Scherben meiner Seele
fügen sich wieder zusammen.
Endlich bin ich wieder
ein Ganzes,
ein Glas mit einem Sprung
von alter Schönheit.
Die Geheimnisse
des Lebens
müssen nicht länger
enträtselt werden.
Und du,
geliebter Freund,
du hältst meine Hand, genesen.
Das Leben
beginnt neu,
wie ein Lied
der Liebe
und der Freude,
das niemals endet.
1. Kapitel
Es war einer dieser kalten, nebligen Tage in Nordkalifornien, mit denen sich der Sommer hin und wieder maskiert. Der Wind pfiff über den Strand und wirbelte Wolken aus feinem Sand auf.
Ein kleines Mädchen in roten Shorts und weißem Sweatshirt spazierte langsam den Strand entlang und stemmte sich gegen den Wind. Ihr Hund schnüffelte an dem Tang, den die Wellen anspülten.
Das Mädchen hatte kurzes, lockiges Haar, bernsteinfarbene Augen und helle Sommersprossen. Diejenigen, die sich mit Kindern auskennen, hätten es auf ungefähr zehn bis zwölf Jahre geschätzt. Es war klein, hatte dünne Beine und bewegte sich sehr anmutig. Ihr Gefährte war ein schokoladenbrauner Labrador. Gemächlich wanderten die beiden fort von der bewachten Siedlung, in Richtung des öffentlichen Strandes.
An diesem Tag hielten sich nur wenige Menschen am Meer auf, es war einfach zu kalt. Dem Mädchen machte das jedoch nichts aus. Der Hund kläffte hin und wieder die kleinen Sandwolken an, dann lief er zum Wasser hinüber und spielte mit den Wellen. Wenn er eine Krabbe entdeckte, wich er zurück und bellte wütend. Das Mädchen lachte. Es war unschwer zu erkennen, dass das Kind und der Hund gute Freunde waren. Die Art, wie sie zusammen den Strand entlanggingen, ließ erahnen, dass die beiden nicht viele andere Freunde besaßen und diesen Weg schon oft gemeinsam beschritten hatten.
Im Juli erwartete man hierzulande eigentlich, dass es heiß und sonnig war. Doch wenn der Nebel aufzog, wurde es regelrecht winterlich kühl. Manchmal sah man vom Ufer aus durch die Streben der Golden Gate Bridge den Nebel über das Wasser wabern. Safe Harbour lag fünfunddreißig Kilometer nördlich von San Francisco. Ein Großteil des Ortes bestand aus einer bewachten Siedlung, deren Häuser auf einer Düne standen. Ein Wächter in einem Häuschen hielt unwillkommene Besucher fern. Der Strand, an den die Häuser grenzten, wurde ausschließlich von den Bewohnern der Siedlung genutzt, und hier traf man nur selten einen Menschen. Am anderen Ende des sichelförmigen Küstenstreifens befand sich ein öffentlicher Strand, der von einer Reihe einfacher Bungalows gesäumt wurde. An heißen Sommertagen war dieser Abschnitt zwar stets völlig überfüllt, aber sonst waren auch hier nur wenige Besucher anzutreffen.
Das Mädchen hatte gerade den Bereich des Strandes betreten, wo die Reihe der einfacheren Häuser begann, da erblickte es einen Mann auf einem Klappstuhl, der vor einer Staffelei saß und ein Aquarell malte. Es blieb stehen. Der Hund lief indessen die Düne hinauf und spürte einem interessanten Geruch nach, den der Wind ihm zugetragen hatte. Die Kleine ließ sich im Sand nieder und schaute dem Maler bei der Arbeit zu – weit genug entfernt, um von ihm nicht entdeckt zu werden. Sie fand Gefallen daran, ihm zuzusehen. Er wirkte so ruhig und irgendwie vertraut, und sie beobachtete fasziniert, wie der Wind durch sein kurzes, dunkles Haar fuhr.
Das Mädchen hatte eine Vorliebe dafür, Menschen heimlich zu betrachten, und oft schaute es den Fischern zu, wenn sie aufs Meer hinausfuhren. Es blieb zwar stets auf Distanz, doch ihm entging nichts von dem, was sie taten. Eine ganze Zeit lang saß die Kleine nun dort und behielt den Mann genau im Auge. Sie erfasste, dass er Boote malte, die gar nicht existierten. Nach einer Weile kam der Hund zurück und ließ sich neben der Kleinen in den Sand fallen. Sie streichelte ihn, ohne ihn anzuschauen. Ihr Blick war auf den Maler gerichtet, nur ab und zu wanderte er hinaus auf den Ozean.
Schließlich erhob sie sich und näherte sich dem Mann von hinten, bis sie direkt hinter ihm stand. Auf diese Weise konnte sie den Fortgang seiner Arbeit verfolgen, ohne von ihm bemerkt zu werden. Sie mochte die Farben, die er verwendete, vor allem jene für den prachtvollen Sonnenuntergang.
Der Labrador wurde langsam unruhig und wartete auf den nächsten Befehl seiner Herrin, doch diese schenkte ihm keine Beachtung, sondern wandte ihre Aufmerksamkeit weiterhin dem Mann zu.
Schließlich verlor der Hund die Geduld und setzte in großen Sprüngen an dem Maler vorbei. Dieser wurde von dem auffliegenden Sand getroffen und blickte überrascht auf. Erst jetzt entdeckte er das Kind. Er hielt kurz inne, sagte aber nichts und arbeitete dann weiter, erstaunt, dass sich das Mädchen nicht rührte und ihn einfach nur ansah. Erst eine halbe Stunde später – er mischte gerade ein wenig Wasser in eine zu intensive Farbe – wandte er erneut kurz den Kopf.
Die Kleine beobachtete ihn nach wie vor vollkommen ungeniert. Irgendwann setzte sie sich wieder in den Sand, da man dem Wind am Boden weniger ausgesetzt war.
Der Maler trug ein Sweatshirt, so wie sie, dazu eine Jeans und ein ausgelatschtes, altes Paar Seglerschuhe. Er hatte ein wettergegerbtes, tief gebräuntes Gesicht, und sie fand, dass er schöne Hände besaß. Er musste ungefähr Mitte vierzig sein.
Als er sich abermals umdrehte, um zu prüfen, ob sie immer noch da war, begegneten sich ihre Blicke, aber keiner von beiden lächelte. Der Mann hatte seit langer Zeit nicht mehr mit einem Kind gesprochen.
»Zeichnest du gern?«, fragte er schließlich. Er konnte sich keinen anderen Grund für die Hartnäckigkeit der Kleinen vorstellen. Wahrscheinlich war sie selbst eine angehende Künstlerin – andernfalls wäre sie doch längst gelangweilt davonmarschiert …
»Manchmal«, antwortete die Kleine wachsam. Ein gesundes Misstrauen erwachte in ihr, denn schließlich kannte sie den Mann ja nicht, und ihre Mutter sagte ihr ständig, sie solle nicht mit Fremden reden.
»Und warum zeichnest du gern?«, fragte er weiter. Während er sprach, nahm er den Pinsel ins Visier, den er gerade säuberte.
Das Mädchen musterte ihn unterdessen interessiert und ignorierte seine Frage. Sie betrachtete sein ansprechendes, kantiges Gesicht, besonders das tiefe Grübchen in der Mitte seines Kinns. Er hatte etwas Stilles, Kraftvolles an sich, das ihr gefiel. Er besaß breite Schultern und lange Beine, und obwohl er auf einem recht niedrigen Klappstuhl saß, sah man, dass er ziemlich groß war.
»Ich zeichne manchmal meinen Hund«, sagte sie unvermittelt. »Wie können Sie Boote malen, die gar nicht da sind?«
Der Mann lächelte und hob den Kopf. Ihre Blicke trafen sich abermals. »Ich stelle sie mir vor. Möchtest du es auch mal versuchen?« Er hielt ihr einen Zeichenblock und einen Bleistift hin.
Die Kleine zögerte, dann stand sie auf, ging zu ihm hinüber und nahm den Block und den Stift entgegen.
»Darf ich meinen Hund zeichnen?« Ihr zartes Gesicht blieb völlig ernst. Es schmeichelte ihr, dass der Maler ihr seinen Block anvertraute.
»Sicher. Du darfst alles zeichnen, was du möchtest.«
Eine Zeit lang saßen sie still nebeneinander und arbeiteten. Das Mädchen war ganz bei der Sache.
»Wie heißt er?«, fragte der Maler, als der Hund an ihnen vorbeihechtete, um Seemöwen zu jagen.
»Mousse«, erwiderte das Kind, ohne den Blick von seiner Zeichnung abzuwenden.
»Wie Apfelmus? Witziger Name«, sagte der Mann, korrigierte etwas an seinem Bild und beäugte es dann kritisch. »Das ist ein französisches Dessert. Aus Schokolade.«
Der Maler nickte. Nach einer Weile murmelte er: »So geht es.« Er sah zufrieden aus. Er gedachte, nun langsam Schluss zu machen. Es war schon nach vier Uhr, und er hatte seit der Mittagszeit gemalt. »Sprichst du Französisch?«, erkundigte er sich, nicht wirklich aus Interesse, sondern nur, um irgendetwas zu sagen. Er war überrascht, dass die Kleine nickte. Ihre stille Konzentration irritierte ihn. Als er sie erneut anblickte, fiel ihm auf, dass sie ein wenig seiner Tochter ähnelte. Vanessa hatte in diesem Alter zwar langes, glattes, blondes Haar gehabt, aber die Körperhaltung und das Benehmen der Kleinen erinnerten ihn an sie. Er musste nur blinzeln und konnte Vanessa beinahe vor sich sehen.
»Meine Mutter ist Französin«, fügte die Kleine hinzu, während sie sich zurücklehnte und ihr Bild betrachtete. Sie war beim Zeichnen auf ein Detail gestoßen, an dem sie immer scheiterte, wenn sie Mousse malte: die Hinterbeine.
Der Maler bemerkte ihren Unmut und streckte die Hand nach dem Zeichenblock aus. »Lass mich mal schauen«, forderte er sie auf.
»Ich bekomme die Hinterbeine nie richtig hin«, stellte das Mädchen unzufrieden fest und überreichte ihm den Block. Sie waren nun Lehrer und Schülerin, und die Zeichnung schuf augenblicklich ein Band zwischen ihnen.
»Ich zeige dir gern, wie es geht … Soll ich?«, fragte er.
Sie nickte.
Mit wenigen, geschickten Strichen korrigierte er das Problem. Ansonsten war es ein erstaunlich gelungenes Porträt. »Das hast du gut gemacht«, lobte er. Er riss das Blatt ab und gab es dem Mädchen zurück. Den Block und den Bleistift verstaute er in seiner Tasche.
»Danke, dass Sie mir gezeigt haben, wie man die Hinterbeine zeichnet.«
»Beim nächsten Mal weißt du, wie du es machen musst«, sagte er und begann, seine Farben einzupacken.
Es war inzwischen noch kühler geworden, aber die beiden schienen das nicht zu bemerken.
»Gehen Sie jetzt nach Hause?« Die Kleine sah enttäuscht aus. Als er in ihre bernsteinfarbenen Augen blickte, beschlich ihn das Gefühl, dass sie einsam war, und das tat ihm leid. Irgendetwas an ihr war anders als an den Kindern, denen er sonst am Strand begegnete …
»Ja, es ist schon spät.« Der Nebel über den Wellen wurde dichter. »Lebst du hier, oder bist du nur zu Besuch?«
»Ich bin den ganzen Sommer über hier.«
In ihrer Stimme schwang keinerlei Begeisterung mit. Der Maler wunderte sich über das Mädchen. Es war einfach in seinen Nachmittag hineinspaziert, und er hatte bereits nach wenigen Stunden das seltsame Empfinden, als gäbe es eine eigentümliche, undefinierbare Verbindung zwischen ihnen.
»Wohnst du drüben in der Siedlung?«
Sie nickte. »Leben Sie denn hier?«, wollte sie wissen, und er machte eine Handbewegung in Richtung eines Bungalows auf der Düne.
»Sind Sie Künstler?«, fragte sie weiter.
»Ich denke, das bin ich.« Der Mann lächelte und blickte auf das Porträt von Mousse, das das Mädchen fest an sich gedrückt hielt.
Keiner von beiden schien wirklich aufbrechen zu wollen, dabei wussten sie, dass es langsam Zeit wurde zu gehen. Die Kleine musste zu Hause sein, bevor ihre Mutter zurückkehrte. Als die Babysitterin wieder einmal stundenlang mit ihrem Freund telefoniert hatte, war sie ihr entwischt.
Dem älteren Mädchen war es allerdings gleichgültig, ob sich ihr Schützling davonstahl. Meistens bemerkte sie das Fehlen der Kleinen nicht einmal, bis die Mutter nach Hause kam und nach ihrer Tochter fragte.
»Mein Vater hat auch gemalt.«
Dem Mann entging nicht, dass das Kind in der Vergangenheitsform sprach, aber er war nicht sicher, was es bedeutete: dass sein Vater inzwischen nicht mehr zeichnete oder dass er die Familie verlassen hatte. Er vermutete, dass Letzteres der Fall war. Die Kleine stammte wahrscheinlich aus einem zerrütteten Elternhaus und hungerte nach Aufmerksamkeit.
»Ist er Künstler?«
»Nein, er ist Ingenieur. Er hat ein paar Sachen erfunden.« Dann seufzte sie und schaute den Mann traurig an. »Ich sollte jetzt besser nach Hause gehen.« Und wie aufs Stichwort erschien Mousse an ihrer Seite. »Vielleicht treffen wir uns ja bald wieder.«
Möglich, dachte der Maler. Es war ja erst Anfang Juli, und er würde im Laufe des Sommers noch oft herkommen. Aber er war dem Mädchen noch nie zuvor begegnet und nahm deshalb an, dass es nicht oft auf dem öffentlichen Strand herumstreunte. Es war schließlich ein recht weiter Weg von der Siedlung hierher …
»Danke, dass ich mit Ihnen zeichnen durfte«, sagte die Kleine höflich, und auf ihren Lippen zeigte sich ein Lächeln. Trotzdem lag so viel Wehmut in ihrem Blick, dass der Maler sie aufmunternd und voller Wärme anlächelte. »Es hat mir Spaß gemacht«, erwiderte er aufrichtig und streckte ihr die Hand entgegen. Er war sich seiner Unbeholfenheit sehr wohl bewusst. »Ich heiße übrigens Matthew Bowles.«
Sie schüttelte feierlich seine Hand, und ihre guten Manieren beeindruckten ihn. Sie war eine bemerkenswerte kleine Dame, und plötzlich freute er sich, sie kennengelernt zu haben.
»Ich bin Pip Mackenzie«, stellte sie sich vor.
»Pip? Das ist aber ein interessanter Name! Ist das eine Abkürzung?«
»Ja, leider.« Das Mädchen kicherte und wirkte zum ersten Mal kindlich. »Ich heiße Phillippa. Nach meinem Großvater, er hieß Philipp. Ist das nicht schrecklich?« Sie schüttelte entrüstet den Kopf und brachte den Maler damit zum Lachen.
»Ich mag den Namen. Phillippa … Vielleicht findest du ihn eines Tages auch gar nicht mehr so übel.«
»Das glaub ich nicht. Es ist ein blöder Name! Ich finde Pip besser.«
»Das werde ich mir merken«, sagte der Mann grinsend.
»Wenn meine Mom am Donnerstag in die Stadt fährt, komme ich wieder«, erklärte sie.
Ihre Worte verstärkten seinen Eindruck, dass sie sich von zu Hause davongeschlichen hatte. Wenigstens war der Hund bei ihr, um auf sie aufzupassen. Ohne ersichtlichen Grund fühlte er sich plötzlich verantwortlich für sie.
Der Maler klappte seinen Stuhl zusammen und hob die alte, abgenutzte Kiste auf, in der er seine Farben aufbewahrte. Anschließend klemmte er sich die Staffelei unter den Arm.
»Danke noch mal, Mr. Bowles.«
»Matt. Du kannst mich gern duzen. Und ich danke dir für deine nette Gesellschaft. Auf Wiedersehen, Pip.«
»Bis dann!«, rief sie, winkte und flog davon wie ein Blatt im Wind. Sie drehte sich noch einmal um, winkte erneut und rannte dann den Strand hinunter, gefolgt von ihrem Hund.
Der Maler schaute ihr lange nach und fragte sich, ob er sie jemals wiedersehen würde – und ob ihm das überhaupt wichtig war. Dann stemmte er sich gegen den Wind und kletterte die Düne zu seinem kleinen, etwas windschiefen Bungalow hinauf. Er öffnete die stets unverschlossene Tür, trat ein und legte seine Ausrüstung in der Küche ab. In seinem Inneren spürte er einen alten Schmerz, den er seit Jahren nicht empfunden hatte und der ihm alles andere als willkommen war. Das ist das Schlimme an Kindern, dachte er bei sich, während er sich ein Glas Wein einschenkte. Sie bohren sich in dein Herz wie ein Splitter unter den Fingernagel, und wenn sie schließlich herausgezogen werden, tut es höllisch weh …
Während er die Begegnung mit Pip noch einmal Revue passieren ließ, wanderte sein Blick zu einem Porträt, das er vor Jahren angefertigt hatte. Das Mädchen auf dem Bild war seine Tochter Vanessa, die damals ungefähr in Pips Alter gewesen sein musste.
Er nahm das Bild von der Wand, ging ins Wohnzimmer hinüber, ließ sich in einem alten, abgewetzten Ledersessel nieder und beobachtete den Nebel, der immer dichter über dem Wasser heraufzog. Doch er sah nur das kleine Mädchen vor sich, mit den leuchtend roten Locken, den Sommersprossen und den bernsteinfarbenen Augen.
2. Kapitel
Ophélie Mackenzie bog um die letzte Kurve der Landstraße und lenkte den Kombi langsam durch das Ortszentrum von Safe Harbour. Das Städtchen bestand aus nicht viel mehr als zwei Restaurants, einer Buchhandlung, einem Geschäft für Surfartikel, einem kleinen Supermarkt und einer Kunstgalerie.
Es war ein anstrengender Nachmittag gewesen. Ophélie hasste es, zweimal in der Woche zu der Selbsthilfegruppe nach San Francisco zu fahren, aber sie musste zugeben, dass die Treffen ihr guttaten. Seit Mai besuchte sie sie nun regelmäßig und hatte noch zwei weitere Monate vor sich. Sie war damit einverstanden gewesen, auch während des Sommers an den Gruppensitzungen teilzunehmen, und hatte Pip deshalb auch an diesem Tag wieder in der Obhut der Nachbarstochter gelassen. Amy war sechzehn und passte gern auf Pip auf oder behauptete dies zumindest. Das Arrangement schien für alle eine gute Lösung zu sein: Ophélie hatte einen Babysitter, Amy konnte mit dem Job ihr Taschengeld aufbessern, und Pip mochte Amy offenbar. Ophélie brauchte nie viel länger als eine halbe Stunde in die Stadt, und im Grunde war es eine angenehme Strecke – abgesehen von dem kurzen Abschnitt zwischen der Autobahn und der Küste, der einige äußerst enge Kurven bereithielt. Trotzdem waren Ophélie die Fahrten lästig. Am liebsten brauste sie noch an den Klippen entlang und blickte dabei aufs Meer. An diesem Nachmittag war sie furchtbar müde. Manchmal war es regelrecht nervenaufreibend, den anderen zuzuhören, und außerdem hatten sich ihre eigenen Probleme seit dem Beginn der Treffen kaum verringert. Dennoch wollte sie die Gruppe nicht aufgeben, denn dort gab es Leute, mit denen sie reden konnte. Wenn es nicht anders ging, schüttete sie ihnen in einer Sitzung ihr Herz aus und gestand, wie erschöpft und verloren sie sich fühlte. Sie wollte auf keinen Fall Pip mit ihren Sorgen belasten. Es war nicht fair, einem elfjährigen Kind den Kummer einer Erwachsenen aufzubürden.
Ophélie fuhr die Hauptstraße entlang und bog dann links in die Sackgasse ein, die zu der bewachten Siedlung führte. Der Eingang war leicht zu übersehen, doch Ophélie hatte diesen Weg schon so oft genommen, dass sie ihn im Schlaf fand. Es war eine gute Entscheidung gewesen, den Sommer in Safe Harbour zu verbringen. Sie und ihre Tochter brauchten die Ruhe, die hier herrschte. Die Stille. Die Einsamkeit. Den langen, scheinbar endlosen, weißen Sandstrand, an dem es manchmal erfrischend kühl, dann wieder heiß und sonnig war.
Ophélie machten die nebligen, kälteren Phasen nichts aus. Sie spiegelten ihre Stimmung besser wider als lachender Sonnenschein und blauer Himmel. An manchen Tagen verließ sie nicht einmal das Haus. Sie blieb im Bett oder zog sich in eine Ecke des Wohnzimmers zurück und gab vor, ein Buch zu lesen. In Wahrheit aber grübelte sie die ganze Zeit über. Sie dachte darüber nach, wie anders ihr Leben früher gewesen war. Vor dem vergangenen Oktober. Es war erst vor neun Monaten passiert, und doch schien es eine Ewigkeit her zu sein.
Ophélie ließ den Wagen nun langsam durch das Tor rollen. Der Wächter winkte ihr zu, und sie nickte grüßend. Dann gondelte sie vorsichtig über die Verkehrsberuhigungshügel und an ein paar Kindern auf Fahrrädern, an mehreren Hunden und winkenden Nachbarn vorbei. Dies war eine dieser Siedlungen, in denen man die anderen Anwohner zwar mit Namen kannte, darüber hinaus aber kaum engeren Kontakt mit ihnen hatte. Seit vier Wochen waren sie nun schon hier und hatten außer den direkten Nachbarn noch niemanden kennengelernt. Ophélie musste sich allerdings eingestehen, dass ihr das sehr recht war.
Sie steuerte den Wagen die Auffahrt hinauf, stellte den Motor ab und blieb bewegungslos hinter dem Lenkrad sitzen. Sie war zu müde, um auszusteigen, nach Pip zu sehen oder das Abendessen vorzubereiten – aber sie wusste, sie würde nicht darum herumkommen. Es war wichtig, gegen diese schreckliche Lethargie anzukämpfen. Trotz ihrer Bemühungen schaffte sie es an manchen Tagen nicht einmal, sich morgens das Haar zu kämmen.
Ihr Leben war vorbei – dessen war sie sich sicher. Sie fühlte sich, als ob sie hundert Jahre alt wäre, dabei war sie erst zweiundvierzig und sah noch viel jünger aus. Sie hatte langes, blondes, lockiges Haar, und ihre Augen besaßen dieselbe warme Bernsteinfarbe wie die Augen ihrer Tochter. Ophélie wirkte beinahe ebenso klein und zerbrechlich wie Pip.
Zu ihrer Schulzeit war sie eine begabte Tänzerin gewesen, und aus diesem Grund hatte sie versucht, Pip ebenfalls schon früh für das Ballett zu begeistern. Doch Pip hasste es vom ersten Moment an. Sie fand das Tanzen eintönig, sträubte sich rigoros gegen die Übungen an der Stange und verabscheute die anderen Mädchen, die erpicht darauf waren, alles perfekt zu machen. Sie scherte sich kein bisschen um Drehungen, Sprünge oder Pliés. Ophélie gab es schließlich auf, Pip zu den Ballettstunden zu bewegen, und erlaubte ihrer Tochter fortan, das zu tun, wonach ihr der Sinn stand. Ein Jahr lang hatte Pip dann Reitstunden genommen und einen Töpferkurs in der Schule besucht, doch letztlich fand sie heraus, dass ihr das Zeichnen am meisten Spaß machte.
Pip hatte ihren ganz eigenen Kopf und war froh, wenn sie sich selbst überlassen war. Meist verbrachte sie ihre Zeit mit Lesen, Zeichnen und Träumen, oder sie spielte mit Mousse. Im Grunde war sie ihrer Mutter sehr ähnlich, denn diese war als Kind ebenfalls eine Einzelgängerin gewesen. Ophélie fragte sich jedoch, ob es gut für ihre Tochter war, dass sie so wenig Umgang mit anderen Kindern hatte. Andererseits schien sie glücklich und zufrieden zu sein. Sie fand immer etwas, womit sie sich beschäftigen konnte, und langweilte sich nie – selbst jetzt nicht, da ihre Mutter ihr so wenig Aufmerksamkeit schenkte.
Es hatte den Anschein, als ob Pip unter der fehlenden Beachtung nicht wirklich litt. Trotzdem hatte Ophélie deswegen oft Schuldgefühle. Sie erwähnte ihre Gewissensbisse des Öfteren im Kreis der Selbsthilfegruppe, und doch fühlte sie sich nicht in der Lage, ihre Teilnahmslosigkeit zu überwinden. Nichts würde je wieder wie früher sein.
Ophélie steckte nun den Wagenschlüssel in ihre Handtasche, schlug die Autotür zu und ging zum Haus. Es bestand keine Veranlassung, den Wagen abzuschließen.
In der Küche fand sie nur Amy vor, die gerade mit hektischen Bewegungen das schmutzige Geschirr in die Spülmaschine räumte. Wenn Ophélie heimkam, war Amy immer sehr beschäftigt, was bedeutete, dass sie den ganzen Nachmittag lang keinen Finger gerührt hatte und nun auf die letzte Minute alles nachzuholen versuchte. Es gab allerdings nie viel zu erledigen in diesem ordentlichen Haus mit den modernen Möbeln, den hellen Holzböden und dem riesigen Panoramafenster, das fast die gesamte Länge des Gebäudes einnahm und einen herrlichen Blick auf das Meer bot. Hinter dem Haus befand sich eine lange, schmale Terrasse, auf der Gartenmöbel standen.
»Hallo, Amy! Wo ist Pip?«, fragte Ophélie mit müdem Blick. Sie sprach fast akzentfrei Englisch, und man konnte ihre französische Herkunft kaum noch heraushören. Nur wenn sie extrem erschöpft oder ärgerlich war, rutschte ihr hin und wieder ein Wort heraus, das sie verriet.
»Ich weiß nicht«, antwortete Amy und setzte ein unschuldiges Gesicht auf.
Ophélie sah sie durchdringend an. Sie hatten dieses Gespräch schon mehr als einmal geführt. Amy hatte oft keinen Schimmer, wo sich Pip gerade aufhielt. Ophélie vermutete, dass das Mädchen wie üblich stundenlang per Handy mit ihrem Freund telefoniert hatte. Das war eigentlich das Einzige, was Ophélie an Amy immer wieder bemängelte. Sie erwartete einfach von dem Mädchen, dass sie ständig ein Auge auf Pip hatte – das Haus lag schließlich direkt am Wasser. Wenn Ophélie nicht wusste, wo ihre Tochter war, geriet sie jedes Mal in Panik. Schließlich konnte ihr etwas Schreckliches zugestoßen sein.
»Ich glaube, sie ist in ihrem Zimmer und liest. Da war sie jedenfalls, als ich das letzte Mal nach ihr gesehen hab«, fügte Amy achselzuckend hinzu.
Tatsächlich war Pip nicht mehr in ihrem Zimmer gewesen, seit sie es am Morgen verlassen hatte.
Ophélie ging nach oben, um nachzuschauen, aber natürlich fand sie Pip nicht vor. Sie ahnte nicht, dass ihre Tochter in diesem Moment den Strand entlang nach Hause rannte. Zurück in der Küche, fragte sie angsterfüllt: »Ist sie vielleicht zum Strand gelaufen?« Ihr versagten neuerdings schnell die Nerven. Normalerweise sah ihr das gar nicht ähnlich, aber seit dem vergangenen Oktober hatte sich alles verändert.
Amy brachte die Geschirrspülmaschine in Gang und machte sich bereit zu gehen. Es schien sie nicht im Geringsten zu interessieren, wo ihr Schützling steckte. Sie war ein unbesonnener Teenager, der noch nichts von den Gefahren auf der Welt ahnte. Ophélie hingegen war sich dessen bewusst, was alles geschehen konnte. Das Leben hatte ihr auf grausame Weise gezeigt, dass man sich niemals sicher fühlen durfte.
»Bestimmt nicht. Dann hätte sie mir doch Bescheid gesagt.«
Ophélie wurde zunehmend wütender. Zwar wusste sie, dass die Kinder in der Siedlung gut aufgehoben waren, aber es gefiel ihr überhaupt nicht, dass Amy Pip erlaubte, ohne jegliche Aufsicht herumzustreunen. Wenn sich Pip verletzte oder auf der Straße von einem Auto angefahren wurde … Ophélie hatte ihrer Tochter regelrecht eingebläut, dass sie sich bei Amy abmelden musste, bevor sie irgendwohin ging, aber weder das Kind noch der Teenager befolgten offenbar ihre Anweisungen.
»Bis Donnerstag dann!«, rief Amy und schwirrte aus der Tür.
Ophélie kickte ihre Sandalen von den Füßen und schaute mit gerunzelter Stirn aus dem Fenster zum Strand. Dann erblickte sie Pip. Ihre Tochter sauste die Düne herauf und hielt irgendetwas in der Hand, das im Wind flatterte. Es sah aus wie ein Stück Papier.
Erleichtert eilte Ophélie Pip entgegen. In ihrem Kopf hatten sich schon die fürchterlichsten Szenarien abgespielt. Es war beinahe fünf Uhr, und es wurde langsam empfindlich kalt.
Ophélie winkte ihrer Tochter, die kurz darauf neben ihr nach Luft schnappend zum Stehen kam.
»Wo bist du gewesen?«, fragte Ophélie in strengem Ton. Sie war noch immer sauer auf Amy. Das Mädchen war einfach ein hoffnungsloser Fall. Ophélie kannte allerdings niemand anderen, der für sie babysitten konnte …
»Ich bin mit Mousse spazieren gegangen.« Sie wedelte mit dem Blatt. »Ich weiß jetzt, was ich bei den Hinterbeinen immer falsch gemacht hab.« Wohlweislich erzählte sie nicht, wie sie es herausgefunden hatte. Ihr war klar, dass sich ihre Mutter entsetzlich aufregen würde, wenn sie erführe, dass sich ihre Tochter mit einem Fremden unterhalten hatte – selbst wenn er ihr nur beim Zeichnen behilflich gewesen war und überhaupt kein Grund zur Besorgnis bestand.
Ophélie war sehr skeptisch, wenn es um Fremde ging. Und sie wusste, wie außergewöhnlich hübsch Pip war … »Ich kann kaum glauben, dass Mousse so lange stillgehalten hat«, sagte Ophélie. Als sie lächelte, konnte man erkennen, wie attraktiv sie war, eine bildschöne Frau mit feinen Gesichtszügen, perfekten Zähnen und wundervollen Augen, die glitzerten, wenn sie lachte. Doch seit Oktober lachte Ophélie nur noch selten.
Abends zogen sie und ihre Tochter sich in ihre jeweils eigene kleine Welt zurück. Dann sprachen sie kaum noch miteinander. Unabhängig davon, wie sehr Ophélie ihr Kind liebte, fielen ihr einfach keine Gesprächsthemen mehr ein, und es war ihr viel zu anstrengend, danach zu suchen. Alles war ihr inzwischen zu viel, manchmal sogar das Atmen.
»Ich hab ein paar Muscheln für dich gesammelt«, sagte Pip nun. Sie zog zwei wohlgeformte Exemplare aus ihrer Hosentasche und überreichte sie ihrer Mutter. »Ich hab außerdem einen Sanddollar gefunden, aber er war kaputt.«
»Das sind sie fast immer«, erwiderte Ophélie und schloss die Finger fest um die Muscheln. Dann gingen sie zusammen ins Haus.
Ophélie hatte ganz vergessen, Pip einen Begrüßungskuss zu geben, aber die Kleine war mittlerweile daran gewöhnt. Es schien ihr, als ob jede Berührung, jede Form von körperlichem Kontakt für ihre Mutter inzwischen unerträglich war. Sie hatte sich in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. Die Mutter, die Pip in den ersten zehn Jahren ihres Lebens versorgt hatte, war verschwunden. Und die Frau, die ihren Platz eingenommen hatte, war ein gebrochener Mensch. Im Schutz der Nacht hatte irgendjemand Ophélie fortgeschafft und sie durch einen Roboter ersetzt. Seine Stimme klang wie ihre, und er duftete wie sie, er fühlte sich an wie Ophélie und sah auch genauso aus wie sie. Doch im Wesen unterschieden sich die beiden grundlegend. Pip hatte keine andere Wahl, als die Veränderung zu akzeptieren, und das gelang ihr sehr gut.
Pip war innerhalb der letzten Monate erwachsen geworden. Für ein Kind war sie erstaunlich vernünftig – weitaus verständiger als andere Mädchen ihres Alters. Zudem hatte sie einen sicheren Instinkt in Bezug auf Menschen entwickelt.
»Hast du Hunger?«, fragte Ophélie nun. Es war für sie zur Qual geworden, das Essen zu kochen, und sie hasste dieses Abendritual regelrecht. Etwas essen zu müssen, war sogar noch schlimmer, als die Mahlzeit zuzubereiten. Sie hatte einfach keinen Appetit mehr – seit geraumer Zeit bekam sie kaum etwas hinunter. In den vergangenen neun Monaten waren sie und Pip immer dünner geworden. »Eigentlich noch nicht. Soll ich heute Abend Pizza machen?«, schlug Pip vor. Pizza mochten sie beide noch am liebsten.
»Wenn du willst …«, erwiderte Ophélie unentschlossen. »Ich könnte aber auch irgendetwas anderes kochen.« Sie hatten schon vier Abende hintereinander eine Pizza in den Ofen geschoben – im Gefrierschrank türmte sich ein ganzer Stapel davon.
»Ich hab eigentlich gar keinen Hunger«, sagte Pip unbestimmt.
Jeden Abend führten sie das gleiche Gespräch. Manchmal machte Ophélie ein gebratenes Hühnchen mit Salat, aber das aßen sie dann auch meist nicht. Pip hatte in letzter Zeit ausschließlich von Erdnussbutter-Sandwiches und Pizza gelebt.
»Vielleicht später.«
Ophélie ging nach oben in ihr Schlafzimmer und legte sich hin. Auch Pip begab sich in ihr Zimmer und lehnte das Porträt von Mousse gegen die Lampe auf ihrem Nachttisch. Das Papier des Zeichenblocks war so dick, dass es nicht umfiel. Während Pip das Bild betrachtete, dachte sie an Matthew. Sie konnte es kaum erwarten, ihn am Donnerstag wiederzusehen. Sie hatte ihn auf Anhieb gemocht. Und dank seiner Korrekturen war ihre Zeichnung erstaunlich gut gelungen. Mousse sah auf dem Bild wie ein echter Hund aus und nicht, wie bei ihren sonstigen Versuchen, zur Hälfte wie ein Hund und zur anderen Hälfte wie ein Kaninchen. Matthew war eindeutig ein wahrer Künstler. Als Pip das Schlafzimmer ihrer Mutter betrat, war es draußen schon dunkel. Sie wollte ihr noch einmal anbieten, das Kochen zu übernehmen, aber Ophélie war schon eingeschlafen. Sie lag derart still auf dem Bett, dass Pip für einen kurzen Moment Angst bekam, aber als sie näher heranging, hörte sie ihre Mutter atmen. Vorsichtig deckte sie sie mit einer Wolldecke zu, die am Fußende des Bettes zusammengefaltet war. Sie wusste, dass ihre Mutter in letzter Zeit sehr leicht fror – wahrscheinlich, weil sie so viel abgenommen hatte.
Danach lief Pip in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Sie hatte keine Lust auf Pizza. Stattdessen schmierte sie sich ein Erdnussbutter-Sandwich und verspeiste es vor dem Fernseher. Eine Zeit lang verfolgte sie das Programm, und Mousse schlief zu ihren Füßen. Er war von dem langen Strandspaziergang völlig erschöpft und schnarchte leise. Erst als seine Herrin den Fernseher und das Licht im Wohnzimmer ausmachte, wachte er auf.
Pip schlenderte ins Badezimmer, putzte sich die Zähne und zog ihren Schlafanzug an. Ein paar Minuten später schlüpfte sie ins Bett und löschte das Licht. Lange Zeit lag sie noch wach und dachte an Matthew Bowles. Schließlich schlief sie ein.
Und Ophélie wachte nicht vor dem nächsten Morgen wieder auf.
3. Kapitel
Der Mittwochmorgen war klar und wolkenlos. Es wurde offenbar einer jener heißen Sommertage, die es nur selten im Norden Kaliforniens gibt. Als Pip aufwachte, war die Luft bereits schwer und drückend. In ihrem Schlafanzug schlurfte sie in die Küche, wo ihre Mutter vor einer dampfenden Tasse Tee am Küchentisch saß. Ophélie war furchtbar müde. Selbst wenn sie eine ganze Nacht lang geschlafen hatte, war sie morgens unausgeruht. Nach dem Aufwachen war ihr nur ein kurzer, wundervoller Moment vergönnt, in dem die Vergangenheit sie noch nicht einholte. Darauf folgte stets der scheußliche Augenblick des Erinnerns, und die grausame Realität brach erneut über sie herein. Wenn sie schließlich aufstand, fühlte sie sich wie gerädert.
»Hast du gut geschlafen?«, erkundigte sich Pip höflich, während sie sich etwas Orangensaft einschenkte und eine Scheibe Brot in den Toaster steckte.
Ophélie überging die Frage ihrer Tochter. Im Grunde wussten sie beide, wie sinnlos Gespräche dieser Art waren. Stattdessen sagte sie: »Es tut mir leid, dass ich gestern so früh eingeschlafen bin. Ich hatte wirklich vor, wieder aufzustehen. Hast du dir was zu essen gemacht?« Ophélie war sehr wohl bewusst, wie sehr sie das Kind vernachlässigte, aber sie war unfähig, etwas dagegen zu unternehmen. Erneut überfielen sie Schuldgefühle.
»Ja«, beruhigte Pip ihre Mutter. Es machte ihr nichts aus, selbst für ihr Abendessen zu sorgen. Sie zog es sogar vor, allein vor dem Fernseher zu essen. Das war allemal besser, als mit Ophélie an einem Tisch zu sitzen und das Schweigen zu ertragen. Vor den Ferien war es noch einfacher für sie gewesen, da musste sie jeden Tag Hausaufgaben machen und hatte damit einen triftigen Grund, nach dem Essen rasch wieder vom Tisch aufzustehen.
Das Brot sprang nun geräuschvoll aus dem Toaster, und Pip bestrich es mit Erdnussbutter. Anschließend aß sie das Sandwich im Stehen, ohne sich die Mühe zu machen, einen Teller aus dem Schrank zu holen. Sie benötigte keinen, denn sie wusste, dass Mousse sämtliche Krümel, die eventuell zu Boden fielen, blitzschnell mit seiner langen Zunge auflecken würde.
Pip ging auf die Terrasse, ließ sich in einen Liegestuhl fallen und genoss die warmen Sonnenstrahlen. Einen Augenblick später trat Ophélie ebenfalls hinaus.
»Andrea hat gesagt, sie würde heute mit dem Kleinen vorbeikommen.«
»Wirklich?« Pips Augen leuchteten. Sie war verrückt nach dem Baby. William, Andreas Sohn, war drei Monate alt und – wie Ophélie oft sagte – ein Symbol für die Unabhängigkeit und den Mut seiner Mutter. Mit vierundvierzig hatte Andrea beschlossen, nicht länger auf ihren Märchenprinzen zu warten. Sie war durch künstliche Befruchtung – mithilfe eines Samenspenders – schwanger geworden und hatte im April einen niedlichen, dunkelhaarigen Jungen mit strahlend blauen Augen und einem unwiderstehlichen Lächeln zur Welt gebracht. Ophélie war Patin, und Andrea war Pips Patentante.
Die beiden Frauen waren seit über achtzehn Jahren befreundet – seit Ophélie mit ihrem Ehemann nach Kalifornien gekommen war. Ophélie und Ted hatten zuvor zwei Jahre lang in Cambridge im Bundesstaat Massachusetts gelebt, wo Ted an der Harvard-Universität Dozent für Physik gewesen war. Auf dem Gebiet der Energieforschung galt Ted als Genie. Er war ein brillanter, etwas wortkarger Mann, den viele für ein wenig seltsam hielten, doch seine Familie kannte ihn als treuen und einst auch liebevollen Ehemann und Vater. Diese Eigenschaften waren jedoch im Laufe der Jahre mehr und mehr verloren gegangen. Ophélie und er hatten schwierige Phasen durchgemacht und zudem ständig in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt. Dann, dreizehn Jahre nach ihrem Umzug nach Kalifornien, war ihnen das Glück plötzlich hold, und zwei von Teds Erfindungen brachten ihnen innerhalb kürzester Zeit ein Vermögen ein. Dadurch wurde alles einfacher, aber Teds Wärme und Freundlichkeit kehrten dennoch nicht zurück.
Ted liebte seine Frau und seine Tochter, dessen war sich Ophélie immer sicher gewesen. Er hatte ihnen seine Liebe nur irgendwann nicht mehr zeigen können. Zuerst waren die Geldsorgen schuld daran, und dann kam der ständige Kampf um neue, bahnbrechende Konstruktionen hinzu. Ted verdiente Millionen von Dollars damit, Patentlizenzen für seine Erfindungen zu verkaufen, und überall auf der Welt respektierte und verehrte man ihn für seine Leistungen. Es war ihm gelungen, den Schatz am Ende des Regenbogens zu finden, aber es schien, als ob er irgendwann vergessen hätte, dass es einen Regenbogen gab. In Teds Leben drehte sich alles um seine berufliche Tätigkeit, und seine Frau und seine Kinder rückten zunehmend in den Hintergrund.
Ted war der typische begnadete Erfinder. Er war oft mürrisch, und seine Stimmungen konnten von einer Minute auf die andere umschlagen. Doch Ophélie liebte ihn von ganzem Herzen und warf ihm seine Eigenheiten und sein sonderliches Verhalten niemals vor. Trotzdem vermisste sie die Innigkeit der ersten Jahre ihrer Ehe. Sie wussten beide, dass nicht allein die Geldsorgen oder Teds harte Arbeit die Veränderung bewirkt hatten. Der wahre Grund war Chad.
Die Krankheit ihres Sohnes hatte Ted für immer verändert. Je schlimmer Chads Beschwerden wurden, desto mehr zog sich Ted von dem Jungen zurück, und dabei entfernte er sich gleichzeitig auch immer weiter von Ophélie.
Ihr Sohn war schon als Kind schwierig gewesen, und nach Jahren voller Probleme wurde bei Chad eine manisch-depressive Erkrankung diagnostiziert. Damals, Chad war vierzehn, begann Ted, sich zu seinem eigenen Schutz vollkommen abzukapseln, sodass sich Ophélie allein um Chad kümmern musste. Ted konnte der Wahrheit offensichtlich einfach nicht ins Gesicht blicken, und er entwickelte seine eigene Methode, mit der Krankheit seines Sohnes umzugehen: Er verdrängte sie.
»Wann kommt Andrea denn?«, fragte Pip nun und hielt ihr Gesicht in die Sonne.
»Sobald sie das Baby gestillt hat, fährt sie los. Sie sagte, irgendwann im Laufe des Vormittags ist sie hier.« Ophélie freute sich auf Andreas Besuch. Das Baby war eine angenehme Ablenkung – besonders für Pip.
Trotz ihres Alters und ihrer Unerfahrenheit war Andrea eine erstaunlich entspannte Mutter. Sie hatte nichts dagegen, dass Pip William überallhin trug, ihn drückte, küsste oder ihn an den Zehen kitzelte. Der Junge mochte Pip anscheinend ebenso sehr wie sie ihn, und sein sonniges Gemüt brachte sie oft zum Lachen.
Andrea, eine erfolgreiche Anwältin, hatte sich zu jedermanns Verwunderung dazu entschieden, nach der Geburt eine Babypause von einem Jahr einzulegen. Sie genoss es, ihre gesamte Zeit mit William zu verbringen, und sagte oft, ihn zu bekommen sei das Beste gewesen, was ihr je passiert war. All ihre Freunde hatten sie zuvor gewarnt, ein Kind zu kriegen. Unzählige Male musste sich Andrea anhören, sie könne es sich aus dem Kopf schlagen, als alleinerziehende Mutter noch einmal einen Mann zu finden. Aber das kümmerte Andrea nicht im Geringsten. Sie genoss ihre Mutterrolle in vollen Zügen.
Ophélie war bei der Geburt dabei gewesen. Sie war schnell und unkompliziert verlaufen. Gleich nachdem William das Licht der Welt erblickt hatte, war er Ophélie von dem Arzt überreicht worden, damit sie ihn Andrea in die Arme legen konnte. Dieses Erlebnis hatte die beiden Frauen noch enger zusammengeschweißt.
An diesem Tag stürmte Andrea wie ein Wirbelwind ins Haus, und nur wenige Minuten nach ihrem Eintreffen lagen überall Decken, Windelpakete und Spielzeug herum. Pip spielte mit dem Baby auf der Terrasse. Mousse, der den Säugling anfangs noch aufgeregt angebellt hatte, schlief bald zu ihren Füßen, und die beiden Frauen unterhielten sich angeregt.
Nach etwa zwei Stunden musste Andrea das Baby wieder stillen, und es wurde ein wenig ruhiger im Haus. Pip machte sich noch ein Sandwich und ging zum Strand, um zu schwimmen. Andrea nahm sich ein Glas Orangensaft und setzte sich zu Ophélie auf die Couch.
»William ist so süß … Du kannst dich wirklich glücklich schätzen«, sagte Ophélie mit einer Spur Neid in der Stimme. Das Baby brachte ein wenig frischen Wind in ihr Haus. Mit einem Mal drehten sich ihre Gedanken nicht mehr nur um Dinge, die zu Ende gegangen waren. Ihr wurde bewusst, dass Andreas Leben zum genauen Gegensatz ihres eigenen geworden war.
Andrea lehnte sich zurück, streckte ihre langen Beine aus und strich dem Säugling an ihrer Brust zärtlich über das Köpfchen. Dabei unternahm sie keinen Versuch, ihren Busen zu bedecken. Sie war stolz darauf, ihr Kind stillen zu können.
Andrea war eine attraktive Frau mit durchdringenden, dunklen Augen und langem, dunklem Haar, das sie stets zu einem Zopf zusammenband. Ihr geschäftsmäßiges Auftreten und die schicken Kostüme, die sie im Gerichtssaal immer getragen hatte, waren seit Williams Geburt verschwunden. Sie war an diesem Tag barfuß nach Safe Harbour gekommen und trug ein pinkfarbenes Stricktop und weiße Shorts. Andrea überragte Ophélie um einen Kopf, und wenn sie hochhackige Schuhe trug, erreichte sie die stattliche Größe von eins zweiundachtzig. Sie war eine Frau, die überall auffiel, sich niemals von irgendjemandem etwas sagen ließ und dennoch eine gewisse Sensibilität ausstrahlte.
»Geht es dir besser, seit ihr hier seid?«, fragte Andrea nun und sah Ophélie prüfend an. Sie sorgte sich um ihre Freundin, da sie ahnte, wie schwer die vergangenen neun Monate für sie gewesen sein mussten.
»Ein bisschen«, antwortete Ophélie, und das war nur zur Hälfte gelogen. Zumindest wohnten sie momentan in einem Haus, das keine grässlichen Erinnerungen in ihr heraufbeschwor – außer jenen, die sie in ihrem Kopf mit hergebracht hatte. »Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Selbsthilfegruppe mich zusätzlich deprimiert. Aber gleichzeitig gibt sie mir auch Rückhalt.«
»Wenigstens bist du mit Menschen zusammen, die etwas Ähnliches durchgemacht haben wie du. Wer sonst sollte verstehen, was in dir vorgeht?«
Andreas Worte trösteten Ophélie ein wenig. Sie hasste es, wenn die Leute sie mitleidig ansahen und Verständnis heuchelten. Jemand, der etwas Derartiges nicht selbst erlebt hatte, konnte sich unmöglich in ihre Lage versetzen. Zumindest Andrea war sich dessen bewusst.
»Da hast du recht. Ich hoffe, du wirst es niemals nachvollziehen können.« Während Andrea das Baby an die andere Brust legte, lächelte Ophélie traurig. »Ich fühle mich furchtbar wegen Pip. Es kommt mir vor, als ob ich irgendwo in den Wolken schwebe und überhaupt nicht mehr zu ihr durchdringe.« Und ganz gleich, wie sehr sie sich auch bemühte, zur Erde zurückzukommen – sie schaffte es einfach nicht.
»Erstaunlicherweise scheint es Pip gar nicht so schlecht zu gehen. Sie hat eine Menge mitgemacht, genau wie du, und trotzdem ist sie ein sehr selbstständiges Kind – und ein sehr hübsches dazu!«
Während der vergangenen Jahre hatte Chads Krankheit der Familie beträchtlich zugesetzt, und auch Teds Eigenarten waren oft eine Belastung gewesen. Wenn man das alles bedachte, war Pip tatsächlich ein bemerkenswert ausgeglichenes Mädchen. Bis vor einigen Monaten war auch Ophélie überraschend gut mit allem zurechtgekommen. Sie war der Leim, der ihre Familie zusammengehalten hatte. Erst seit dem vergangenen Oktober schien alle Kraft sie verlassen zu haben. Andrea war jedoch überzeugt davon, dass sich Ophélie irgendwann wieder in jenen lebensfrohen Menschen verwandeln würde, der sie einst gewesen war. Und sie als ihre Freundin wollte alles tun, um ihr dabei zu helfen.
Die beiden Frauen hatten sich vor achtzehn Jahren durch gemeinsame Bekannte kennengelernt, und obgleich sie nicht unterschiedlicher hätten sein können, waren sie sich sofort sympathisch gewesen.
Gerade die Gegensätze waren es, die sie einander näherbrachten. Während Ophélie eher still, stets freundlich und zurückhaltend war, verfügte Andrea über ein enormes Durchsetzungsvermögen und vertrat ihre Ansichten lautstark und rigoros. Andrea wechselte zudem häufig ihre Partner und ließ sich von keinem Mann etwas vorschreiben.
Ophélie hingegen hatte sich ihrem Mann während ihrer Ehe stets untergeordnet. Sie hatte dies freiwillig getan und ihre Rolle keineswegs als unangenehm empfunden. Andrea und sie waren über diesen Punkt stets uneinig gewesen, und Andrea hatte ihre Freundin immer wieder ermutigt, unabhängiger zu sein.
Die beiden Frauen besaßen jedoch auch einige Gemeinsamkeiten und teilten eine große Leidenschaft für Kunst, Musik und Theater. Zwei Mal waren sie sogar zusammen zur Premiere eines interessanten neuen Stücks nach New York geflogen.
Andrea hatte mit Ophélie und ihrer Familie bereits auch gemeinsam Urlaub gemacht. Es gab dabei nie Probleme, denn Andrea und Ted verstanden sich ausgezeichnet. Wenn sie zusammen unterwegs waren, kam es niemals zu Streitereien, und keiner fühlte sich je wie das fünfte Rad am Wagen.
Bevor Andrea in Stanford Jura studierte, hatte sie einen Abschluss in Physik am Massachusetts Institute of Technology gemacht. Ihr Beruf als Anwältin führte sie dann bald nach Kalifornien, wo sie sich schließlich niederließ.
Ted war seinerzeit davon begeistert gewesen, dass sich eine Physikerin in ihren Freundeskreis einreihte. Er liebte es, stundenlang mit Andrea über seine neuesten Projekte zu diskutieren, denn sie verstand genau, wovon er sprach – was bei seiner Frau selten der Fall war. Ophélie machte es nichts aus, dass die beiden so gut miteinander auskamen. Vielmehr freute sie sich, eine solch gebildete Freundin zu haben.
In ihrer Funktion als Anwältin vertrat Andrea hauptsächlich große Firmen. Sie hatte in all den Jahren, die sie ihren Beruf nun schon ausübte, niemals die Rolle der Verteidigerin übernommen, sondern ohne Ausnahme die der Klägerin, da dies ihrer unerschrockenen Persönlichkeit einfach besser entsprach.
Genau dieser Charakterzug veranlasste sie immer wieder dazu, Ted in wissenschaftliche Streitgespräche zu verwickeln. Ted bewunderte Andrea für ihre Courage und ihre Eloquenz und dachte oft, sie könne es in vielerlei Hinsicht weitaus besser mit ihm aufnehmen als seine eigene Frau. Er vergaß dabei, dass Andrea es sich leisten konnte, ihn zu provozieren – sie hatte schließlich nichts zu verlieren.
Ophélie hätte es niemals gewagt, auf solch herausfordernde Weise mit ihrem Mann zu sprechen. Ted spielte sich permanent als Herr des Hauses auf und erwartete, dass seine Familie spurte – mit Ausnahme von Chad, den er von einem gewissen Zeitpunkt an einfach ignorierte. Chad hatte einmal gesagt, er hasse seinen Vater schon seit seinem zehnten Lebensjahr – vor allem sein rechthaberisches, dominantes Verhalten und die Art, wie er auf Menschen, die nicht genauso geistreich waren wie er selbst, herabblickte. Chad war nicht weniger intelligent als sein Vater, aber durch seine Krankheit war er oft chaotisch, und es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren.
Ted wollte nicht akzeptieren, dass sein Sohn kein Musterschüler war, und trotz Ophélies Anstrengungen, zwischen den beiden zu vermitteln, schämte sich Ted für seinen Sohn. Chad wusste das, und dies hatte zahllose heftige Streitigkeiten verursacht.
Einzig Pip schaffte es, sich aus den ständigen Auseinandersetzungen innerhalb ihrer Familie völlig herauszuhalten. Schon in sehr jungem Alter hatte sie sich darum bemüht, zwischen anderen Menschen Frieden zu stiften. Andrea bewunderte diese Seite an ihr. Pip war ein ganz besonderes Mädchen, und jeder, der sie kennenlernte, schien wie verzaubert von ihr zu sein.
Pip war während der vergangenen Monate ein wahrer Segen für Ophélie gewesen. Das Mädchen verstand offenbar, dass sich seine Mutter weder um sie noch um den Haushalt kümmern konnte. Es warf Ophélie nichts vor und verzieh ihr anscheinend jede ausgebliebene Aufmerksamkeit. Insofern verhielt sich Pip gänzlich anders, als Ted oder Chad es getan hätten. Keiner von beiden hätte Ophélies Schwäche toleriert, sogar dann nicht, wenn sie selbst der Grund dafür gewesen wären.
»Was tust du hier so den ganzen Tag über?«, erkundigte sich Andrea nun. Das Baby war an ihrer Brust eingeschlafen.
»Nicht viel. Lesen, schlafen, am Strand spazieren gehen…«
»Mit anderen Worten: Du versteckst dich«, bemerkte Andrea ein wenig spitz.
»Wäre das denn so falsch? Vielleicht ist das genau das, was ich gerade brauche.«
»Kann schon sein, aber du musst dich der Welt irgendwann wieder stellen, Ophélie. Du kannst dich nicht für immer hier verkriechen!«
Allein der Name der Siedlung, in der Ophélie für diesen Sommer ein Haus gemietet hatte, war ein Symbol für das, was sie sich wünschte. Safe Harbour – sicherer Hafen. Ophélie sehnte sich nach einem Rückzugsgebiet, einem Ort, wo sie sich von den Stürmen erholen konnte, die während der vergangenen Jahre über ihr Leben hereingebrochen waren und im letzten Oktober ihren traurigen Höhepunkt erreicht hatten.
»Warum nicht?«, gab Ophélie mit leiser Stimme zurück und sah so verzweifelt aus, dass es Andrea einen Stich versetzte.
»Es ist nicht gut für dich, wenn du dich dermaßen in dich selbst zurückziehst. Früher oder später braucht Pip ihre Mutter wieder. Du kannst dich nicht für immer ausklinken – du musst wieder anfangen zu leben! Du solltest ausgehen und dich mit Leuten treffen, dich mit irgendeinem netten Mann verabreden. Oder willst du etwa auf ewig allein bleiben?« Andrea hätte Ophélie am liebsten vorgeschlagen, sich einen Job zu suchen, aber sie wusste: Ihre Freundin war einfach noch nicht in der Verfassung, wieder zu arbeiten.
»Das kommt überhaupt nicht infrage!«, rief Ophélie entsetzt. Es war für sie unvorstellbar, mit einem anderen Mann als Ted ihr Leben zu teilen. Sie hatte noch immer das Gefühl, mit ihm verheiratet zu sein, und das würde sich wahrscheinlich niemals ändern.
»Du könntest auch mit etwas anderem beginnen. Wie wäre es, wenn du dir zum Beispiel regelmäßig die Haare kämmen würdest?« Immer wenn Andrea ihre Freundin in den vergangenen Wochen gesehen hatte, sah sie zerzaust und ungepflegt aus – manchmal hatte sie sich sogar offensichtlich seit Tagen nicht umgezogen.
Ophélie duschte zwar jeden Tag, aber danach schlüpfte sie meist in das alte Sweatshirt und die Jeans, die sie schon am Vortag getragen hatte. Nur wenn sie zu einem Gruppentreffen fuhr, gab sie sich ein wenig Mühe mit ihrem Äußeren.
In Andreas Augen wurde es langsam Zeit, dass sich Ophélie zusammenriss und ihr Leben wieder in die Hand nahm. Es war ihre Idee gewesen, dass Ophélie und Pip den Sommer in diesem verschlafenen Nest verbrachten. Andrea hatte das Haus für sie aufgetan und alle Formalitäten mit dem Immobilienmakler geklärt. Wie sie nun feststellen konnte, war Safe Harbour die ideale Wahl gewesen. Ophélie hatte seit Monaten nicht besser ausgesehen. Trotz ihres Kummers war sie braun gebrannt und ließ sich sogar ab und an zu einem Lächeln hinreißen.
»Was willst du tun, wenn der Sommer vorüber ist und ihr in die Stadt zurückgeht? Du kannst dich nicht noch einmal einen ganzen Winter lang im Haus einschließen.« »Doch, natürlich!« Ophélie lachte gepresst. »Ich kann alles tun, was ich will!« Sie wussten beide, dass das nicht übertrieben war. Ted war in den vergangenen Jahren zu einem reichen Mann geworden und hatte seiner Frau ein enormes Vermögen hinterlassen. Ophélie vergaß jedoch nie, dass es auch eine Zeit gegeben hatte, in der die vierköpfige Familie in einer winzigen Zweizimmerwohnung in äußerst fragwürdiger Nachbarschaft lebte. Die Kinder teilten sich damals das Schlafzimmer, und Ted und Ophélie schliefen auf einer Ausziehcouch im Wohnzimmer. Doch trotz ihrer finanziellen Nöte waren dies ihre glücklichsten Jahre gewesen. Nachdem sich Ted zu einem führenden Wissenschaftler auf seinem Gebiet hochgearbeitet hatte, war alles viel komplizierter geworden.
»Ich werde dir ordentlich Dampf unterm Hintern machen, wenn du nach Hause kommst und wieder diese Einsiedlernummer abziehst!«, drohte Andrea. »Ich werde dich zwingen, jeden Tag mit William und mir in den Park zu gehen! Oder wir fliegen nach New York und sehen uns irgendein Stück in der Metropolitan Opera an. Ich schleife dich an den Haaren hin, wenn ich muss!«, rief Andrea halb im Ernst.
»Das traue ich dir ohne Weiteres zu!«, gab Ophélie scherzhaft zurück.
Das Baby zuckte im Schlaf zusammen und strampelte mit den Beinchen. Beide Frauen betrachteten den Jungen lächelnd, und seine Mutter streichelte ihm über die Wange. Sie sah keinen Grund, ihn in sein Tragebettchen zu legen. Warum sollte er nicht weiter an ihrer Brust schlafen, wo er am glücklichsten war?
Ein paar Minuten später kehrte Pip zurück, gefolgt von Mousse. In den Händen hielt sie eine Auswahl von kleinen Steinen und Muscheln, die sie vorsichtig auf dem Wohnzimmertisch ablegte – zusammen mit jeder Menge Sand.
»Die sind für dich, Andrea«, sagte Pip strahlend. »Du kannst sie mit nach Hause nehmen.«
»Liebend gern! Darf ich den Sand auch einstecken?«, neckte Andrea die Kleine. »Was hast du da draußen denn so getrieben? Hast du mit Kindern aus der Nachbarschaft die Gegend unsicher gemacht?« Andrea hoffte, dass Pip inzwischen ein paar Freunde gefunden hatte.
Pip zuckte mit den Achseln. Sie war allein herumgestromert. Es geschah äußerst selten, dass sie überhaupt jemandem am Strand begegnete. An einem solch heißen Tag wie heute waren zwar einige Leute auf dem Gebiet des bewachten Strandes unterwegs gewesen, aber Pip hatte niemanden von ihnen gekannt.
»Ich muss euch wohl öfter besuchen, damit ihr endlich mal in die Gänge kommt. Es wird hier doch noch andere Kinder in deinem Alter geben! Vielleicht sollte ich mit dir zum Strand gehen und ein paar von denen ansprechen.«
»Nicht nötig«, winkte Pip ab, so wie ihre Mutter es erwartet hatte. Pip wollte niemandem Umstände bereiten. Sie beschwerte sich niemals über etwas. Sie hatte erkannt, dass es letztlich auch keinen Sinn machte, zu nörgeln – dadurch würde sich nichts ändern. Ihre Mutter war im Augenblick einfach nicht in der Lage, neue Bekanntschaften zu schließen. Pip akzeptierte das. Und sie selbst hatte auch keinen Antrieb, selbst die Initiative zu ergreifen.
Andrea blieb bis zum späten Nachmittag und fuhr kurz vor dem Abendessen nach Hause, denn sie wollte daheim sein, bevor der Nebel heraufzog. Bis sie Ophélie und Pip verließ, hatten sie lachend und schwatzend auf der Terrasse in der Sonne gesessen.
Es war ein rundum schöner Tag gewesen, doch in der Minute, als Andrea und das Baby davonbrausten, verwandelte sich das Haus wieder in einen traurigen, stillen Ort.
»Sollen wir uns vielleicht einen Film ausleihen?«, schlug Ophélie nun lustlos vor.
»Von mir aus nicht, Mom, ich sehe einfach fern«, sagte Pip ruhig.
»Bist du sicher?«
Pip nickte, und sie überlegten wie üblich, was sie zu Abend essen sollten. Ophélie fühlte sich verpflichtet, ihrer Tochter eine nahrhafte Mahlzeit zu kochen, und servierte wenig später Hamburger und Salat. Die Hamburger waren zwar sehr knusprig geraten, aber Pip beklagte sich nicht. Sie wollte ihre Mutter nicht entmutigen, immerhin hatte sie sich aufgerafft und ein Mal keine Pizza in die Röhre geschoben.