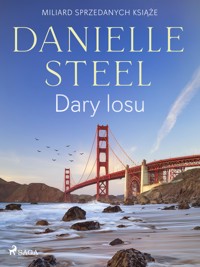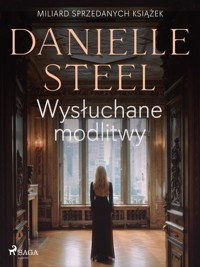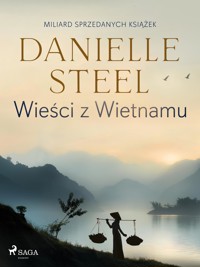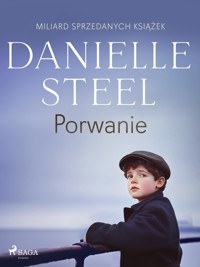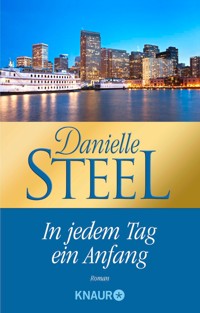
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie kommt aus einer reichen Familie und hätte in ihrem Leben alles haben können. Doch Coco hat der Welt der Reichen den Rücken gekehrt und lebt zurückgezogen an der Küste Kaliforniens. Als sie den Mann ihres Lebens trifft, muss Coco sich entscheiden, wer sie sein will – denn Leslie ist ausgerechnet ein weltbekannter Filmstar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Danielle Steel
In jedem Tag ein Anfang
Roman
Aus dem Amerikanischen von Silvia Kinkel
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ihre Mutter: eine gefeierte Bestsellerautorin; ihr Vater: ein bedeutender Film- und Literaturagent; ihre Schwester Jane: eine einflussreiche Filmproduzentin – Coco Barrington kommt aus allerbestem Haus, lehnt zum Ärger ihrer Familie jedoch den Glamour Hollywoods entschieden ab. Nur äußerst ungern stimmt sie zu, in Janes Abwesenheit deren Nobelvilla in San Francisco zu hüten. Doch als dort ein unerwarteter Gast eintrifft – der weltbekannte Schauspieler Leslie, atemberaubend attraktiv, unwiderstehlich charmant, für den Coco heimlich schwärmt – muss sie sich plötzlich entscheiden zwischen Herz und Verstand.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Für meine geliebten Kinder,
Beatrix, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Maxx und Zara.
Ihr seid die Hoffnung und die Liebe und die Freude meines Lebens!
Von ganzem Herzen und in Liebe,
Mom/d.s.
Was auch immer geschieht, geschehen ist oder noch geschehen wird,
ich glaube an die Liebe, welche unorthodoxe oder außergewöhnliche Form sie auch annehmen mag.
Gib niemals die Hoffnung auf.
d.s.
1. Kapitel
Es war ein perfekter Junitag. Coco Barrington saß auf der Veranda ihres kleinen Hauses in Bolinas und betrachtete den Sonnenaufgang über der Stadt. Sie hatte es sich auf dem verschossenen Liegestuhl vom Flohmarkt gemütlich gemacht und trank einen Becher dampfenden chinesischen Tee. Unweit von ihr stand die verwitterte Holzstatue von Kwan Yin, der Göttin der Barmherzigkeit. Die Statue war ein kostbares Geschenk gewesen. Unter dem wohlwollenden Blick der Göttin bewunderte die hübsche junge Frau die rosa- und orangefarbenen Streifen am Himmel. Die Strahlen der aufgehenden Sonne ließen ihr langes, welliges Haar kupferfarben aufleuchten. Coco war barfuß und trug ein altes Flanellnachthemd, auf dem die verblassten Herzen kaum noch erkennbar waren. Ihr Haus lag über der Bolinas Bay mit Blick auf das Meer und den schmalen Strand. Coco wohnte seit vier Jahren hier, und sie wollte nirgendwo anders sein. Dieses vergessene, ehemalige Fischer- und Holzfällerdorf knapp eine Stunde nördlich von San Francisco war für die 28-Jährige der perfekte Ort zum Leben.
Ihr Heim als Haus zu bezeichnen, war fast schon verwegen. Es war kaum mehr als eine Hütte. Cocos Schwester und ihre Mutter bezeichneten es immer als Bruchbude oder, an ihren gönnerhaften Tagen, als Schuppen. Die beiden konnten nicht verstehen, warum Coco hier leben wollte. In den Augen ihrer Familie war ein Alptraum wahr geworden. Cocos Mutter hatte mit Flehen, Schmeicheln, Drohen und sogar Bestechen versucht, ihre Tochter an den Ort zurückzuholen, den sie als Zivilisation bezeichnete – Los Angeles. Aber für Coco war das Leben ihrer Mutter nicht »zivilisiert«, sondern nur schöner Schein. Die Menschen in L. A., die Art, wie sie lebten, die Ziele, die sie verfolgten, ihre Häuser und die gelifteten Gesichter der Frauen, all das wirkte auf Coco künstlich. Ihr Leben in Bolinas dagegen war einfach, aber echt. Es war unkompliziert und ehrlich, so wie Coco selbst. Sie war in L. A. inmitten dieses Jahrmarkts der Eitelkeiten aufgewachsen und verabscheute alles Aufgesetzte.
Ihre Mutter war seit 30 Jahren Bestsellerautorin von Liebesromanen und hatte eine riesige Fangemeinde. Was sie schrieb, war nicht sonderlich tiefgründig. Sie veröffentlichte ihre Bücher unter dem Pseudonym Florence Flowers, bei dem sie sich des Mädchennamens von Cocos Großmutter bedient hatte. Florence war 62 Jahre alt. Sie war mit Buzz Barrington verheiratet gewesen, dem bedeutendsten Literatur- und Theateragenten von L. A. Vor vier Jahren erlitt Buzz einen tödlichen Schlaganfall. Er war 16 Jahre älter gewesen als seine Frau, aber immer noch so fit, dass sein Tod alle völlig unerwartet traf. In seiner Branche war er einer der mächtigsten Männer gewesen und hatte seine Frau in den 36 Jahren ihrer Ehe umsorgt und gefördert. Er war es, der sie zum Schreiben ermutigte und ihre Karriere unterstützte. Coco hatte sich immer gefragt, ob ihre Mutter auch ohne seine Hilfe eine bekannte Autorin geworden wäre. Florence stellte sich diese Frage nie. Sie zweifelte keine Sekunde lang an dem Wert ihrer Arbeit, genauso wenig, wie sie je ihre eigene Meinung in Frage stellte. Sie machte auch keinen Hehl daraus, dass Coco für sie eine Enttäuschung war, und zögerte nicht, sie als Aussteigerin oder Hippie zu bezeichnen.
Das Urteil von Cocos ebenfalls sehr erfolgreicher Schwester Jane fiel keineswegs milder aus. Für sie war Coco eine »chronische Versagerin«. Jane hielt ihrer Schwester vor, dass ihr aufgrund ihres Elternhauses alle Möglichkeiten offengestanden hätten, etwas aus ihrem Leben zu machen. Stattdessen habe sie jegliche Chance vertan. Sie erinnerte Coco regelmäßig daran, dass es noch nicht zu spät sei, das Ruder herumzureißen. Aber solange sie wie ein Strandhippie in dem Schuppen in Bolinas hause, werde ihr Leben ein einziger Schlamassel bleiben.
Für Coco war es überhaupt kein Schlamassel. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt selbst und lag ihrer Familie nicht auf der Tasche. Sie nahm keine Drogen, hatte weder ständig wechselnde Sexualpartner, noch war sie bislang ungewollt schwanger geworden oder im Gefängnis gelandet. Sie hatte noch nie den Lebenswandel ihrer Schwester kritisiert und diesbezüglich auch keinerlei Ambitionen. Genauso wenig sagte sie ihrer Mutter, dass die sich lächerlich machte, weil sie sich viel zu jugendlich anzog, oder dass ihr letztes Gesichtslifting zu straff ausgefallen war. Coco wollte einfach nur sie selbst sein. Mit dem Luxusleben ihrer Familie hatte sie sich nie anfreunden können. Als Kind hatte sie es gehasst, als Sprössling zweier Berühmtheiten herausgestellt zu werden, und genauso wenig mochte sie es nun, als »jüngere Schwester« einer Berühmtheit in der Presse aufzutauchen. Coco wollte nie so leben wie ihre Familie. Aber zum Knall kam es erst, als sie ihr Jurastudium in Stanford im zweiten Jahr abbrach. Das war jetzt drei Jahre her.
Nach ihrem Abschluss in Princeton hatte sie ihrem Vater versprochen, es mit Jura zu versuchen, und er versicherte ihr, dass es für sie immer einen Platz in seiner Agentur gebe. Er sagte, dass es hilfreich sei, ein Juraexamen zu haben, wenn man ein erfolgreicher Agent werden wolle. Das Problem war nur, dass Coco weder Agentin sein noch für ihren Vater arbeiten mochte. Sie hatte nicht das geringste Bedürfnis, Bestsellerautoren oder Filmstars zu vertreten, die sich ständig danebenbenahmen. Für ihren Vater bedeutete die Agentur nicht nur einen Broterwerb, sie war vielmehr seine wahre Leidenschaft. In Cocos Kindheit war jede Berühmtheit Hollywoods bei ihnen ein und aus gegangen. Sie konnte sich nicht vorstellen, auch noch den Rest ihres Lebens mit diesen Leuten zu verbringen. Insgeheim war sie davon überzeugt, dass ihren Vater der Stress umgebracht hatte, den ihm jene verwöhnten, unverschämten, krankhaft geltungsbedürftigen Menschen bereitet hatten. Für sie klang dieser Job wie ein Todesurteil.
Er war während ihres ersten Jahres an der juristischen Fakultät gestorben. Coco hielt noch ein Jahr lang durch und brach das Studium dann ab. Ihre Mutter war monatelang fassungslos und lag ihr damit noch immer in den Ohren. Sie hatte die »Hütte« ihrer Tochter in Bolinas nur ein einziges Mal gesehen, sich jedoch bis heute nicht von diesem Schock erholt. Nachdem Coco Stanford verlassen hatte, beschloss sie, im Raum San Francisco zu bleiben. Der Norden Kaliforniens gefiel ihr nun mal besser als der Süden. Ihre Schwester Jane war vor drei Jahren ebenfalls hergezogen, pendelte jedoch wegen ihres Jobs zwischen L. A. und San Francisco. Ihre Mutter nahm es beiden Töchtern übel, dass sie weggezogen waren, obwohl Jane sie des Öfteren besuchte. Coco dagegen tat das nur selten.
Jane war 39 und seit neun Jahren eine der wichtigsten Filmproduzentinnen Hollywoods. Sie konnte eine glanzvolle Karriere vorweisen, mit elf Kassenschlagern, die sämtliche Rekorde gebrochen hatten. Jane war bereits viermal für den Oscar nominiert worden. Ihr Erfolg ließ Coco umso schlechter dastehen. Ihre Mutter versäumte nie, Coco gegenüber zu erwähnen, wie stolz ihr Vater auf Jane gewesen war, und dann brach sie wieder in Tränen aus über das verschwendete Leben ihrer jüngeren Tochter. Mit Tränen hatte sie stets bekommen, was sie wollte, vor allem bei Cocos Vater. Buzz hatte seine Frau verwöhnt und seine Kinder vergöttert. Coco gab sich manchmal der Illusion hin, dass sie ihm ihre Entscheidung und die Gründe dafür bestimmt hätte verständlich machen können. Aber in Wahrheit wusste sie, dass das nur eine Wunschvorstellung war. Auch er hätte sie nicht verstanden und wäre von ihr enttäuscht. Als sie nach Stanford ging, hatte er gehofft, dass das Jurastudium ihre liberalen Ansichten verändern würde. Seiner Meinung nach war es in Ordnung, sich Sorgen um den Planeten und seine Mitmenschen zu machen – solange man es nicht übertrieb. Genau den Eindruck hatte er jedoch bei Coco während ihrer Collegezeit. Er hatte Florence damals versichert, dass das Jurastudium dem ein Ende bereiten würde. Aber stattdessen hatte Coco das Studium an den Nagel gehängt.
Ihr Vater hatte ihr mehr als genug Geld zum Leben hinterlassen, aber Coco rührte es nie an. Sie hatte ihr Auskommen mit dem, was sie verdiente, und spendete sogar noch für den Umweltschutz, für den Erhalt bedrohter Tierarten oder die Unterstützung notleidender Kinder in Ländern der Dritten Welt. Ihre Schwester Jane bezeichnete sie deshalb als sentimental. Tatsächlich verfügte Cocos Familie über ein ganzes Repertoire wenig schmeichelhafter Ausdrücke für sie – und alle waren verletzend. Dass sie sentimental sei, gab Coco allerdings bereitwillig zu. Deshalb liebte sie auch die Statue von Kwan Yin. Die Göttin der Barmherzigkeit berührte Coco tief in ihrem Inneren. Coco hatte ein großes Herz und immer das Wohl der anderen im Blick. Und dazu stand sie auch.
Jane hatte als Teenager selbst für einen Skandal gesorgt. Mit 17 konfrontierte sie ihre Eltern mit der Tatsache, dass sie lesbisch sei. Coco war damals erst sechs und bekam gar nicht mit, was für einen Aufschrei ihre Schwester damit verursachte. Jane war damals im letzten Jahr an der Highschool und ging anschließend an die UCLA, um Film- und Fernsehwissenschaften zu studieren. Dort engagierte sie sich aktiv für die Rechte von Lesben. Es hatte ihrer Mutter das Herz gebrochen, als Jane ablehnte, am Debütantinnenball teilzunehmen. Genau genommen hatte Jane gesagt, dass sie eher sterben würde. Aber trotz ihrer sexuellen Ausrichtung und Rebellion in jungen Jahren strebte sie dieselben materiellen Ziele wie ihre Eltern an. Ihr Vater verzieh ihr alles, als er sah, dass sie sich mit ihrer Karriere auf der Überholspur befand. Seit zehn Jahren lebte Jane mit einer bekannten Drehbuchautorin zusammen, die nicht nur ein liebenswürdiger Mensch, sondern ebenfalls sehr erfolgreich war. Die beiden waren nach San Francisco gezogen, weil es dort eine große homosexuelle Szene gab. Ihre Mutter hatte schon seit Jahren kein Problem mehr mit der Tatsache, dass Jane und Elizabeth zusammenlebten. Cocos Hippieleben regte sie dagegen maßlos auf.
Irgendwann ging Florence dazu über, Cocos damaligem Freund die Schuld an allem zu geben. In ihrem zweiten Studienjahr war Coco mit Ian zusammengekommen. Ian White stammte aus Sydney, Australien. Er hatte selbst sieben Jahre zuvor das Jurastudium abgebrochen und war die Personifizierung dessen, was Cocos Eltern nicht für ihre Tochter wollten. Er mochte clever und tüchtig sein und hatte eine gute Schulbildung, war aber – wie Jane es ausdrückte – genauso ein Versager wie Coco. Nachdem Ian sein Studium in Australien geschmissen hatte, kam er nach San Francisco und eröffnete eine Tauch- und Surfschule. Ian gehörte zu jener Art unabhängiger Menschen, die tun, was sie wollen. Coco wusste vom ersten Tag an, dass sie in ihm ihren Seelenverwandten gefunden hatte. Zwei Monate später zogen sie zusammen. Coco war damals 24. Zwei Jahre später kam Ian bei einem Unfall ums Leben. Er wurde beim Drachenfliegen vom Wind gegen die Felsen geschleudert und stürzte ab. Ian war sofort tot und ihre gemeinsamen Träume mit ihm. Sie hatten zusammen das Häuschen in Bolinas gekauft, und nach seinem Tod gehörte es Coco allein. Sie hatte damals eine schwere Zeit durchgemacht. Anfangs waren ihre Mutter und Jane verständnisvoll gewesen, aber nach einem Jahr ging ihnen das Mitgefühl aus. In ihren Augen wurde es Zeit, dass Coco über den Verlust hinwegkam, erwachsen wurde und sich ein eigenes Leben aufbaute. Das tat Coco auch, allerdings anders, als die beiden es sich vorstellten. Und das empfanden sie als schwere Beleidigung.
Coco wusste selbst, dass sie die Erinnerung an Ian endlich loslassen musste. Im letzten Jahr hatte sie sich ein paar Mal mit Männern verabredet, aber niemand konnte Ian das Wasser reichen. Sie hatte noch keinen Mann gefunden, der so voller Energie steckte und so warmherzig und charmant war wie er. Selbst Ian hätte nicht gewollt, dass sie allein blieb. Aber Coco hatte keine Eile. Sie war zufrieden in Bolinas und nahm jeden Tag so, wie er kam. Als Karriere konnte man das nicht bezeichnen. Aber sie wollte und brauchte für ihr Selbstwertgefühl keinen Ruhm – so wie der Rest der Familie. Coco wünschte sich kein großes Haus in Bel Air. Sie wollte nicht mehr als das, was sie mit Ian gehabt hatte: wundervolle Stunden zu zweit, glückliche Tage und leidenschaftliche Nächte. All das würde sie für immer in ihrem Herzen bewahren. In den zwei Jahren seit Ians Tod hatte Coco ihren Frieden damit geschlossen, allein zu sein. Er fehlte ihr, aber sie hatte schließlich akzeptiert, dass er nicht mehr an ihrer Seite war. Sie war nicht verzweifelt darauf aus, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Mit 28 schien nichts davon dringend zu sein.
Als sie damals nach Bolinas zogen, kam ihr das Leben dort sonderbar vor. Die Anwohner des Dorfes bildeten eine lustige kleine Gemeinschaft. Sie hatten schon vor Jahren entschieden, nicht einfach nur unauffällig zu sein, sondern quasi von der Bildfläche zu verschwinden. Sie montierten die Straßenschilder, die den Weg nach Bolinas wiesen, regelmäßig ab, damit der Ort für Fremde nicht so leicht zu finden war. Bolinas war wie eine Zeitschleife, die sie und Ian ein wenig belächelt, aber geliebt hatten. In den 60ern lebten hier Hippies und Blumenkinder, von denen die meisten geblieben waren. Nur dass sie jetzt faltige, wettergegerbte Haut und graue Haare hatten. Die einzigen Geschäfte in der Stadt waren ein Bekleidungsladen, der geblümte Muumuus und Batikhemden verkaufte, ein Restaurant, in dem die alten Surfer tagein, tagaus abhingen, ein Lebensmittelladen, der vor allem Bioprodukte verkaufte, und ein Shop, in dem es Krimskrams und Wasserpfeifen in sämtlichen Farben, Formen und Größen gab. Das Dorf selbst stand auf einem Felsplateau über dem schmalen Strand. Ein Meeresarm trennte es von dem ausgedehnten Stinson Beach mit seinen teuren Strandhäusern. Auch in Bolinas gab es ein paar wunderschöne, versteckt liegende Häuser, aber die meisten waren sehr einfach und wurden von in die Jahre gekommenen Surfern und Leuten bewohnt, die sich entschlossen hatten, der Welt des Konsums und schönen Scheins den Rücken zu kehren. Auf ihre Weise war es eine elitäre Gemeinschaft und der Gegensatz zu der Welt, in der Coco aufgewachsen war. Ian stammte ebenfalls aus einer erfolgreichen Familie, vor der er so wie Coco geflohen war. Jetzt lebte Coco schon seit einiger Zeit allein hier, und sie hatte nicht das geringste Bedürfnis, von hier wegzugehen – egal, was ihre Mutter und ihre Schwester sagten. Der Therapeut, den sie seit Ians Tod bis vor kurzem aufgesucht hatte, war der Meinung, dass sie mit ihren 28 Jahren immer noch gegen das Elternhaus rebelliere. Das war schon möglich, aber soweit es Coco betraf, funktionierte es. Sie war zufrieden mit dem Leben, das sie sich ausgesucht hatte. Und eines wusste sie ganz sicher: Sie würde nie wieder nach L. A. ziehen.
Als die Sonne am Himmel weiter aufstieg, ging Coco ins Haus, um sich eine zweite Tasse Tee zu holen. Sallie, Ians Australian Shepherd, tapste an ihr vorbei. Der Hund war gerade erst aus Cocos Bett geklettert und noch schläfrig. Sallie war sehr unabhängig, aber sie hörte aufs Wort und half Coco bei der Arbeit. Ian hatte Sallie gut ausgebildet und Coco erzählt, dass Australian Shepherds hervorragende Rettungs- und Hütehunde seien.
Während sich Coco Tee einschenkte, trottete Sallie nach draußen in Richtung Strand davon. Es war kurz nach sieben, und Coco wollte noch duschen, bevor sie zur Arbeit fuhr. Sie war gern um acht auf der Golden Gate Bridge und um halb neun an ihrer ersten Station. Coco war stets pünktlich und höchst gewissenhaft. Was sie in ihrer Familie über harte Arbeit und Erfolg gelernt hatte, kam ihr nun zustatten. Coco besaß eine außergewöhnliche kleine Firma, mit der sie erstaunlich gut verdiente. Seit Ian ihr vor drei Jahren geholfen hatte, ihr »Unternehmen« auf die Beine zu stellen, war ihr Service gefragt. Und in den zwei Jahren seit seinem Tod war es enorm gewachsen. Coco musste die Zahl ihrer Kunden begrenzen, denn sie war gern um vier wieder zu Hause, um mit Sallie einen Spaziergang am Strand zu machen, bevor es dämmerte.
Cocos Nachbarn in Bolinas waren eine Aromatherapeutin auf der einen und ein Akupunkteur auf der anderen Seite, die beide in der Stadt arbeiteten. Der Akupunkteur war mit einer Lehrerin der Schule in Bolinas verheiratet, und die Aromatherapeutin lebte mit einem Feuerwehrmann zusammen. Sie alle waren sehr hilfsbereit. Nach Ians Tod hatten sie sich rührend um Coco gekümmert. Die Lehrerin etwa hatte sie auf andere Gedanken bringen wollen und sie mit einem ihrer Freunde bekannt gemacht. Ein paar Mal war Coco mit ihm ausgegangen, aber bei ihr hatte es nicht gefunkt. Am Ende waren sie Freunde geworden, was Coco genügte.
Nach einer heißen Dusche ging Coco nun hinaus zu ihrem alten Van. Ian hatte ihn für sie bei einem Autohändler in Inverness entdeckt. Der verbeulte Van war genau das, was sie brauchte, auch wenn er schon Tausende Meilen drauf hatte. Der Wagen war keine Schönheit und die ursprüngliche Farbe kaum noch erkennbar, aber er lief tadellos. Ian hatte ein Motorrad gehabt, mit dem sie an den Wochenenden herumfuhren, wenn sie nicht mit seinem Boot unterwegs waren. Mit dem Motorrad war sie seit seinem Tod nicht mehr gefahren. Es stand immer noch in der Garage hinter dem Haus. Coco brachte es einfach nicht fertig, sich davon zu trennen. Zumindest sein Boot hatte sie verkauft, und die Tauchschule war geschlossen, da es niemanden gab, der sie hätte weiterführen können.
Coco öffnete die Tür zum Laderaum, und Sallie sprang aufgeregt hinein. Ihr Strandlauf hatte sie munter werden lassen, und sie war bereit zur Arbeit. Coco lächelte den großen, schwarz-weißen Hund an. Jemand, der die Rasse nicht kannte, konnte Sallie leicht für eine Promenadenmischung halten, aber sie war reinrassig, mit ernsten blauen Augen. Coco schloss die Tür und setzte sich ans Steuer. Im Vorbeifahren winkte sie ihrem Nachbarn zu, der gerade von seiner Nachtschicht bei der Feuerwehr von Stinson Beach nach Hause kam.
Coco folgte der kurvenreichen Straße am Rand des Kliffs und fuhr in Richtung Stadt, die in einiger Entfernung im Licht der Morgensonne schimmerte. Es würde ein wunderschöner Tag werden, was ihr die Arbeit erleichterte. Und so, wie sie es einschätzte, war sie um acht auf der Brücke. Sie würde pünktlich bei ihrem ersten Kunden sein. Ihre Auftraggeber hätten kein Problem damit gehabt, wenn sie sich verspätete, aber für Coco war Pünktlichkeit wichtig. Sie war längst nicht die unzuverlässige Person, die ihre Familie in ihr sah.
Sie nahm die Abzweigung nach Pacific Heights und fuhr in südlicher Richtung auf der Divisadero. Als sie kurz vor der Broadway Street war, klingelte ihr Handy. Es war ihre Schwester Jane.
»Wo bist du?«, fragte Jane kurz angebunden.
Sie klang immer so, als handle es sich um einen Notfall. Sie lebte in einem Dauerzustand von Stress. Das entsprach der Natur ihrer Branche und harmonierte vollkommen mit ihrer Persönlichkeit. Ihre Lebenspartnerin, Elizabeth, war wesentlich entspannter und der Ruhepol in der Beziehung der beiden. Coco mochte Liz. Liz war 43 Jahre alt und genauso talentiert und erfolgreich wie Jane. Sie hatte einen Master in englischer Literatur und summa cum laude in Harvard promoviert. Bevor sie nach Hollywood kam, um Drehbücher zu schreiben, hatte sie einen düsteren, aber interessanten Roman veröffentlicht. Seither hatte sie viele Drehbücher geschrieben und im Laufe der Jahre zwei Oscars gewonnen. Sie und Jane hatten sich vor zehn Jahren bei Dreharbeiten kennengelernt und waren seither unzertrennlich. Ihre Beziehung war solide und funktionierte perfekt. Die beiden betrachteten sich als Partner fürs Leben.
»Ich bin auf der Divisadero. Warum?«, gab Coco lustlos zurück. Es ärgerte sie, dass Jane nie fragte, wie es ihr ging, sondern ihr einfach nur sagte, was sie von ihr wollte. Aber so war ihre Beziehung von Kindheit an gewesen. Coco war und blieb Janes Laufbursche, trotz der vielen Stunden, die sie schon mit ihrem Therapeuten darüber gesprochen hatte. Sie wollte es ja ändern, schaffte es aber nicht. Sallie saß auf dem Beifahrersitz und beobachtete Coco aufmerksam, als spüre sie die Anspannung.
»Gut. Ich brauche dich sofort«, antwortete Jane.
Sie klang erleichtert und gleichzeitig gehetzt. Coco wusste, dass ihre Schwester und Liz in Kürze wegen eines Films, bei dem die beiden Co-Produzenten waren, nach New York fliegen wollten.
»Wofür brauchst du mich?«, fragte Coco misstrauisch, und Sallie legte den Kopf schief.
»Ich stecke in der Klemme. Mein Homesitter hat mir soeben abgesagt, und ich muss in einer Stunde los.«
Die Verzweiflung war Jane anzuhören.
»Ich dachte, du würdest erst nächste Woche fliegen?«, erwiderte Coco argwöhnisch, während sie an der Broadway Street vorbeifuhr. Ihre Schwester wohnte nur wenige Blocks von hier, in einem atemberaubenden Haus mit Blick auf die Bucht. Dieser Stadtteil wurde als Gold Coast bezeichnet. Hier standen die teuersten Villen. Und zweifellos war die von Jane eine der schönsten – wenn auch nicht Cocos Stil. Genauso wenig, wie Jane Cocos Haus gefiel. Die beiden Schwestern waren so unterschiedlich, als stammten sie von verschiedenen Planeten.
»Die Tontechniker am Set wollen streiken. Liz ist gestern schon hingeflogen. Heute Abend muss ich ebenfalls da sein und mich mit den Gewerkschaftern treffen, aber ich habe niemanden für Jack. Meine Homesitterin muss für unbestimmte Zeit zu ihrem kranken Vater nach Seattle. Sie hat mich soeben angerufen, und mein Flug geht in zwei Stunden.«
Stirnrunzelnd hörte Coco zu. Sie konnte eins und eins zusammenzählen. Diese Situation kam ihr bekannt vor. Coco war stets die Notlösung, wenn es bei ihrer Schwester Probleme gab. Da sie in Janes Augen sowieso kein richtiges Leben führte, erwartete die stets von ihr, auf der Stelle alles stehen und liegen zu lassen und ihr zu Hilfe zu eilen. Und Coco würde der Schwester, die sie ein Leben lang eingeschüchtert hatte, nie etwas abschlagen. Jane dagegen hatte kein Problem damit, nein zu sagen. Das war ein Grund für ihren Erfolg. Coco hatte jedoch Mühe, dieses Wort in ihrem Wortschatz zu finden. Dessen war sich Jane vollauf bewusst, und sie nutzte es bei jeder Gelegenheit aus.
»Ich werde vorbeischauen und mit Jack Gassi gehen«, bot Coco vorsichtig an.
»Du weißt, dass das nicht funktioniert«, erwiderte Jane verärgert. »Er wird depressiv, wenn abends niemand nach Hause kommt. Dann heult er die ganze Nacht und treibt die Nachbarn in den Wahnsinn. Außerdem brauche ich jemanden, der auf das Haus aufpasst.«
Jack war in etwa so groß wie Cocos Haus in Bolinas. Aber falls es nötig war, würde Coco ihn mit dorthin nehmen. »Möchtest du, dass ich ihn zu mir hole, bis du einen neuen Homesitter gefunden hast?«
»Nein«, entgegnete Jane energisch. »Du musst bei mir wohnen.« Du musst, diese Formulierung hörte Coco wohl zum tausendsten Mal. Kein würdest du bitte … könntest du vielleicht … würde es dir etwas ausmachen. Verdammt. Das war wieder mal eine Gelegenheit, nein zu sagen. Coco öffnete den Mund, aber kein Ton kam ihr über die Lippen. Sie blickte zu Sallie, die sie reglos anstarrte.
»Sieh mich nicht so an«, sagte Coco zu dem Hund.
»Was?«, fragte Jane gehetzt.
»Schon gut. Warum kann er nicht bei mir wohnen?«
»Weil er gern zu Hause in seinem eigenen Bett schläft«, erwiderte Jane mit fester Stimme.
Coco verdrehte die Augen. Sie war einen Block entfernt vom Haus ihres Kunden und wollte nicht zu spät kommen, aber irgendetwas sagte ihr, dass sie genau das tun würde. Ihre Schwester übte einen Sog auf sie aus wie der Mond auf die Gezeiten, eine Kraft, der sich Coco nicht widersetzen konnte.
»Ich schlafe auch gern in meinem Bett«, antwortete Coco und bemühte sich, entschlossen zu klingen. Aber damit überzeugte sie niemanden, am wenigsten Jane. »Und ich werde auf keinen Fall fünf Monate lang auf dein Haus aufpassen«, fügte sie hinzu. Coco wusste, dass Jane und Liz mindestens so lange in New York bleiben wollten. Und Dreharbeiten zogen sich manchmal in die Länge. Es konnten leicht sechs oder sieben Monate daraus werden.
»Na fein. Ich werde schon jemand anderen finden«, sagte Jane missbilligend, als wäre Coco ein ungezogenes Kind. Damit bekam Jane sie jedes Mal zu packen, und wenn sich Coco noch so oft sagte, dass sie erwachsen war. »Aber das kann ich nicht in der einen Stunde bis zu meiner Abreise. Ich werde mich von New York aus darum kümmern. Gütiger Gott. Man könnte meinen, ich hätte dich gebeten, in der Bronx abzusteigen. Es gibt weitaus Schlimmeres, als fünf Monate in meiner Villa zu verbringen. Es würde dir guttun, und du müsstest nicht immer pendeln.« Jane zog alle Register.
Aber Coco hasste das Haus ihrer Schwester. Es war wunderschön, makellos – und kalt. Es war in beinahe jeder Zeitschrift für Design vorgestellt worden, und Coco fühlte sich dort jedes Mal unwohl. Es gab keinen Platz, um sich einzuigeln und behaglich zu fühlen. Und es war so sauber, dass Coco dort jedes Mal Angst hatte, auch nur zu atmen, geschweige denn, etwas zu essen. Jane und Liz waren Ordnungsfanatiker. Coco dagegen fand ein bisschen Unordnung gemütlich. Das trieb Jane in den Wahnsinn.
»Ich springe für ein paar Tage ein, maximal eine Woche. Aber du musst dich um jemand anderen kümmern. Ich will nicht monatelang in deinem Haus wohnen«, erklärte Coco entschieden in dem Versuch, ihrer Schwester Grenzen zu setzen.
»Ist angekommen. Ich werde tun, was ich kann. Wenn du ein paar Nächte bleibst, ist mir erst mal geholfen. Kannst du sofort kommen und dir die Schlüssel holen? Ich möchte dir die Alarmanlage noch einmal erklären, wir haben ein paar Sachen ergänzt. Ich will nicht, dass du aus Versehen den Alarm auslöst. Jacks Futter kannst du bei Canine Cuisine abholen, sie bereiten es zweimal wöchentlich für ihn zu, montags und donnerstags. Und vergiss nicht, dass wir den Tierarzt gewechselt haben. Wir sind jetzt bei Dr. Hajimoto auf der Sacramento Street. Jack bekommt nächste Woche eine Auffrischungsimpfung.«
»Wie gut, dass du keine Kinder hast«, erwiderte Coco trocken und wendete den Van. Sie würde wirklich zu spät bei ihrem Kunden sein, aber dann hatte sie es zumindest hinter sich. Andernfalls würde Jane sie doch nur verrückt machen. »Dann könntest du nie die Stadt verlassen.«
Der Bullmastiff war für Jane und Liz zum Ersatzkind geworden. Er bekam speziell für ihn zubereitete Nahrung, hatte einen Trainer und einen Hundefriseur, die ins Haus kamen, und erhielt mehr Aufmerksamkeit als manch ein Kind von seinen Eltern. Coco fuhr hoch zum Haus ihrer Schwester. In der Einfahrt wartete bereits eine Limousine, die Jane zum Flughafen bringen würde. Coco stellte den Van ab und stieg aus. Sallie blieb im Wagen und beobachtete alles neugierig durch das Wagenfenster. Sie würde in den nächsten Tagen viel Spaß mit Jack haben. Der Bullmastiff war dreimal so groß wie sie, und wenn sie sich gegenseitig jagten, würde eine Menge im Haus zu Bruch gehen. Vielleicht erlaubte Coco ihnen sogar, im Pool zu schwimmen. Das Einzige, was Coco an dem Haus mochte, war der überdimensionale Bildschirm im Schlafzimmer, auf dem sie sich vom Bett aus Filme ansehen konnte.
Coco klingelte an der Haustür. Schon im nächsten Moment wurde sie aufgerissen, und Jane stand vor ihr, das Handy ans Ohr gepresst. Sie machte irgendjemandem die Hölle heiß wegen der Gewerkschafter. Die beiden Frauen sahen sich recht ähnlich. Beide waren groß, schlank und ausgesprochen hübsch. Als Teenager hatten sie beide gemodelt. Der auffälligste Unterschied zwischen ihnen bestand darin, dass Jane eine eher knabenhafte Figur und lange blonde Haare hatte, die sie zu einem Pferdeschwanz gebunden trug. Cocos kastanienbraunes Haar, das ihr bis zur Taille reichte, und die weiblicheren Rundungen ließen sie weicher wirken. Außerdem schimmerte in Cocos Augen oft ein Lächeln, während Jane der personifizierte Stress war. Sie strahlte etwas Kühles aus, das war schon als Kind so gewesen. Aber alle, die sie besser kannten, wussten, dass sich hinter dem messerscharfen Mundwerk ein gutes Herz verbarg. Dennoch konnte sie knallhart sein, das wusste Coco nur allzu gut.
Jane trug eine schwarze Jeans, eine schwarze Lederjacke und Diamantohrstecker. Coco hatte ein weißes T-Shirt an, eine blaue Jeans, die ihre langen, wohlgeformten Beine betonte, und wie immer bei der Arbeit Laufschuhe. Dazu hatte sie ein verwaschenes Sweatshirt um die Taille geknotet. Coco wirkte viel jünger, als sie war. Janes eleganter Stil dagegen machte sie älter. Ungeachtet dessen sahen beide Frauen so auffallend gut aus wie ihr berühmter Vater. Ihre Mutter war so blond wie Jane, jedoch kleiner und hatte weiblichere Rundungen. Ihr Vater hatte pechschwarzes Haar gehabt, demzufolge musste Coco ihre kastanienbraune Mähne von einem Teil ihrer Großeltern geerbt haben.
»Gott sei Dank!«, sagte Jane.
In dem Moment kam auch schon der riesige Bullmastiff angerannt, stellte sich auf die Hinterbeine und legte Coco die Vorderpfoten auf die Schultern. Er wusste, was es bedeutete, wenn sie da war: Happen von dem Essen, das auf dem Tisch stand (was sonst streng verboten war), und in dem riesigen Bett im Hauptschlafzimmer zu schlafen, was Jane nie erlaubte. Die liebte ihren Hund zwar über alles, war aber auch eine Verfechterin klarer Regeln. Sogar Jack wusste, dass Coco nicht nein sagen konnte. Er wedelte mit dem Schwanz und leckte ihr übers Gesicht, was eine wesentlich herzlichere Begrüßung war als jene, die sie von Jane bekommen hatte.
Jane reichte Coco einen Schlüsselbund und ein Informationsblatt über die neue Alarmanlage. Sie wiederholte die Anweisungen bezüglich Tierarzt, Impfung und Jacks Futter und gab Jane mit dem Tempo eines Schnellfeuergewehrs etwa ein Dutzend weitere Instruktionen.
»Und ruf sofort an, falls mit Jack irgendetwas sein sollte«, beendete sie ihren Vortrag.
Coco wollte fragen: »Und falls mit mir etwas sein sollte?«, aber das hätte Jane nicht lustig gefunden.
»Wir werden versuchen, ab und zu am Wochenende herzukommen, damit du mal Pause machen kannst. Aber noch weiß ich nicht, wann wir wegkönnen, vor allem wegen diesem Ärger mit der Gewerkschaft.«
Sie klang hektisch und erschöpft, noch bevor sie überhaupt in New York angekommen war. Aber Coco wusste, dass Jane hervorragend in ihrem Job war und das Kind schon schaukeln würde.
»Moment mal«, sagte Coco, weil ihr plötzlich mulmig wurde. »Ich mache das hier für ein paar Tage, richtig? Höchstens eine Woche. Ich werde auf keinen Fall die ganze Zeit hier wohnen«, stellte sie noch einmal klar, damit es ja kein Missverständnis gab.
»Ich weiß, ich weiß. Man sollte eigentlich meinen, dass du dich freust, mal in einem anständigen Haus zu wohnen.«
Statt ihr dankbar zu sein, sah Jane sie verärgert an.
»Es ist dein ›anständiges‹ Haus«, betonte Coco. »Mein Zuhause ist in Bolinas«, sagte sie fest.
»Lass uns jetzt nicht davon anfangen«, erwiderte Jane und warf Coco einen vielsagenden Blick zu. Dann wurden ihre Züge weicher. »Danke, dass du mich herausboxt, Kleines. Ich weiß das zu schätzen. Es ist toll, dich als kleine Schwester zu haben.« Sie schenkte ihr jenes anerkennende Lächeln, das so selten war und das Coco ihr Leben lang dazu gebracht hatte, ihrer Schwester gefallen zu wollen. Aber um ein solches Lächeln zu bekommen, musste man eben tun, was Jane wollte.
Coco hätte sie gern gefragt, warum sie eine tolle kleine Schwester war. Weil sie nach ihrer Pfeife tanzte? Aber sie nickte nur schweigend und hasste sich dafür, dass sie so schnell nachgegeben hatte. Wie immer hatte sie sich kampflos gefügt. Widerstand war ohnehin zwecklos, Jane gewann sowieso. Sie würde immer die große Schwester sein, die Coco bei jedem Spiel schlug und sie mehr einzuschüchtern vermochte als ihre Eltern.
»Lass mich nicht hier sitzen«, sagte Coco mit beinahe flehender Stimme.
»Ich werde dich anrufen und dir Bescheid geben«, lautete Janes kryptische Antwort. Dann stürzte sie ins Nebenzimmer, wo zwei Telefone gleichzeitig klingelten. »Nochmals danke«, rief sie über die Schulter hinweg.
Coco seufzte und tätschelte dem Hund den Kopf. »Bis nachher, Jack«, sagte sie leise, schloss die Tür hinter sich und ging zurück zu ihrem Van. Sie würde 20 Minuten zu spät bei ihrem Kunden sein. Während sie losfuhr, beschlich sie das unangenehme Gefühl, dass Jane sie monatelang hier schmorenlassen würde. Sie kannte ihre Schwester leider nur allzu gut.
Fünf Minuten später war sie beim Haus ihres Kunden angelangt. Sie holte eine Schließkassette aus dem Handschuhfach ihres Wagens, tippte die Zahlenkombination ein und holte einen Schlüsselbund heraus, an dem ein kleines Schild mit einem Nummerncode hing. Sie hatte Schlüssel zu den Häusern all ihrer Kunden. Die vertrauten ihr blind. Jetzt stand sie vor einem Backsteinhaus, das fast so groß wie Janes Villa und von gepflegten Hecken umgeben war. Coco ging zur Hintertür, schaltete den Alarm aus, öffnete die Tür und pfiff laut. Innerhalb weniger Sekunden tauchte eine graublaue Dänische Dogge auf und wedelte bei Cocos Anblick begeistert mit dem Schwanz.
»Hi, Henry, wie läuft’s, mein Junge?« Sie hakte seine Leine am Halsband ein, schaltete den Alarm wieder ein und zog die Tür hinter sich zu. Dann ließ sie die Dogge in den Van steigen, wo sie begeistert von Sallie begrüßt wurde. Die beiden bellten sich freudig an und begannen sofort, freundschaftlich zu balgen.
Coco fuhr zu vier weiteren, ähnlich luxuriösen Häusern in der Nähe und sammelte einen überraschend sanftmütigen Dobermann, einen Rhodesian Ridgeback, einen Irischen Wolfshund und einen Dalmatiner ein. Ihr erster Auslauf des Tages fand immer mit den größten Hunden statt. Die brauchten die Bewegung am meisten. Sie fuhr zum Ocean Beach, wo sie und die Hunde meilenweit laufen konnten. Manchmal fuhr sie mit ihnen auch in den Golden Gate Park. Und falls nötig, half Sallie ihr, den Trupp zusammenzuhalten. Seit drei Jahren ging Coco mit den Hunden der reichen Elite von Pacific Heights Gassi. Nie hatte es einen unangenehmen Zwischenfall gegeben oder war ihr ein Hund abhandengekommen. Sie genoss einen ausgezeichneten Ruf. Sicher würde sie diesen Job nicht für den Rest ihres Lebens machen wollen, aber momentan war Coco damit zufrieden.
Sie lieferte den letzten der großen Hunde wieder zu Hause ab. Als Nächstes würde sie die mittelgroßen Hunde ausführen. Die kleinsten kamen erst um die Mittagszeit dran, da sie schon morgens mit ihren Besitzern spazieren waren. Bevor Coco dann am Nachmittag wieder zurück nach Marin fuhr, ging sie noch einmal eine Runde mit den großen Hunden. Ihr Handy klingelte. Es war Jane. Sie saß bereits im Flugzeug und redete hastig, denn jeden Moment würde die Ansage kommen, man solle die Handys ausschalten.
»Ich bin noch mal meinen Kalender durchgegangen – Jack muss erst in zwei Wochen zur Impfung und nicht in einer.«
Manchmal wunderte sich Coco, dass Janes Kopf nicht platzte von all den Kleinigkeiten, die sie gleichzeitig im Auge behalten musste. Kein Detail entging ihrer Aufmerksamkeit. Mit ihrem autoritären Führungsstil managte sie alles und jeden in ihrem Leben, auch ihren Hund.
»Mach dir keine Sorgen. Wir kommen schon klar«, versicherte Coco ihrer Schwester. Der Strandlauf hatte sie besänftigt. »Amüsier dich gut in New York.«
»Ganz bestimmt nicht.«
Jane erinnerte Coco an einen Draht kurz vorm Durchglühen. Aber sie wusste, dass Jane ruhiger werden würde, sobald sie wieder mit Liz zusammen war. Ihre Partnerin hatte einen wohltuenden Einfluss auf sie.
»Versuch es wenigstens. Und vergiss nicht, dir einen neuen Homesitter zu suchen«, erinnerte Coco sie.
»Nein, bestimmt nicht.« Jane seufzte. »Und danke noch mal, dass du mich gerettet hast. Es bedeutet mir viel, dass Jack und das Haus in guten Händen sind.« Ihre Stimme klang nun sanfter.
»Bitte.« Coco lächelte matt und fragte sich, warum ihr die Anerkennung ihrer Schwester bloß so wichtig war. Und warum es so weh tat, wenn sie die nicht bekam. Ihr war klar, dass sie früher oder später den Mut aufbringen musste, ihrer Schwester Paroli zu bieten. Sonst würde sie sich nie abnabeln. Aber noch war sie nicht so weit.
2. Kapitel
Um sechs Uhr abends fuhr Coco zurück in die Stadt. Sie hatte zu Hause eine Tasche mit Sweatshirts, Jeans, Ersatzlaufschuhen, frischer Unterwäsche und einem Stapel ihrer Lieblings-DVDs gepackt, die sie sich auf Janes Großbildschirm ansehen wollte. Gerade war sie über die Mautstelle gefahren, da klingelte ihr Handy. Es war Jane. Sie war inzwischen in dem Apartment in New York angekommen, das sie und Liz gemietet hatten.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Jane. Sie klang besorgt.
»Ich bin unterwegs zu dir«, beruhigte Coco sie. »Jack und ich werden bei Kerzenlicht zu Abend essen, während sich Sallie im Fernsehen ihre Lieblingsshow ansieht.« Coco verdrängte den Gedanken an die Zeit, als Ian und sie abends gemeinsam gekocht hatten und im Mondschein am Strand spazieren gegangen waren. Damals führte sie noch ein eigenes Leben, statt Designer-Mahlzeiten für den Hund ihrer Schwester zuzubereiten.
In jenem Sommer hatten sie heiraten wollen. Es sollte eine schlichte Zeremonie am Strand werden, mit anschließender Grillparty für ihre Freunde. Ihrer Mutter hatte sie damals noch nichts erzählt, die hätte einen Anfall bekommen. Irgendwann wollten sie nach Australien gehen und dort eine Tauchschule eröffnen. Coco schob die Erinnerungen rasch beiseite, sie machten sie nur wehmütig. Diese Zeiten waren ein für alle Mal vorbei.
Nun kam Liz an den Apparat und bedankte sich, dass Coco auf Jack und das Haus aufpasste.
»Ist schon okay. Ich freue mich, dass ich euch helfen kann – vorausgesetzt, dass es nicht zu lang wird.« Coco wollte, dass sich auch Liz darüber im Klaren war.
»Wir werden jemanden finden, versprochen«, versicherte Liz und war ehrlich dankbar für Cocos Unterstützung. Im Gegensatz zu Jane sah sie Cocos Hilfe nie als selbstverständlich an.
»In Ordnung«, sagte Coco. »Wie ist es in New York?«
»Gut – wenn wir den Streik verhindern können. Aber mit ein bisschen Glück erzielen wir heute Abend eine Einigung.«
Sie klang hoffnungsvoll. Sie war aus tiefstem Herzen eine Friedensstifterin. Jane war von beiden die Kämpferin.
Coco wünschte ihr viel Erfolg und hielt vor dem Haus. Manchmal beneidete sie Jane und Liz um ihre Beziehung. Sie kamen so gut miteinander klar, wie es unter Ehepaaren längst nicht selbstverständlich war. Coco war mit dem Wissen aufgewachsen, dass ihre ältere Schwester Frauen liebte, und sie hatte deren Lebensstil nie in Frage gestellt. Viel schwieriger war es für sie, dass Jane alle Leute in ihrem Umfeld wie eine Dampfwalze überrollte, um an ihr Ziel zu kommen. Nur Liz schien in der Lage zu sein, Jane im Zaum zu halten, und selbst ihr gelang das nicht immer. Von den Eltern verwöhnt und für ihre Erfolge bewundert, war Jane es gewohnt zu bekommen, was sie wollte. Coco hatte stets an zweiter Stelle gestanden, in Janes Schatten, zumindest hatte sie es so empfunden. Und daran hatte sich bis heute nichts geändert. Nur während sie mit Ian zusammen gewesen war, hatte sie nicht darunter gelitten. Damals war ihr Janes Anerkennung nicht so wichtig gewesen. Dass Ian sie liebte, war das Einzige gewesen, was damals für sie zählte. Die Vorstellung, mit ihm nach Australien zu gehen, hatte sie begeistert und regelrecht beflügelt. Und jetzt war sie hier, im Haus ihrer Schwester, und passte mal wieder auf deren Hund auf. Was wäre wohl, wenn Ian noch lebte? Dann müsste Jane jemand anderen finden, der für sie einsprang. Wie würde es sich anfühlen, Jane eine Abfuhr zu erteilen? Wäre sie dann endlich erwachsen? Oder bliebe sie das kleine ungezogene Mädchen, das nicht tat, was die große Schwester wollte? Darauf wusste Coco keine Antwort. Und wenn sie ehrlich war, wollte sie die Antwort gar nicht finden. Es war einfacher zu tun, was Jane von ihr verlangte.
Coco fütterte die Hunde und schaltete den Fernseher ein. Sie machte es sich auf dem weißen Mohairsofa bequem und legte die Füße auf den weißlackierten Couchtisch. Der Teppich war ebenfalls weiß und aus dem Haar irgendeines seltenen südamerikanischen Tieres gewebt. Coco erinnerte sich vage daran. Jane und Liz hatten das Haus von einem berühmten mexikanischen Architekten gestalten lassen. Es war wunderschön, aber dazu gedacht, sich mit makelloser Kleidung, gewaschenen Händen und brandneuen Schuhen darin zu bewegen. Coco hatte oft das Gefühl, einen Fleck zu hinterlassen, sobald sie nur etwas berührte. Und ihre Schwester würde ihn sofort sehen. Das setzte sie unter Druck, und außerdem war es hier längst nicht so gemütlich und bequem wie in ihrer »Hütte« in Bolinas.
Schließlich ging sie in die Küche, um nach etwas Essbarem zu suchen. Da Elizabeth und Jane früher als geplant aufgebrochen waren, hatten sie keine Zeit mehr gehabt, den Kühlschrank zu füllen. Coco fand lediglich einen Kopf Salat, zwei Zitronen und eine Flasche Weißwein. Im Schrank standen eine Packung Nudeln und Olivenöl. Coco kochte die Nudeln und machte sich dazu den Salat. Währenddessen trank sie von dem Wein. Plötzlich fingen die Hunde an, wie verrückt zu bellen. Sie standen vor der Terrassentür, die in den Garten hinausging. Coco schaute sofort nach, was los war. Im Garten tobten zwei Waschbären herum. Es dauerte ein paar Minuten, bis Coco die Hunde beruhigt hatte und die Waschbären endlich verschwanden. Plötzlich roch es verkohlt, wie bei einem Kabelbrand. Coco schnupperte. Sie lief in alle Zimmer, die Treppe rauf und runter, fand jedoch nichts. Schließlich führte ihre Nase sie in die Küche. Das Nudelwasser war verkocht, und die Nudeln klebten als schwarze Masse am Topfboden.
»Verdammt!«, murmelte Coco, schob den Topf ins Spülbecken und ließ kaltes Wasser hineinlaufen. Qualm stieg auf, und sogleich heulte der Feueralarm los. Und noch bevor sie bei der Feuerwehr anrufen konnte, hörte sie schon die Sirenen, und zwei Feuerwehrwagen kamen in die Einfahrt geschossen. Verlegen erklärte sie den Feuerwehrmännern, was passiert war. Das war gar nicht so leicht, denn die Hunde kläfften wie verrückt. Und dann klingelte auch noch Cocos Handy. Natürlich Jane.
»Ist etwas passiert? Die Feuerwehr hat bei mir angerufen. Brennt es im Haus?« Sie klang panisch.
»Es ist alles okay«, versicherte Coco. »Warte mal einen Moment.« Sie bedankte sich noch einmal bei den Feuerwehrmännern. Die gingen zurück zu ihren Wagen, und Coco schloss die Tür. Sie musste den Alarm wieder einschalten, wusste aber nicht genau, wie das ging. Das mochte sie Jane jedoch nicht auf die Nase binden. »Ich habe Nudeln anbrennen lassen. Im Garten waren zwei Waschbären, und die Hunde haben verrücktgespielt. Während ich sie beruhigte, habe ich die Nudeln vergessen.«
»Gütiger Gott, du hättest das Haus in Schutt und Asche legen können.« Janes Stimme überschlug sich.
»Ich kann jederzeit zurück nach Bolinas fahren«, bot Coco an.
»Ist schon gut. Aber versuch wenigstens, niemanden umzubringen und das Haus nicht abzufackeln.« Jane erinnerte Coco noch daran, den Alarm wieder einzuschalten.
Kurz darauf saß Coco an der Theke mitten in der makellosen schwarzen Granitküche und aß Salat. Sie war müde, hungrig und wollte nach Hause.
Nachdem sie gegessen hatte, stellte sie die Salatschüssel in die Spülmaschine und warf den verkokelten Topf weg. Dann schaltete sie das Licht aus und ging, gefolgt von den zwei Hunden, nach oben ins Schlafzimmer. Erst dort fiel ihr auf, dass unter ihrem Schuh ein Salatblatt klebte. Coco kam sich vor wie ein Elefant im Porzellanladen. Sobald sie in den Orbit ihrer Schwester eintrat, verließ sie ihre Selbstsicherheit, und sie fühlte sich unbeholfen. Erschöpft zog sie die Schuhe aus und ließ sich auf das Bett fallen. Sogleich sprangen die Hunde neben sie. Coco lachte. Ihre Schwester würde sie umbringen.
Sie schob eine DVD in den Player und sah sich einen ihrer Lieblingsfilme an. Im Haus stank es immer noch nach den angebrannten Nudeln. Sie würde den Topf ersetzen müssen. Cocos Gedanken schweiften zu Ian und Bolinas, und sie schlief schon nach der Hälfte des Films ein.
Sobald sie am nächsten Morgen erwachte, eilte sie unter die Dusche und zog sich an. Sie überlegte kurz, ob sie sich einen Tee kochen sollte, entschied sich aber dagegen. Sie lotste beide Hunde zum Auto und machte sich auf den Weg zu ihrem ersten Kunden. Zum Glück rief Jane ausnahmsweise nicht an.
Nach ihrer üblichen Runde mit den Hunden im Presidio, im Golden Gate Park und am Crissy Field war sie um vier Uhr nachmittags zurück im Haus an der Broadway Street. Müde ließ sie sich in den Jacuzzi sinken. Coco hatte bereits beschlossen, heute nicht zu kochen, sondern sich Essen vom Chinesen bringen zu lassen und wieder einen ihrer Lieblingsfilme anzuschauen.
Sie hatte gerade eine Frühlingsrolle verdrückt und probierte das würzige Rindfleisch, da rief ihre Mutter aus L. A. an. Jack saß sabbernd in Augenhöhe der Tischplatte und Sallie neben ihm.
»Hi, Mom«, begrüßte Coco ihre Mutter mit vollem Mund. Sie hatte die Nummer des Anrufers auf dem Display gesehen. »Wie geht es dir?«
»Gut, und um einiges besser, seit ich weiß, dass du dich in einem ordentlichen Haus aufhältst und nicht in dieser Feuerfalle in Bolinas. Du kannst dich glücklich schätzen, dass deine Schwester dich bei sich wohnen lässt.«
»Meine Schwester kann sich glücklich schätzen, dass ich mich innerhalb von fünf Minuten bereit erklärt habe, auf ihr Haus aufzupassen«, brauste Coco auf. Jack schnappte sich eine Frühlingsrolle vom Tisch und verschlang sie mit einem Biss. Auch dafür würde Jane sie ermorden. Schnell brachte Coco den Teller in Sicherheit.
»Sei nicht albern«, schalt ihre Mutter sie. »Du hast doch sowieso nichts zu tun und kannst froh sein. Das Haus ist umwerfend.«
Das ließ sich nicht leugnen, aber Coco kam es jedes Mal so vor, als befände sie sich in einer Filmkulisse.
»Du solltest dich nach einer Wohnung in der Stadt umsehen. Und nach einem anständigen Job und nach einem Mann. Und wieder mit dem Jurastudium anfangen.«
Coco hörte das nicht zum ersten Mal. Ihre Mutter und ihre Schwester wussten alles besser, wenn es um Cocos Leben ging, und sie hielten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg.
»Und wie geht es dir, Mom? Ist alles in Ordnung?« Coco zog sich wie immer aus der Affäre, indem sie ihre Mutter dazu brachte, über sich zu reden. Das war im Grunde sowieso das Einzige, was Florence interessierte.
»Ich habe ein neues Buch angefangen«, antwortete sie begeistert. »Und die Handlung ist dermaßen fesselnd. Es geht um einen Nordstaaten-General und eine Frau aus den Südstaaten während des Bürgerkriegs. Die beiden verlieben sich, müssen sich aber trennen. Als sie Witwe wird, hilft ihr treuer Sklave ihr, in den Norden zu fliehen. Der General ist währenddessen verzweifelt auf der Suche nach ihr. Und dann geht es noch um die Frau des Sklaven, die wiederum flieht und ihren Mann sucht. Es sind zwei Geschichten in einer. Ich liebe es zu schreiben!«, schwärmte sie vergnügt.
Coco lächelte. Ihr Leben lang hatte sie sich diese Geschichten angehört. Sie war heute stolz auf ihre Mutter. Aber als Kind war ihr deren Erfolg peinlich gewesen. Sie hatte sich eine ganz normale Mutter gewünscht, die Plätzchen backt und bei Fahrgemeinschaften mitmacht. Aber mit diesen Dingen hatte Florence schlichtweg gar nichts am Hut. Als Coco auf die Welt kam, war Florence bereits ein Star. Und solange sie denken konnte, schrieb ihre Mutter entweder an einem Buch oder gab Interviews. Coco hatte jene Kinder beneidet, die keine berühmten Eltern hatten.
»Ich habe gehört, dass dein letzter Roman auf Platz eins der Bestsellerlisten steht«, sagte Coco. »Bei dir geht nie etwas daneben, stimmt’s, Mom?« Sie klang beinahe wehmütig.
»Ich versuche, das zu verhindern, Liebes. Der süße Duft des Erfolgs gefällt mir nun mal«, sagte sie lachend.
Cocos ganzer Familie gefiel dieser Duft. Sie selbst hatte sich oft gefragt, wie es sein würde, in einer »normalen« Familie aufzuwachsen, mit einem Vater, der Arzt oder Anwalt war oder Versicherungen verkaufte. Coco hatte nicht viele Freunde in L. A., die so aufgewachsen waren.
Bei den meisten von ihnen war wenigstens ein Elternteil berühmt. Die Eltern der Kinder, mit denen sie zur Schule ging, waren Produzenten, Regisseure, bekannte Schauspieler oder Leiter von Filmstudios. Coco war auf der Harvard-Westlake gewesen, eine der besten Schulen von L. A., und viele der Leute, mit denen sie die Schulbank gedrückt hatte, waren heute selbst berühmt. Schließlich hatten sie alle hohen Erwartungen gerecht werden müssen. Einige ihrer ehemaligen Mitschüler waren allerdings schon tot, Drogen, Autounfälle, bei denen sie betrunken am Steuer saßen, oder auch Selbstmord. So etwas passierte natürlich in allen Schichten, aber bei Prominenten schien es häufiger vorzukommen. Diese Menschen lebten auf der Überholspur und bezahlten einen hohen Preis für ihren Lebensstil. Als Coco heranwuchs, hatten ihre Eltern nicht im Traum damit gerechnet, dass sie sich weigern würde mitzuspielen und einfach ausstieg.
»Da du jetzt in der Stadt bist und auf Janes Haus aufpasst, könntest du doch ein paar Kurse belegen.«
»Was denn für Kurse, Mom?«, fragte Coco und spürte, wie ihre innere Anspannung wuchs. »Klavierunterricht? Gitarre? Makramee? Kochen? Ikebana? Ich bin glücklich mit meiner Arbeit.«
»Wenn du mit 50 immer noch die Hunde anderer Leute ausführst, machst du dich zur Witzfigur«, erwiderte ihre Mutter ruhig. »Du bist nicht verheiratet und hast keine Kinder. Du kannst nicht den Rest deines Lebens nur die Zeit totschlagen. Du brauchst eine sinnvolle Aufgabe. Wie wäre es mit einem Zeichenkurs? Früher hast du dich doch auch für so etwas interessiert.«
Es war zum Heulen. Warum konnten die beiden sie nicht in Ruhe lassen? Und warum musste Ian … aber es war müßig, darüber nachzudenken.
»Ich habe nun mal nicht dein Talent, Mom. Oder Janes. Ich kann weder Bücher schreiben noch Filme drehen. Und vielleicht werde ich eines Tages Kinder haben. Aber bis dahin habe ich ein geregeltes Auskommen.«
»Du musst dich nicht um ein ›geregeltes Auskommen‹ kümmern. Du brauchst etwas, das dir ein Gefühl von Erfüllung gibt. Und du kannst nicht darauf bauen, Kinder zu deinem Lebensinhalt zu machen. Die werden groß und gehen weg, um ihr eigenes Leben zu führen. Und ein Ehemann kann sterben oder dich verlassen. Du musst eine eigenständige Person sein, Coco. Wenn dir das klargeworden ist, wirst du sehr viel glücklicher sein.«
»Ich bin glücklich. Deshalb lebe ich in Bolinas. In diesem Wespennest in L. A. würde ich verrückt werden.«
Ihre Mutter seufzte. Es war, als würden sie sich über den Grand Canyon hinweg etwas zuflüstern – keiner verstand den anderen. Schon komisch, wie sehr es ihre Mutter und ihre Schwester wurmte, dass sie mit den Hunden anderer Leute Gassi ging. Coco hatte deswegen keinerlei Minderwertigkeitsgefühle. Manchmal taten ihr die beiden richtig leid, weil sie so erfolgsversessen waren und deshalb ständig unter Druck standen.