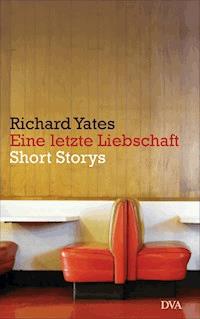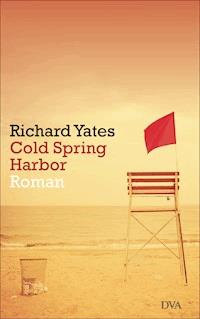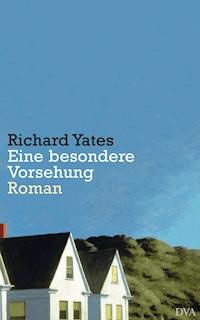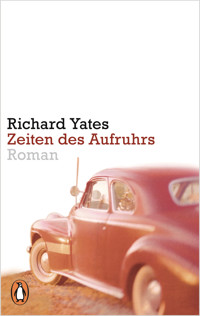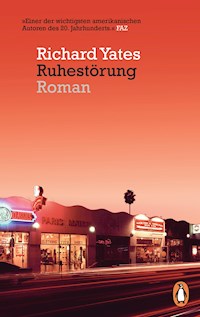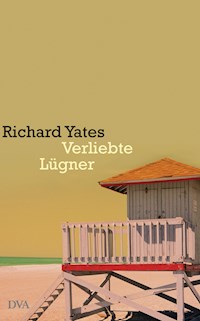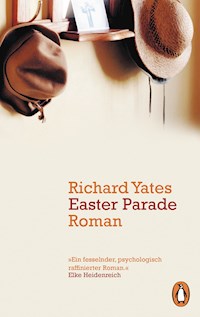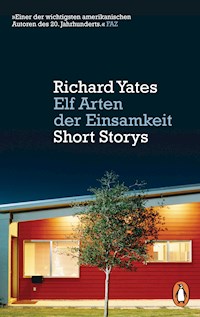5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein knallhartes, berührendes Generationen- und Zeitporträt.« WAZ
Sein Haar ist seit Tagen nicht gewaschen, sein zerschlissenes Hemd ziert ein Muster aus Flecken. William Grove, fünfzehn Jahre alt und gerade als Stipendiat an der Dorset Academy angenommen, wird schnell ein Stempel aufgedrückt: Mit diesem Außenseiter möchte keiner der Internatsschüler etwas zu tun haben. Denn Grove kann nicht verbergen, dass er aus einfachen Verhältnissen stammt. Doch genau das soll er an der Dorset Academy, Hort englischer Erziehungstraditionen, lernen – seine Mutter hofft, dass ihrem Sohn sich so die Türen zur höheren Gesellschaft öffnen, die ihr, der großen Künstlerin, trotz aller Bemühungen verschlossen geblieben sind.
Mit viel Feingefühl zeichnet Richard Yates das bewegende Porträt eines Jungen, der seinen Platz in der Gesellschaft noch finden muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Richard Yates
EINE GUTE SCHULE
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Eike Schönfeld
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Originalausgabe erschien 1978 unter dem TitelA Good School bei Delacorte Press/Seymore Lawrence, USA. Der Übersetzung lag die 2007 bei Vintage, London, erschienene Taschenbuchausgabe zugrunde.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © 1978 by Richard Yates Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Alle Rechte vorbehalten Gestaltung und Satz: DVA/Brigitte Müller Gesetzt aus der Stone
ISBN 978-3-641-24714-0V001
www.dva.de
www.randomhouse.de
Zum Gedenken an meinen Vater
Rück mit dem Stuhl heranBis an den Rand des AbgrundsDann erzähle ich dir eine Geschichte.
F. SCOTT FITZGERALD
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Als junger Mann studierte mein Vater im Staat New York Gesang. Er hatte eine schöne, disziplinierte Tenorstimme, in der sich große Kraft mit großer Zartheit verband; ihn singen gehört zu haben zählt zu den schönsten meiner frühen Erinnerungen.
Ich glaube, er hat einige Male professionelle Engagements gehabt, in Städten wie Syracuse, Binghampton und Utica, doch es gelang ihm nicht, das Singen zum Beruf zu machen, stattdessen wurde er Handelsvertreter. Ich nehme an, es war als eine Art Übergangslösung gedacht, als er sich der General Electric Company in Schenectady anschloss, damit ein paar Dollar hereinkamen, während er weiter nach Engagements suchte, doch es dauerte nicht lange, dann hatte die Firma ihn geschluckt. Mit vierzig, als ich geboren wurde, lebte er schon längst in der Stadt und hatte sich in der Tätigkeit eingerichtet, die er den Rest seines Lebens ausüben sollte, als stellvertretender Regionalverkaufsleiter in der Sparte Mazda-Lampen (Glühbirnen).
Bei gesellschaftlichen Anlässen wurde er immer noch gebeten zu singen – »Danny Boy« schien allgemein der Lieblingswunsch zu sein –, und manchmal sang er dann auch, doch in späteren Jahren lehnte er immer häufiger ab. Drang man in ihn, trat er einen Schritt zurück und machte eine kleine verneinende Handbewegung, wobei er lächelte und zugleich die Stirn runzelte: Das alles, schien er zu sagen – »Danny Boy«, die Jahre im Norden, das Singen selbst –, sei doch Vergangenheit.
Sein Büro im General-Electric-Gebäude war kaum groß genug für einen Schreibtisch und eine gerahmte Fotografie von meiner älteren Schwester und mir, als wir noch klein waren; in diesem Kabäuschen verdiente er das, was er eben brauchte, um meiner Mutter jeden Monat, Jahr um Jahr, das Geld zu schicken, um das sie ihn bat. Sie waren fast so lange geschieden, wie meine Erinnerung zurückreicht. Er liebte meine Schwester sehr – das dürfte auch der Hauptgrund für seine nie nachlassende Großzügigkeit uns gegenüber gewesen sein; er und ich dagegen schienen, ungefähr ab meinem zwölften Lebensjahr, ständig voneinander irritiert zu sein. Zwischen uns herrschte offenbar immer die stillschweigende Übereinkunft, dass ich mit der Scheidung in den Besitz meiner Mutter übergegangen war.
In dieser Annahme lag ein Schmerz – für uns beide, würde ich sagen, auch wenn ich nicht für ihn sprechen kann –, aber auch eine ungute Gerechtigkeit. Sosehr ich es mir auch anders wünschen mag, bevorzugte ich eben doch meine Mutter. Ich wusste, sie war unvernünftig und verantwortungslos, sie redete zu viel, sie machte wegen nichts irrwitzige Szenen, und man konnte darauf rechnen, dass sie in einer Krise zusammenbrach, doch ich war allmählich zu der düsteren Ahnung gelangt, dass ich womöglich ganz ähnlich strukturiert war. In einer Art und Weise, die weder hilfreich noch besonders angenehm war, gereichten sie und ich einander zum Trost.
Die Bildhauerkunst und das Aristokratische hatten sie immer gleichermaßen angesprochen, und so wurde sie nach der Scheidung Bildhauerin und sehnte sich danach, dass reiche Leute ihre Arbeit bewunderten und sie an ihrem Leben teilhaben ließen. Beide Ambitionen, die künstlerische wie auch die gesellschaftliche, wurden immer wieder durchkreuzt, häufig auf demütigende Art, dennoch waren da gelegentlich hoffnungsfrohe Momente, in denen sich für sie alles hübsch zu fügen schien.
Einen solchen Moment gab es im Mai oder Juni 1941, als ich fünfzehn war. Seit ungefähr einem Jahr gab sie in ihrem Studio in Greenwich Village, das zugleich das Wohnzimmer unseres Apartments war, wöchentlich einen kleinen Bildhauerkurs, und eine ihrer Schülerinnen war ein reiches Mädchen von außergewöhnlicher Schönheit und Anmut namens Jane. Ich glaube, Jane hat meine Mutter wohl, wie viele andere auch (darunter ich), als verkannte Künstlerin romantisiert; wie auch immer, als sie den Bildhauerkurs verließ, um zu heiraten, lud sie uns zur Hochzeit ein.
Es war eine echte Hochzeit der feinen Gesellschaft, sie fand in Westchester County statt, auf dem riesigen Rasen des Hauses von Janes Eltern; so etwas hatten wir noch nie gesehen. Der Bräutigam, ein junger Marineoffizier in makelloser weißer Uniform mit Stehkragen und steifen schwarz-goldenen Epauletten, war fast so umwerfend wie die Braut. Ein Orchester spielte, ein eigens errichtetes, mit weißem Segeltuch besetztes Podest bildete die Tanzfläche, und kaum hatten Jane und ihr Marineoffizier die Torte mit seinem wild blitzenden Degen angeschnitten, tanzten dort, wie es schien, Hunderte hübscher Mädchen mit ihren Partnern.
Ich trug einen billigen, breitschultrigen Winteranzug, den mein Vater mir bei Bond’s am Times Square gekauft hatte und aus dem ich längst herausgewachsen war. Und wenn ich mich schon unbehaglich fühlte, wage ich nicht, mir vorzustellen, wie sich meine Schwester vorgekommen sein muss: Sie war ungefähr ein Jahr jünger als Jane, sie kannte keinen der prächtigen jungen Männer und Frauen, ihre Kleidung war bestimmt um nichts weniger deplatziert als meine, und dennoch lief sie mit mir auf jener riesigen Rasenfläche hinter unserer Mutter her, lächelnd, von einem Grüppchen plaudernder Gäste zum nächsten, und knabberte dabei kleine Brunnenkresse-Sandwiches.
»Besucht dieser Junge eine Schule?«, fragte eine harsche Frauenstimme.
»Nun«, sagte meine Mutter, »eigentlich suche ich gerade eine für ihn, aber es gibt so viele, und es ist alles so verwirrend, dass ich …«
»Dorset Academy«, sagte die Frau, und da musterte ich sie: groß, barsch, eine Menge loses Fleisch unterm Kinn. »Es ist die einzige Schule im Osten, an der man Jungs versteht. Meiner fand es dort großartig.« Sie schob sich ein zusammengefaltetes Brunnenkresse-Sandwich in den Mund und kaute energisch. Dann sagte sie um das Kauen herum: »Dorset Academy, Dorset, Connecticut. Nicht vergessen. Schreiben Sie es sich auf. Sie werden es nie bereuen.«
Ich war nicht zu Hause, als W. Alcott Knoedler, der Direktor der Dorset Academy, meine Mutter auf ihre schriftliche Anfrage hin besuchte, später erfuhr ich davon jedoch in allen Einzelheiten. Der Direktor persönlich! Das war doch was! Er war gerade in New York gewesen; er hatte ihren Brief dabeigehabt; er hatte einfach vorbeigeschaut, um ihr von Dorset zu erzählen. Sie entschuldigte sich atemlos – ihr Studio sei ein heilloses Durcheinander, sie habe keinen Besuch erwartet –, und als sie die Höhe des Schulgelds hörte, konnte sie ihm nur noch sagen, wie sehr es ihr leidtue: Vierzehnhundert Dollar kamen nicht in Betracht. Und das Bemerkenswerte war, dass W. Alcott Knoedler nicht ging. Hin und wieder, erklärte er, sei es möglich, eine Anpassung nach unten vorzunehmen – vielleicht gar bis zur Hälfte der normalen Gebühren. Ob siebenhundert im Rahmen ihrer Mittel wären? Ob sie es wenigstens überdenken könne? Und ob sie und ihr Sohn ihm gegen Ende des Sommers die Freude bereiten würden, für einen Rundgang übers Schulgelände seine Gäste zu sein?
»Er war einfach – ich weiß auch nicht – ein ganz reizender Mann«, sagte sie mir. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie reizend er war. Und es scheint mir auch so eine interessante Schule zu sein. Sie ist sehr klein, nur etwa hundertfünfundzwanzig Schüler, und das bedeutet nämlich, dass jeder Junge mehr persönliche Zuwendung erhält und so weiter. Ach, und weißt du, was er gesagt hat?« Ihre Augen leuchteten.
»Was?«
»Er hat gesagt: ›Dorset glaubt an Individualität.‹ Könnte das nicht die ideale Schule für dich sein?«
Unser Rundgang über das Schulgelände wurde ein wahrer Zustimmungstaumel. Es war, wie meine Mutter bestimmt zwanzig Mal sagte, sehr schön. Die Dorset Academy lag im nördlichen Connecticut, meilenweit entfernt von jeder Stadt. Sie war in den Zwanzigerjahren von einer exzentrischen Millionärin namens Abigail Church Hooper gegründet und erbaut worden, die häufig dahingehend zitiert wurde, es sei ihre Lebensaufgabe, eine Schule »für die Söhne der besseren Leute« zu etablieren, und dafür hatte sie keine Kosten gescheut. Sämtliche Gebäude waren im, wie man uns sagte, »Cotswold«-Stil erbaut, mit dickem dunkelrotem Stein und gegiebelten Schieferdächern, für deren Balken bewusst junges Holz verwendet worden war, damit sie beim Altern einsackten und sich zu interessanten Formen verzogen. Vier lange Gebäude mit Klassen- und Schlafräumen bildeten ein hübsches, drei Stockwerke hohes und viele große Bäume umschließendes Viereck. Dahinter lag, an gewundenen Steinplattenwegen, eine reizvolle Ansammlung weiterer Gebäude, großer wie kleiner, ein jedes mit seinem durchhängenden Dachfirst und seiner Zurschaustellung tiefer, teurer, bleigefasster Fenster, und dann noch üppige Rasenflächen.
Doch ich sollte Jahre brauchen, bis ich bemerkte, was klügere Leute offenbar auf den ersten Blick sahen, dass in der Schönheit der Anlage etwas Überspanntes, ja Kulissenhaftes lag – eine Privatschule, die auch aus den Studios Walt Disneys hätte stammen können. Und eine weitere Sache, die mir erst in einem langwierigen Lernprozess bewusst wurde, obwohl eigentlich auch der Tonfall der Frau auf Janes Hochzeit es mir hätte verraten können: Die Dorset Academy hatte den weitreichenden Ruf, Jungen aufzunehmen, die keine andere Schule haben wollte – aus welchen Gründen auch immer.
Wieder in New York und von einer hohen Mission erfüllt, rief meine Mutter meinen Vater in seinem Büro an und führte ein leidenschaftliches Gespräch mit ihm, um das Geld zu bekommen. Ich glaube, es bedurfte mehrerer solcher Anrufe, aber schließlich willigte er ein, wie immer. Der Papierkram wurde verblüffend prompt erledigt, und so wurde ich als Schüler der vierten Klasse (zehnte Stufe) eingeschrieben, der Unterricht sollte im September beginnen.
Der nächste Schritt war die Anschaffung meiner Schuluniform bei Franklin Simon’s, deren Herrenabteilung die exklusive Lizenz dafür besaß. Tagsüber trug man als Dorset-Junge einen geschmackvollen grauen Tweedanzug – der Verkäufer sagte, es sei üblich, zwei zu besitzen, wir aber beließen es bei einem –, und es gab noch die Möglichkeit, den offiziellen Dorset-Blazer zu tragen, aus burgundrotem Flanell mit blauen Paspeln und dem Schulwappen auf der Brusttasche, was wir uns sparten. Für den Abend gab es dann noch eine separate Pflichtuniform: schwarzer Zweireiher und gestreifte Hose, weißes Hemd mit abnehmbarem steifem Kragen (normal oder Kläppchen) sowie schwarze Fliege.
»Also«, sagte meine Mutter, als wir das Geschäft verließen. »Jetzt bist du ein Dorset-Junge.«
Noch nicht ganz. An dem Sermon des Direktors hatte mich am meisten interessiert, dass die Dorset-Jungen »Gemeinschaftsarbeit« leisteten – sie fällten Bäume, machten Feldarbeit, fuhren wie Arbeiter hinten auf einem Pick-up herum –, und so war unsere Einkaufstour erst beendet, nachdem ich mit meiner Mutter in einem Army-and-Navy-Laden gewesen war und die richtige Latzhose samt Arbeitshemden ausgesucht hatte, dazu noch die richtigen hohen Arbeitsstiefel und ein Marinejackenimitat. Wenn alle Stricke rissen, konnte ich mich, wie ich fand, mit einer solchen Kluft an der Dorset Academy ganz gut behaupten.
Es ist nicht schwer zu erraten, wie mein Vater das alles fand. Die Vorstellung eines teuren Internats muss ihm absurd erschienen sein, und die Kosten dafür stürzten ihn bestimmt in Schulden. Mir gegenüber zeigte er sich dazu aber nur positiv eingestellt. Er nahm mich mit auf einen seltenen Besuch in seine Wohnung an der West Side, nur wir beide, und servierte ein gutes Abendessen, einen Lammeintopf, den wohl seine Freundin am Nachmittag für uns auf dem Herd hatte köcheln lassen (ich hatte schon mehrere nervöse Begegnungen mit ihr gehabt, aber vermutlich fand sie, dass sie uns an dem Abend allein lassen sollte). Verglichen mit dem chaotischen Bildhaueratelier, in dem ich lebte, war sein Zuhause erfrischend sauber und aufgeräumt; nachdem wir das Geschirr gespült hatten, saßen wir noch zwei Stunden da und redeten – zögernd und stockend wie immer, aber ich weiß noch, dass ich dachte, wir hätten es besser hingekriegt als sonst. Und an jenem Abend schickte er mich mit zwei Geschenken nach Hause, die er für einen Jungen, der aufs Internat ging, nützlich fand – eine abgestoßene, schwere, irgendwie altmodische Tasche, »Boston Bag« genannt, die in meinem letzten Schuljahr schließlich auseinanderfiel, und ein Rasierzeug im Etui, das neu wirkte und mit seinen Initialen geprägt war; ich hatte es während meiner ganzen Armeezeit bei mir, bis ich es irgendwo in Deutschland verlor.
Und ich nehme an, dass er bestimmt auch jedermann sonst gegenüber positiv darüber sprach. Ich kann mir vorstellen, wie er und ein Kollege, beide in Hemdsärmeln, jeder mit einer Handvoll Geschäftspapiere, im Vorzimmer seiner Büroetage stehen bleiben, um über dem unaufhörlichen Geklapper der Schreibmaschinen einen freundlichen Gruß zu wechseln. Ich male mir den anderen Mann größer und raubeiniger als mein Vater aus, womöglich legt er ihm die freie Hand auf die Schulter.
»Was macht die Familie, Mike?«, sagt er vielleicht. Mein Vater hieß Vincent, aber im Büro nannten ihn alle »Mike« – warum, habe ich nie erfahren.
»Ach, ganz gut, danke.«
»Deine hübsche Tochter, heiratet die bald?«
»Ach, ich weiß nicht – hoffentlich nicht so schnell, aber wohl doch schon ziemlich bald.«
»Das möchte ich doch wetten. Sie ist ein Schätzchen. Und der Junge?«
»Also, der geht im Herbst an eine Privatschule.«
»Ach ja? Privatschule? Mann, Mike, kostet dich das nicht eine Stange Geld?«
»Na ja – billig ist es nicht, aber ich denke, ich krieg das schon hin.«
»Welche Schule denn?«
»Sie heißt Dorset Academy, in Connecticut.«
»Dorset?«, sagt der Mann. «Von der habe ich, glaube ich, noch nie gehört.«
Und ich kann meinen Vater sehen, wie er sich daraufhin abwendet, die Nettigkeiten beendet, müde wirkt. Er war nicht alt in jenem Sommer – erst fünfundfünfzig –, aber anderthalb Jahre später war er tot. »Na ja«, sagt er dann wohl, »eigentlich habe auch ich noch nie von ihr gehört, aber es soll – na ja – es soll eine gute Schule sein.«
Erstes Kapitel
Mit fünfzehn hatte Terry Flynn das Gesicht eines Engels und den Körper eines Modellathleten. Er war eher von kleinem Wuchs, aber unglaublich schön. War er vollständig bekleidet mit seinen Freunden unterwegs, bewegte er sich mit einer leichten, flinken, besonderen Anmut, die ihn von allen anderen abhob; schon wenn man ihn gehen sah, hatte man vor Augen, wie er losrannte, um einen Vorwärtspass zu fangen, beliebig vielen potenziellen Tacklern auswich und vor den tobenden Zuschauern allein zum Sieges-Touchdown rannte.
Und wenn schon der bekleidete Terry gut aussah, war das nichts im Vergleich mit der Darbietung, die er tagtäglich im Wohnhaus gab, wenn er sich auszog, ein Handtuch um die Hüfte schlang und durch den Flur zu den Duschen ging. Er hatte das, was man Muskeldefinition nennt: Jede Wölbung, jeder Strang, jeder Wulst an ihm war konturiert wie vom Meißelstoß eines klassischen Bildhauers, und entsprechend hielt er sich auch. »Hi, Terry«, riefen die Jungen, wenn er vorüberging, und »Hey, Terry«; schon sehr wenige Tage nach seinem Eintreffen in der Dorset Academy war Terry Flynn der Einzige von den Neuen in Haus drei, der von allen mit Vornamen angeredet wurde.
Im Duschraum, der außerdem noch die beiden Toilettenkabinen und vier Waschbecken dieses Flurendes enthielt, glänzte er stets. Er machte eine kleine, bescheidene Schau, indem er sich das Handtuch von den Lenden riss und damit bewies, dass er bestückt war wie ein Pferd; dann trat er in die heiße Gischt und posierte darin, verlagerte das Gewicht von einem Fuß auf den anderen, eine triefende, schimmernde Statue. Einmal hatte er sich bei einem Footballspiel den kleinen Finger der rechten Hand gebrochen, und er war nie wieder richtig zusammengewachsen; er ließ sich nicht krümmen, und die feine Steifheit dieses Fingers, die zunächst affektiert wirkte, verlieh seinem Wesen genau die richtige Note von Nonchalance.
Dorset war Terrys vierte Privatschule, und trotzdem war er erst in der zweiten Klasse – er konnte noch immer nicht richtig lesen –, weswegen seine Klassenkameraden nicht seine Altersgenossen waren. Die Stunden vor dem Mittagessen verbrachte er mit seinen Klassenkameraden, ein Haufen Dreizehnjähriger, denen allen warm und albern zumute wurde, wenn Terry sie anlächelte, die übrige Zeit widmete er seinen Altersgenossen. Sein Zimmer war der beliebteste Versammlungsort in diesem Teil von Haus drei und wurde manchmal auch mit der Anwesenheit älterer Jungen beehrt, Sechzehn –, Siebzehnjähriger, die hereinschauten, um sich an den Balgereien zu beteiligen. Terry redete nicht viel, aber wenn er etwas sagte, dann war es meistens genau das Richtige. Und er hatte eine denkwürdige Lache, ein explosives »Babba-haa!«, das im ganzen Flur zu hören war.
»He, habt ihr schon von Mr Draper und seinem Selbstgebrauten gehört?«, sagte jemand bei einem dieser Anlässe. Mr Draper war der Chemielehrer, ein gebrechlicher Mann, der an allen vier Gliedmaßen von einer Kinderlähmung so stark behindert war, dass er kaum gehen und kaum einen Bleistift halten konnte. »MacKenzie musste gestern Abend ins Labor und ein Buch oder so was Blödes holen, und als er Licht macht, liegt da Draper auf dem Boden – auf dem Rücken – und rudert mit Armen und Beinen in der Luft wie so ein – also, wie ein Käfer, der versucht, sich umzudrehen. Also bückt sich MacKenzie und hebt ihn hoch – er sagt, der wiegt bloß um die dreißig Kilo –, und da schlägt ihm so eine irrsinnige Fahne entgegen: Draper war stockbesoffen.«
»Babba-haa!«, sagte Terry Flynn.
»Der hatte das ganze Selbstgebraute gepichelt, das er hinten im Labor macht – habt ihr mal dieses große Dingsda gesehen? Diesen großen Bottich, aus dem dieses Schlauchdings raussteht? –, und dann ist er einfach umgefallen. Mann, wenn MacKenzie nicht gekommen wär, dann hätte der die ganze Nacht auf’m Rücken verbracht. MacKenzie setzt ihn also auf einen Stuhl, und Draper sieht aus, als würde er da auch gleich wieder runterfallen, und er sagt: ›Bitte holen Sie meine Frau.‹ Also macht sich MacKenzie auf zu den Drapers und holt sie …«
»War sie allein?«, unterbrach ihn eine andere Stimme. »War sie allein oder war Frenchy La Prade mit ihr im Bett?«
»Babba-haa! Babba-haa-haa!«, sagte Terry Flynn.
»Weiß ich nicht, wahrscheinlich allein; jedenfalls schaffen die beiden den alten Draper nach Hause und so, und dann sagt Mrs Draper zu MacKenzie – die sagt: ›Das bleibt aber unter uns, ja?‹«
In jenem Jahr waren etliche englische Jungen an der Dorset, Kriegsflüchtlinge, und sie wurden wegen ihrer guten Manieren beim Lehrertee bevorzugt. Einer von ihnen war Richard Edward Thomas Lear, dessen Zimmer gegenüber dem von Terry Flynn lag. Er hielt sich sehr gerade, hatte dichtes schwarzes Haar und helle Augen, ein hübscher Junge, wäre sein Mund nicht so schlaff und nass wie bei einem Wühltier gewesen.
»Du vermisst deine Familie sicher ganz schrecklich«, sagte Mrs Edgar Stone eines Nachmittags im Oktober zu ihm, als sie sich vorbeugte, um ihm Tee nachzugießen. »Und ich fände es so schön, wenn du mir mehr über Tunbridge Wells erzählen könntest. Gab es dort viele Luftangriffe? Ich habe gerade The White Cliffs zu Ende gelesen und fand es wunderbar bewegend, obwohl mein Mann natürlich meint, es sei kein gutes Buch.« Mrs Stone war die flatterhafte Frau des Englischlehrers, und ein Besuch in ihrem Haus war wichtig, weil die Stones eine reizende, schüchterne fünfzehnjährige Tochter namens Edith hatten. Sie war selten zu Hause, aber es war ja immerhin möglich, dass sie doch da war. Außerdem war auch Mrs Stone gar nicht übel: Wenn sie sich so vorbeugte, hatte man mit etwas Glück einen guten Blick auf volle, sahnige Brüste bis hinab zum Nabel.
»Ich hoffe doch, Tunbridge Wells hat sich nicht allzu sehr verändert, Mrs Stone«, sagte Richard Edward Thomas Lear. »Ich möchte es gern so wiedersehen, wie ich es in Erinnerung habe.« Dann leerte er seinen Tee und stand auf. »Leider muss ich jetzt gehen. Haben Sie ganz herzlichen Dank.« Und als Mrs Stone sich umdrehte, um ihren Mann aus dem Arbeitszimmer zu rufen, griff Lear mit einer Hand nach sechs teuren, in Schokolade getunkten Plätzchen und stopfte sie in die Seitentasche seines Dorset-Blazers.
»Schön, dass du da warst, äh, Lear«, sagte Dr. Stone, in der Tür blinzelnd.
»Es war mir ein Vergnügen, Sir.« Wie er so lächelte, eine Hand tief in der Blazertasche, war er das Abbild eines höflich sich verabschiedenden Gastes. »Nochmals Dank Ihnen beiden.«
Als er über das Viereck zu Haus drei ging, aß er rasch hintereinander alle Plätzchen auf. Oben in seinem Zimmer, wo ihm von dem Übermaß ein wenig übel wurde, zog er sich aus, um zu duschen. Lear brauchte die prüfenden Blicke im Duschraum nicht zu fürchten: Er war vielleicht nicht so spektakulär wie Terry Flinn, aber sein Körper war ganz ordentlich, sein Schwanz passabel, und er hatte kraftvolle, vortrefflich behaarte Beine. Noch etwas: Er verstand es besser als jeder sonst, anderen Duschenden ein nasses Handtuch auf den Hintern zu klatschen.
Manchmal jedoch, zumal zu dieser Tageszeit, legte sich eine unerklärliche Melancholie über ihn. Dann wollte er schlagen, ringen und brüllen; es waren die einzigen Tätigkeiten, durch die er sich wieder fit fühlte. Nach vollendeter Dusche und vollzogenem Kleiderwechsel fürs Abendessen trat er in den Flur, wo er auf Art Jennings traf, der konzentriert Fussel von seinem schwarzen Jackett zupfte. Jennings war ein massiger, umgänglicher, kurzsichtiger Junge und größer als Lear, aber das reizte ihn nur noch mehr.
»Mein Gott! Sieh nur!«, rief Lear schockiert aus und zeigte theatralisch zum Duschraum, und als Jennings hinsah, trat er vor und schlug ihn mit aller Kraft auf den Oberarm.
»Aua! Du Blödmann!« Jennings wollte ihn seinerseits schlagen, verfehlte ihn aber – Lear war außer Reichweite getreten und stand lächelnd, mit schimmernd nassem Mund da –, und dann waren sie ineinander verklammert, verhakt in einer Reihe unbeholfener Ringergriffe, bis sie schließlich in Jennings’ Zimmer wankten und stürzten. Erst waren sie auf dem Fußboden, wo sie den Stuhl umstießen und Jennings die Brille herunterfiel, dann auf dem Bett, wo eins von Lears zappelnden Beinen einen langen Riss in die Seekarte machte, mit der Jennings seine Wand geschmückt hatte. Sechs, acht Jungen gingen an der offenen Tür vorbei und sahen ohne größeres Interesse zu ihnen hinein. Letztlich war es Terry Flynn, der sie auseinanderzog, so lässig, als trennte er zwei Hündchen. »Kommt schon«, sagte er. »Das war der Rundengong.«
Benommen und nach Luft schnappend, die schmerzenden Glieder, Hälse und Rippen reibend, rappelten sie sich auf. Ihre Abendgarderobe war ruiniert: Eine Schulternaht von Lears Jacke war aufgerissen, beider Hemden waren grau von Schweiß, und ihre steifen Kragen und Fliegen waren grotesk verdreht. Über Jennings’ Revers zog sich silbrig ein langer fadenartiger Strang von Lears Spucke.
»Das nächste Mal krieg ich dich, du Sack«, sagte Jennings.
»Du und wer noch?«, erkundigte sich Lear. Er fühlte sich großartig – und Jennings, der mit zusammengekniffenen Augen seine Brille wieder aufsetzte, sah auch aus, als ginge es ihm gut.
In seinem zweiten Jahr als Französischlehrer an der Dorset Academy hatte Jean-Paul La Prade einen brüchigen Waffenstillstand mit der Schule geschlossen. Viel lieber wäre er wieder in New York gewesen, um sich dort als Übersetzer durchzuschlagen und »ab und zu was Journalistisches« zu machen, wie er es nannte – in New York hatte er bis mittags im Bett bleiben können, häufig mit einer temperamentvollen Frau –, doch als Mann musste man sich verändern, wenn die Zeiten sich änderten. Die Arbeit hier war nicht schwer, wenn man erst mal gelernt hatte, sich die kleinen Scheißer vom Hals zu halten; das Gehalt war jämmerlich, aber es gab ohnehin nichts, wofür man es hätte ausgeben können; der Alltag mochte spartanisch sein, aber mit ein wenig Fantasie konnte man doch einigermaßen wie ein Erwachsener leben.
La Prade war achtunddreißig. In seiner New Yorker Zeit hatten ihn mehrere Frauen »herrlich gallisch« genannt, was ihm half, seinen durchdringenden Blick und die unbekümmerten Gesten und Bewegungen des klein geratenen Mannes noch zu verstärken; er war mit seinem Aussehen zufrieden und neigte dazu, beim Dozieren im Unterricht herumzustolzieren. Auch seine Stimme mochte er: Sie war präzise und tief, melodiös beim Ermuntern, Furcht einflößend beim Tadeln, und sie enthielt gerade so viel französischen Akzent, dass er ihr Gewicht verlieh.
»Ich glaube, es ist vor allem deine Stimme«, hatte Alice Draper letztes Frühjahr zu ihm gesagt. »Deine Stimme, deine Augen und wie du mich berührst – ah, wie du mich berührst.« Und da hatte er innerlich das Gesicht verzogen, weil Alice viele Jahre lang von nichts als den weichen, zittrigen Händen ihres bedauernswerten Mannes berührt worden war. Das Schlimmste daran war, dass er den armen Jack Draper ganz gern hatte; einst hatte er ihn sogar als Freund betrachtet, soweit das an dieser komischen kleinen Schule eben möglich war.
Trotzdem, Alice war eine gute Geliebte gewesen. Für eine Sechsunddreißigjährige hatte sie beachtlich festes Fleisch und war in ihrer Begierde erstaunlich jung geblieben. Unermüdlich hatten sie gebumst und sich herumgewälzt und sich aneinander genährt, erst in seiner Wohnung (wo ihr Vergnügen noch dadurch gesteigert wurde, dass gleich hinter dem Dampfrohr über ihnen ein Schlafsaal voller Jungen war) und dann auf einer Decke im Wald. Dort hatte sie ihn eines Nachmittags weggestoßen, sich die Brüste bedeckt und auf einen schwerfällig rennenden, geräuschvoll sich zurückziehenden Jungen zwischen den Bäumen in fünfzig Metern Entfernung gezeigt. La Prade hatte ihr, so gut er konnte, versichert, es sei nicht schlimm, sie müsse sich deswegen keine Sorgen machen, doch auch er war beunruhigt gewesen. Beim Abendessen im großen Speisesaal aus Stein und Holz hatte er gelegentlich verstohlen von seinem Teller aufgeschaut, um zu sehen, ob einer in dem langen, weiten Jungenmeer zu ihm hersah. Hier und da saß einer schweigend da, in Einsamkeit vor seinem Essen versunken (und La Prade verstand das; diese Mahlzeiten im Speisesaal waren eine Qual). Die meisten aber waren aufgewühlt vom Reden und Lachen – was in Gottes Namen fanden die nur ständig so komisch? –, aber selbst bei den herzhaftesten Lachern und Stupsern entdeckte er nicht die Spur eines auf ihn gerichteten Blicks. Einmal versuchte er diskret, quer durch den Raum hindurch Alices Aufmerksamkeit zu erregen – er wollte ihr mit dem leisen Hauch eines Lächelns sagen, dass alles gut sei –, doch sie schaute nicht auf. Sie trug ein strenges schwarzes Kleid; ihre Schultern hatten etwas Angespanntes, und was sie für ein Gesicht machte, konnte er nicht erkennen, weil sie den Kopf gesenkt hielt. Am anderen Ende von Drapers Tisch, viele schwatzende Kinder weiter, war der arme Jack ganz von der Schwierigkeit in Anspruch genommen, sein Fleisch zu schneiden.
»Noch diesen Sommer wirst du mich vergessen«, hatte Alice ihm im Juni prophezeit. »Dann hast du alle deine alten New Yorker Frauen wieder, und wenn du im Herbst zurückkommst, hast du vergessen, dass du mich je hattest.«
»Schön«, hatte er gesagt. »Dann werde ich dich eben von Neuem haben wollen.«
Doch es war ein scheußlicher Sommer gewesen. Er hatte in einem schrecklichen Hotel am oberen Broadway gewohnt, zu viel Geld für schlechtes Essen ausgegeben und es bei keinem seiner alten Zeitungskontakte geschafft, Arbeit zu finden – und mit einer Ausnahme, einer trägen unechten Blondine namens Nancy, die sich über die »Schäbigkeit« seines Zimmers beschwerte, hatte er keine seiner Frauen zurückgewinnen können. Im September dann, ein weiteres Jahr in Dorset vor sich, konzentrierte er sich ganz auf Alice. Er vermisste sie; er wollte sie und wusste zugleich, dass er den Herbst damit verbringen würde, einen eleganten Weg zu finden, sich von ihr zu lösen. So eine Geschichte hatte einfach keine Zukunft.
»O Gott, wie ich dich vermisst habe«, sagte sie an ihrem ersten gemeinsamen Abend zu ihm. »Ich dachte, du kommst nie mehr zurück. Hast du mich auch vermisst?«
»Ich habe die ganze Zeit an dich gedacht.«
Doch jetzt war November, und die Vernunft stellte klar, dass es nicht weitergehen konnte. Sie war nett, aber sie wollte zu viel.
Er war allein in seiner Wohnung und zog gerade den dunkleren seiner beiden Anzüge fürs Abendessen an, und während er vor dem Spiegel die Krawatte band, ging er einige der Dinge durch, die er ihr sagen wollte. »So was hat doch keine Zukunft«, würde er sagen. »Ich glaube, das haben wir beide von Anfang an gewusst. Auch abgesehen von Jack fände ich …« Und da klingelte es an der Tür.
Sie war doch sicher nicht so dumm, zu dieser Tageszeit herzukommen. Als er durch den kleinen Raum zur Wohnungstür eilte, löste sich seine Verärgerung in eine belebende, nützliche Form des Zorns auf: Das war der ideale Vorwand für die Szene, die ihm vorschwebte; einen besseren hätte er sich gar nicht wünschen können.
Doch es war nicht Alice: Es war ein schlaksiger, trübseliger Junge von ungefähr fünfzehn Jahren. Es war William Grove, einer der Neuen, der Dümmste in seinem Französischunterricht in der Vierten.
»Sir«, sagte Grove, »ich sollte um halb sechs zu einer Besprechung kommen.«
Und La Prade hätte beinahe »Ach ja?« gesagt, doch er fing sich rechtzeitig. Vielmehr sagte er: »Richtig. Komm rein, Grove; setz dich.«
Der Junge war völlig verwahrlost. Sein Tweedanzug hing speckig an ihm, weil er nicht gereinigt war, seine Krawatte war ein verdrehter Lappen, seine langen Fingernägel waren blau, und er musste sich mal wieder die Haare schneiden lassen. Bei seinem Gang zum Sessel schien er in Gefahr, über die eigenen Beine zu stolpern, und er setzte sich so umständlich hin, als wollte er damit ausdrücken, dass sein Körper unmöglich zu innerer Ruhe finden konnte. Welch ein Aushängeschild für die Dorset Academy!
»Ich habe dich hergebeten, Grove«, begann La Prade, »weil ich mir Sorgen um dich mache. Wir haben jetzt November, und wie ich es sehe, hast du noch überhaupt kein Französisch gelernt. Was ist los?«
»Ich weiß nicht, Sir.«
»Manchmal«, sagte La Prade, »scheitert ein Schüler an einer Fremdsprache, weil ihm die sprachlichen Grundfertigkeiten fehlen. Aber das ist bei dir eindeutig nicht der Fall: Von Dr. Stone höre ich, dass deine Leistung in Englisch ordentlich ist.«
»Ja, Sir.«
»Und wie erklärst du es dir also? Wie kann jemand in Englisch ordentlich sein und bei den Grundkenntnissen in Französisch vollkommen unfähig? Hm?«
»Ich weiß nicht, Sir.«